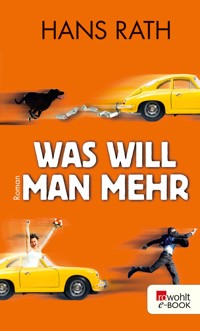
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Paul-Trilogie
- Sprache: Deutsch
HERZ ODER KOPF? GEHEN ODER BLEIBEN? JUNGE ODER MÄDCHEN? Es läuft nicht rund für Paul. Verliebt in Iris – aber einen Sohn mit ihrer Schwester. Paul will für Mutter und Kind da sein, steht aber in der Familienrangliste offenbar ganz unten. Noch unter Timothy, dem Kerl, der ihn nicht nur die Traumfrau, sondern auch den Job gekostet hat. Als Paul herausfindet, dass Timothy in schmutzige Geschäfte verwickelt ist, wittert er seine letzte Chance, bei Iris und beruflich. Zusammen mit Schamski, Günther und Bronko, seinen alten WG-Gefährten, versucht er, den Schwindler zu entlarven. Ganz legal ist das allerdings nicht möglich ... «Wirklich witzig – und als Bonus erfährt die Leserin, wie Männer tatsächlich ticken.» (Für Sie) «Erhellend und erheiternd.» (Maxi)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Hans Rath
Was will man mehr
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Es läuft nicht rund für Paul: verliebt in Iris – aber ein Kind mit Audrey, ihrer Schwester. Paul will für Mutter und Kind da sein, steht aber in der Familienrangliste offenbar ganz unten. Noch unter Timothy, dem Kerl, der ihn nicht nur die Traumfrau, sondern auch den Job gekostet hat. Als Paul herausfindet, dass Timothy in schmutzige Geschäfte verwickelt ist, wittert er seine letzte Chance, bei Iris und berufl ich. Zusammen mit Schamski, Günther und Bronko, seinen alten WG-Gefährten, versucht er den Schwindler zu entlarven – aber ganz legal ist das nicht möglich …
Über Hans Rath
HANS RATH, Jahrgang 1965, studierte Philosophie, Germanistik und Psychologie in Bonn. Er lebt in Berlin, wo er sein Geld unter anderem als Drehbuchautor verdient. Mit seinen Romanen «Man tut, was man kann» und «Da muss man durch» eroberte er die Bestsellerliste im Sturm.
Inhaltsübersicht
Ein Abenteuer mit Betty Crowley
Gott ist ein Witzbold. Ich glaube, er hat Sachen wie Sex oder Reisebusse nur erfunden, um uns in komische Situationen zu bringen. Vielleicht leben wir überhaupt nur deshalb, weil Gott sonst sterbenslangweilig wäre.
Mein Sitznachbar, ein anglikanischer Priester namens Brian Mulligan, findet die Theorie theologisch nicht unproblematisch, betrachtet sie aber als eine gute Erklärung für den Schlamassel, in dem wir gerade stecken. Es ist mitten in der Nacht, und seit Stunden sucht unser Busfahrer den Hafen von Calais. Dabei hat er bislang nicht einmal die Stadt selbst gefunden. Im Moment befinden wir uns in einem winzigen französischen Dorf irgendwo im Landesinneren. Genauer gesagt in der winzigsten Gasse dieses winzigen französischen Dorfes. Wir haben uns nämlich zum wiederholten Male festgefahren. Willi, der Mann am Steuer, versichert per Mikrophon, dass er und sein Kollege Bertram die Situation im Griff haben. Bertram steht draußen im strömenden Regen und fuchtelt wild mit den Armen, um den Reisebus aus der Gasse zu dirigieren. Das stetig lauter werdende Geräusch von schabenden Metallteilen lässt vermuten, dass dieses Manöver in die Hose gehen wird. Ich glaube, eine Straßenlaterne hat sich in die Flanke des Busses gebohrt. Für das ohnehin hochbetagte Fahrzeug dürfte das der Todesstoß sein. Willi ist offenbar anderer Meinung. Er gibt unbeirrt weiter Gas, wodurch sich zu dem Kreischen der Metalle noch ein Knirschen und Knacken gesellen, die an ein Schiff in höchster Seenot erinnern. Im Grunde klingt es, als würde der Bus jeden Moment in seine Einzelteile zerfallen.
«Hallo, hier ist nochmal der Willi», tönt es aus den Lautsprechern. «Wir machen jetzt ein bisschen Musik, und in Kürze geht unsere …»
Die Durchsage wird von einem explosionsartigen Knall unterbrochen, im gleichen Moment verdunkelt sich ein Teil der Straße. Im Rauschen des Regens hört man Glas auf dem Asphalt zersplittern. Unweit des Busses gehen in einigen Häusern die Lichter an.
«Gib Gummi, Willi! Sonst haben die uns gleich am Wickel!», hört man Bertram von draußen rufen.
Die Vorstellung, Willi und Bertram könnten von aufgebrachten Franzosen geteert und gefedert werden, finde ich ganz reizvoll. Ich befürchte nur, dass wir anderen auch nicht ungeschoren davonkommen würden.
Willi tritt noch energischer aufs Gas. Der Motor röhrt wie ein Hirsch mit Bandscheibenproblemen, und das metallische Schaben wird für quälend lange Sekunden ohrenbetäubend laut. In der Straße gehen nun immer mehr Lichter an. Vereinzelt kommen Anwohner aus ihren Häusern. Die meisten haben Hunde, einige sogar Gewehre dabei. Kurz bevor sie unseren Bus erreichen, was wahrscheinlich der Beginn einer Gewaltorgie wäre, geschieht jedoch ein kleines Wunder. Mit einem lauten Ächzen, das an den Stapellauf eines Ozeanriesen erinnert, schiebt sich unser Bus an der völlig demolierten Straßenlaterne vorbei. Ein Ruck geht durch das Fahrzeug, die Reifen quietschen, und dann nehmen wir auch schon Fahrt auf. Für ein paar Sekunden erwarte ich, Schüsse zu hören, weil die Einheimischen uns an der Flucht zu hindern versuchen. Aber nichts dergleichen geschieht. Wenige Minuten nach unserer wundersamen Befreiung lassen wir das Dorf hinter uns und rollen durch die dunkle und regnerische Nacht in Richtung Meer – oder in welche Richtung auch immer.
Reverend Mulligan beugt sich zu seiner Kühltasche hinab, öffnet noch zwei Dosen Bier und stellt eine davon auf mein winziges Klapptischchen.
«Danke, ich hab noch.»
«Trinken Sie! Das wird Ihnen helfen, ein bisschen Schlaf zu finden. Es ist noch eine Ewigkeit bis London. Falls die beiden Idioten es überhaupt schaffen, uns mit diesem Schrotthaufen bis zur Fähre zu bringen.»
Da ist was dran. Wir trinken.
«Wo waren wir eben?», fragt Mulligan und lehnt sich in seinem Sitz zurück.
«Ich habe Sie gefragt, warum Sie Priester geworden sind.»
«Ach ja, genau. Das war so: Als junger Mann wollte ich ein Mädchen aus dem Nachbardorf ins Bett kriegen …»
«Fangen eigentlich viele Priesterbiographien so an?», unterbreche ich kurz.
Mulligan nickt ernst. «Die meisten. Oft geht es aber eher um Jungs aus dem Nachbardorf. In meinem Fall handelte es sich jedenfalls um Betty Crowley. Süße siebzehn, blond, sommersprossig und ein bisschen naseweis. Sie sang im Kirchenchor, und sie schwärmte für den Reverend. Also habe ich ihr gesagt, dass ich ebenfalls Priester werden will.»
«Oha! Das klingt nach einer schweren Sünde», bemerke ich. Ärgerlich, dass mir dieser Trick als Teenager nicht eingefallen ist.
«Sicher, aber Betty Crowley war jede Sünde wert», konstatiert Mulligan.
«Und hat die Strategie funktioniert?»
«Ja und nein. Wir hatten tatsächlich eine kurze Affäre. Aber als sie erfuhr, dass ich sie belogen hatte, verließ sie mich Knall auf Fall.»
«Was man ihr nicht verübeln kann», antworte ich. «Aber immerhin haben Sie bekommen, was Sie wollten: ein Abenteuer mit Betty Crowley.»
«Das schon. Nur leider hatte ich mich zu diesem Zeitpunkt bereits unsterblich in sie verliebt», erklärt Mulligan. Das Bedauern über diese unvorhergesehene Wendung der Ereignisse ist ihm noch heute anzusehen, obwohl die Sache wahrscheinlich mehr als vierzig Jahre zurückliegt.
Ich nehme noch einen großen Schluck Guinness und lasse Mulligan ein wenig Zeit für ein paar melancholische Gedanken an laue Sommernächte mit Betty Crowley. «Haben Sie versucht, sie umzustimmen?»
«Selbstverständlich. Ich habe ihr Briefe geschrieben und Blumen geschickt. Ich habe sie mit Einladungen überhäuft. Ich habe massenweise Konzert- und Kinokarten gekauft. Ich habe sie angefleht, wenigstens ein Eis mit mir essen zu gehen. Aber es half alles nichts. Anfang 1970 trennten sich nicht nur Simon and Garfunkel, sondern auch Betty Crowley und ich.»
«Traurige Geschichte», sage ich und frage mich, was wohl aus den beiden geworden wäre, wenn Betty eingelenkt hätte.
«Allerdings. Das mit Simon and Garfunkel hat mir den Rest gegeben», erwidert Mulligan. «Glücklicherweise trennten sich wenig später auch die Beatles. Das machte die Sache dann wieder ein bisschen wett.»
«Haben Sie sie je wiedergesehen?»
«Die Beatles?»
«Betty Crowley.»
«O ja!», erwidert Mulligan. «Ich beschloss, nach unserer Affäre tatsächlich Priester zu werden. Ich war frustriert, enttäuscht, ein bisschen lebensmüde, und ich war definitiv fertig mit der Liebe. Ideale Voraussetzungen, um als Seelsorger zu arbeiten. Ich war jedenfalls sicher, dass ich nie wieder eine Frau in meine Nähe lassen würde.»
Ich stutze. «Ich dachte, Sie sind Anglikaner.»
«Na und? Auch Anglikaner können ein Keuschheitsgelübde ablegen.»
«Ach, Sie haben …», sage ich und überlege. «Das finde ich …» Tja, wie finde ich es eigentlich, wenn jemand freiwillig auf Sex verzichtet? Auf jeden Fall seltsam. Und auch irgendwie fahrlässig. Was, wenn das alle machen würden? Sex könnte dann eines Tages plötzlich von der Evolutionsliste verschwinden. Wahrscheinlich haben Emus und Strauße auf ganz ähnliche Weise ihre Flugfähigkeit verzockt.
«Na ja, ich war eben jung, und deshalb habe ich überreagiert», unterbricht Mulligan meine Überlegungen. «Bereits im ersten Semester hatte sich mein Keuschheitsgelübde erledigt. Eine Irin hat dafür gesorgt. Sie hieß Grace McCorman, hatte rote Locken und die Angewohnheit, beim Orgasmus das halbe Studentenheim aufzuwecken.»
«Hören Sie das eigentlich auch?», frage ich. Seit unserer Havarie sind zu den beunruhigenden Geräuschen, die der Bus schon vorher gemacht hat, ein paar noch beunruhigendere Geräusche hinzugekommen. Zum einen ein Wummern, zum anderen ein Knirschen.
Mulligan schließt die Augen und konzentriert sich. «Klingt, als käme es von unten. Vielleicht das Fahrwerk. Oder die Räder. Oder auch die Bremsen.»
«In jedem Fall scheint es etwas zu sein, das wir noch benötigen», fasse ich zusammen. «Ich glaube, ich werde mal ein paar Worte mit unserer kompetenten Reiseleitung wechseln.»
«Ob das was bringt?», unkt Mulligan. «Die beiden haben gerade absichtlich eine Straßenlaterne überfahren. Glauben Sie, die interessieren sich für technische Feinheiten?»
«Hallo, hier ist nochmal der Willi», tönt es in diesem Moment wie zur Bestätigung aus den Lautsprechern. «Nach unserem kurzen ungeplanten Abstecher in die französische Provinz hat unser Navigationssystem jetzt wieder Empfang. Voraussichtlich werden wir in knapp einer Stunde in Calais eintreffen und dort die Fähre um …»
Diesmal wird Willis Durchsage von einem Scheppern unterbrochen, dass in eine Art Bimmeln übergeht. Es klingt, als würde uns ein penetranter Eisverkäufer verfolgen. Der Bus verringert die Geschwindigkeit, wodurch nun auch das Bimmeln leiser wird.
«Scheiße, Mann!», hört man Bertram sagen. «Das ist bestimmt die verfluchte Stoßstange. Die war eben schon locker.»
«Ja, und jetzt?», fragt Willi ratlos.
«Nix. Lass schleifen. Die fällt schon irgendwann ab», erwidert Bertram.
«Quatsch! Ist doch viel zu laut», stellt Willi fest. «Wie sollen die dahinten bei dem Krach denn pennen?»
Man hört Bertram lange seufzen. «Gut. Dann halt eben an. Wir schrauben das Drecksding ab. Dann ist Ruhe.»
Offenbar hat Willi vergessen, das Mikrophon abzuschalten, denn der Dialog war nicht für uns gedacht. Man merkt es an Willis folgender diplomatischer Durchsage: «Hallo, hier ist nochmal der Willi. Wir haben leider einige winzige technische Probleme, die wir aber rasch selbst beheben können. Wir werden deshalb kurz anhalten. Ich verspreche Ihnen, es dauert nicht lange. Vielen Dank schon jetzt für Ihr Verständnis.»
«Hab es mir abgewöhnt», sage ich wenig später zu Mulligan, als der mir eine Zigarette anbietet. Wir stehen auf der nassen Straße etwas abseits des Busses unter einem imposanten Sternenhimmel. Der Regen hat aufgehört. Leise hört man Bertram und Willi diskutieren, während sie sich mit der Stoßstange abmühen. Ein paar der Reisenden vertreten sich die Beine, rauchen und plaudern. Die meisten sind auf ihren Plätzen geblieben.
«Ich habe auch ein paarmal versucht, es mir abzugewöhnen», erwidert Mulligan. «Hat leider nie lange gehalten. Und inzwischen hab ich keine Lust mehr aufzuhören. Ist jetzt einfach zu spät.»
«Angeblich ja nicht», erwidere ich. «Es lohnt sich wohl noch …»
«Ja, ich weiß», unterbricht Mulligan ein wenig ungehalten. «Hat mein Arzt auch gesagt. Angeblich lohnt es sich immer. Wenn ich jetzt aufhöre, hat er gesagt, dann habe ich in zehn Jahren die Konstitution eines Nichtrauchers.»
«Und?»
«Nichts und. In zehn Jahren bin ich über siebzig. Was soll ich da mit der Konstitution eines Nichtrauchers? Besser aus dem Sessel hochkommen?»
Man hört klirrend einen Schraubenschlüssel auf den Asphalt fallen, gefolgt von einem leisen Fluchen.
«Kann ich jetzt doch eine Zigarette haben?», bitte ich.
«Auf gar keinen Fall.» Mulligan macht keine Anstalten, die Packung hervorzukramen. «Lassen Sie den Quatsch einfach. Ich bin ein alter Sack, aber Sie noch lange nicht. Wie alt sind Sie? Neununddreißig? Vierzig?»
«Dreiundvierzig.»
«Jedenfalls lohnt es sich bei Ihnen noch.»
«Sechzig ist eigentlich auch kein Alter.»
Mulligan lächelt. «Das stimmt. Es gibt ja auch einige Dinge in meinem Leben, für die es nicht zu spät ist. Und vielleicht gibt es sogar ein paar wenige Dinge, für die es im Leben NIE zu spät ist …» Er unterbricht sich selbst, inhaliert tief und bläst den Rauch in den Nachthimmel. «Aber kennen Sie das denn nicht? Diese Momente im Leben, wo etwas definitiv zu spät ist?»
«Doch», antworte ich und muss an Iris denken. Genau das hat sie zu mir gesagt. Dass aus uns vielleicht was hätte werden können. Dass es aber dafür definitiv zu spät ist.
«Ich sehe Ihnen an, dass Sie wissen, wovon ich rede», sagt Mulligan und hält mir nun doch die Packung Zigaretten hin.
Ich schüttele den Kopf. «Danke. Vielleicht sollte ich es wirklich lassen.»
Zufrieden steckt Mulligan die Zigaretten wieder ein.
«Sie haben eben gesagt, dass Sie Betty Crowley wiedergesehen haben.»
Mulligan nickt, kommt jedoch nicht dazu, mir zu antworten.
«Alles klar! Es kann weitergehen!», ruft Bertram, schiebt geräuschvoll seinen Werkzeugkasten in den Laderaum des Busses und lässt die Luke mit einem derartigen Krachen ins Schloss fallen, dass die meisten Reisegäste aus dem Schlaf hochschrecken.
Als wir wieder unsere Plätze eingenommen haben, sehe ich, dass auch Mulligan müde ist. Wir nippen an unseren Bieren.
«Ich möchte nur kurz die Augen schließen, nur eine Minute», sagt er. Im nächsten Moment ist er eingeschlafen.
Auch ich lehne mich zurück und lasse das Wummern des Motors und das Rauschen des Fahrtwindes auf mich wirken. Keine Minute später spüre ich eine bleierne Müdigkeit auf mich herabsinken.
«Endstation», höre ich als Nächstes Willi sagen. Die Stimme kommt aus weiter Ferne. Nur langsam erwache ich aus einem traumlosen Schlaf und schaue in das Gesicht unseres Fahrers.
«Was ist los?», frage ich verwirrt. «Sind wir etwa schon in London?»
Mulligan erwacht ebenfalls. Er murmelt etwas Unverständliches, nimmt einen Schluck Bier und späht aus dem Fenster.
«Haben Sie meine Durchsage nicht gehört?», fragt Willi.
Ich schüttele den Kopf. Dabei fällt mir auf, dass der Bus leer ist. Mulligan und ich sind die letzten Fahrgäste. Auch er registriert es nun.
«Die Achse ist hin», erklärt Willi. «Totalschaden. Also ist hier Schluss. Tut mir wirklich leid, aber da kann man nichts machen.»
«Haben wir etwa den Ersatzbus verpasst?», fragt Mulligan.
Willi schüttelt den Kopf. «Es gibt keinen Ersatzbus. Zumindest nicht vor morgen früh. Die anderen Reisegäste haben sich zu Fuß auf den Weg gemacht. Es sind nur knapp vier Kilometer bis zum Hafen, und die nächste Fähre geht erst in zwei Stunden. Das ist also problemlos zu schaffen.»
«Ist denn niemand auf die Idee gekommen, ein Taxi zu rufen?», fragt Mulligan verwundert und nimmt noch einen großen Schluck Guinness.
«Doch, aber da geht keiner ran. Entweder die sind beschäftigt, oder die haben auch technische Probleme.»
Mulligan und ich wechseln einen Blick.
«Tja …», sage ich und denke mit Unbehagen an meine beiden schweren Koffer. Vor vier Jahren hatte ich meinen ersten Bandscheibenvorfall, der zweite dürfte heute Nacht fällig werden.
Mulligan scheint ganz ähnliche Befürchtungen zu haben. «Wir sollen also mitsamt unserem Gepäck …?»
«Nein. Das Gepäck liefern wir selbstverständlich nach», unterbricht Willi generös. «Sie brauchen nur das Nötigste mitzunehmen. Die restlichen Sachen können ab morgen Mittag in unserem Büro in London abgeholt werden. Zusammen mit einem Reisegutschein als kleine Entschädigung für die Unannehmlichkeiten.»
«Und wie kommen wir von Dover nach London?», frage ich.
«Wir tun unser Bestes, um einen Ersatzbus zu chartern. Es dauert ja noch ein paar Stunden, bis die Fähre drüben ist. Bis dahin haben wir sicher eine Lösung gefunden.»
Mulligan zieht seine Kühltasche unterm Sitz hervor, greift nach seiner Jacke und erhebt sich. «Dann wollen wir mal, oder?»
Ich zucke mit den Schultern. «Wird uns nichts anderes übrigbleiben.»
Die Luft ist klar, schwarze Wolken verdecken den Sternenhimmel. Eine Weile gehen wir schweigend die spärlich beleuchtete Landstraße entlang. Mulligan steckt sich eine Zigarette an, öffnet eine Dose Bier und hält sie mir hin. Ich schüttele den Kopf. Ein Kaffee wäre mir jetzt lieber.
«Gibt es eigentlich in Ihrem Leben auch eine Betty Crowley? Oder hatten Sie mehr Glück in der Liebe als ich?»
Betty Crowley! Jetzt fällt mir wieder ein, dass wir zuletzt über sie sprachen. «Sie haben mir noch nicht erzählt, unter welchen Umständen Sie sie wiedergesehen haben.»
«Weichen Sie etwa meiner Frage aus?»
«Keineswegs.»
«Kommt mir aber so vor.»
«Es gibt auch eine unglückliche Liebe in meinem Leben», erwidere ich. «Ich erzähle Ihnen die Geschichte, aber zuerst möchte ich wissen, was aus Betty Crowley geworden ist.»
Mulligan wirft seine gerade erst angerauchte Zigarette auf die Straße, wo sie zischend in einer kleinen Pfütze erlischt. «Schmeckt nicht», kommentiert er und spült mit einem Schluck Guinness nach. «Ich habe Betty Crowley gleich nach meinem Studium wiedergesehen. Und seitdem sehe ich sie praktisch täglich.»
«Dann hatte die Geschichte doch ein Happy End?», frage ich irritiert.
«Nein. Wie ich viel später erfahren habe, hatte Betty noch ein zweites Eisen im Feuer, als sie mich abservierte. Während ich noch dachte, sie wäre sauer auf mich, lag sie längst im Bett von Patrick Tailor. Im Vergleich zu mir war er klar die bessere Partie. Er wollte das Autohaus seines Vaters übernehmen und eine Filiale in London eröffnen.»
«Sie ist seine Frau geworden», rate ich.
«Ganz genau», erwidert Mulligan. «Zu einer Londoner Filiale hat Patrick es nie gebracht, aber er bekam Betty. Später obendrein das Amt des Bürgermeisters. Und all das in genau jenem Kaff, das ich als Seelsorger betreue. Mein Bischof hielt es nämlich für eine gute Idee, dass ich dort als Priester arbeite, wo ich geboren bin.»
«Warum haben Sie nicht einfach um eine Versetzung gebeten?»
«Hab ich. Leider ohne Erfolg. Drei lange Jahre hab ich mich regelmäßig beim Bischof gemeldet, um immer neue Argumente für meine Versetzung vorzubringen. Aber er hat mich nicht erhört. Immerhin war das die Zeit, die ich brauchte, um über Betty Tailor hinwegzukommen.»
«Drei Jahre», wiederhole ich gedehnt und überschlage, dass die Sache mit Iris ein gutes Jahr zurückliegt. Ich stecke also noch in der ersten Halbzeit, und schon die kommt mir quälend lang vor.
«Am meisten hat es mir geholfen, mich in die Situation von Patrick zu versetzen», fährt Mulligan fort. «Betty lässt kein gutes Haar an ihm, weil er sich für die Provinz und gegen London entschieden hat. Überhaupt ist sie krankhaft ehrgeizig. Wenn ich mir vorstelle, dass sie heute mir die Hölle heißmachen würde, dann bin ich sehr froh, dass sie sich damals nicht für mich entschieden hat.»
«Das ist Ihnen erst nach drei Jahren klargeworden?», frage ich ungläubig.
«Ja», erwidert Mulligan leichthin. «Ich verliebte mich plötzlich in die Leiterin der Stadtbibliothek, und in diesem Moment fühlte ich, dass Betty Tailor aus meinem Herzen verschwunden war.»
«Sind Sie auch auf dem Weg zur Fähre?», hört man in diesem Moment eine alte und schwache Stimme aus dem Dunkel fragen.
Mulligan und ich halten inne. Am Straßenrand ist die Silhouette eines Mannes zu erkennen. Wie wir wenig später erfahren, handelt es sich um den dreiundneunzigjährigen William McCullum, einen starrköpfigen Iren, der sein Gepäck nicht mehr aus der Hand gibt, seit man es ihm einmal gestohlen hat.
«Das war am Abend des 14. März 1937», erklärt William. «Es regt mich immer noch fürchterlich auf, wenn ich nur dran denke.»
William hat deshalb seinen Koffer mitgenommen. Jetzt ist der alte Mann leider mit seinen Kräften am Ende. «Wenn Sie mir helfen würden, dann könnte ich es pünktlich bis zur Fähre schaffen. Sie müssen wissen, meine Urenkelin in Newham wird morgen volljährig.»
Mulligan dreht sich um. Weit hat McCullum es mit seinem Koffer nicht geschafft. Unser havarierter Reisebus steht keine dreihundert Meter entfernt. Ich ahne, was der Reverend denkt. Es wäre die einfachste Lösung, Williams Koffer zurückzubringen und dann gemeinsam zur Fähre zu gehen, statt das Gepäck des alten Mannes mehrere Kilometer weit zu schleppen. Wahrscheinlich wird William sich auf diesen Vorschlag jedoch nicht einlassen, weil er durch den mehr als siebzig Jahre zurückliegenden Kofferraub traumatisiert ist. Ich greife nach dem Gepäck vom alten McCullum und erleichtere damit Mulligan die Entscheidung.
Da der alte Mann auch ohne seinen schweren Koffer nicht gut zu Fuß ist, hätten wir um Haaresbreite die Fähre verpasst. Dort sorgt ein freundliches Besatzungsmitglied immerhin dafür, dass William sich auf einer Pritsche im Mannschaftsraum ausruhen darf. Der alte Mann ist froh, so anständige Leute wie uns getroffen zu haben, und bedankt sich überschwänglich. Seinen Koffer nimmt William trotzdem sicherheitshalber lieber mit in den Mannschaftsraum.
Während ich zwei Sixpacks Guinness besorge, um Mulligans Kühltasche aufzufüllen, und zwei Tassen Kaffee, um die Müdigkeit zu vertreiben, sucht der Reverend uns einen Fensterplatz. Die Sessel und Tische sind aus Hartplastik und in verschiedenen Orangetönen gehalten. Das soll wahrscheinlich frisch und freundlich wirken, tut es aber nicht. Man fühlt sich, als würde man in den siebziger Jahren an einem verlassenen Busbahnhof herumlungern.
Draußen herrscht tiefschwarze Nacht. Gischt spritzt gegen die Fensterscheiben. Man spürt deutlich den starken Seegang. Zu hören ist vom Rollen der Wellen und vom Rauschen des Windes hier drinnen aber kaum etwas. Lediglich das dumpfe und monotone Klopfen der Maschinen im Bauch des Schiffes erinnert daran, dass sich die Fähre durch schweres Wetter kämpft.
«Dann legen Sie mal los!», bittet Mulligan und öffnet eine Dose Bier, nachdem er kurz an seinem Kaffee genippt hat.
Ich sehe ihn fragend an.
«Ihre Betty-Crowley-Geschichte», setzt er nach.
«Ach ja», erwidere ich und überlege, wo ich anfangen soll.
«Wie heißt sie denn überhaupt?», hilft Mulligan mir auf die Sprünge.
«Iris.»
«Ein hübscher Name.» Er zieht ein weiteres Bier aus der Kühltasche, öffnet es und stellt es neben meinen Kaffee.
«Ihre Schwester erwartet ein Kind von mir», falle ich mit der Tür ins Haus.
Mulligan schiebt langsam seine Kaffeetasse zur Seite. «Sie lieben eine Frau, von deren Schwester Sie ein Kind erwarten.»
«Genauso ist es», sage ich nickend.
«Und wieso? Haben Sie sich nicht entscheiden können?», rät Mulligan.
«Doch, ich hätte mich für Iris entschieden. Aber die ist die Frau eines anderen geworden. Wir hatten kurz vor ihrer Hochzeit was miteinander. Ich wollte sie überreden, nicht vor den Altar zu treten. Leider kam ich zu spät. Ihr Mann ist ihr nicht sonderlich treu, aber die beiden haben ein Kind. Deshalb will sie ihn nicht verlassen.»
«Haben Sie nach der Hochzeit nochmal mit ihr gesprochen?»
«Mehrmals», erwidere ich. «Ich habe auch versucht, sie umzustimmen, aber Iris hat jedes Mal klargemacht, dass es dafür zu spät ist.»
«Und wie kam es dann zu der Affäre mit der Schwester?»
«Ach, eigentlich war das mit Audrey keine Affäre.»
Mulligan stutzt. «Aber sie erwartet doch ein Kind von Ihnen, oder?»
Ich nicke. «Trotzdem hatten wir nur ein einziges Mal Sex.»
Mulligan schiebt die Unterlippe ein wenig vor und nickt anerkennend.
«Was?», frage ich leicht gereizt. «Kommen Sie mir jetzt nicht mit göttlicher Fügung oder so. Es war ein Zufall, nichts weiter.»
Er winkt ab und nippt an seinem Bier. «Ich käme nie auf die Idee, Gott in Ihre Bettgeschichten reinzuziehen. Aber sagen Sie mir: Ist das jetzt ein glücklicher oder ein unglücklicher Zufall, dass Sie Vater werden?»
«Gute Frage», erwidere ich. «Ich habe es erst vorgestern erfahren und hatte bis jetzt noch keine Gelegenheit, darüber nachzudenken.»
«Aber was sagt Ihr Bauchgefühl?», insistiert Mulligan.
Ich nehme einen Schluck Kaffee und versuche zu meinem Bauchgefühl durchzudringen. «Keine Ahnung», sage ich dann. «Ich habe damit gerechnet, dass ich irgendwann einmal Vater werden würde. Allerdings habe ich es mir etwas anders vorgestellt.»
«Wie Sie bereits wissen, habe ich mir mein Leben auch etwas anders vorgestellt», erwidert Mulligan. «Aber das muss ja nichts heißen.»
«Audrey ist zum Beispiel viel jünger als ich.»
«Muss nichts heißen», lächelt Mulligan.
«Sie jettet als Fotografin durch die Weltgeschichte.»
«Muss nichts heißen.»
«Wir leben nicht mal im gleichen Land.»
«Muss auch nichts heißen.»
«Ich bin immer noch in Iris verliebt.»
Kurzes Schweigen.
«Gut. Das ist Scheiße», stellt Mulligan sachlich fest.
Wir nippen an unseren Getränken und hängen unseren Gedanken nach.
«Ich bin auf dem Weg nach London, weil ich versuchen will, das Beste aus der Situation zu machen», sage ich nach einer Weile. «Ich glaube nicht, dass Audrey und ich eine Beziehung haben werden. Aber immerhin können wir dafür sorgen, dass es dem Kind gutgeht.»
«Hört sich an, als würden Sie sich aufopfern.»
«Nein! Quatsch!», erwidere ich im Brustton der Überzeugung, bin aber doch einen kurzen Moment irritiert.
Mulligan sieht mich ruhig an und schweigt.
«Sie glauben, dass ich das alles eines schlechten Gewissens wegen mache?», frage ich unbehaglich.
«Ich weiß es nicht, aber Sie sollten darüber nachdenken. Schuld ist eine starke Triebfeder. Wenn es sie nicht gäbe, dann könnten wir sämtliche Kirchen dichtmachen.»
Während ich überlege, sieht Mulligan mich forschend an. «Ich scheine jedenfalls nicht ganz falschzuliegen», sagt er nach einer Weile.
Ich greife nun doch nach meinem Bier und seufze. «Audrey und Iris stammen aus wohlhabenden Verhältnissen. Die Familie besaß einen Verlag, der aber der Wirtschaftskrise im letzten Jahr zum Opfer gefallen ist.»
«Und was hat das mit Ihnen zu tun?»
«Ich habe das Unternehmen geleitet.»
Mulligan stößt einen anerkennenden Pfiff aus.
«Ich habe den Verlag schon vorher verlassen. Der Bankrott war also nicht meine Schuld, aber …»
«… aber für die Familie sind Sie trotzdem der Schuldige», vollendet Mulligan den Satz.
Ich zucke mit den Schultern. «Sagen wir, zumindest die Patriarchin ist nicht gut auf mich zu sprechen», erwidere ich.
«Ist sie hübsch? Könnte sie mein Typ sein?», fragt Mulligan, ohne eine Miene zu verziehen.
«Elisabeth von Beuten ist zwanzig Jahre älter als Sie.»
«Elisabeth von Beuten», wiederholt Mulligan langsam. «Ist sie wirklich so hart, wie ihr Name klingt?»
Ich nicke. «Mindestens so hart.»
«Wo müssen Sie eigentlich hin?», fragt Mulligan.
«Irgendwo in den Norden von London», erwidere ich und krame einen Zettel aus der Tasche, auf dem ich die Adresse notiert habe.
«Ich muss zwar in den Süden, aber ich nehme Sie mit», verkündet Mulligan. «Sie haben schon genug Probleme am Hals, da müssen Sie sich jetzt nicht auch noch mit öffentlichen Verkehrsmitteln durchs Vereinigte Königreich schlagen.»
«Sie haben ein Auto?», frage ich.
«Nein. Ich habe kein Auto. Ich werde ein Taxi nehmen.»
«Das kann ich mir nicht leisten», erwidere ich. Und denke mit Unbehagen daran, dass ich mir im Moment kaum etwas leisten kann.
«Ich mir auch nicht», verkündet Mulligan. «Ich werde einfach die Kollekte der letzten drei Monate auf den Kopf hauen.»
«Vielleicht kriegen wir in Dover ja auch unseren Ersatzbus», sage ich.
Mulligan lacht. «Ich wette fünf Pfund dagegen.»
«Hätte ich mir denken können, dass Sie auch noch wetten.»
Mulligan nickt zufrieden. «Ja. Ich trinke. Ich rauche. Ich wette. Und wenn es möglich wäre, dann würde ich auch mit Betty Tailor schlafen.»
Es dämmert, als der Reverend mich in einem Londoner Vorort absetzt. Am Ende eines verwilderten Gartens ist ein kleines Cottage zu sehen, das sich unter einer mächtigen Ulme zu ducken scheint. Alles ist ruhig. Ich kann mein Herz schlagen hören. Das liegt aber nicht an der Stille, sondern an der bevorstehenden Begegnung mit Iris, denke ich, und gelange an die hölzerne Eingangstür. Ich klopfe. Nichts geschieht. Ich klopfe erneut und stelle mir vor, dass gleich diese Tür aufgeht und Iris’ Engelsgesicht erscheinen wird. Wieder keine Reaktion, wieder klopfe ich. Nun sind leise Geräusche zu hören. Ich warte.
Langsam wird die Tür geöffnet. Iris steht vor mir. Sie sieht nicht nur nicht engelhaft aus, sondern völlig verwahrlost. Ihre Haare sind wirr und ungewaschen, der Morgenmantel ist fleckig, sie hat tiefe Ringe unter den Augen, und ihr Gesichtsausdruck erinnert an verwirrte alte Frauen, die mit Dutzenden von Katzen zusammenleben.
«Hi», sage ich ebenso unsicher wie erschrocken.
«Wenn sie jetzt wieder wach wird, dann bring ich dich um», flüstert Iris. Es klingt wie das gefährliche Versprechen einer geisteskranken Serienmörderin.
Stille. Ich frage mich, was mit ihr los ist.
Dann hört man plötzlich ein kurzes Aufstöhnen, gefolgt von dem langsam anschwellenden, sirenenartigen Geräusch eines schreienden Säuglings.
Das Londoner Büro hat Funkkontakt
«Soll ich uns vielleicht einen Kaffee machen?», frage ich durch die geschlossene Badezimmertür. Keine Reaktion von Iris.
«Und gibt es hier vielleicht irgendwo einen Bäcker?», setze ich nach. «Ich könnte uns ein paar …» Drinnen wird demonstrativ ein Föhn eingeschaltet. Ich soll also meine Frühstücksplanung offenbar für mich behalten.
«Deine Mami ist immer noch sauer auf mich», sage ich zu Mary-Ann. Die Kleine hört mir ebenfalls nicht zu, sondern wartet darauf, dass ich ihre gerade abgelaufene Spieluhr wieder aufziehe. Routiniert betätige ich den Drehknopf. Das rhythmische Knacken lässt Mary-Ann aufgeregt an ihrem Schnuller nuckeln. Dann klimpert der kleine Plastikkasten über ihrem Bettchen ein weiteres Mal Frère Jacques. Sie lächelt zufrieden. Wir haben das Lied seit Sonnenaufgang nach meiner Schätzung etwa eine Million Mal gehört. Mary-Ann ist offenbar ein großer Fan der Melodie. Ich hingegen befürchte, dass Frère Jacques mein Ticket in eine düstere viktorianische Nervenheilanstalt sein könnte, wo ich als «Crazy Brother John» den Rest meiner Tage in einer Einzelzelle verbringen muss.
«Hast du mich eben was gefragt?», erkundigt sich Iris und reißt mich damit aus meinen apokalyptischen Tagträumen. Ein paar Stunden Schlaf und eine Dusche haben ihr sichtlich gutgetan. Sie wirkt erholt und längst nicht mehr so angespannt wie in den frühen Morgenstunden. Mit wenigen Handgriffen bindet sie ihre Haare zu einem Zopf.
«Rot?», frage ich verblüfft. «Blond stand dir aber auch nicht schlecht.»
«War es das, was du wissen wolltest?»
«Nein. Ich wollte uns einen Kaffee machen», erwidere ich.
«Ich mach schon», sagt sie und geht die wenigen Schritte zur Küchenzeile.
«Du bist nicht mehr sauer auf mich», stelle ich erfreut fest.
«Wegen Mary-Ann? Nein. Du hast mir ein paar Stunden Freizeit ermöglicht. Ich müsste dir eigentlich sogar sehr dankbar sein.»
Dann hat sich meine Nachtschicht zumindest in dieser Hinsicht gelohnt, denke ich. Im gleichen Moment fällt mir Iris’ merkwürdige Wortwahl auf.
«Wieso müsste?», frage ich.
«Na ja. Dass ich mir überhaupt die Nächte mit Mary-Ann um die Ohren schlagen muss, habe ich schließlich dir zu verdanken. Timothy könnte mir helfen, aber er ist in Deutschland und versucht im Verlag zu retten, was noch zu retten ist.»
«Und das heißt?», frage ich verdutzt. Mir ist völlig schleierhaft, worauf Iris hinauswill.
Sie ist nun ebenfalls verwundert. «Ich glaube, du bist an der ganzen Misere nicht völlig unschuldig, oder?»
Ich bin baff. «Doch, bin ich. Ich hab den Laden verlassen, lange bevor das Insolvenzverfahren eröffnet wurde», wehre ich mich.
«Ja, und zwar Hals über Kopf. Gewisse Leute glauben, du hast sehr genau gewusst, was auf den Verlag zukam, und dich deshalb rechtzeitig aus dem Staub gemacht.»
Ich spüre, dass Iris’ Verdächtigungen mich auf die Palme bringen. «Bei diesen gewissen Leuten handelt es sich nicht zufällig um deinen Vater und deine Großmutter, oder?»
«Wenn alle so schrecklich falschliegen, dann sag du mir doch einfach, wie es wirklich war», erwidert sie schnippisch und stellt eine Tasse Kaffee auf den alten, aber hübschen Küchentisch. «Bitte sehr.»
«Danke sehr.» Ich nehme einen Schluck und überlege. «Du willst die Wahrheit wissen? Okay. Die Wahrheit ist, dass ich den Job deinetwegen hingeschmissen habe.»
Jetzt ist Iris bass erstaunt. Sie stellt eine weitere Tasse Kaffee auf den Tisch und setzt sich. «Was soll das heißen: meinetwegen?»
«Du hast mich doch damals gebeten, Timothy zu helfen …», beginne ich.
Ihr spöttisches Lachen beendet den Satz vorzeitig. «Schon klar. Du hast dich aufgeopfert, um meine Ehe zu retten. Willst du mir das erzählen?»
Ich schüttele den Kopf. «Deine Ehe war mir völlig gleichgültig. Ich hab sogar lange Zeit gehofft, dass sie scheitern würde. Vielleicht hätte ich dann ja eine Chance bei dir bekommen.»
Sie sieht mich durchdringend an. «Aber stattdessen hast du Timothy geholfen und damit auch meiner Ehe. Wie passt denn das zusammen?»
«Ganz einfach. Hätte ich dir die Bitte abgeschlagen, säßen wir jetzt nicht hier. Du würdest mir nämlich bis in alle Ewigkeit vorwerfen, dass ich deine Ehe zerstört und dich zur mittellosen, alleinerziehenden Mutter gemacht habe. Außerdem hatte ich sowieso keine Lust mehr auf den Job. Die Entscheidung ist mir also leichtgefallen.»
Letzteres stimmt nicht ganz. Erst als ich verstanden hatte, dass Iris für mich unerreichbar bleiben würde, hatte ich plötzlich das drängende Verlangen, mein Leben über den Haufen zu werfen. Ich weiß nicht, ob ich das auch getan hätte, wenn Iris nicht gewesen wäre.
Sie sieht mich immer noch an. «Du bist ein merkwürdiger Mensch, Paul.»
«Ja. Schon möglich.»
«Stimmt es, dass du alles verloren hast?»
«Gut, dass du das ansprichst. Ich wollte dich nämlich sowieso bitten, mir ein bisschen Geld zu leihen.» Die Frage ist mir zwar äußerst unangenehm, aber ich weiß gerade nicht einmal, wovon ich eine Busfahrkarte in die City bezahlen soll, um dort meinen Freund Schamski zu treffen.
Iris erhebt sich wortlos, zieht einen Geldschein aus einer Schublade und legt ihn mir hin. «Fünfzig Pfund. Mehr habe ich im Moment nicht.»
«Danke.» Rasch stecke ich das Geld ein. «Ich hoffe, Audrey kann mir was vorstrecken, bis ich einen Job habe. Dann gebe ich es dir sofort zurück.»
Iris winkt ab. «Schon okay. Im Moment helfen wir uns alle gegenseitig. In ein paar Wochen wissen wir, wie es um den Verlag und das Familienvermögen steht. Mit etwas Glück beginnen dann wieder bessere Zeiten.»
«Ich weiß. Audrey hat mir erzählt, dass sie eine Weile bei euch wohnen kann. Das ist sehr großzügig. Wo steckt sie eigentlich?»
«Im Kongo.»
Das stundenlange Geklimper von Frère Jacques zeigt offenbar Wirkung.
«Entschuldige», sage ich. «Ich habe gerade verstanden: im Kongo.»
Iris nickt. «Richtig. Das habe ich ja auch gesagt.»
«Im Kongo», wiederhole ich und stelle mir vor, wie in meinem Gehirn die Angestellten hektisch durcheinanderlaufen, weil sie die Information nicht zuordnen können. «Audrey war vorgestern noch bei mir», rekapituliere ich hilflos. «Und sie ist hochschwanger. In ein oder zwei Wochen könnte das Kind kommen.»
«Oder in genau vier Tagen», erwidert Iris ungerührt. «Das wäre dann nämlich der errechnete Geburtstermin.»
«Reden wir denn vom gleichen Kongo?», frage ich ebenso blöd wie aufgeschmissen.
«Ich rede von dem in Afrika», erklärt Iris.
«Aber wie ist sie denn da überhaupt hingekommen? Das dauert doch ewig mit dem Schiff», stelle ich empört fest.
«Sie ist geflogen.» Iris sieht, dass ich etwas einwenden will, und hebt die Hand. «Es war kein regulärer Flug. Eine humanitäre Organisation hat die Maschine gechartert, um zwanzig Ärzte in den Kongo zu fliegen. Audrey ist dabei, um die Aktion fotografisch zu dokumentieren. Die Initiatoren sind Freunde von ihr. Deshalb hat sie zugesagt. Außerdem ist sie ja umringt von Ärzten, falls es Schwierigkeiten gibt. Es kann also eigentlich nichts passieren.»
«Ist das wirklich deine Meinung?», frage ich skeptisch.
«Nein! Das hat Audrey gesagt. Ich fand die Aktion sehr gewagt.»
«Gewagt?», ereifere ich mich. «Das ist totaler Schwachsinn! Was, wenn sie Wehen bekommt? Dann ist zwar das größte Ärzteteam der Geschichte bei ihr, aber wahrscheinlich müssen sich alle ein Stethoskop teilen. Außerdem sind die Krankenbaracken sicher total überfüllt. Das Wasser ist dreckig, die Tiere sind giftig, und die Hitze ist mörderisch.»
«Die politischen Unruhen hast du vergessen.»
«Meinetwegen gibt es auch noch politische Unruhen», ergänze ich schlecht gelaunt. «Kann ich sie irgendwie erreichen?»
«Nein. Im Grunde nicht», erwidert Iris. «Das Londoner Büro hat Funkkontakt, aber auch nur gelegentlich. Am besten, du gehst da vorbei und fragst, ob sie dich mit Audrey verbinden können. Übermorgen will sie aber sowieso wieder zurück sein.»
«Dann hoffe ich nur, dass sich unser Sohn an seinen errechneten Geburtstermin hält.» Es hört sich wie ein Witz an. Aber gerade mache ich mir wirklich Sorgen um Audrey und das Baby.
«Meine Schwester kennt sich mit Extremsituationen ganz gut aus», sagt Iris beruhigend. «Audrey ist zwar risikofreudig und manchmal auch ziemlich chaotisch. Aber sie ist nicht verrückt. Mach dir also keine Sorgen, es wird schon alles gutgehen.»
Auf dem Weg zu Schamski hallt Iris’ Bemerkung in meinem Kopf nach. In den vergangenen Monaten habe ich getreu diesem Leitspruch gelebt. Ich habe mir keine Sorgen gemacht und daran geglaubt, dass die Dinge sich schon irgendwie zum Guten wenden werden. Leider ist das Gegenteil eingetreten. Seit ich auf mein Glück vertraue, hält mir das Pech eisern die Treue. Jetzt bin ich ein Mann in den Vierzigern, der keinen Job, kein Geld und keine berufliche Perspektive hat, dafür aber bald eine Familie ernähren muss. Vielleicht sollte man den Leitspruch einfach abwandeln. Ich würde es so formulieren: Mach dir schon deshalb keine Sorgen, weil du damit rein gar nichts an deinen Problemen änderst.




























