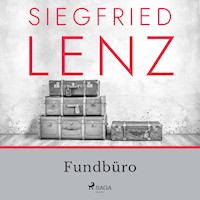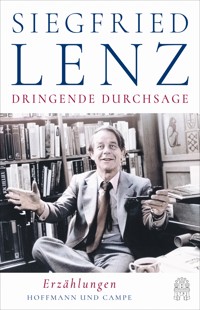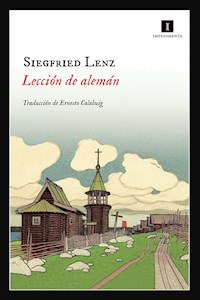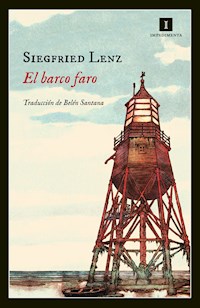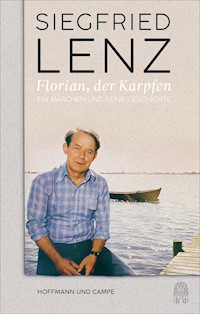12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Von Meer und Küste, Fluss und Hafen, Wracks und Tauchern und dem Glück, einen Fisch zu fangen. Die schönsten Meerestexte von Siegfried Lenz in einem Band versammelt, von Hanjo Kesting zusammengestellt. Siegfried Lenz, der mit seinem Roman "Deutschstunde" Weltruhm erlangte, ist nicht nur einer der letzten großen Geschichtenerzähler, er ist auch ein Schriftsteller des Meeres. Strände, Häfen, Inseln, Küsten, Fjorde, große und kleine Schiffe und Wracks sind die Schauplätze seines Werks. "Der Mann fühlte, wie eine eigentümliche Unruhe ihn ergriff, der Wunsch, an das Wrack zu gelangen, das kaum zwanzig Meter unter ihm lag und groß war, schwarz und unbekannt. Er war allein auf dem Strom, und er ließ sich mehrmals über die Stelle treiben, wo das Wrack lag, aber er konnte nichts erkennen. Er wußte nur, daß es da war, ein Wrack, das nur er allein kannte. Die anderen Wracks, die im Strom gelegen hatten, waren längst gehoben oder unter Wasser gesprengt worden: was er wußte, wußte er allein."
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Siegfried Lenz
Wasserwelten
Von Meer und Küste, Fluß und Hafen,
Wracks und Tauchern und dem Glück,
einen Fisch zu fangen
Nebst einem Epilog: Kleines Strandgut
Herausgegeben
von Hanjo Kesting
1. Auflage 2009
Copyright © für diese Zusammenstellung
by Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg
www.hoca.de
ISBN 978-3-455-40258-2
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
www.kreutzfeldt.de
Inhalt
Vorwort von Hanjo Kesting 9
Meer und Küste 21
Fluß und Hafen 83
Marine 157
Die Wracks und die Taucher 169
Vom Fischen und Angeln 243
Aquariums-Kulturoder Der große Zackenbarsch 305
Seit dem Märzmorgen, an dem ich durch das
Eis des Lyck-Sees brach, hatte ich eine besondere
Beziehung zum Wasser – eine Art dämmerndes
Heimweh verbindet mich mit ihm, ein sanfter
neurotischer Eros beginnt wirksam zu werden,
sobald ich unter die Oberfläche tauche; es gab
schon Augenblicke, da hielt ich mich für einen
masurischen, rundköpfigen Bruder Undines.
»Ich zum Beispiel«, 1966
Vorwort von Hanjo Kesting
Undines Bruder
Die Wasserwelten des Siegfried Lenz
Von früh auf fühlte er sich vom Wasser angezogen, von früh auf war er mit dem Wasser vertraut. Den Lyck-See in Masuren befuhr er als Junge mit dem Boot und dem Binsenfloß, dort lernte er, bevor er lesen lernte, das Schwimmen, Tauchen und Fischen, dort genoß er die Schönheit der Fische, die Verheißungen des Horizonts, die Märchenwelt reglos gespiegelter Kindheit. Dem See bot er seine zarte Freundschaft an, die auch nicht erschüttert wurde, als er an einem Märzmorgen durch das mürbe Eis brach und nur mit Mühe gerettet wurde. Das Unglück nahm er als eine Vertraulichkeit, es befestigte nur sein Verhältnis zum See und zum Wasser.
Früh war bei Siegfried Lenz die Ahnung da, daß er sich auf dem Wasser würde bestätigen müssen: »Ich sah mich als Boot, durchschnitt mit meinem Bug die Wellen, und die einzige Spur, die ich zurückließ, war die schaumige, sacht sterbende Linie des Kielwassers.« So steht es in dem einzigen autobiographischen Text, den wir von Lenz kennen und der mit »Ich zum Beispiel« überschrieben ist. Weiter heißt es da: »In trüber Voraussicht erkannte ich, daß ich meine Höchstleistung auf dem Wasser vollbringen würde.« Noch mit achtzehn, als er sichzur Marine meldete, hielt er sich für einen Favoriten des Wassers, des Meeres, für einen »ausgemachten Günstling der einflußreichen Wassergeister«.
War es nur ein Kindheits- und Jugendtraum? Auch als Schriftsteller ist Siegfried Lenz vom Wasser nicht losgekommen. Das Wasser ist in seinen Romanen und Erzählungen allgegenwärtig, in allen Erscheinungsformen durchzieht es sein Werk: als Meer, als Fluß, als See, als Hafen. Ebbe und Flut bestimmen seinen Rhythmus, Inseln, Küsten, Fjorde, große und kleine Schiffe bilden seine Schauplätze. Sein Personal besteht zu großen Teilen aus Menschen, die am Wasser und vom Wasser leben: Fischer, Angler, Taucher, Matrosen, Hafenarbeiter, Schauerleute. Wenn der Autor der Erzählung »Der Mensch auf dem Meeresboden« einmal verwundert konstatiert, daß sich die meisten Menschen mit dem knappen Drittel Festland auf unserer Erde begnügen, dann gilt diese Feststellung zweifellos nicht für ihn selbst. Siegfried Lenz fühlt sich unwiderstehlich von der weitaus größeren Wasserfläche angezogen, die den Globus bedeckt. Seine Bücher sind ohne das Wasser nicht denkbar. Und wie alle Wasserläufe der Welt zuletzt ins Meer einmünden, so führt auch der Strom von Siegfried Lenz’ Erzählen am Ende unfehlbar zum Wasser, als folge es einem verborgenen Gesetz.
Als ich ihn kennenlernte, vor nunmehr fünfunddreißig Jahren, um ein erstes Gespräch für den Rundfunk mit ihm aufzunehmen, fielen mir zunächst seine Augen auf, Augen von einer tiefen, ungewöhnlichen Bläue, die ihr Gegenüber – so kam es mir vor – nicht fest fixierten undklar ins Auge faßten, sondern in denen etwas Weiches, Verschwimmendes, Flutendes war, fast möchte ich sagen, etwas von der Farbe und der Bewegung des Meeres. Unwillkürlich fiel mir beim Blick in diese Augen die Beschreibung ein, die Sophia Hawthorne, die Frau des berühmten Schriftstellers, von Melville gegeben hat, nachdem dieser zu einem nachbarschaftlichen Besuch nach Lenox gekommen war. Sie rühmt das Wahrnehmungsvermögen seiner nicht sehr großen Augen und fährt dann fort: »Manchmal weicht seine Lebhaftigkeit einem außergewöhnlich stillen Ausdruck in diesen Augen, ein zurückgenommener, verschwommener Blick, der dir gleichzeitig das Gefühl gibt, daß er in diesem Augenblick auf das genaueste wahrnimmt, was vor ihm ist. Es ist ein merkwürdiger, träger Blick, von dem aber eine ganz einmalige Kraft ausgeht. Er scheint dich nicht zu durchdringen, sondern dich in sich aufzunehmen.«
Bei jeder späteren Begegnung mit Siegfried Lenz hat sich dieser Eindruck erneuert, sogar noch über die Bilder des Fernsehschirmes, als bei der Feier seines achtzigsten Geburtstags die Kameras für einige Sekunden auf seinem Gesicht verweilten. Die Vermutung war nicht abzuweisen, dieser Schriftsteller besitze eine besondere Beziehung zum feuchten Element. Tatsächlich ist er, wie vor ihm Melville, aber auch Conrad und Hemingway, ein Schriftsteller des Wassers und des Meeres. Es sind aber nicht die fernen Gewässer der Südsee oder der Karibik, zu denen er sich hinträumt, sondern die heimatlichen Gewässer, die er aus eigener Erfahrung kennt: Nordsee und Ostsee,das Wattenmeer, die nord- und ostfriesischen Inseln, die Seen Dänemarks und Schleswig-Holsteins, die Elbe, der Hamburger Hafen. Die Seekarte des Lenzschen Werkes zeigt eine vertraute Topographie. Das gilt für frühe Erzählungen wie »Das Wrack« und »Die Flut war pünktlich«, die auf der Elbe bzw. am Wattenmeer spielen, und für die Erzählung »Das Feuerschiff«, die ein festliegendes Schiff an der Küste der Ostsee zum Schauplatz hat. Es gilt nicht weniger für den großen Roman Deutschstunde mit seinen wechselnden Schauplätzen: hier das Dorf Rugbüll am nordfriesischen Wattenmeer, wo der Maler Max Ludwig Nansen seine verbotenen Bilder malt, dort die Elbinsel mit der Jugendstrafanstalt, wo der Erzähler Siggi Jepsen seine Geschichte zu Papier bringt: »... schau ich zum Fenster hinaus, fließt da durch mein weiches Spiegelbild die Elbe; mach ich die Augen zu, hört sie nicht auf zu fließen, ganz bedeckt mit bläulich schimmerndem Treibeis.«
Nicht denkbar ist der frühe Roman Der Mann im Strom ohne den Hamburger Hafen und die Präsenz des großen Flusses, der bereits mit den ersten Sätzen ins Bild kommt. In der Erzählung »Einstein überquert die Elbe bei Hamburg« wiederum, einem in nur drei Sätzen erzählten novellistischen Glanzstück, gewinnt der Fluß in aller Genauigkeit des realistischen Details ein quasi surrealistisches Ansehen, als gerieten Zeit und Ort durch den unwirklichen Fahrgast an Bord der Fähre für einen Augenblick aus den Fugen.
Eine andere Erzählung, zwölf Jahre früher entstanden,heißt »Stimmungen der See« und handelt von dem Versuch einer Ostseeüberquerung in einem kleinen Fischkutter. Erzählt wird die – einigermaßen zeittypische – Geschichte einer Flucht aus dem Dritten Reich. Doch im Verlauf der Erzählung verlieren die Personen allmählich an Bedeutung neben dem eigentlichen Protagonisten der Geschichte, dem wandelbaren, launischen, übermächtigen Meer, das sein Gesicht innerhalb weniger Stunden unaufhörlich verändert und das Gesetz des Handelns bestimmt.
Lenz’ Schilderung ist von einer intensiven Genauigkeit, die seine intime Vertrautheit mit den maritimen Vorgängen belegt. Er kennt die »Stimmungen der See«, die wechselnden Farben des Wassers, die unberechenbaren Strömungen, die Launen des Windes, die Wolkenbildungen, die Bewegungen des Bootes, das auf den Wellenkämmen reitet, torkelt, trudelt oder schwojt. Jederzeit ist spürbar, daß der Autor sich nicht nur kurzfristig »kundig gemacht« hat – so wie man sich für einen bestimmten Zweck gewisse, genau umgrenzte Kenntnisse aneignet –, Siegfried Lenz kennt sich tatsächlich aus. Er kennt die Küsten und Inseln, Flüsse und Seen Norddeutschlands, die Gewohnheiten der Bewohner, ihre scheinbar nüchterne Wesensart, ihre Einsilbigkeit und Kurzangebundenheit, ihre schwere, oft mühselige Arbeit, aber auch die Eigenarten der nautischen Berufe: Typen und Formen von Schiffen und Booten, die Handgriffe der Seeleute, ihre Sprache und Fachausdrücke, das besondere Vokabular, das ihre Redeweise prägt. Solche Kenntnis erwirbt sich nicht von heute auf morgen, sie setzt lange Beschäftigung aus Neigung und innerer Affinität voraus.
Siegfried Lenz hat sich einmal einen »Bruder Undines« genannt, aber man könnte ihn auch einen Nachfahren von Odysseus, Robinson und Ahab nennen, von Figuren also, die schon früh seine Phantasie besetzt hielten. Wie sie suchen die Helden seiner Bücher den Kampf, das Abenteuer, die Möglichkeit der Bewährung. Doch bleibt ihnen die Erfahrung des Scheiterns und der Niederlage nicht erspart, auch wenn sie durch Geduld und Ausdauer verzögert wird. Schon in dem frühen Roman Duell mit dem Schatten erklärt der Protagonist: »Am Aushalten ... erkennt man den Grad der Mündigkeit. Aushalten, das heißt, dem Gleichmut der Welt seinen eigenen Gleichmut entgegensetzen.«
Der Satz ist ein Schlüsselsatz für Lenz, eine Konfession des Schriftstellers, der lebenslang geschrieben und »ausgehalten« hat: den Gleichmut der Welt und ihre Widerstände. Wenn zur Vollendung eines Schriftstellers, mit Goethe gesprochen, die Fülle gehört, die Stetigkeit in verschiedenen Lebensphasen, dann gibt es dafür in unserer Literatur kein besseres Beispiel als Siegfried Lenz. In über fünfzig Jahren hat er ein Werk von erstaunlichem Umfang hervorgebracht: vierzehn Romane, über hundert Erzählungen, Theaterstücke, Essays, Reden, Rezensionen, daneben die vielen Forderungen des Tages, denen er sich nicht entzogen hat, ohne der Gefahr zu erliegen, zum »Oberkellner der Aktualität« zu werden.
Das auffälligste Merkmal dieses Schriftstellers ist Stetigkeit, Stetigkeit in jeder Hinsicht und in allen Lebenslagen: in seinem persönlichen Leben, in seiner Beziehung zu bestimmten Orten, im Verhältnis zu seinem Verlag, in seinen literarischen Themen, seiner Technik, seiner epischen Geduld. »Ich habe früh festgestellt«, hat er in einem Gespräch gesagt, »daß, wenn man schreibend leben möchte, Sitzfleisch dazu gehört, nicht nur Inspiration, sondern Sitzfleisch, Starrsinn, Ausdauer.«
Blicken wir einen Augenblick zurück. Lenz’ Debütroman Es waren Habichte in der Luft, der 1951 erschien, handelte von Schrecken und Entscheidungsnot, von der Möglichkeit richtigen und falschen Handelns. Der Roman war durch Thema, Sprache und Form typisch für die frühe Nachkriegszeit. Der Autor zeigte, daß er seine Lektion gelernt hatte – die geschichtliche Lektion eines jungen Deutschen, der im masurischen Ostpreußen geboren worden war und die Heimat seiner Kindheit und Jugend unwiederbringlich verloren wußte. Der als Siebzehnjähriger in den Hitler-Krieg zog und durch ihn seiner Illusionen (wenn er denn welche gehabt hatte) beraubt und um einige schmerzhafte Erfahrungen bereichert wurde. Davon hat Siegfried Lenz in der autobiographischen Skizze »Ich zum Beispiel«, später auch in der Erzählung »Ein Kriegsende« berichtet. Den Satz von André Gide: »Ich baue nur noch auf die Deserteure«, hat er beherzigt, sein Gewehr weggeworfen und sich durchgeschlagen von Versteck zu Versteck in den dänischen Wäldern. Er war neunzehn, als Krieg und Naziherrschaft zu Ende waren, er begann zu schreiben, als die Bundesrepublikgegründet wurde, und er war bereits einer ihrer bekanntesten Schriftsteller, als sie im Wirtschaftswunder blühte und mit ihrer Vorgeschichte allzu schnell fertig zu werden schien.
Dieser Erfahrung, diesem Thema ist Siegfried Lenz niemals entkommen. Vor allem seine beiden dem Umfang nach größten Romane sind davon bestimmt: Deutschstunde und Heimatmuseum, erschienen 1968 und 1978. Diese Bücher stellen so etwas wie epischen Geschichtsunterricht dar, ohne in dieser Kennzeichnung völlig aufzugehen. Nicht zufällig hat Marcel Reich-Ranicki mit Blick auf die beiden Romane Thomas Mann zitiert: »Nicht deutscher kann’s zugehen, als wo Deutsches mit Deutschem gezüchtigt wird.«
Trotz dieser Romane ist Lenz seinem Wesen nach ein Geschichtenerzähler. Die Welt liefert ihm unaufhörlich Stoff für Geschichten. Stoff zugleich für die alte Schriftstellerhoffnung, die Welt durch Geschichten wenn nicht begreifbarer, so doch überschaubarer zu machen. Lenz war ein Wegbereiter der Short Story in der jungen Bundesrepublik, neben Weyrauch und Schnurre, Borchert und Böll – er ist heute ihr letzter großer Vertreter in seiner Generation. Die Kurzgeschichte war nach dem Zweiten Weltkrieg kein literarisches Genre unter anderen, sie war gleichsam Programm. Knapp dem Umfang nach, klar im Umriß, nüchtern in der Thematik, glänzte sie durch eine Eigenschaft, die Alfred Polgar einst an Hemingway rühmte: kein Gramm Literaturfett. Man denke an eine Erzählung wie »Das Wrack« von 1952, die den Autorder 49 Stories – Lenz selbst hat darauf hingewiesen – als literarisches Vorbild unverkennbar durchscheinen läßt. Noch deutlicher sind die Verbindungen zu der im selben Jahr erschienenen berühmten Erzählung »Der alte Mann und das Meer«. Doch hat Lenz sich von Hemingways Feier der Tat, den »Momenten gewaltsamer Erprobung«, allmählich gelöst, um auch die Vor- und Nachgeschichten zu untersuchen und dem notorischen Scheitern die »Vision der Ausdauer« entgegenzusetzen.
Bei Lenz findet man keine zornige Anklage gegen die Gesellschaft (was nicht mit Gleichgültigkeit und Apathie zu verwechseln ist), aber auch keinen verzückten Gebrauch der eigenen Kunstmittel (obwohl er ein Meister des Metiers ist und jüngere Autoren viel von ihm lernen können). Man könnte sagen, daß er erzählt, wie er fischt, doch gilt auch die Umkehrung: Wenn er über die »Kunst, einen Fisch zu fangen« berichtet, erfahren wir gleichzeitig viel über das Handwerk des Schreibens: »Vorbereitung ist alles, und diese Vorbereitung beginnt, wenn die innere Einstellung zur Beute nichts mehr zu wünschen übrigläßt – mit dem Angelgeschirr, mit seiner kunstvollen, bedächtigen Auswahl und Zusammenstellung.« Kennzeichnend für diesen Schriftsteller ist eine epische Behutsamkeit, die ihm den Ruf eingetragen hat, ein Traditionalist zu sein, ein altmodischer Erzähler fast im Sinn des neunzehnten Jahrhunderts. Tatsächlich begegnet in seiner besten Prosa der sensitive Reichtum der russischen Novellisten dem Lakonismus der Angelsachsen.
Das ist nicht als Einwand zu verstehen. Und ist auchvon den Millionen Lesern, die Siegfried Lenz gefunden hat, nicht als Einwand verstanden worden. Obwohl dieser Autor die Welt keineswegs vernunftgemäß eingerichtet findet, will er doch bessern und erleuchten, will aufklären. Beides wird ihm zuweilen angekreidet, wie auch die Haltung des Epikers, die Welt und die Menschen lieber zu verstehen als zu verurteilen. Vor vierzig Jahren hat er, der von literarischen Theorien wenig hält, sein episches Programm formuliert: den Wunsch, wie er damals sagte, einen »wirkungsvollen Pakt mit dem Leser« zu schließen. Da Lenz nie dazu neigte, den Mund voll zu nehmen, brauchte er später wenig zurückzunehmen. Das hat ihn auch davor bewahrt, die politischen Möglichkeiten des Schriftstellers zu überschätzen.
Von der Literatur hat er gesagt, sie sei eine »Wieder- Erfindung der Welt«. Die Formel verblüfft durch ihre Einfachheit, was ihre Gültigkeit nicht einschränkt. Bei dem Versuch, die Welt durch Geschichten zu verstehen, mag die Erfahrung des Scheiterns am Ende stehen, doch ist sie nicht gleichbedeutend mit Resignation. Vielleicht liegt es daran, daß Lenz sich immer wieder, vor allem in seinen Rundfunkarbeiten, mit dem Hamburger Hafen und, als Hinterlassenschaft des Krieges, den »Wracks von Hamburg« beschäftigt hat, die ihn auf eine düstere Weise faszinierten: von dem frühen Hörstück »Die Nacht des Tauchers« (das dem Roman Der Mann im Strom um einige Jahre vorausging) bis hin zu dem späten Dialog »Die Bergung«. Das Wrack in seiner doppelten Bedeutung: als Zeichen des Scheiterns, aber auch als Aufforderung zurBergung, mithin zum Neubeginn, gehört zu den bestimmenden Leitmotiven von Lenz. So wie die Hauptfiguren dieser Texte Taucher sind, so reiht sich der Autor ein in die Garde jener »Gedanken-Taucher«, die, wie Melville schrieb, »zum Grund der Dinge hinabtauchen und mit blutunterlaufenen Augen wieder in die Höhe kommen«.
»Ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen«, hat Siegfried Lenz gesagt. Auch seine Wasserwelten sind reich an Geschichten, die meist nur beiläufige Anstöße brauchen und an scheinbar geringfügige Ursachen anknüpfen. Da reicht ein Weg durch den Hafen aus, um auf Geheimnisse zu stoßen, die in Geschichten verborgen liegen, und ein Spaziergang am Meeresufer genügt, um dem aufgesammelten Strandgut neue Geschichten abzulesen. Wie geht das zu? Man rührt mit der Frage an das Geheimnis der Kreativität. Der Maler Max Ludwig Nansen drückt es in der Deutschstunde mit den Worten aus: »Man beginnt zu sehen, wenn man aufhört, den Betrachter zu spielen, und sich das, was man braucht, erfindet: diesen Baum, diese Welle, diesen Strand.«
Hanjo Kesting, April 2007
Meer und Küste
... das gleiche Bild sehen wir selbst in allen
Flüssen und Meeren. Es ist das Bild vom unfaßbaren
Phantom des Lebens, und das ist der Schlüssel zum
Ganzen.
Herman Melville, Moby Dick
Also hier, wo Hilke und ich unseren Butt peddeten, soll es entstanden sein: Leben und all das; haben Sie so was schon mal gehört? Hier aus dem Watt, aus der schlammgrauen oder tonfarbenen Einöde, die von Prielen durchschnitten, von flachen Tümpeln durchsetzt war, soll sich nach Per Arne Scheßel, dem Schriftsteller und Heimatforscher, der Aufbruch vollzogen haben: wer atmen konnte und all das, erhob sich eines Tages vom Meeresboden, wanderte über den amphibischen Gürtel an den Strand, wusch sich den Schlamm ab, entfachte ein Feuer und kochte Kaffee. Mein Großvater schrieb das, dieser Einsiedlerkrebs.
Jedenfalls, wir waren draußen im Watt, um unsern Butt zu pedden, zogen über den glitschigen Meeresboden weit vor der Halbinsel, Hilke immer voran. Mit uns fischten die Seevögel. Hilke hatte ihr Kleid hochgezogen und vor dem Bauch gerafft, ihre Beine waren mit Mudd bedeckt bis zu den Kniekehlen, der Rand ihres Schlüpfers war schwarz vor Nässe. Die Seevögel fischten, indem sie ihre geöffneten Schnäbel durch das Wasser der Tümpel zogen, klappten, schmatzten. Die scharf eingeschnittenen Rinnen der Priele, ihre Verästelungen zur offenen See hin: wenn das Meer zurückwich, ließ es sich hier gut fischen. Wir nahmen uns meist bei der Hand, traten in einen grauen Tümpel oder an den Rand eines flachen Priels und ließen uns einfach einsinken in den Schlamm, fühlten, tasteten mit den Zehen, zogen unsere Beine, einander stützend, heraus und arbeiteten uns systematisch weiter durch Schlick und Schlamm, immer gespannt und darauf gefaßt, daß sich unter der Fußsohle etwas krümmte; es schlug, es zappelte und bog sich, sobald wir einen Flachfisch aufgespürt hatten, eine Scholle, einen Butt, sehr selten eine Seezunge, und Hilke schrie und quietschte jedesmal, wenn sie den Fisch entdeckt hatte und festtrat: ich kenne keinen, der so ausdauernd Butt pedden konnte wie meine Schwester Hilke. Obwohl sie sehr kitzlig war, sich jedesmal schreckhaft aufbäumte und quietschte, ließ sie kaum einen Flachfisch entkommen, sie hielt ihn so lange unter dem Fuß, bis ich ihn gepackt und hervorgezogen hatte.
Manchmal sackte sie bis zu den Schenkeln ein, dann riß sie ihr Kleid bis zur Brust hoch. Manchmal glitschte sie über eine flache Tonschicht wie über Eis. Es machte ihr Spaß, wenn es im kühlen Mudd gluckste und sabbschte, wenn Blasen platzten, wenn sie weich und stetig einsank in den Grund. Nie vergaß sie, die Strömung in den Prielen zu beobachten. Wenn der wellig geriffelte Grund des Watts härter wurde, hüpfte sie auf einem Bein und landete jedesmal auf einem der schnurförmigen Kotkringel der Sandwürmer. Sie fing Muschelkrebse, Scherenasseln und Borstenwürmer, beobachtete sie eine Weile in der offenen Hand und setzte sie ins Wasser zurück. Sie sammelte leere Wellhornschnecken, warf die Gehäuse in ihren Schlüpfer; der Gummizug am Schenkel verhinderte, daß sie sie verlor. Das alles gehört unbedingt zur Szene.
Deutschstunde, 1968
Eine seltsame Wasserwelt liegt zwischen der Küste und den Inseln, das Watt, vom Hochwasser überflutet, von der Ebbe weithin freigegeben. Priele und Rinnen durchziehen das Schwemmland in Schlingen und Windungen, durch die der Ebbstrom zurückfließt ins Meer. Kleine und schmale Rinnsale sind es zuerst, die in ständig wechselnden, mäanderartigen Mustern das hohe Watt zeichnen und sich in die Wattströme ergießen. Mit größter Wucht reißt die gewaltige Strömung dann die Wassermassen durch die Seegatts zwischen den einzelnen Inselleibern hinaus in die offene See.
Wenn zur Flutzeit alles mit Wasser bedeckt ist, ahnt der Unkundige nicht, warum das Gebiet für die Schifffahrt solche heimtückischen Schwierigkeiten hat. Darum stecken auch längs der Priele, der tiefen Rinnen, die Birkenstämmchen, Pricken genannt, die den Schiffahrtswegquer durchs Watt anzeigen, und Baken und Tonnen bezeichnen ja überall Tiefen und Untiefen.
Eine neue Welt offenbart sich dem Wattwanderer. Offen liegt bei Ebbe der Boden, in schönen Mustern geriffelt und gerippelt, in Schlick und Sand stehengebliebene Wellenformen. Wie bei einem Festlandfluß gibt es auch auf dem Meeresboden den Prallhang, wo in der Priel- schlinge der Strom auf das Ufer prallt und seinen »Steilhang« zerstört. Er bewirkt gleichzeitig auf der Innenseite, auf dem sanfteren Gleithang, das Ablagern von weiterem Schlick, der schon manchem Ungeübten zur großen Mühsal wurde. Das Ganze ist ein ähnlicher Vorgang, wie er an den Kanten der Inseln zu beobachten ist, nur wesentlich schneller, weicher, geräuschloser, aber nicht minder gefährlich.
Im Schlick und Sand des Wattenmeeres lebt eine eigene Tierwelt, die sich während der Ebbezeit in ihren nassen Wohnungen, in Röhren und Trichtern, verbirgt. Muscheln, Würmer, Krebse vergraben sich tief im Sand. Denn sie wissen, daß sie jetzt den nahrungsuchenden Vögeln frei ausgesetzt sind. Silbermöwen gehen auf Jagd, Austernfischer, Seeschwalben, Brandenten.
Wo die Möwen schreien ..., 1976
Dann die Trübnis des Wattenmeers, niedrige Wolken im Westen, stoßartiger Wind, der die Priele krauste und die Tümpel, und der das Gefieder der Seevögel sträubte, das ferne Motorengeräusch eines einzelnen Flugzeugs, der sandige Schimmer der Halbinsel, die Höhe des Deichs – noch sicherer, noch unbezwinglicher vom Watt her – und weit hinten auf der Düne die Hütte des Malers.
Ich trug den Korb mit den Fischen. Ich folgte Hilke durch das Watt, warf nach fischenden Seevögeln, versuchte, wie sie, auf einem Bein zu hüpfen. Ich zertrat gelbliche Schaumhügel, die der Wind zusammengeweht hatte. Die Fische zappelten im Korb und klappten beim Atmen ihre Kiemendeckel ab. Mehrmals forderte Hilke mich auf, ihr mit dem strömenden Wasser eines Priels die Beine abzuwaschen, über die sich muddrige Fäden zogen; sie stützte sich dabei auf meinen Rücken. Die Schneckenhäuser in ihrem Schlüpfer stießen gegeneinander, es klang wie eine Klapper. Ich setzte meinen Fuß auf winzige Erhebungen und ließ den Schlamm durch die Zehen quellen. Der rotblaue Ring auf Hilkes Schenkeln stammte aus Gummizug, er sah quaddlig aus, man mußte an einen Kranz von Insektenstichen denken. Der Wind warf ihr Haar hin und her, manchmal war ihr Gesicht ganz verdeckt.
Deutschstunde, 1968
In jedem Jahrhundert sieht eine Karte von Schleswig- Holsteins Westküste anders aus. Die großen Buchten, die Halbinseln haben ihre Umrisse verändert, Inseln wurden vom Festland losgerissen, wurden geteilt und überströmt von der See. Dafür sind neue Landstriche gewonnen worden, wo einst Meer und Watt mit salzigen Fluten ihre Herrschaft ausübten. Das ist wohl der auffallendste Unterschied zur fördenreichen Ostseeküste: das Wattenmeer, das sich ausgesprochen verkehrsfeindlich auswirkt und keine größeren Häfen zuläßt.
Der Anschauungsunterricht über die Wirkungen von Ebbe und Flut, die Eigenarten des Watts und der Neulandgewinnung sind hier ebenso deutlich wie vor der Küste von Ostfriesland. Reist man im Westen Schleswig- Holsteins nordwärts, so zieht sich am Rande der Geest ein Dünenwall, hier Donn genannt, von Süd nach Nord, von Heide und Ginster bewachsen, und ist ein Aussichtsweg von wunderbarer Weite. Was davor liegt, ist gewissermaßen Neuland, dem Meere abgerungen in jahrhundertelanger Arbeit. Marschhöfe liegen auf ihrer Warft, beschattet von Silberpappeln und Eschen. Schräg stehen die Bäume vom ewigen Westwind. Aber umgeben sind sie von Feldern, die hinter den See- und Flußdeichen wohlgeschützt seit langem gute Ernten bringen. An vielen Stellen sieht man Deiche weit entfernt von dem heutigen Küstensaum die Marsch durchziehen, ein Zeichen dafür, wie die Landgewinnung vorgerückt ist.
Aus der Luft sind die neuen Köge besonders gut zu erkennen, die grauen Schlickmassen, die sich hinter den Lahnungen fangen, wo der Queller schon Fuß gefaßt hat, diese merkwürdige Salzwasserpflanze, die in ihren vielen Armen Sickerstoffe, Sand und Lehm auffängt und damit die Verlandung einleitet; das erste Weideland vor dem Sommerdeich, wo man schon Schafe grasen läßt, hinter dem Deich Marschwiesen für Rinder und schließlich die üppigen Felder mit Korn und Kohl.
Aber auch von ganz eindeutig umgekehrter Entwicklung weiß man. Zum Beispiel Büsum, das kleine Seebad, der Fischereihafen, lag einst am Nordende einer Insel. Sie wurde von Süden immer mehr von der See verschlungen, gleichzeitig wurde vom Festland her Land gewonnen, so daß Kirche und Ort schließlich am südlichsten Punkt der Halbinsel Norderdithmarschen einen neuen Geschichtsabschnitt erleben, also auf dem Festland.
Wo die Möwen schreien ..., 1976
Unmittelbar neben dem Pfad zog sich eine Flutlinie von Seetang, verdorrtem Pfeilgras und Geröll hin, und parallel zu ihr liefen andere, ältere Linien: jede große Flut hatte so ihre Markierung hinterlassen, ihren Erinnerungsstreifen, der von der winterlichen Kraft der See zeugte oder von ihrem winterlichen Grimm. Jede Flut hatte etwas anderes erbeutet, eine hatte weißgewaschenes Wurzelwerk aufs Land geschleudert, eine andere Korkstücke und einen zerschlagenen Kaninchenstall, da lagen Tangknollen und Muscheln und zerrissene Netze und jodfarbene Gewächse, die wie groteske Schleppen aussahen, und meine Schwester und der Akkordeonspieler gingen an allem vorbei zur Halbinsel. Sie stiegen nicht hinauf zum Gasthaus »Wattblick«, sie gingen auf der Seeseite vorbei, Hand in Hand jetzt, von sprühender Gischt getroffen, mit brennenden Gesichtern. Draußen, wo die Halbinsel flach in die Nordsee stach, waren die schafwolligen Schaumkronen der Strandwellen zu sehen, die aus schwarzer Weite anliefen und sich im seichten Grund zerschlugen, wie ein Lauffeuer schäumten sie heran, bergauf und bergab, begleitet von einem unablässigen Summton.
Die Halbinsel stand in der See wie ein scharfer Schiffsbug, sie stieg nur langsam an zu einem gefalteten Dünenbuckel, der baumlos war, mit hartem Strandhafer bedeckt. Dort nisteten die Möwen. Dort bauten sie ihre kümmerlichen Nester in jedem Frühjahr; zwischen der Hütte des Vogelwarts und der Hütte des Malers, die frei am Fuß einer Düne lag und ein niedriges, aber sehr breites Fenster zum Meer hin hatte.
Deutschstunde, 1968
Den tiefsten Einschnitt bildet die Eider-Treene-Mündung. Hier war es, wo der Schiffahrtsweg von Haithabu begann – oder endete, der zu Wikingerzeiten die Frachten in die Schlei und damit in die Ostsee beförderte. Später wurde von Herzog Friedrich III. Friedrichstadt gegründet als Konkurrenzunternehmen zu dem königlich-dänischen Glückstadt an der Unterelbe. Glückstadt sollte eigentlich Hamburg überflügeln, was ihm nicht gelang. Und Friedrichstadt wurde nicht ein Welthafen, sondern ein freundliches Städtchen, geeignet für den Umschlag ländlicher Erzeugnisse aus der Umgebung.
Noch etwas weiter nördlich: Husum ist durch seine Lage dazu bestimmt, den Verkehr zu den Halligen und den Inseln zu übernehmen. Es hat zeitweise auch den Handel nach Schleswig hinüber besorgt. Im großen und ganzen aber ist es jetzt der Markt für die umliegenden Gräsermarschen. Tausende von Mastochsen wechseln dort alljährlich ihren Besitzer. Im Frühjahr bringen die Geestbauern ihr Magervieh zum Verkauf an die Marschbauern, die es im Laufe des Sommers heranmästen und dann der Fleischindustrie zuführen.
Erstaunlich ist doch, wie man im vorigen Jahrhundert zum Beispiel von der »grauen Stadt am Meer« sprach, während die Künstler unserer Zeit, allen voran Emil Nolde aus Seebüll im äußersten Norden Schleswig-Holsteins, wahrhafte Farbensymphonien in dieser Landschaft sahen.
Sicher ist beides da, regenverhangene graue Tage und trostlose Wochen, die das Gemüt verzagt machen. Aber auch das andere stimmt: flammenprangende Wolkenberge türmen sich über dem Meer, über der Marsch, die golden erglüht. Die See rollt heran mit schäumenden Wellen, Abendsonne verfärbt das Blau zu flüssigem Rot, bis die Sonne herabtaucht in den unendlichen, verblassenden Ozean. Auch über den Gärten flutet das gleiche Licht, das der Seewind und die Feuchte zum Strahlen bringt. Die Blumen strotzen vor Kraft, ihre Farben brennen in intensivem Glanz, der Erdboden, dunkelbraun, verströmt seinen gesunden Duft, den man zu riechen meint, wenn man ein solches Bild betrachtet. Das sind die Themen, mit denen sich ein Maler, der verfemt war und nicht malen und ausstellen durfte, über diese Zeit hinweghalf – mit der Natur verbunden und durch sie gehalten. Seine Aquarelle, die er seine ungemalten Bilder nannte, oft nur postkartengroß, sind Skizzen seiner Schöpferkraft. »Der große Gärtner« heißt eines seiner späten Bilder. Gottes Geist schwebt über den Blumen der Erde, berührt sie mit sorgender Hand. Hoffnung regt sich, daß nach dem Grauen neues Blühen verheißen wird.
Und jeder weiß um die Geschichte der Halligen, der Nordfriesischen Inseln überhaupt, daß sie vor Jahrhunderten abgerissen sind vom Festland, daß vielleicht sogar ein viel größeres Land versunken ist, zu dem unsere Inseln und Helgoland und vielleicht auch Großbritannien gehörten, die allein noch aus dem Meer aufragen – wobei an vielen Stellen das Wort »ragen« keinesfalls angebracht erscheint.
Und die Tatsache, daß diese Inseln Land sind, zum Land gehören und nur zeitweilig Inseln sind, hat mich vor einigen Jahren zu einer Geschichte veranlaßt:
Die Frau, die ihren Mann unwiderruflich haßt, wird ihn eines Tages dadurch los, daß sie ihn, einen eifrigen Wattgänger, ins Watt hinausschickt mit einer zurückgestellten Uhr.
Wo die Möwen schreien ..., 1976
Die Flut ist pünktlich
Zuerst sah er ihren Mann. Er sah ihn allein heraustreten aus dem flachen, schilfgedeckten Haus hinter dem Deich, den Riesen mit dem traurigen Gesicht, der wieder seine hohen Wasserstiefel trug und die schwere Joppe mit dem Pelzkragen. Er beobachtete vom Fenster aus, wie ihr Mann den Pelzkragen hochschlug, gebeugt hinaufstieg auf den Deich und oben im Wind stehenblieb und über das leere und ruhige Watt blickte, bis zum Horizont, wo die Hallig lag, ein schwacher Hügel hinter der schweigenden Einöde des Watts. Und während er noch hinüberblickte zur Hallig, stieg er den Deich hinab zur andern Seite, verschwand einen Augenblick hinter dergrünen Böschung und tauchte wieder unten neben der tangbewachsenen eisernen Spundwand auf, die sie weit hinausgebaut und mit einem Steinhaufen an der Spitze gesichert hatten. Der Mann ging in die Hocke, rutschte das schräge Steinufer hinab und landete auf dem weichen, grauen Wattboden, der geriffelt war von zurückweichendem Wasser, durchzogen von den scharfen Spuren der Schlickwürmer; und jetzt schritt er über den weichen Wattboden, über das Land, das dem Meer gehörte; schritt an einem unbewegten Priel entlang, einem schwarzen Wasserarm, der wie zur Erinnerung für die Flut dalag, nach sechs Stunden wieder zurückzukehren und ihn aufzunehmen mit steigender Strömung. Er schritt durch den Geruch von Tang und Fäulnis, hinter Seevögeln her, die knapp zu den Prielen abwinkelten und suchend und schnell pickend voraustrippelten; immer weiter entfernte er sich vom Ufer, in Richtung auf die Hallig unter dem Horizont, wurde kleiner, wie an jedem Tag, wenn er seinen Wattgang zur Hallig machte, allein, ohne seine Frau. Zuletzt war er nur noch ein wandernder Punkt in der dunklen Ebene des Watts, unter dem großen und grauen Himmel hier oben: er hatte Zeit bis zur Flut ...
Und jetzt sah er von seinem Fenster aus die Frau. Sie trug einen langen Schal und Schuhe mit hohen Absätzen; sie kam unter dem Deich auf das Haus zu, in dem er wartete, und sie winkte zu seinem Fenster hinauf. Dann hörte er sie auf der Treppe, hörte, wie sie die Tür öffnete, zögernd von hinten näher kam, und jetzt wandte er sich um und sah sie an.
»Tom«, sagte sie, »oh, Tom«, und sie versuchte dabei zu lächeln und ging mit erhobenen Armen auf ihn zu.
»Warum hast du ihn nicht begleitet?« fragte er.
Sie ließ die Arme sinken und schwieg; und er fragte wieder: »Warum bist du mit deinem Mann nicht rübergegangen zur Hallig? Du wolltest einmal mit ihm rübergehen. Du hattest es mir versprochen.«
»Ich konnte nicht«, sagte sie. »Ich habe es versucht, aber ich konnte es nicht.«
Er blickte zu dem Punkt in der Verlorenheit des Watts, die Hände am Fensterkreuz, die Knie gegen die Mauer gedrückt, und er spürte den Wind am Fenster vorbeiziehen und wartete. Er merkte, wie die Frau sich hinter ihm in den alten Korbstuhl setzte, es knisterte leicht, ruckte und knisterte, dann war sie still, nicht einmal ihr Atem war zu hören.
Plötzlich drehte er sich um, blieb am Fenster stehen und beobachtete sie; starrte auf das braune Haar, das vom Wind versträhnt war, auf das müde Gesicht und die in ruhiger Verachtung herabgezogenen Lippen, und er sah auf ihren Nacken und die Arme hinunter bis zu ihrer schwarzen, kleinen Handtasche, die sie gegen ein Bein des alten Korbstuhls gelehnt hatte.
»Warum hast du ihn nicht begleitet?« fragte er.
»Es ist zu spät«, sagte sie. »Ich kann nicht mehr mit ihm zusammensein. Ich kann nicht allein sein mit ihm.« »Aber du bist mit ihm hier raufgekommen«, sagte er. »Ja«, sagte sie. »Ich bin mit ihm auf die Insel gekommen, weil er glaubte, es ließe sich hier alles vergessen.
Aber hier ist es noch weniger zu vergessen als zu Hause. Hier ist es noch schlimmer.«
»Hast du ihm gesagt, wohin du gehst, wenn er fort ist?«
»Ich brauche es ihm nicht zu sagen, Tom. Er kann zufrieden sein, daß ich überhaupt mitgefahren bin. Quäl mich nicht.«
»Ich will dich nicht quälen«, sagte er, »aber es wäre gut gewesen, wenn du ihn heute begleitet hättest. Ich habe ihm nachgesehen, wie er hinausging, ich stand die ganze Zeit am Fenster und beobachtete ihn draußen im Watt. Ich glaube, er tat mir leid.«
»Ich weiß, daß er dir leid tut«, sagte sie, »darum mußte ich dir auch versprechen, ihn heute zu begleiten. Ich wollte es deinetwegen tun; aber ich konnte es nicht. Ich werde es nie können, Tom. – Gib mir eine Zigarette.«
Der Mann zündete eine Zigarette an und gab sie ihr, und nach dem ersten Zug lächelte sie und zog die Finger durch das braune, versträhnte Haar. »Wie sehe ich aus, Tom?« fragte sie. »Sehe ich sehr verwildert aus?«
»Er tut mir leid«, sagte der Mann.
Sie hob ihr Gesicht, das müde Gesicht, auf dem wieder der Ausdruck einer sehr alten und ruhigen Verachtung erschien, und dann sagte sie: »Hör auf damit, Tom. Hör auf, ihn zu bemitleiden. Du weißt nicht, was gewesen ist. Du kannst nicht urteilen.«
»Entschuldige«, sagte der Mann. »Ich bin froh, daß du gekommen bist«, und er ging auf sie zu und nahm ihr die Zigarette aus der Hand. Er drückte sie unterm Fensterbrett aus, rieb die Reste der kleinen Glut herunter, wischte die Krümel weg und warf die halbe Zigarette auf eine Kommode. Die untere Seite des Fensterbretts war gesprenkelt von den schmutzigen Flecken ausgedrückter Zigaretten. Ich muß sie mal abwischen, dachte er; wenn sie weg ist, werde ich die Flecken abwischen, und jetzt trat er neben den alten Korbstuhl, faßte ihn mit beiden Händen oben an der Lehne und zog ihn weit hintenüber.
»Tom«, sagte sie, »oh, Tom, nicht weiter, bitte, nicht weiter, ich falle sonst, Tom, du kannst das nicht halten.« Und es war eine glückliche Angst in ihrem Gesicht und eine erwartungsvolle Abwehr ...
»Laß uns hier weggehen, Tom«, sagte sie danach, »irgendwohin. Bleib noch bei mir.«
»Ich muß mal hinaussehen«, sagte er, »einen Augenblick.«
Er ging zum Fenster und sah über die Einsamkeit und Trübnis des Watts; er suchte den wandernden Punkt in der Einöde draußen, zwischen den fern blinkenden Prielen, aber er konnte ihn nicht mehr entdecken.
»Wir haben Zeit bis zur Flut«, sagte er. »Warum sagst du das nicht? Du bist immer nur zu mir gekommen, wenn er seinen Wattgang machte zur Hallig raus. Sag doch, daß wir Zeit haben für uns bis zur Flut. Sag es doch.«
»Ich weiß nicht, was mit dir los ist, Tom«, sagte sie, »warum du so gereizt bist. Du warst es nicht in den letzten zehn Tagen. In den letzten zehn Tagen hast du mich auf der Treppe begrüßt.«
»Er ist dein Mann«, sagte er gegen das Fenster. »Er istnoch immer dein Mann, und ich hatte dich gebeten, heute mit ihm zu gehen.«
»Ist es dir heute eingefallen, daß er mein Mann ist? Es ist dir spät eingefallen, Tom«, sagte sie, und ihre Stimme war müde und ohne Bitternis. »Vielleicht ist es dir zu spät eingefallen. Aber du kannst beruhigt sein: er hat aufgehört, mein Mann zu sein, seitdem er aus Dhahran zurück ist. Seit zwei Jahren, Tom, ist er nicht mehr mein Mann. Du weißt, was ich von ihm halte.«
»Ja«, sagte er, »du hast es mir oft genug erzählt. Aber du hast dich nicht von ihm getrennt; du bist bei ihm geblieben, zwei Jahre, du hast es ausgehalten.«
»Bis zum heutigen Tag«, sagte sie, und sie sagte es so leise, daß er sich vom Fenster abstieß und sich umdrehte und erschrocken in ihr Gesicht sah, in das müde Gesicht, über das jetzt eine Spur heftiger Verachtung lief.
»Ist etwas geschehen?« fragte er schnell.
»Was geschehen ist, geschah vor zwei Jahren.« »Warum hast du ihn nicht begleitet?«
»Ich konnte nicht«, sagte sie, »und jetzt werde ich es nie mehr brauchen.«
»Was hast du getan?« fragte er.
»Ich habe versucht zu vergessen, Tom. Weiter nichts, seit zwei Jahren habe ich nichts anderes versucht. Aber ich konnte es nicht.«
»Und du bist bei ihm geblieben und hast dich nicht getrennt von ihm«, sagte er. »Ich möchte wissen, warum du es ausgehalten hast.«
»Tom«, sagte sie, und es klang wie eine letzte, resignierte Warnung, »hör mal zu, Tom. Er war mein Mann, bis sie ihm den Auftrag in Dhahran gaben und er fortging für sechs Monate. So lange war er es, und als er zurückkam, war es aus. Und weil du dein Mitleid für ihn entdeckt hast heute, und weil du wohl erst jetzt bemerkt hast, daß er mein Mann ist, will ich dir sagen, was war. Er kam krank zurück, Tom. Er hat sich in Dhahran etwas geholt, und er wußte es. Er war sechs Monate fort, Tom, sechs Monate sind eine Menge Zeit, und es gibt viele, die es verstehen, wenn so etwas passiert. Vielleicht hätte ich es auch verstanden, Tom. Aber er war zu feige, es mir zu sagen. Er hat mir kein Wort gesagt.«
Der Mann hörte ihr zu, ohne sie anzusehen; er stand mit dem Rücken zu ihr und sah hinaus, sah den grünen Wulst des Deiches entlang, der in weitem Bogen zum Horizont lief. Ein Schwarm von Seevögeln kam von den Prielen draußen im Watt zurück, segelte knapp über den Deich und fiel in jähem Sturz in das Schilf bei den Torfteichen ein. Sein Blick lief suchend; über das Watt zur Hallig, wo sich jetzt der wandernde Punkt lösen mußte; jetzt mußte er die Rückwanderung antreten, um vor der Flut auf dem Deich zu sein: er war nicht zu erkennen.
»Und du bist zwei Jahre bei ihm geblieben«, sagte der Mann. »So lange hast du es ausgehalten und nichts getan.«
»Ich habe zwei Jahre gebraucht, um zu begreifen, was passiert ist. Bis heute morgen hat es gedauert. Als ich ihn begleiten sollte, habe ich es gemerkt, Tom, und du hast mir geholfen dabei, ohne daß du es wolltest. Du hast ausMitleid oder aus schlechtem Gewissen verlangt, daß ich ihn begleiten sollte.«
»Er ist immer noch nicht zu sehen«, sagte der Mann. »Wenn er vor der Flut hier sein will, müßte er jetzt zu erkennen sein.«
Er öffnete das Fenster, befestigte es gegen den Widerstand des Windes mit eisernen Haken und blickte über das Watt.
»Tom«, sagte sie, »oh, Tom. Laß uns weggehen von hier, irgendwohin. Laß uns etwas tun, Tom. Ich habe so lange gewartet.«
»Du hast dir lange etwas vorgemacht«, sagte er, »du hast versucht, etwas zu vergessen, und dabei hast du gewußt, daß du es nie vergessen kannst.«
»Ja«, sagte sie, »ja, Tom. So etwas kann kein Mensch vergessen. Wenn er es mir gleich gesagt hätte, als er zurückkam, wäre alles leichter gewesen. Ich hätte ihn verstanden, vielleicht, wenn er nur ein Wort gesagt hätte.«
»Gib mir das Fernglas«, sagte er.
Die Frau zog das Fernglas vom Bettpfosten, gab es ihm mit dem ledernen Etui, und er öffnete es, hob das Glas und suchte schweigend das Watt ab. »Ich kann ihn nicht finden«, sagte der Mann, »und im Westen kommt die Flut.«
Er sah die Flut in langen Stößen von Westen herankommen, flach und kraftvoll über das Watt hin ziehend; sie rollte vor, verhielt einen Augenblick, als ob sie Atem schöpfe, und stürzte sich in Rinnen und Priele, und kam dann wieder schäumend aus ihnen hervor, bis sie die eiserne Spundwand erreichte, sich sammelte und hochstieg an ihr und unmittelbar neben dem schrägen Steinufer weiterzog, so daß die dunkle Fläche des Watts gegen Osten hin abgeschnitten wurde.
»Die Flut ist pünktlich«, sagte er. »Auch dein Mann war pünktlich bisher, aber ich kann ihn jetzt nicht sehen.«
»Laß uns weggehen von hier, Tom, irgendwohin.«
»Er kann es nicht mehr schaffen! Hörst du, was ich sage? Er ist abgeschnitten von der Flut, weißt du das?« »Ja, Tom.«
»Er war jeden Tag pünktlich zurück, lange vor der Flut. Warum ist er noch nicht da? Warum?«
»Seine Uhr, Tom«, sagte sie, »seine Uhr geht heute nach.«
1953
Das auffallendste bei einem Flug über die deutsche Nordseeküste ist doch wohl die Kette der Inseln. Kein Land – außer Holland – hat eine solche aufzuweisen. Von Wangerooge bis Borkum liegen sie vor dem Festland, eigentlich jede wie eine lange Sandbank, ohne erhebliche Erhöhungen außer dem Zug der Dünen und manchmal einer niedrigen Steilkante.
Aber wie kann man an ihnen die Arbeit, die Gewalt desMeeres erkennen! Wie die Flut vom Westen aufkommt, so wird am Westende der Inselsaum angenagt, fortgespült, zerrissen. Und mit dem Zug der Strömung wird dieser gleiche Sand am Ostende wieder angeschwemmt, denn die Ebbe ist hier zu schwach, ihn wieder zurückzunehmen. So wandern die Inseln stetig nach Osten und verändern ihre Form in jedem Jahrzehnt. 200 Jahre errechnete man für die zwei Kilometer Wanderschaft, die Wangerooge hinter sich hat. Der alte Turm, der ursprünglich in der Mitte des Dorfes stand, hält sich nun gerade noch am äußersten Rande. Manches Haus auf den Inseln mußte aufgegeben werden, Dörfer verschwanden und wurden an anderem Platze wieder neu erbaut.
Darum haben in jüngster Zeit auch fast alle diese Inseln einen besonders festen Schutzwall erhalten. Basaltene Buhnen strecken sich ins Meer, darüber Mauerwerk, oft mit breiter Krone, die als Wandelgang eine großartige Aussicht bietet.
Man fragt sich im Binnenland sicher manchmal, ob sich so kostspielige Schutzbauten eigentlich lohnen für ein kleines Eiland voller Sand, auf dem nur wenige Menschen wohnen. Die Fragestellung ist nicht richtig. Mit der Erhaltung der Inseln schützt man zugleich die Festlandküste mit ihrem Marschland.
Und außerdem – was für ein wunderbares Ferienland ist diese Inselwelt! Wie erfrischt den Binnenländer, den Großstadtmenschen eine Urlaubszeit in Salzluft und Meerwasser! Das haben kluge Leute schon früh erkannt und sich unermüdlich dafür eingesetzt, die nötigen Anlagen für einen richtigen Badebetrieb zu schaffen. Einer davon war der Göttinger Philosoph Lichtenberg. Als man ihm von der umständlichen Reise und der drohenden Seekrankheit sprach, meinte er nur: Da befände man sich ja in guter Gesellschaft, auch der römische Kaiser Augustus machte schon jedes Jahr seine kleine Vomitiv-Reise.
Norderney hatte seine erste »Saison« schon 1 800. Da gab es bereits ein Konversationshaus mit Speise- und Tanzsaal. Aber dann kam Napoleon und beschlagnahmte alles. Aus der Badeanstalt wurden Kasernen. Die Gäste dieser ersten Jahrzehnte wohnten bei Fischern und Schiffern und hatten vorliebzunehmen mit Quartier und Verpflegung, wie es dort üblich war.
Auch Heinrich Heine hat das erlebt. Er gibt in seinen Reisebildern von Norderney im Herbst 1826 eine Schilderung, die seiner scharfen Zunge und beißenden Kritik entspricht: »Das Seefahren hat für diese Menschen einen großen Reiz; und dennoch, glaube ich, daheim ist ihnen allen am wohlsten zumute. Sind sie auch auf ihren Schiffen sogar nach jenen südlichen Ländern gekommen, wo die Sonne blühender und der Mond romantischer leuchtet, so können doch alle Blumen dort nicht das Leck ihres Herzens stopfen, und mitten in der duftigen Heimat des Frühlings sehnen sie sich wieder zurück nach ihrer Sandinsel, nach ihren kleinen Hütten, nach dem flackernden Herd, wo die Ihrigen, wohlverwahrt in wollenen Jacken, herumkauern und einen Tee trinken, der sich von gekochtem Seewasser nur durch den Namen unterscheidet, und eine Sprache schwatzen, wovon kaum begreiflich scheint, wie es ihnen selber möglich ist, sie zu verstehen.«
Das also war der Tee von Norderney – vor 1 50 Jahren.