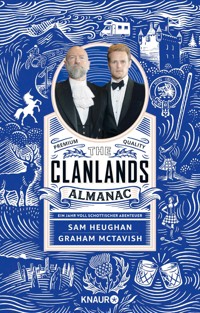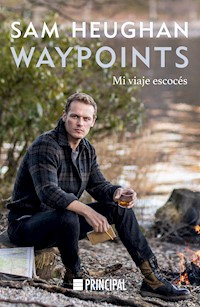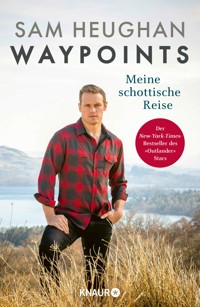
19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine Liebeserklärung an die raue Schönheit Schottlands von "Outlander"-Star Sam Heughan Sam Heughan, auch bekannt durch seine Rolle als schottischer Krieger Jamie Fraser in der Serie "Outlander", nimmt uns mit auf eine ganz persönliche Reise durch die schottischen Highlands. Seine fesselnde Lebensgeschichte ist eine Autobiographie der anderen Art. Fernab vom Film und dem Trubel Hollywoods begibt sich Sam Heughan auf eine Reise durch seine Vergangenheit: Allein läuft er den West Highland Way, den berühmten Fernwanderweg Schottlands, und denkt dabei über die Wegpunkte in seinem Leben nach - seine Träume, seinen Ehrgeiz, die Erfahrungen, die er mit Familie und Freunden gemacht hat. Die Reise wird zu einer intensiven Selbstfindungsreise, die ihm viel über seine Herkunft und seine Heimat offenbart. Aufgewachsen mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem Bruder hat ihn die tiefe Verbundenheit zu Schottland schon immer sehr geprägt. Doch sein Leben als Hollywood-Star ohne Anonymität kann manchmal einen starken Gegensatz dazu bilden. Ein Must-Read für alle Outlander-Fans und alle, die es noch werden wollen!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 409
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Sam Heughan
Waypoints
Meine schottische Reise
Aus dem Englischen von Barbara Schnell
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Eine Liebeserklärung an die raue Schönheit Schottlands von »Outlander«-Star Sam Heughan
Sam Heughan, auch bekannt durch seine Rolle als schottischer Krieger Jamie Fraser in der Serie »Outlander«, nimmt uns mit auf eine ganz persönliche Reise durch die schottischen Highlands. Seine fesselnde Lebensgeschichte ist eine Autobiographie der anderen Art.
Fernab vom Film und dem Trubel Hollywoods begibt sich Sam Heughan auf eine Reise durch seine Vergangenheit: Allein läuft er den West Highland Way, den berühmten Fernwanderweg Schottlands, und denkt dabei über die Wegpunkte in seinem Leben nach - seine Träume, seinen Ehrgeiz, die Erfahrungen, die er mit Familie und Freunden gemacht hat. Die Reise wird zu einer intensiven Selbstfindungsreise, die ihm viel über seine Herkunft und seine Heimat offenbart.
Aufgewachsen mit seiner alleinerziehenden Mutter und seinem Bruder hat ihn die tiefe Verbundenheit zu Schottland schon immer sehr geprägt. Doch sein Leben als Hollywood-Star ohne Anonymität kann manchmal einen starken Gegensatz dazu bilden.
Ein Must-Read für alle Outlander-Fans und alle, die es noch werden wollen!
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Vorwort
Prolog
Tag null: Auszeit
Tag eins: Auf in die Wildnis
Tag zwei: Der Weckruf
Tag drei: Alles auf Anfang
Tag vier: Die harte Tour
Tag fünf: Pilzköpfe
Tag sechs: Wegpunkte
Epilog
Bildteil
Rückblick und Ausblick
Wildpilze in Schottland
Dank
Bildnachweise und Dank des Verlags
Über den Autor
Für Owen, einen geduldigen, freundlichen Mann und stolzen Schotten, der immer für einen Spaziergang, ein Schwätzchen und einen guten Whisky zu haben war. Danke.
Und für alle, die sich auf ihrem Weg allein fühlen oder Gesellschaft brauchen – kommt mit mir. Ich verspreche euch, dass ihr auf eurer Wanderung nicht allein sein werdet, und am Ende gebe ich euch einen aus.
Slàinte. X
»Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen. Du betrittst die Straße, und wenn du nicht auf deine Füße aufpasst, kann man nicht wissen, wohin sie dich tragen.«
(Der Herr der Ringe, J. R. R. Tolkien)
Vorwort
Sam betritt den Raum. Als Erstes fällt mir an ihm auf, wie offen sein Gesicht ist. Nervös, nehme ich an, und wachsam, aber offen für die Welt, voll Vertrauen. Die formellen und möglicherweise stressigen Umstände der Begegnung – ein Regisseur, der einen Schauspieler für seine erste professionelle Bühnenrolle vorsprechen lässt – haben weder seinen Blick getrübt noch sein inneres Gleichgewicht beeinträchtigt. So ist das nicht immer. Der Prozess des Castings kann für alle Beteiligten hart sein, am meisten aber für den Schauspieler oder die Schauspielerin (Sam erzählt in diesem Buch mehrmals davon), und natürlich enthalten sie uns einen Teil ihrer selbst vor, ich nehme an, aus, nun ja, Selbstschutz. Aber Sam trägt heute keine Rüstung, nur einen Umhang aus stillem Charme.
Es ist spätes Frühjahr 2002, und Sam befindet sich noch in der Schauspielausbildung. Bei dem Stück handelt es sich um Outlying Islands von David Greig für das Traverse Theatre in Edinburgh, wo es im Sommer im Rahmen des Festivals aufgeführt werden soll. Die Rolle ist John, ein junger schottischer Ornithologe von privilegierter Herkunft in den 1930ern. Sam öffnet den Text auf der Seite, die ich vorschlage, und spricht den Text. Er trifft auf Anhieb den richtigen Ton. Er strengt sich nicht zu sehr an, der klassische Anfängerfehler. Stattdessen trifft er Johns Eigenschaften auf den Punkt: schüchtern, zurückhaltend, umgänglich, loyal, vernünftig – ein echter Gentleman. Sam ist John für mich, und damit hat sich die Sache erledigt. Ich glaube nicht, dass ich ihm das je erzählt habe, aber wir haben keinen anderen Schauspieler für die Rolle vorsprechen lassen.
Als er den Raum verlässt, versetze ich der Luft einen kleinen Fausthieb. Nicht nur, dass wir unseren John haben, dieser Typ scheint auch überhaupt nicht zu ahnen, wie gut er ist.
Ich glaube, ich darf sagen, dass Outlying Islands ein Erfolg war – das Stück gewann Preise, zog nach London weiter und ging international auf Tour. (Sie können sich vorstellen, wie wir alle gelacht haben, als es im Daily Telegraph in den »Top Five Bühnen-Sexszenen« aller Zeiten auftauchte.) Das hätte für einen jungen Schauspieler aber durchaus ein irreführender, unrealistischer Karriereeinstieg sein können.
Dieses Buch beschreibt auf faszinierende, oft aber auch schmerzhaft detaillierte Weise die Irrungen und Wirrungen des Schauspielerlebens. Ich habe mir immer damit geschmeichelt, weiterverfolgt zu haben, was Sam im Lauf der Jahre erreicht hat, aber jetzt wird mir klar, dass ich höchstens die Hälfte mitbekommen habe.
Sams Tagebuch seiner Wanderung über den West Highland Way liest sich wie eine Parabel für die viel längere Reise, die ihn zu dem gefragten Schauspieler gemacht hat, der er heute ist. Es ist ein ungewöhnliches Privileg, einen so detaillierten Einblick in die Entwicklung eines Schauspielers zu bekommen und ihm dann auf seinem Weg durch die mörderischen Gewässer der Theater- und Filmindustrie zu folgen. Je größer die Herausforderung, desto tapferer nimmt unser einsamer Ranger sie an. Das gilt für seinen unbekümmerten Abstecher auf den Conic Hill am abendlichen Loch Lomond genauso wie für die Dreharbeiten der eindrucksvollen Folterszenen (die mir heute noch nachhängen) am Ende der ersten Outlander-Staffel. Die Geschichte seiner Reise ist so unmittelbar, sie hallt so in uns nach, dass wir in unseren Köpfen mit ihm wandern, bei Regen und bei Sonnenschein (mehr Regen als Sonnenschein). Und wir staunen, wie oft die schottische Landschaft den Höhen und Tiefen in Sams Leben gleicht, als Schauspieler, aber auch einfach als Mensch.
Was erfahre ich hier über Sam, was ich bei unserer ersten Begegnung vor zwanzig Jahren noch nicht wusste? Dass er eine unfassbar treue Seele ist, entwaffnend selbstkritisch, von Natur aus ein Suchender – ja, auch wenn er sich nicht ganz sicher ist, wonach er sucht – und vor allem fest entschlossen, ein Mensch zu sein, der andere niemals im Stich lässt.
Outlying Islands spielt auf einer namenlosen schottischen Insel, von der wir im Lauf des Stücks erfahren, dass sie als Schauplatz für ein militärisches Experiment mit einer neuen biologischen Waffe dienen soll, einer Waffe, die die Ökologie der Insel zerstören wird. Als Teil der Recherche für die Produktion beschließen wir zu viert, uns auf eine Expedition nach North Rona zu begeben, eine Insel, die in etwa so entlegen ist, wie es dem Autor vorschwebt. North Rona liegt etwa sechzig Kilometer weiter nördlich als der nördlichste Punkt der Äußeren Hebrideninsel Lewis, und 2002 kommt man nur mithilfe eines Extremsport-Anbieters dorthin. Und so kommt es, dass sich Sam, der Junge aus Galloway, mitten im Nordatlantik angeschnallt auf einem Festrumpfschlauchboot wiederfindet, wo Sturmböen den nächsten Schauer jagen, Tölpel sich ins Meer stürzen und plötzliche Sonnenstrahlen hervorbrechen wie das Licht bei einem Rockkonzert.
In der Mitte dieser winzigen, verlassenen Insel (was beharrliche Entlegenheit betrifft, kann St. Kilda im Vergleich mit North Rona einpacken) liegt die Ruine der Kapelle des heiligen Ronan und seiner angrenzenden Eremitenzelle aus dem 8. Jahrhundert. Sam betrachtet die Behausung des Eremiten und sieht zufrieden aus. Ich hoffe, er glaubt nicht, dass wir hierbleiben. Er grinst, und wir lachen beide. Aber jetzt, da ich dieses Buch gelesen habe – in welchem Sam uns mitteilt, dass er sich gern ganz am Rande hält –, blicke ich zurück und denke, dass er vielleicht ernsthaft davon ausgegangen ist. Sam Heughan, von Geburt Lowlander, charakterlich Highlander. Und jetzt Insulaner?
Der Skipper scheucht uns früher als gehofft zurück zum Boot, denn der Wetterbericht für unsere zweieinhalbstündige Rückfahrt nach Lewis scheint ihm Sorgen zu machen. Und so kommt es auch; die Realität der Rückreise macht kurzen Prozess mit der Erinnerung, dass der Hinweg harmlos war. Jetzt klatscht jede Welle das Boot mit solcher Wucht auf das Wasser zurück, dass uns die Knochen klappern. Obwohl wir mit Lassos (so fühlt es sich zumindest an) an unsere sattelähnlichen Sitze geknotet sind, halten wir uns mit aller Kraft fest. Und – Sie haben richtig geraten – Sam ist der Einzige von uns, der keine Angst hat. Er schreit, er brüllt, er jubelt. Das ist seine natürliche Umgebung.
Philip Howard
Edinburgh
August 2022
Prolog
Es ist ein langer Weg bis hierher gewesen. Die Blockhütte steht am Rand des Waldes. Sie besteht aus von Hand halbierten Baumstämmen und Brettern und wird teilweise von hohen, majestätischen, dicht belaubten Bäumen verdeckt. An der Tür angekommen, sehe ich mich um und stelle fest, wie herrlich die Aussicht auf das Tal und die dahinterliegenden Berge ist.
Das ist ein guter Ort zum Leben, denke ich. Ich kann verstehen, warum sich jemand an so einem entlegenen, abgeschiedenen Ort niederlassen möchte. Diese Art von Zuhause gefällt mir.
Der Kochbereich ist draußen unter dem Dach einer großen Veranda. Eine Reihe Töpfe und Pfannen und ein Küchensieb baumeln an Haken, die an der Außenwand befestigt sind. Ein großes Messer liegt quer über einem Hackblock, und Zwiebeln und Chilis hängen an Schnüren in der Sonne, um zu trocknen und mehr Aroma zu bekommen.
Davor lässt ein großer, von der Sonne gesprenkelter Tisch mit Bänken darauf schließen, dass unser Gastgeber jemand ist, der gern für andere Essen zubereitet. Ich stelle mir eine Gruppe von Freunden zu beiden Seiten des Tisches vor, die Bier aus Flaschen trinken, lachen und Witze erzählen, während sie nach Gnitzen schlagen. Auf der Schwelle der Hütte lasse ich meinen Blick auf der Szenerie ruhen, die eine Bühne für ein Open-Air-Theaterstück sein könnte. Sie lässt auf ein Leben schließen, das ganz anders ist als meins. Ich zögere einzutreten.
»Los«, sagt mein älterer Bruder Cirdan, der mich auf dieser Reise begleitet.
Wir sind hier auf Einladung der Frau, die vor uns eingetreten ist. Sie hat meinen Bruder und mich am Flugplatz abgeholt und ist auf unserer nächtlichen Fahrt im Leihwagen einen Teil der Strecke gefahren. Cirdan und ich kennen sie nur vom Telefon. Sie ist sehr nett – etwas über sechzig, würde ich sagen –, und doch ist unser Umgang von einer ruhigen Förmlichkeit bestimmt.
»Kommt rein«, sagt sie, als sie merkt, dass wir noch auf der Veranda sind.
Ich fühle den sanften Händedruck meines Bruders auf meinem Rücken.
Innen, jenseits des Sonnenscheins, empfängt uns der Geruch von Holzrauch, Tabak und Kaffeesatz. Ich frage mich, ob ich auch einen Hauch von Gras wahrnehme, aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt für eine Bemerkung oder auch nur einen Blickwechsel mit meinem Bruder.
Als unsere Gastgeberin die Tür hinter uns schließt, können sich meine Augen an das Innere gewöhnen. Es scheint nur einen zentralen Wohnbereich zu geben, und eine Holztreppe führt zu einem Schlafzimmer und einem Bad hinauf. Auf den ersten Blick bekomme ich den Eindruck eines bequemen, gemütlichen, wenn auch sichtlich schlichten Hauses.
Auf den Regalen reihen sich Bücher ohne besondere Sortierung aneinander. Die Buchrücken sind auf eine Weise zerknickt, die mir sagt, dass der Besitzer ein leidenschaftlicher Leser ist. In der Ecke steht ein Schreibtisch. Wer immer dort sitzt, arbeitet gern bei Kerzenlicht. Ich ertappe mich dabei, dass ich einen Haufen Skizzen und Listen in einer hastigen Handschrift betrachte. Ich lasse meine Fingerspitzen durch die Blätter gleiten und finde darunter eine astrologische Karte. In der Mulde eines offenen Feuers befindet sich Asche, die sich auch als Staub auf den Kamin gelegt hat. Wenn hier ein Feuer lodert, stelle ich mir vor, ist dies ein Ort, der Zuflucht vor der Außenwelt bietet. Der abgenutzte Polstersessel lässt darauf schließen, dass diese Hütte schon lange ein Zuhause ist. Ein Ort, an dem man endlich Ruhe findet, denke ich, und das erinnert mich an den Zweck unseres Besuchs.
Als uns unsere Gastgeberin kurz allein lässt, um nach oben zu gehen, stelle ich fest, dass wir von Dingen umgeben sind, die die Stationen eines Lebens markieren. Mein Bruder scheint das auch zu spüren. Er schaut sich überall um, die Hände hinter dem Rücken verschränkt wie ein Museumsbesucher.
Vor einem Fenster hängt ein Modellflugzeug an einer Angelschnur. Mit seinen glänzend roten Flügeln ist der Flieger aus dem Ersten Weltkrieg in einer Fassrolle erstarrt, als bereite er einen Angriff vor. Sofort erkenne ich den Roten Baron, eine Figur, die mich als Kind faszinierte. Jemand hat mir einmal erzählt, dass der Besitzer dieses Modells früher gern geflogen ist. Das Flugzeug ist selbst gebaut und handbemalt. Es ist beeindruckend detailliert und erinnert mich daran, dass der Schaffensdrang die Menschen in sehr unterschiedliche Richtungen führen kann.
Ich gehe etwas näher an das Regal heran, neugierig, was für Titel ich wohl finden werde, doch was mir ins Auge fällt, ist kein Buch, sondern eine DVD, die mir nur zu vertraut ist. Ich hole sie mit Daumen und Zeigefinger hervor, obwohl ich genau weiß, wie das Cover aussieht, weil ich eine der Figuren in diesem Film spiele. Wortlos zeige ich meinem Bruder die Hülle. Er zieht die Augenbrauen hoch – entweder weil er überrascht ist, dass die DVD überhaupt hier ist, oder weil er etwas bestätigt findet, was wir von Anfang an hätten erwarten sollen.
Ich schiebe die DVD wieder in das Regal. In dem Bewusstsein, dass der Besitzer meinen Weg aus der Ferne verfolgt hat, fahre ich mit dem Finger über die Bücher, die danebenstehen. Nicht weit, und ich finde ein Bibliotheksexemplar des ersten Bandes einer Romanserie, die demnächst für das Fernsehen adaptiert werden wird. Ich habe sie alle gelesen, da ich eine Hauptrolle in der Verfilmung spielen werde. Ich ziehe den Wälzer heraus, um nachzusehen, ob er nicht schon überfällig ist. Dem Datum nach wurde das Buch erst kürzlich ausgeliehen. Dann frage ich mich, ob die Person, die es aus der Bibliothek geholt hat, Zeit haben wird, es zu lesen, und ich gebe mir große Mühe, nicht traurig zu werden. Es ist eine merkwürdige Variante eines vertrauten Gefühls. Es hat nur wenig Gewicht, als wäre es nur ein Hinweis, wie ich reagieren sollte, statt eine echte Emotion.
Ich nehme kleine Hobbitbehausungen aus Ton in die Hand und einen Magierschlapphut aus Filz. Jeder Gegenstand markiert einen Punkt auf einem Lebensweg; von dem alten Feuerzeug zu einem Becher, der ein Lieblingsstück sein muss. Alle zusammen sollten mich zu der Person führen, die hier lebt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das, was ich vorfinden werde, zu meinen Erwartungen passen wird. Eigentlich sind ein paar vage frühe Erinnerungen und eine Handvoll Erzählungen alles, was ich habe, aber wenn ich ehrlich bin, habe ich im Lauf der Jahre nicht viel daran gedacht. Bis jetzt.
Das Geräusch von Schritten auf der Treppe lässt mich einen Schritt zurücktreten. Ich drehe mich um und lächele höflich.
»Euer Vater fühlt sich nicht gut genug, um euch jetzt zu sehen«, sagt sie entschuldigend. »Wir können später wiederkommen.«
Tag null
Auszeit
Ich muss los!« Ich richte mich so heftig im Bett auf, dass die Bettdecke hochfliegt und zerknautscht zu meinen Füßen landet. »Ich muss das machen … auf der Stelle!«
Ich spreche hier ausschließlich mit mir selbst. Ich bin ja auch allein zu Hause. Ich bin erst seit ein paar Tagen wieder da. Nachdem ich monatelang zu Dreharbeiten, PR-Terminen und für geschäftliche Projekte unterwegs war, sollte ich jetzt froh sein, still liegen zu können. Allein in den letzten vier Wochen bin ich von Mexiko bis Los Angeles, New York und Chicago durch Abflugs- und Ankunftshallen gehastet. Nicht, dass mir das lästig wäre. Ich bin gern beschäftigt. Aber ich habe jedes Recht, in Jogginghosen herumzuhängen und absolut nichts zu tun. Dank meines Jetlags und eines kleinen Katers nach einem Date mit meiner Whiskysammlung gestern Abend kann ich meine Gedanken nicht daran hindern umherzuschweifen.
»Ich könnte es doch einfach tun«, rede ich mir selbst ein, als müsste ich den rationalen Teil meines Gehirns von meinem Plan überzeugen. »Oder?«
Seit ich die Tür aufgeschlossen und meine Taschen im Flur abgestellt habe, ertappe ich mich dabei, dass ich ziellos die Zeit totschlage. Ich komme nicht zur Ruhe, kann nachts nicht schlafen und verdöse die Tage. Ehrlich gesagt fühlt es sich an, als hätte ich vergessen, wie man ohne Terminkalender lebt. Bis jetzt habe ich mich nur von einem Zimmer zum nächsten treiben lassen, wie um mich daran zu erinnern, dass ich hier tatsächlich wohne. Die Übergänge von Mahlzeiten zu Snacks sind fließend geworden. Ich habe mit meinem Porridge herumexperimentiert, aber nichts schmeckt besser darauf als gefrorene Blaubeeren, Erdnussbutter und eine Prise Zimt. Ich habe die Salz- und Pfefferstreuer davor gewarnt, sich ein Urteil über mich zu erlauben, nur weil mir Eier mit Ketchup und scharfer Soße schmecken. Ein nachmittäglicher Ausflug zum Fitnessstudio war mein einziger Grund, mich anzuziehen – wenn auch mit ziemlich zusammengewürfelter Kleidung, Frühjahr trifft die Herbst-Winter-Kollektion, beides circa 2009. Danach schalte ich Wiederholungen von Zurück in die Zukunft ein und billig produzierte Polizeidokus. Die Auszeit, die ich genießen sollte, fühlt sich dumpf und verschwommen an. SssssccccccCCCCCrrrrrrackKK! Die neue Kaffeemaschine, deren Bedienung ich so mühsam gelernt habe, spuckt die letzten Tropfen einer spektakulären, brutal schwarzen Flüssigkeit in meinen Lieblingsporzellanbecher. Zwei Tassen reichen, um mich aus dem Bett zu kriegen. Drei wären ideal.
Ich ärgere mich über mich selbst, weil ich mich so sehr auf diese Pause gefreut hatte. Ich hatte mich glücklich geschätzt, in einer Branche zu arbeiten, die einen Weg gefunden hatte, auch in einem weiteren Pandemiejahr zu funktionieren. Die ganze Welt war davon betroffen gewesen, und uns ging es nicht anders. Filme und Serien zu drehen, war vielen Einschränkungen unterworfen gewesen, aber ich war so dankbar, in einem der wenigen Sektoren beschäftigt zu sein, die die Arbeit fortsetzen konnten. Jetzt hatte ich Pause, und doch kostete es mich Mühe, mich mehr als einen Tag auszuruhen. Ich bin nicht hyperaktiv, eigentlich bin ich süchtig nach Erholung, aber ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mich nicht zu irgendetwas antreibe.
Im Lauf des letzten Jahres konnten wir endlich die sechste Outlander-Staffel drehen. Sie war kürzer, aber auch intensiver und hatte einen dunkleren Unterton. Ich spiele den Highland-Krieger Jamie Fraser, und seit Drehbeginn im Jahr 2013 sind die Schauspieler und die ganze Crew für mich wie eine Familie geworden. Obwohl diese Staffel nur acht Folgen hatte, entpuppte sie sich als eine der schwierigsten. Inmitten all der neuen Richtlinien und Restriktionen haben wir zusammengehalten wie nie zuvor, um die Staffel zu etwas ganz Besonderem zu machen. Danach war ich erschöpft und freute mich wirklich auf diese kurze Unterbrechung.
Die Outlander-Produktion ist in den Wardpark Film & Television Studios in Lanarkshire nordöstlich von Glasgow beheimatet. Wir mussten in einer Blase arbeiten und haben nur wenige Menschen von außerhalb gesehen. Am ersten Drehtag, der uns mitten in den schottischen Winter katapultierte, fand ich mich in Begleitung meines treuen, stets verlässlichen Fahrers Davie Stewart wieder. Davies Spitzname ist »Hollywood«, weil er schon viele große Stars chauffiert hat. Mich hält er hoffentlich für gewöhnliche Fracht, denn er ist bei unseren Fahrten immer entspannt und beste Gesellschaft. Wir haben dieselbe Leidenschaft für schlechte Technomusik, und freitagabends kann es auf dem Heimweg im Auto ziemlich wild zugehen. Auch wenn ich selber eher flexibel mit Terminen umgehe, kann ich garantieren, dass er mich immer pünktlich abliefert.
Obwohl ich an diesem Morgen untypischerweise pünktlich fertig gewesen war und schon auf ihn gewartet hatte, kamen wir wegen des Schnees auf den letzten Drücker an. Schnee puderte die Landschaft und krönte die Campsie Fells, als wir über die M80 nach Cumbernauld fuhren, uns aber bremste er aus, weil auf der Straße Schneegestöber herrschte. Zum Glück war nicht viel Verkehr. Das lag nicht nur an den Wetterbedingungen, sondern auch an der Tatsache, dass die Welt mehr oder weniger aufgehört hatte, sich zu drehen, seit das Virus aufgetaucht war. Inzwischen betrachteten wir die leeren Straßen als Selbstverständlichkeit, und während sich Davie aufs Fahren konzentrierte, dachte ich darüber nach, wie die Pandemie keinen Aspekt unseres Lebens unberührt gelassen hatte. Man konnte ihr buchstäblich nicht entkommen. Ich war gerade erst wieder in Schottland, nachdem ich einen Film mit dem Titel Love again mit Celine Dion und Priyanka Chopra fertig gedreht hatte. Aufgrund der Abstandsregeln, die während des ganzen Drehs galten, war es eine große Herausforderung gewesen. Die Regeln während der Vorbereitungszeit waren ziemlich streng: Maximal fünfundzwanzig Minuten gemeinsam in einem Raum, allgemeine Maskenpflicht und so weiter. Ich fand es aber wichtig, eine vertrauensvolle Beziehung zu Priyanka aufzubauen, weil wir ja ein Liebespaar auf Umwegen spielen sollten. Also sorgten wir gemeinsam mit dem Regisseur dafür, dass wir uns auch nach Feierabend treffen konnten. In mancher Hinsicht haben uns die Einschränkungen gezwungen, uns ganz besonders anzustrengen, um perfekte Arbeit abzuliefern. Daran musste ich denken, als wir im Schneematsch in die Einfahrt von Wardpark fuhren und mir schon schwante, dass diese Staffel kein Spaziergang werden würde.
»Alles, was ich brauche, ist ein bisschen Ausrüstung.« Ich bin jetzt aufgestanden und denke laut nach, während ich im Zimmer auf und ab laufe. »Ein Zelt … Regenkleidung … Wanderschuhe … Steigeisen?« Ich halte einen Moment inne, denn ich weiß die Antwort tatsächlich nicht, aber ich muss ohnehin ganz von vorn anfangen, also lasse ich die Frage erst einmal außen vor. »Das kann ich alles regeln«, beschließe ich, obwohl ich mir nicht ganz sicher bin, was sonst noch auf der Liste stehen sollte.
Ja, ich folge hier einfach der Eingebung des Augenblicks. Die Entscheidung ist zwar impulsiv, aber das Abenteuer, das mir vorschwebt, ist mir nicht einfach so eingefallen. In der letzten Outlander-Drehwoche sind wir vom Studio zu einem Außendreh nach Glencoe gefahren. Dem Wanderer bietet dieser großartige Ort in den Highlands Gipfel, Täler, Wege und Wasserfälle. Außerdem ist Glencoe ein legendärer Drehort, wie gemacht für die große Leinwand; hier wurden wichtige Szenen für Skyfall und die Harry-Potter-Filme gedreht. Am Ende eines harten Winters strahlte die Landschaft Ruhe und Wildheit zugleich aus. Wann immer ich nicht vor der Kamera stand, fühlte ich mich einfach nur zu der Aussicht hingezogen. Dann stand ich für eine Rückblende aus dem Gefängnis von Ardsmuir (Staffel drei) in Jamies zerschlissenen Lumpen und schlecht sitzenden Schuhen da, atmete die kalte, reglose Luft ein und sehnte mich danach, mich in dieser gewaltigen, herrlichen Wildnis zu verlieren. Meine Begeisterung für Outlander rührt zum Großteil daher, dass die Geschichte tief in die historischen Kämpfe und Triumphe der Highland-Schotten eintaucht. Es ist eine Ehre, Jamie zu spielen, eine leidenschaftliche, treue, unbeirrbare, tapfere Seele, und doch hatte ich mich nie näher mit dem Land beschäftigt, das seine Heimat war.
Also verabredete ich mich am letzten Drehtag mit einem Kollegen, der auch begeisterter Jogger war, lange vor unserem Auftritt aufzustehen und unsere Trailschuhe anzuziehen. Die kalte Luft weckte mich auf, als wir auf den Buachaille Etive Mòr (den großen Hirten des Etive) zuliefen, den imposanten Berg, der das Tal beschützt. Wir folgten einem Pfad, der bei Wanderern und Rucksacktouristen beliebt war, einer Wanderroute namens West Highland Way. Wie ein breiter Faden durchschnitt er die Landschaft, wand sich um die kleineren Hügel und verschwand in Mulden und Falten. Er zog meinen Blick mit sich, so weit ich schauen konnte.
»Von Glasgow bis Fort William«, sagte Jack, mein Begleiter, als wollte er mich auffordern, mir die schiere Länge der Route auszumalen. »Wie weit ist das? Ungefähr hundertsechzig Kilometer?«
»Es ist weit«, gab ich zurück, denn mein Hirn schlief noch unter der Tartanbettwäsche im Hotel. Ich war mir nicht sicher, wie lang der Wanderweg genau war, aber mir war bewusst, dass wir für ein kurzes Stück einem Weg folgten, der das Tor zu einer rauen, ursprünglichen Landschaft bildete. »Ich glaube, er fängt ungefähr da an, wo ich wohne«, fügte ich hinzu.
»Wow.« Mein Begleiter, der kaum außer Atem war, warf mir einen Blick zu. »Das muss ein herrliches Abenteuer sein.«
Ich antwortete nicht. Wir fanden allmählich unseren Rhythmus, aber ich konzentrierte mich auf meine Füße, weil ich nicht sämtliche Ausreden abspulen wollte, warum ich nichts darüber wusste. Der West Highland Way war eins dieser Dinge, die ich auf meinem Zettel stehen hatte. Ich war nur einfach noch nicht dazu gekommen, ihn abzuhaken. Er lag buchstäblich vor meiner Haustür, und doch war ich anscheinend immer zu beschäftigt, um das zu ändern. Ironischerweise war ich gern unter freiem Himmel unterwegs. Ich hatte sogar eine Organisation gegründet, die den Menschen Mut machen will, sich Aufgaben zu stellen und glücklich und gesund zu leben – und hier stand ich nun, zu verlegen zuzugeben, dass ich eine der großartigen Routen meiner Heimat noch vor mir hatte.
Während es am Horizont heller wurde, trotteten wir an einem am Weg geparkten Wohnmobil vorbei. Die Vorhänge waren geschlossen. Die von Klappstühlen und Campingbechern umringten Reste eines Lagerfeuers neben dem Vorzelt erinnerten mich daran, warum mein Kopf immer noch nicht ganz klar war. Der Camper gehörte meiner Landsmännin Wendy, meiner großartigen Maskenbildnerin, die ihr mobiles Reich dem Hotel vorzog, in dem die Besetzung und die Crew wohnten. Wendy hatte ihren Mann auf diese Reise mitgenommen. Gestern Abend hatten sie ein paar von uns eingeladen, gemeinsam etwas zu trinken. Wir hatten uns um das warme Feuer geschart, vornehme Kekse von Fortnum & Mason gegessen, Whisky getrunken, ihre beiden übergewichtigen Chihuahuas gestreichelt und uns Geschichten vom Dreh und aus unserem Leben erzählt. Immer wieder hatte ihr ansteckendes Lachen die kühle Abendluft durchbohrt.
Wendy war eine tolle Gastgeberin mit viel Sinn für Humor, und ich war versucht, an ihre Wand zu hämmern, um sie zu wecken. Aber so gern ich ihr einen Streich gespielt hätte, erst recht, weil es unser letzter Drehtag war – es war wirklich noch sehr früh. Außerdem fand ich, dass mein Kumpel nicht unbedingt etwas aus Wendys umfangreichem Lexikon der Glasgower Schimpfwörter lernen musste. Ich konnte mir ihre Reaktion vorstellen: »Hör auf damit! Du spinnst wohl, um diese Zeit zu laufen, Idiot.« Also liefen wir in aller Stille an dem Camper vorbei und setzten die Runde fort, die wir uns vorgenommen hatten. Wir verließen den Weg und hielten quer über das Moorland auf den Fluss Etive zu. Die Ufer des rauschenden Gewässers waren sumpfig und kein einfacher Untergrund, aber es fühlte sich so gut an, einfach nur draußen zu sein und ein bisschen Freiheit zu spüren. Dies war der letzte Drehtag unserer härtesten Staffel. Mir wurde leichter ums Herz, und ich war glücklich, die Covid-Regeln und den unerbittlichen Zeitplan, der die Tage, Wochen und Monate der Dreharbeiten beherrscht hatte, hinter mir zu lassen.
Nach unserer Rückkehr zum Hotel hatte ich gerade noch Zeit zum Duschen, ehe ich wieder hinaushastete, wo mich »Hollywood« schon am Steuer seines Wagens erwartete.
»Schon wieder auf den letzten Drücker«, scherzte er.
Ich hatte den frischen Uferschlamm noch an meinen Laufschuhen – ob er wirklich meinte, dass ich schlicht verschlafen hatte?
»Wie immer«, sagte ich trotzdem.
Der letzte Drehtag war nicht weniger fordernd als seine Vorgänger. Die letzte Szene, die wir filmen wollten, würde die Staffel eröffnen. Wir hatten die letzten sechs Monate im Studio gedreht, doch das war den Produzenten nicht dramatisch genug, und sie beschlossen, dass sie für den Anfang diesen legendären Ort haben wollten.
Das Schauspielerleben kann manchmal chaotisch sein, und als ich mich dann mit dem Motorrad auf den Heimweg nach Glasgow machte, freute ich mich darauf, dass wieder ein wenig Normalität in mein Leben einziehen würde. Ich würde zu Hause wieder auf den Boden kommen können, dachte ich auf der langen Rückfahrt in die Stadt. Da ich eine Woche lang keine beruflichen Verpflichtungen hatte, plante ich, mich einfach zurückzulehnen und nichts zu tun. Ich beschloss, meine neu gewonnene Freiheit zu feiern, und fuhr die längere Strecke, durch Stirling und vorbei am Loch Lubnaig, einem herrlichen See in der Nähe des Ben Ledi und des geheimen Standorts von Fraser’s Ridge und des Herrenhauses. Ich winkte im Vorbeifahren hinüber. »Bis zur nächsten Staffel!«, rief ich unter meinem nostalgischen Motorradhelm.
»Es sind nur hundertvierundfünfzig Kilometer«, sage ich zu mir selbst, während ich im Bett am Laptop eine Karte des West Highland Ways studiere. In diesem Moment fühlt es sich so an, als würde das Fehlen dieser zusätzlichen sechs Kilometer, mit denen ich gerechnet hatte, alles ändern. Auf dem Bildschirm betrachte ich eine Linie, die Höhenlinien kreuzt oder ihnen folgt, während sie sich von meiner Heimatstadt zu einer Ortschaft am Fuß des Ben Nevis zieht, eines Bergs, auf den ich schon immer gern gestiegen wäre. Seit mein Laufkumpel und ich diesen berühmten Weg betreten haben, muss ich an ihn denken. Es fühlt sich an, als hätten mir diese paar Hundert Meter einen Vorgeschmack vermittelt, und jetzt will ich jeden Moment erleben, vom Anfang bis zum Ende. Und zum Schluss den Ben Nevis erklimmen – was für eine Herausforderung!
Die Route wurde vor über vierzig Jahren eingerichtet, um den Menschen die Gelegenheit zu geben, die schottische Landschaft zu erleben. Sie beginnt in Milngavie, einem nördlichen Vorort von Glasgow, und verläuft dann etwa fünfundvierzig Kilometer an der Ostflanke des Loch Lomond entlang. Dann schwenkt sie durch die Täler in Richtung Inverarnan und Tyndrum, Kingshouse und Kinlochleven. Der Weg verläuft durch zunehmend wildes, wundervolles Terrain, bis er schließlich zu dieser Anhöhe ansteigt, die den Blick auf Britanniens höchsten Gipfel preisgibt.
Ich mache mir Notizen auf einem Zettel und versuche auszurechnen, wie lange es dauern würde, den Zielpunkt in Fort William zu erreichen. Körperlich bin ich fit, weil ich leidenschaftlich trainiere und hin und wieder laufe. Außerdem bin ich von blindem Optimismus erfüllt (oder naiv).
»Kein Problem. Fünf Tage«, beschließe ich, nachdem ich mir zurechtgelegt habe, dass ich zweiunddreißig Kilometer am Tag mit links hinbekomme. »Los geht’s.«
Ich habe nicht viel Zeit, aber sie reicht gerade eben. Wenn ich die Idee jetzt verwerfe, weiß ich nicht, wann sich noch einmal eine solche Gelegenheit ergeben könnte. Ich schließe den Laptop, und in diesem Moment fühlt es sich gar nicht wie eine überstürzte Idee an. Es ist Schicksal, schlicht und ergreifend. Mit zwei Extratagen, die ausreichen, um mit dem Zug nach Hause zu fahren und mich auf meine nächste berufliche Verpflichtung vorzubereiten, kriege ich das locker hin.
Inspiriert durch Wendys pseudobescheidenes Nomadenleben, denke ich mir, dass es am effizientesten und passendsten wäre, unterwegs zu campen. Ich könnte bei Sonnenuntergang ein Zelt aufbauen, mir über dem Feuer etwas zu essen kochen und dann unter den Sternen in meine Stoffbehausung kriechen. Ich habe seit meiner Pfadfinderzeit nicht mehr richtig gezeltet (ich hatte einfach nur Spaß daran, die Abzeichen zu sammeln), abgesehen von einem grauenvollen Schlammerlebnis beim T in the Park, Schottlands traditionell überschwemmtem Musikfestival. Das hier wird anders sein, beschließe ich. Es wird das wahre Campingerlebnis werden.
»West Highland Way, ich komme«, proklamiere ich und lehne mich zurück, um die Landkarte auf dem Monitor zu adressieren. »Ich bin dann mal weg.«
Vor meinem Aufbruch muss ich die ganze Ausrüstung besorgen, die ich für meine Woche in der Wildnis brauchen werde. Nachdem meine spontane Entscheidung getroffen ist, weiß ich, dass ich mich beeilen muss. Nicht nur, weil ich am nächsten Tag im Morgengrauen aufbrechen will, sondern mir bleibt auch nicht mehr viel Zeit bis zum Ladenschluss.
»Ist das alles, Sir?« Der junge Mann an der Kasse gibt sich große Mühe, Blickkontakt zu halten und nicht auf den Berg von Dingen zu starren, die ich auf die Ladentheke gelegt habe.
»Ich glaube schon«, sage ich und hoffe, dass es beiläufig und selbstsicher klingt. Ich spiele den erfahrenen Bergwanderer und hoffe, dass er mich nicht ertappt.
Tatsächlich fühle ich mich hoffnungslos unvorbereitet, seit ich hier stöbere. Ich bin ja nicht nur für ein paar Ausrüstungsgegenstände hier; ich brauche alles, von Mütze und Outdoorjacke bis hin zu Wanderschuhen und allem möglichen Kleinkram. Mein Korb ist schnell gefüllt, und ich fange an, auch meinen freien Arm zu beladen. Ich schnappe mir ein Zelt, einen Schlafsack, einen Riesenrucksack, einen Gaskocher und eingeschweißte Mahlzeiten, die mir die Energie für den Weg liefern sollen. Ich greife mir sogar einen AeroPress-Kaffeebereiter, weil ich befürchte, ohne meinen morgendlichen Koffeinschock nicht funktionieren zu können.
Nachdem mich mein Panikkauf in jeden Gang und zu jedem Regal geführt hat, steuere ich die Kasse an. Mehr kann ich sowieso nicht tragen.
»Ausflugsvorbereitungen?«, fragt mich der Verkäufer, während er anfängt, die Preise in die Kasse einzugeben.
»West Highland Way«, sage ich.
»Cool! Im Frühjahr?«
»Morgen«, sage ich zu ihm. »Bei Tagesanbruch.«
Der Mann hält beim Scannen inne. Mir ist absolut bewusst, dass es draußen in Strömen regnet, genau wie die ganzen letzten Tage. Die Schultern meines Mantels sind nass, obwohl ich über die Einkaufsstraße gehastet bin, um dem Unwetter zu entkommen. Das Wetter ist nicht ungewöhnlich. Das hier ist schließlich Glasgow. Ende Oktober.
»Das wird bestimmt … interessant«, sagt er und verschluckt sich fast an seinem eigenen Taktgefühl. Just in diesem Moment versucht ein Windstoß, durch den Spalt in der Glastür in den Laden einzudringen. »Die meisten Menschen nehmen ihn im Sommer in Angriff.«
Ich nicke, als sei diese Option für einen Naturmenschen wie mich nicht herausfordernd genug, doch dann beende ich die Maskerade. Denn mir wird klar, dass dieser Typ vermutlich weiß, wovon er spricht.
»Bin ich verrückt?«, frage ich jetzt bescheidener. »Ganz ehrlich.«
Eine Sekunde lang kann ich sehen, wie er Luft holt, um mir zu sagen, was ich hören will. Da ich ihn weiter unverwandt ansehe, seufzt er und schenkt mir ein beruhigendes Lächeln.
»Ich glaube, es könnte toll werden«, sagt er, und dann bietet er mir an, einen Blick auf meine Einkäufe zu werfen und mir zu helfen, das auszuwählen, was ich wirklich brauche. »Und hoffentlich aus den allerbesten Gründen unvergesslich.«
In dem sicheren Gefühl, alles Notwendige zu besitzen, um mich im Fall einer Zombie-Apokalypse selbst zu versorgen, komme ich nach Hause und baue im Wohnzimmer mein Zelt auf. Dabei sind mir nicht Steine und Bäume im Weg, sondern mein Sofa und der Beistelltisch. Auf die Zeltheringe verzichte ich, weil ich dazu Löcher in meine Bodendielen hämmern müsste. Als ich mein Werk dann vom Sessel aus betrachte, bin ich froh, es ausprobiert zu haben. Nicht nur, dass ich mir jetzt nicht mehr über die richtige Position der Stangen und Zeltleinen den Kopf zerbrechen muss, sondern ich habe auch das Gefühl, das bisschen Zeit seit meinem Entschluss bestmöglich genutzt zu haben. Als Schauspieler, der ständig mit mehreren Projekten jonglieren muss, bin ich es gewohnt, langfristig zu planen. Das bedeutet, dass ich oft schon Monate im Voraus weiß, was ich wann tun werde. Meine Entscheidung, einfach loszuziehen und eine sehr lange Wanderung zu unternehmen, ist ungewöhnlich für mich und erfrischend.
Als mir an diesem Abend unter meiner warmen Bettdecke langsam die Augen zufallen, mischt sich ein Hauch von Selbstzweifel und Unsicherheit in meine Aufregung. Seit ich beschlossen habe, dass der West Highland Way eine Wanderung ist, die nicht warten kann, komme ich nun nach der Aufregung der Vorbereitungen zum ersten Mal zur Ruhe. Der gefürchtete Zweifel beginnt, sich breitzumachen. Jetzt, da ich einen Moment zur genaueren Betrachtung habe, frage ich mich, was ich mir dabei eigentlich denke. Ist das wirklich klug? Ich verbringe so viel Zeit damit, von einem Dreh zum nächsten zu reisen, und hier habe ich die seltene Gelegenheit, einfach nichts zu tun. Ich bin endlich zu Hause. An einem Ort, nach dem ich mich manchmal sehne, wenn es sich anfühlt, als fehlte meinem Leben der Pausenknopf. Stattdessen bin ich im Begriff, Sam der Wanderer zu werden, ein Pionier, der sich von der Sonne und den Sternen leiten lässt (und dem wetterfesten Faltplan, von dem mein Freund im Laden meinte, dass ich ihn unbedingt brauche). In meinem Kopf habe ich mir eine echte Odyssee ausgemalt. Aber genau jetzt komme ich mir ein bisschen albern vor.
Ich lausche dem unablässigen Regen im Freien, und kurz vor dem Eindösen frage ich mich, ob ich meinen Wecker abstellen sollte. Dann könnte ich einfach verschlafen, und meine Zeit würde nur noch dazu reichen, meine Sachen in den Laden zurückzubringen und mir mein Geld erstatten zu lassen.
Tag eins
Auf in die Wildnis
Der West Highland Way wurde 1980 eröffnet. Im selben Jahr bin ich zur Welt gekommen, im Südwesten meines Startpunkts im Bezirk Dumfries and Galloway. Meine erste Kindheitserinnerung fühlt sich bis heute wie ein Rätsel an, das ich noch lösen muss. Ich sitze auf halber Höhe auf der Treppe in dem kleinen Haus, in dem wir damals gewohnt haben, einem denkmalgeschützten ehemaligen Wirtshaus an der alten Viehtreiber- und Pilgerstraße von Edinburgh nach Whithorn und St. Ninians. Mein Vater steht oben an der Treppe; meine Mutter ist anderswo, vielleicht in der Küche. Ich spüre Abstand zwischen ihnen, und obwohl ich zu dem Zeitpunkt noch zu klein war, um die ganze Situation zu begreifen, erinnere ich mich, dass ich mich hin- und hergerissen fühlte. Ich kann nicht sagen, ob sie sich gestritten haben oder ob ich etwas falsch gemacht habe. Es ist einfach ein Bild, das ich seit vierzig Jahren in mir trage.
Eines ist allerdings sicher. Dieser Moment ist nicht symptomatisch für meine Kindheit. Obwohl meine Eltern getrennte Wege gingen, als ich gerade achtzehn Monate war, habe ich nichts als Liebe erfahren.
Meine Mum und mein Dad sind 1970 zusammengekommen. Sie sind sich am Strand von Brighton begegnet, wo sich mein Vater David einen Spitznamen eingefangen hat, den er sein Leben lang behalten sollte: Pebbles. Kiesel. Chrissie, meine Mutter, hat eine ausgeprägte künstlerische Ader, und sie fühlte sich diesem jungen Freigeist von (vermutlich) schottischer Herkunft verbunden. Sein Hintergrund war immer ein bisschen vage, wobei feststeht, dass er in einem besetzten Haus an der Strand in London gewohnt hat. Als die Polizei die regelwidrigen Bewohner zwangsräumte, schaffte es ein Foto meines Dads im Zentrum des Dramas auf die Titelseite der Times. Der Familienlegende nach war das der Grund, warum ihn seine streng militärischen Eltern enterbt haben.
Zu Beginn ihrer Beziehung haben meine Eltern an verschiedenen Orten im Süden Englands gewohnt – darunter ein Hausboot – und sich ihr Geld als Gärtner verdient. Schließlich sind sie in den Südwesten von Schottland gezogen und haben sich just jenseits der Landesgrenze in Dumfries and Galloway in einem Dörfchen namens Balmaclellan niedergelassen. Dort haben sie zwei Söhne bekommen, meinen älteren Bruder Cirdan und mich. Mein Vater war ein großer Herr der Ringe-Fan, weshalb er meinen Bruder nach einer Elbenfigur aus diesem Fantasy-Epos benannte, und mich hat er, glaube ich, manchmal »Samwise« genannt, auch wenn ich Gott sei Dank nicht offiziell so heiße! Da passt es ja, dass ich gerade im Begriff bin, meine eigene Heldenreise zu beginnen, obwohl ich mit meinen eins neunzig wohl kaum ein Hobbit bin. Allerdings habe ich die Bücher immer geliebt. Meine Mum hatte eine wohlgehütete Sonderausgabe, die ich als Kind immer wieder las; mit seinem Prägedruckumschlag und den hauchdünnen Seiten fühlte es sich an wie ein Zauberbuch aus Gandalfs persönlicher Bibliothek oder Diebesgut aus Smaugs Schatz.
Meine Mutter meint, ich sei ein abenteuerlustiger kleiner Junge gewesen, der aber auch sehr sensibel sein konnte. Wenn ich alleine war, konnte ich fröhlich den Anführer spielen, aber wenn wir zu mehreren waren, war es mir lieber, wenn ich nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit stand. Ich war nicht schüchtern. Ich habe mich nur wohler gefühlt, wenn ich von der Seite aus zuschauen konnte. Wir werden als Kinder von so vielen Einflüssen geformt, aber ich war zu jung, um mich an den einen zu erinnern, der vermutlich prägend war. Ich weiß nur, dass mein Vater, als ich achtzehn Monate war, das Haus verlassen hat und nie zurückgekommen ist.
Ich habe keinerlei Erinnerung an diese Zeit – weder an den Schock, den er hinterlassen haben muss, noch an die Ungewissheit, denn sein Aufenthaltsort war uns lange ein Rätsel. Als ich größer wurde und meine Umgebung und die Menschen darin wahrzunehmen begann, wurde mir bewusst, dass unsere Mutter alles getan hat, um für meinen Bruder und mich eine Familie zu schaffen. Cirdan, der fünf Jahre älter war, konnte vielleicht besser verstehen, warum manchmal die ganze Welt auf ihren Schultern zu lasten schien.
Meine Mum war von dem, was passiert war, sehr getroffen, und doch reagierte sie darauf, indem sie jede Anstrengung unternahm, ihre Jungen in einer sicheren, liebevollen Umgebung großzuziehen.
»Snood«, sage ich am nächsten Morgen am Steuer zu mir. »Snoooood.«
Ich habe keinen besonderen Grund, das Wort zu wiederholen. Mir gefällt einfach, wie es sich anhört. Seit mir der Verkäufer in dem Campingladen versichert hat, dass ich bei meinem Abenteuer für einen solchen Mützenschal noch dankbar sein werde, ist es ein Ohrwurm, den ich nicht abschütteln kann. Im Moment trage ich den fraglichen Gegenstand um den Hals. Da die Lüftung im Auto versucht, die Wetterbedingungen im Freien nachzustellen, bin ich dankbar für die Wärme, die er mir spendet.
Über Nacht ist ein Sturm durchgezogen. Er hat einen Teppich aus Baumtrümmern auf den kleinen Straßen hinterlassen, denen ich zu meinem Ziel folge. An manchen Stellen sind sie überflutet, sodass ich extrem langsam fahren muss und inständig hoffe, dass ich am Ende nicht auf der Ladefläche eines Abschleppwagens nach Hause zurückkehren muss. Unter weniger schwierigen Bedingungen sind es von zu Hause aus höchstens zwanzig Minuten; so nahe, dass es an ein Verbrechen grenzt, dass ich noch nie auf dem West Highland Way gewandert bin. Ich freue mich darauf loszugehen, bin aber auch ein bisschen nervös. Es ist keine vierundzwanzig Stunden her, dass mir die Idee gekommen ist, von Glasgow nach Fort William zu laufen, und jetzt bin ich mit dieser ganzen Ausrüstung unterwegs und habe keine Ahnung, was mich erwartet.
Ich verlangsame das Tempo, um einem heruntergefallenen Ast auszuweichen, und bemerke, dass ich das Lenkrad ein bisschen zu fest gepackt habe. Ich rufe mir ins Gedächtnis, dass ich weiß, wie man seine Nerven unter Kontrolle bringt. Als Schauspieler habe ich gelernt, das vor jeder Art von Auftritt zu tun. Aber ich bin ja nicht zu einem Filmdreh oder ins Theater unterwegs. Es wird keinen Regisseur geben, der mir Anweisungen gibt, kein Publikum im Parkett. Ich bin im Begriff, mich auf unbekanntes Terrain zu begeben. Ein Soloakt ohne Skript, bei dem ich improvisieren und hoffen werde, dass ich mich nicht verlaufe.
So gesehen ist ein bisschen Nervosität wohl ganz natürlich, und sie verblasst im Vergleich zu meiner Vorfreude.
»Ach, das wird toll«, sage ich mir, als könnte ich so das Gefühl überwinden, dass ich zu Hause aus Versehen die Kühlschranktür offen gelassen habe. »Alles wird gut.«
Ich schalte das Radio ein, um mich abzulenken, und wähle einen lokalen Sender. Ich möchte ein bisschen Geplauder hören, während ich über die heutige Wanderung und das folgende Zeltlager nachdenke. Mir ist klar, dass ich um diese Jahreszeit das Tageslicht nicht auf meiner Seite habe. Mir bleiben vielleicht acht Stunden, bis es dunkel wird, und ich habe dreißig Kilometer vor mir, ehe ich für die Nacht anhalte. Da ich weiß, dass ich einen Marathon in unter dreieinhalb Stunden laufen könnte, also knapp zehn Kilometer mehr, als ich gehen muss, schätze ich, dass ich in aller Ruhe am späten Nachmittag mein Zelt aufschlagen werde. Ich habe reichlich Zeit, bin aber auch fest entschlossen, unterwegs keine einzige Sekunde zu vergeuden.
Für ungefähr anderthalb Kilometer entspanne ich mich auf dem Fahrersitz und kehre zu meinem Snood-Mantra zurück. Doch dann höre ich, wie der Radiomoderator meinen Namen erwähnt, und meine Hände klammern sich wieder um das Lenkrad. Vor Kurzem habe ich getwittert, wie aufgeregt ich bin, an der Entstehung von Outlander-Legofiguren beteiligt zu sein. Ich liebe Lego. Als Kind habe ich stundenlang mit der Burg gespielt und eine Guillotine gebastelt, um arme Legomännchen in den Tod zu schicken. Doch der Moderator liest es einfach nur als Nachricht vor, wenn man es so nennen möchte. Die Serie hat so ein begeistertes Publikum in aller Welt gefunden, aber mir fällt es schwer zu begreifen, dass die Menschen der Besetzung hinter den Figuren so viel Aufmerksamkeit schenken.
Als ich in Milngavie das Parkplatzschild erspähe, wo der West Highland Way beginnt, schalte ich das Radio aus und rufe mir ins Gedächtnis, dass niemand außer mir von meinem Vorhaben weiß.
Zum ersten Mal seit Ewigkeiten habe ich die Gelegenheit, diesen rothaarigen schottischen Typen aus Outlander hinter mir zu lassen. Ich störe mich nicht an dem Scheinwerferlicht, das mich überall verfolgt, aber als ich das Auto parke, wird mir bewusst, wie sehr ich es vermisse, einfach nur Teil der Landschaft zu sein. Und so hat es durchaus etwas Feierliches, als ich ein letztes Mal auf mein Handy schaue, ehe ich es stumm schalte. Für die Dauer dieser Wanderung wünsche ich mir nur eine Verbindung, und zwar mit dem Boden unter meinen Füßen.
»Na dann«, sage ich zu mir selbst, als ich mir den Rucksack auf den Rücken hieve. »Jetzt gibt es kein Zurück mehr.«
Der Parkplatz liegt etwas versteckt hinter dem Bahnhof. Die Sonne lässt zwar noch auf sich warten, aber ich hege die Hoffnung, dass sich die Wolken bald verziehen werden, weil es so stürmisch ist. Das bisschen Regen, das meine Scheibenwischerautomatik auf Trab gehalten hat, stört mich nicht. In meiner neuen Kapuzenjacke bin ich für alles bereit. Okay, der Rucksack fühlt sich schwerer auf meinen Schultern an als zu Hause beim Anprobieren. Ja, ich habe dann noch ein paar zusätzliche Teile hineingestopft, von Ersatzsocken bis zu der Gaskartusche, ohne die mein tragbarer Kocher nutzlos wäre. Jedenfalls fühlt es sich an, als wäre mir ein blinder Passagier auf den Rücken gesprungen, als ich jetzt das Auto hinter mir lasse.
»Kein Problem«, murmele ich und denke, dass ein hochgewachsener, breitschultriger Schotte wie ich doch den Anschein erwecken sollte, als käme er damit locker zurecht.
Auf der anderen Seite des Parkplatzes weist mir ein Schild an der Bahnhofswand den Weg zum offiziellen Beginn des West Highland Ways. Eine Fußgängerunterführung ist zwar kaum das Tor zur Wildnis, das ich mir vorgestellt hatte, aber jetzt kommt es mir ganz passend vor. Ich bin im Begriff, die moderne Welt hinter mir zu lassen, die mir angesichts des Abenteuers, das mich auf der anderen Seite erwartet, grau und wenig aufregend erscheint. Ohne das Gewicht auf meinem Rücken zu beachten, schreite ich auf den Eingang zu, und plötzlich durchströmt mich Adrenalin. Ich kann es nicht erwarten loszugehen, auch wenn das Premierenfieber angesichts meines gewaltigen Vorhabens noch nicht von mir abgefallen ist.
»Cool bleiben«, sage ich leise. »Wandern wir nach Norden und erobern den Nevis.«
Vor dem Bahnhof sind ein paar Menschen unterwegs. Ich halte den Kopf gesenkt und sehe ganz klar aus wie ein Mann, der weiß, was er will … bis ich an der Unterführung kehrtmache und zu meinem Auto zurückhaste, um sicherzugehen, dass ich es auch wirklich abgeschlossen habe.
Unsere dreiköpfige Familie ist aus Balmaclellan in die Kreisstadt New Galloway gezogen. Dort hat meine Mum in einer Holzschuhwerkstatt gearbeitet, um uns über Wasser zu halten. Eigentlich war sie Künstlerin, aber das Wichtigste für sie war, für uns zu sorgen. Statt über unseren Dad zu sprechen, der bald ein abgeschlossenes Kapitel in unserem Leben war, hat sie alles getan, um unseren Neustart so zu gestalten, dass wir Wurzeln schlagen konnten. Ich war zu jung, um mich an die kurze Zeit in der Stadt zu erinnern, doch unser folgendes Zuhause wurde ein prägender Teil meiner Kindheit: Ich war fünf, als wir ein paar Kilometer südlich aufs Land gezogen sind. Meine Mum hatte eine Wohnung in einem umgebauten Stall etwas außerhalb von New Galloway gefunden. Die Gebäude umringten einen Innenhof, auf dem immer Menschen waren, und es herrschte eine gemeinschaftliche Atmosphäre. Niemand schloss seine Haustür ab. Alle achteten aufeinander, und das fühlte sich für mich natürlich und herzlich an. Zu unserem ersten Neujahrsfest in der neuen Wohnanlage kamen Nachbarn und Freunde aus den umliegenden Dörfern, und jeder konnte jeden besuchen und sich an dem Essen bedienen, das für alle aufgetischt war. Es war ein Netzwerk, das auf Vertrauen gegründet war, und nach dem Verschwinden meines Dads war das für uns unschätzbar wertvoll. Ich war quasi von Familien umringt. Unsere war ihnen zwar vielleicht nicht ähnlich und auch nicht den Familien, die ich in unserem Schwarz-Weiß-Fernseher sah, aber ich hatte nie das Gefühl, dass etwas fehlte. Dafür hat meine Mum gesorgt. Als kleiner Junge, der gern auf Erkundungsreise ging, interessierte mich vor allem, dass mein neues Zuhause auf dem Gelände einer Burgruine lag.
Die Burg Kenmure ist der Familiensitz der Gordons of Lochinvar, und sie atmet Geschichte. Ihr berühmtester Bewohner, William Gordon, wurde wegen seiner Rolle bei dem Jakobitenaufstand von 1715 hingerichtet. Es heißt, sie sei der Geburtsort von John Balliol, der von 1292 bis 1296 König der Schotten war, und in den Achtzigern war sie auf jeden Fall der perfekte Spielplatz für einen kleinen Jungen mit einer blühenden Fantasie.
Die Burg, die auf einem steilen Hügel steht, war seit Mitte des 20. Jahrhunderts verlassen. Seitdem wurde sie von der Natur belagert. Das Dach war eingestürzt, und die Wände bröckelten, während aus jeder Ritze und Spalte Brombeeren, Gräser und kleine Bäume wuchsen. Sämtliche Fenster waren lange zerborsten, die Eingänge mit Ziegelhaufen blockiert. Natürlich war es uns verboten hineinzugehen – ein Sirenenruf für einen Jungen auf der Suche nach einer Bühne, auf der er sich in König Artus oder Robert Bruce verwandeln konnte.
Ein paarmal habe ich mich hineingetraut. Der einzige brauchbare Zugang war eine Wendeltreppe, die sowohl gefährlich als auch sehr gruselig war. Natürlich rankten sich Spukgeschichten um die Burg. Dem kopflosen Dudelsackspieler, der hier angeblich der Stargast war, bin ich zwar nie begegnet, aber ich habe mich auf jeden Fall immer wieder vor meinem eigenen Schatten erschrocken. Ich habe auf der Treppe einfach die Luft angehalten und war auf alles gefasst.