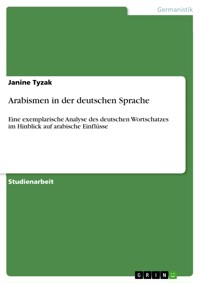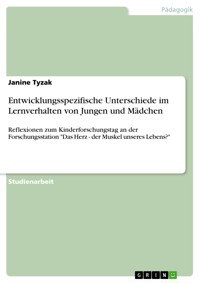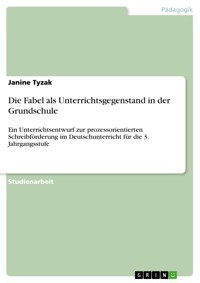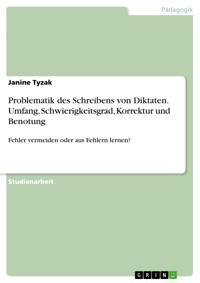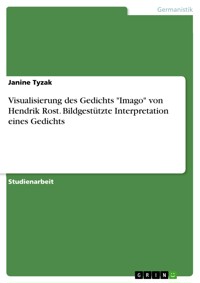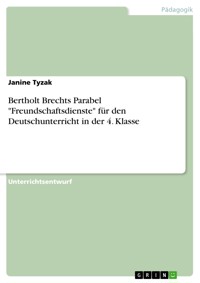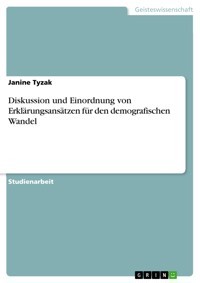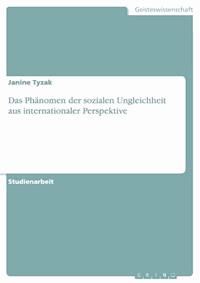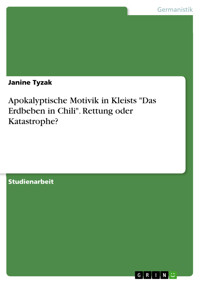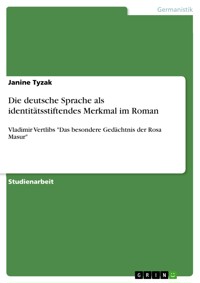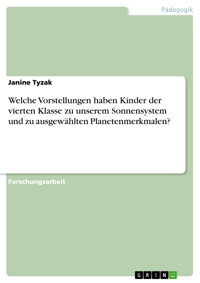
Welche Vorstellungen haben Kinder der vierten Klasse zu unserem Sonnensystem und zu ausgewählten Planetenmerkmalen? E-Book
Janine Tyzak
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Forschungsarbeit aus dem Jahr 2016 im Fachbereich Didaktik - Sachunterricht, Heimatkunde, Note: 1,3, , Sprache: Deutsch, Abstract: „Welche Vorstellungen haben Kinder der vierten Klasse zu unserem Sonnensystem und zu ausgewählten Planetenmerkmalen?“ Um diese Fragestellung beantworten zu können, wurde eine qualitative Querschnittsuntersuchung durchgeführt, die mittels eines strukturierten Leitfadeninterviews realisiert wurde. Alle Befragen haben individuelle Vorstellungen über das Sonnensystem, dabei stellen besonders die Planeten einen zentralen Bestandteil dar. Größtenteils wissen die Kinder, dass das System heliozentrisch angeordnet ist. Dennoch fällt es vielen Schülerinnen und Schülern schwer, über den Gegenstand nachzudenken und astronomische Phänomene ihrer Zeichnungen zu erklären. Mögliche Gründe für diese Problematik sind die Nicht-Thematisierung in Lehrplänen und Unterricht, sowie die Komplexität des Gegenstandes. Gerade aber durch das große Interesse an der Thematik seitens der Befragten, kann der Sachunterricht viele Möglichkeiten bieten, das Sonnensystem als Unterrichtsgegenstand zu integrieren. Der Inhalt kann nicht nur einen Mehrwert für die Förderung sachunterrichtsspezifischer Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen darstellen, sondern auch eine Grundlage für nachhaltige Lernprozesse (BNE) schaffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
1.Abstract
„Welche Vorstellungen haben Kinder der vierten Klasse zu unserem Sonnensystem und zu ausgewählten Planetenmerkmalen?“Um diese Fragestellungbeantwortenzu können,wurde eine qualitativeQuerschnittsuntersuchung durchgeführt, die mittels einesstrukturiertenLeitfadeninterviews realisiert wurde.Alle Befragen haben individuelle Vorstellungen über das Sonnensystem, dabei stellen besonders die Planeten einen zentralen Bestandteil dar. Größtenteils wissen die Kinder, dass das System heliozentrisch angeordnet ist. Dennoch fällt es vielen Schülerinnen und Schülern schwer, über den Gegenstand nachzudenken und astronomische Phänomene ihrer Zeichnungen zu erklären. Mögliche Gründe für diese Problematik sind die Nicht-Thematisierung in Lehrplänen und Unterricht, sowie die Komplexität des Gegenstandes. Gerade aber durch das große Interesse an der Thematik seitens der Befragten, kann der Sachunterricht viele Möglichkeiten bieten, das Sonnensystem als Unterrichtsgegenstand zu integrieren. Der Inhalt kann nicht nur einen Mehrwert für die Förderung sachunterrichtsspezifischer Denk-, Arbeits- und Handlungsweisen darstellen, sondern auch eine Grundlage für nachhaltige Lernprozesse (BNE) schaffen.
Inhalt
1.Abstract
2. Einführung in die Thematik
3. Definitorische Grundlagen
3.1 Warum braucht die Forschung Definitionen?
3.1.1 Vorstellungen – was ist das?
3.1.2 Unser Sonnensystem – ein komplexer Gegenstand
3.1.3 Merkmale von Planeten und ihre Bewegung
3.2 Vorstellungen zum Sonnensystem – eine Forschungslücke?
3.3 Das Sonnensystem im Sachunterricht?
4. Zu Beginn der Arbeit – die Forschungsfrage
4.1 Was soll erforscht werden und wozu?
4.2 Der Weg zur konkreten Fragestellung
5. Methoden als Basis für empirische Forschungen
5.1 Allgemeine Informationen zur Studie
5.2 Erhebungs- und Auswertungsmethoden – ein Überblick
5.2.1 Die Methode des Leitfadeninterviews
5.2.2 Die qualitative Inhaltsanalyse als Auswertungsmethode
6. Welche Ergebnisse konnten erzielt werden?
6.1 Gibt es Bezüge zwischen der kindlichen Lebenswelt und dem Gegenstand Sonnensystem?
6.1.1 Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse schätzen ihre Kenntnisse zum Sonnensystem unterschiedlich ein
6.1.2 Schülerinnen und Schüler finden es schwierig, über das Sonnensystem nachzudenken
6.1.3 Das Sonnensystem ist bis zum jetzigen Zeitpunkt kein Unterrichtsgegenstand gewesen, das Interesse am Gegenstand ist jedoch groß.
6.2 Wissen Kinder der vierten Jahrgangsstufe, dass Planeten ein Bestandteil des Sonnensystems sind?
6.2.1 Schülerinnen und Schüler der vierten Klasse haben die Vorstellung, dass Planeten ein fester Bestandteil unseres Sonnensystems sind.
6.3 Wie stellen sich die SuS unser Sonnensystem vor?
6.3.1 Überblick
6.4 Wissen die SuS etwas über Planetenmerkmale?
7. Reflexion des Forschungsprozesses
8. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen für den Sachunterricht
9. Literaturverzeichnis
Abbildungs-Diagramm-Tabellenverzeichnis
2. Einführung in die Thematik
„Astronomie begeistert, fasziniert und weckt Neugier, besonders bei jungen Menschen. Aus pädagogischer Sicht gibt es keine bessere Voraussetzung für die Wissensvermittlung. Denken wir also gemeinsam darüber nach, welches astronomische Grundwissen in der Schule tatsächlich vermittelt werden sollte“ (Fiedler 2010, 61).
Viele Stimmen in der Debatte um den Schulkanon fordern, dass astronomische Inhalte als fester Bestandteil in den (Grund-)Schulunterricht integriert werden sollen. Besonders im Grundschulalter können Schülerinnen und Schüler (SuS) ihre Neugier nutzen, um astronomische Inhalte zu erfassen (vgl. ebd.). Der Sachunterricht spielt dabei eine zentrale Rolle. Dort wird die Möglichkeit geschaffen, mit allen Sinnen und mit ausreichender Zeit die „Faszination Weltraum“ und somit auch einen Teil der kindlichen Lebenswelt zu erschließen.
„Die unendliche Weite des Alls drückt sich aus in den fast unvorstellbar großen Zahlen, die im Zusammenhang mit dem Thema benutzt werden; Größen, die die Vorstellungskraft von Kindern überschreiten und deshalb wieder Geheimnisse und Abenteuer bergen, die erforscht werden wollen“ (Datz 2007, o.S.).
Dennoch sind in den Lehrplänen für den Sachunterricht Themen, die den Weltraum und vor allem unser Sonnensystem betreffen, nicht vorhanden. Auch gibt es in der Bildungsdebatte Parteien, die meinen, dass die Astronomie für Kinder nicht verstehbar ist und daher eher in den weiterführenden Schulen einen Platz finden sollte (vgl. Clausnitzer 2012, 13). Ist die Thematik Sonnensystem für Kinder greifbar? Haben die SuS in der vierten Jahrgangsstufe schon Vorstellungen zu unserem Sonnensystem?
Es gibt vereinzelt Forschungen über Vorstellungen von SuS zum Aufbau der Erde als Planet, jedoch keine Forschungen zu den Vorstellungen von Kindern über unser Sonnensystem. Dabei wird in den wenigen Forschungen oft erwähnt, wie wichtig eine Thematisierung wäre, da SuS schon mit Beginn der Schullaufbahn „ein ausgeprägtes Verständnis für die Gestalt der Erde und ihrer Umgebung haben“ (Sommer 2002, 70). Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es keine klare politische Entscheidung diesbezüglich in der Bildungsdiskussion.
Das Ziel dieser Arbeit ist, durch eine qualitative Querschnittsstudie in Form eines Leitfadeninterviews SuS-Vorstellungen zu unserem Sonnensystem erfahrbar zu machen. Durch die Ergebnisse dieser Forschung, kann abschließend beurteilt werden, ob die Forderung in der Bildungsdebatte nach mehr astronomischen Inhalten gerechtfertigt ist. Darüber hinaus kann (trotz kleiner Stichprobe) nach der Auswertung eine Tendenz gegeben werden, ob dieser Unterrichtsgegenstand für Kinder der vierten Jahrgangsstufe überhaupt greifbar ist und ob diese ein Interesse am Gegenstand haben. Um dieses Ziel erreichen zu können, wurde eine Forschungsfrage konzipiert, die im Hinblick auf Grundschullehrpläne und (Sach-)Unterrichtsforschung ein unerforschtes Gebiet antastet. Gerade das Eruieren von SuS-Vorstellungen in bisher unbekannten Themengebieten spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, Sachunterricht modern, innovativ und schülerorientiert gestalten zu können.
„Welche Vorstellungen haben Kinder der vierten Klasse zu ausgewählten Merkmalen von Planeten in unserem Sonnensystem?“
3. Definitorische Grundlagen
3.1 Warum braucht die Forschung Definitionen?
Bevor das Forschungsvorhaben untersucht werden kann, müssen zunächst definitorische Grundlagen geschaffen werden. So können die Determinanten der Forschungsfrage operationalisiert und von allen Rezipienten gleichermaßen erfasst und verstanden werden.
3.1.1 Vorstellungen – was ist das?
Nach der Definition von Duit (1997, 234) sind Vorstellungen geistige Entwürfe „die sich ein Mensch von der ihn umgebenden und durch Sinneseindrücke auf ihn wirkenden Welt macht.“ Diese Definition wurde vor dem Hintergrund des Forschungszweckes bewusst ausgewählt, da diese sehr weit gefasst ist und sich nicht nur auf mündlich reproduzierbare Äußerungen bezieht. Vorstellungen können demnach auch „das im Bewußtsein auf Grund von vorhergehenden […][W]ahrnehmungen und Empfindungen zustande kommende Bild eines Gegenstandes oder Vorgangs der Außenwelt“ (Hoffmeister 1955, 655)sein.
Hervorzuheben ist, dass Vorstellungen im Rahmen dieser Arbeit als Konstrukte gesehen werden, die ohne schulischen Input aufgrund von Beobachtungsvorgängen entstehen. Diese werden von den SuS[1] in eine für sie logische Verknüpfung übertragen (vgl. Barke 2006, 21). Die Beobachtungsvorgänge finden sich in den verschiedensten Kontexten der kindlichen Lebenswelt wieder, zum Beispiel im Umgang mit der Natur, Sinnes- oder Spracherfahrungen sowie durch Kommunikation und Medienerfahrungen (vgl. Hartinger, Lange 2014, 39f.).
Im aktuellen Forschungsdiskurs, besonders auch im Sachunterricht, sind unterschiedliche Synonyme für den Begriff Vorstellung geläufig. Häufig fallen in diesem Kontext Begriffe wie Alltagsvorstellungen, Präkonzepte und Vorwissen (vgl. Hartinger, Lange 2014, 38f.).
In diesem Forschungsvorhaben wird nur das Synonym Alltagsvorstellungen verwendet, da dieses mit den oben genannten Ausführungen übereinstimmt. Dahingegen müssen die Ausführungen zu Präkonzepten und Vorwissen differenziert betrachtet werden. Präkonzepte zeichnen sich dadurch aus, dass
„Schülervorstellungen im fortgeschrittenen Unterricht […] nicht allein ursprünglichen Überlegungen der […] [SuS] zuzuschreiben [sind], sondern überwiegend durch die Vermittlungsprozesse im Unterricht ent[stehen]. Daher können diese nach Barke als Präkonzepte […] [bezeichnet werden]“ (Barke 2006, 21).
Präkonzepte sind demnach durch den Unterricht bereits beeinflusste Vorstellungen, die zu naturwissenschaftlichen Konzepten hinführen sollen (vgl. Lange, Hartinger 2014, 40). Dieses Synonym ist im Folgenden nicht mit dem Begriff der Vorstellung gleichzusetzen, da das Forschungsvorhaben die unbeeinflussten Alltagswahrnehmungen der SuS untersucht.
Vorwissen kann unter anderem durch „deep structures“ beschrieben werden (vgl. Möller 2010, 39). Diese sind „stabile, tief bestehende Strukturen“ (Möller 2010, 39). Vorstellungen hingegen, müssen nicht tief im Verständnis des Kindes verankert sein, sondern können auch aus spontane Äußerungen bestehen. Aus diesem Grund wird auch dieser Begriff nicht synonym verwendet.
Zusammenfassend werden Vorstellungen oder Alltagsvorstellungen in diesem Kontext als Ausgangspunkt für Lernprozesse angesehen. Sie entstehen durch die unbeeinflusste Auseinandersetzung der SuS mit ihrer Lebenswelt, die sie mit allen Sinnen wahrnehmen. Dabei entwickeln die SuS nicht nur sprachlich reproduzierbare sondern auch bildlich-imaginäre Vorstellungen.
3.1.2 Unser Sonnensystem – ein komplexer Gegenstand
Vor etwa 4.5 Milliarden Jahren ist unser (s.u.) Sonnensystem durch eine Sternexplosion entstanden (vgl. Weiß 2006, 6f.). Dabei umfasst dieses System „alle Himmelskörper, die die Sonne mit ihrer Anziehungskraft gefangen hält“(Schlüpmann 2013, o.S.). Resultierend daraus entsteht das Bild, dass die Sonne das Zentrum unseres Sonnensystems darstellt. Dieses findet sich auch im Begriff ‚Sonnen‘-system wiederfinden. Die Anordnung der Himmelskörper innerhalb des Sonnensystems war lange Zeit umstritten. Bis zum Mittelalter wurde davon ausgegangen, dass die Erde den unbewegten Mittelpunkt des Systems bildet, um den alle anderen Planeten kreisen (geozentrisches Weltbild). Der Astronom Kopernikus veröffentlichte im Jahr 1543 seine Auffassung zum heliozentrischen (kopernikanische) Weltbild, welches bis heute seine Gültigkeit hat. Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Sonne den Mittelpunkt unseres Sonnensystems darstellt und alle Planeten von ihrer Anziehungskraft abhängig sind (vgl. Hanslmeier 2014, 41ff.). Aktuelle Forschungsergebnisse verweisen darauf, dass insgesamt acht Planeten zu dem System gehören (Mars, Venus, Erde, Merkur, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun). In dieser Zählung sind nur Planeten aufgezählt, die von besonderem Ausmaß sind, das heißt einen größeren Durchmesser als 2240 km aufweisen (vgl. Schlüpmann 2013, o.S.). Durch dieses Kriterium fällt Pluto, der lange Zeit als Planet angesehen wurde, aus der Planetenliste heraus. Er ist schlichtweg zu klein, um einer der dominierenden Himmelskörper darzustellen (vgl. Hanslmeier 2013, 49). Neben Planeten umfasst unser Sonnensystem Asteroiden, Kometen, Satelliten und Sterne, welche für den Forschungsprozess in diesem Rahmen nur von geringer Bedeutung sind und daher an dieser Stelle nicht weiter definiert werden.
Nicht gleichzusetzen ist unser Sonnensystem mit der Milchstraße. Das Sonnensystem stellt mit seinem Durchmesser von 50 „Astronomischen Einheiten“[2] gerade einmal einen kleinen Raum in der Milchstraße dar. Insgesamt besteht diese aus mehr als 40 Galaxien, sodass „relativ betrachtet, […] unser Sonnensystem im Kosmos weniger Platz ein als ein Sandkorn in der Sahara [einnimmt]“ (Weiß 2006, 6f.). Aus diesem Grund wird in der Forschungsfrage bewusst die Formulierung ‚unser‘ Sonnensystem verwendet. So wird deutlich, dass in diesem Kontext nur ein kleiner Teil der Milchstraße gemeint ist, nämlich das Sonnensystem, welches für den Menschen von existentieller Bedeutung ist.
3.1.3 Merkmale von Planeten und ihre Bewegung
Wie können Planeten unseres Sonnensystems definiert werden? Was zeichnet sie aus?