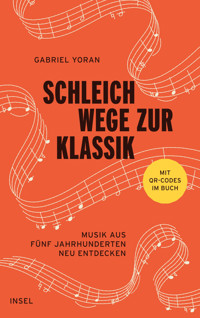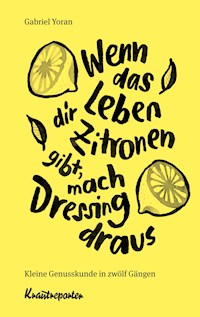
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Krautreporter
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Die Welt ist kompliziert, die Menschen sind schwierig, aber probiere eine belgische Nougatpraline oder lass dir den Saft eines reifen, saftigen Pfirsichs in der sengenden Mittagssonne durch die Finger rinnen und alles andere ist kurz unwichtig. In Anbetracht der sich vor uns auftürmenden Krisen können wir etwas Genuss gebrauchen. Denn er erzeugt einen kleinen, wertvollen Moment des Innehaltens. Dieses Buch über gutes Essen will dir dabei helfen. In zwölf Gängen führt Gabriel Yoran in die Welt des Genusses ein. Er verrät, wie Pastagerichte garantiert gelingen, welches die perfekte Formel für Sandwiches ist und was du aus wenigen Zutaten kochen kannst, die du garantiert zuhause hast. Zehntausende haben die Genusskolumnen von Gabriel Yoran gelesen. Jetzt erscheinen sie erstmals als Buch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
1. Gönn dir (dieses Buch)
2. Genuss für alle: Wie wir schleichend zu Gourmets (gemacht) werden
3. Niemandem sind Kekse egal
4. Ich hab nix da, was soll ich kochen?
5. Die Sandwich-Formel – und eine Marmelade aus Tomaten
6. Arrivederci al dente: Pasta kochen wie die Profis
7. Gemüse ist geil – lasst es uns genießen!
8. Die besten Getränke, von denen du noch nie gehört hast
9. Alles schmeckt besser mit Café-de-Paris-Butter
10. Mit diesem Brötchen ist alles möglich
11. Wenn das Leben dir Zitronen gibt, mach Dressing draus
12. Der Nachtisch: die wichtigste Mahlzeit des Tages
Verzeichnis der Rezepte
1. Gönn dir (dieses Buch)
Wir brauchen ein paar Dinge, die das Leben jetzt sofort schöner machen können. Denn wir dürfen, nein, wir müssen uns etwas gönnen. Dabei will ich dir mit diesem kleinen Buch über gutes Essen helfen
Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan?
Ich weiß noch, wie ich zum ersten Mal einen Flødebolle gegessen habe, den dänischen Schaumkuss. Ich erwarte nichts Besonderes, denn ich kenne ja seinen deutschen Bruder. Ich beiße hinein und erlebe den perfekten Sturm: Zuerst mal ist der Schaum dichter, er ist nicht puff, sondern däng. Die Farbe ist anders und er schmeckt nach – Lakritze! Noch während ich diesen herben Schock verwinde, meldet sich ein süßes, kompaktes Gegenmittel: Der Boden ist keine einfache Waffel, die bestenfalls den Schaum hält, sondern versöhnliches Marzipan. Und zusammengehalten wird diese kleine Eskapade von hervorragender, knackiger, glänzender, etwas dickerer Schokolade als beim deutschen Schaumkuss. Sie muss etwas dicker sein, weil man sonst nicht würdigen könnte, wie gut sie ist. Mein erster Flødebolle ist für mich der Inbegriff von Genuss. Ich erinnere mich ganz genau daran.
Klimakrise, Pandemie, Krieg, Extremismus, Hassverbrechen, Inflation, Umweltkatastrophen, Energiepreise – in Anbetracht der sich vor uns auftürmenden Krisen können wir etwas Genuss nicht nur gebrauchen, wir sind auch empfänglicher für ihn.
Denn Genuss erzeugt einen kleinen, wertvollen Moment des Innehaltens. Er ist unmittelbar: Du musst nicht überlegen, ob du etwas genießt. Du weißt es und du weißt es sofort. Die Welt ist kompliziert, die Menschen sind schwierig, aber probiere eine belgische Nougatpraline, beiße in einen saftigen Burger mit karamellisierten Zwiebeln, lass dir den Saft eines ganz reifen, ganz saftigen Pfirsichs in der sengenden Mittagssonne durch die Finger rinnen oder bestelle endlich mal wieder ein Spaghettieis mit Erdbeersauce wie im Eiscafé Capri vor vierzig Jahren und alles andere ist kurz unwichtig.
Genießen aber gilt leicht als überflüssig, elitär, unsozial, verantwortungslos und bestimmt auch umweltschädlich. Mit einem globalen moralischen Horizont verbietet sich eigentlich der Genuss, denn er steht ja für das Überflüssige, das sinnlos Verfeinerte. Die Menschen leiden und du bist unzufrieden mit der Konsistenz des Milchschaums in deinem Cappuccino? Geht‘s noch? Über Leute mit verfeinertem Geschmack macht man sich lustig, sie gelten als Snobs und schwierig, sie werden auch nicht mehr nach Hause zum Essen eingeladen, weil man befürchtet, nicht das richtige Olivenöl parat zu haben. Oder nur das billige Salz.
Aber Gehabe ist nicht Genuss. Genuss ist ein inneres Phänomen. Nur du selbst kannst wissen, ob du etwas genossen hast. Aber wenn du mehr weißt, hast du mehr davon. Es beginnt damit, die Aufmerksamkeit bewusst auch auf die einfachsten Dinge zu richten: Wie genau schmeckt zum Beispiel ein Toffifee? Welche Oberflächen haben das Karamell, die Schokolade, die Haselnuss? Wie schmecken sie einzeln, warum sind sie zusammen so gut? Da kommt Hartes, Schmelzendes, Knackiges und Zähes zusammen. Und welche Rolle spielen Farbe, Verpackung, deine Erwartung? Wer Toffifee abfällig ein Industrieprodukt nennt, ist selber schuld: Die Erfahrung, wie es ist, ein Toffifee zu essen, hat eine ausführliche Beschreibung verdient. Immerhin tun Millionen Menschen das jeden Monat.
Dieses Buch versammelt meine Krautreporter-Kolumnen aus der Reihe »Gönn dir!«, die ich nach dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie zu schreiben begonnen habe. Darin teile ich einige meiner Genuss-Episoden, weil ich so oft dachte: Das ist so gut! Warum kannte ich das noch nicht? Probiere das doch auch mal! Ich habe so viele Leute in fantastische Lokale geschleift, weil ich Angst hatte, dass diese Lokale pleite gehen (es ist leider sehr oft so gekommen, weil gute Küche noch kein gutes Restaurant macht). Vor allem aber hatte ich das Glück, dass mein Vater, ein leidenschaftlicher Esser, mich schon sehr früh in interessante Restaurants mitgenommen hat. Als Zehnjähriger wurde ich so mit gepfefferten Erdbeeren konfrontiert. Seitdem denke ich bei Erdbeeren immer: Die könnten etwas groben Pfeffer vertragen – das würde die ganze Sache so viel spannender machen! Aber selbst wäre ich nie darauf gekommen. Die Gewohnheit, Erdbeeren mit Sahne zu essen, ist einfach sehr stark. Als ich dann ein paar Jahre in den USA gelebt habe, merkte ich, wie viel von unseren Essgewohnheiten eben genau das sind: Gewohnheiten. Ich habe dort im Supermarkt abgepackte Sets aus Salzbrezeln und Hummus-Dip entdeckt. Und während wir ja beide Produkte kennen, tauchen sie hierzulande nie zusammen auf. Das Authentizitätsgebot ist stark in Deutschland: Salzbrezeln gibt es zum Bier, Hummus zum Falafel. Die Amerikaner:innen haben da eine unbeschwerte Experimentierfreude: Sie mixen alles zusammen, was die Leute aus ihren Heimatländern mitbringen, irgendwas davon wird schon funktionieren. Ich kann bestätigen: Salzbrezeln mit Hummus funktionieren.
Mein Freund Ulf schreibt für ein Gourmet-Magazin. Er kann mir sagen, was ich an einem Wein gut finde: »Du magst den, weil der so cremig ist.« Ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen Wein »cremig« zu nennen, aber seine Beschreibung traf es perfekt. Natürlich ersetzt Ulfs Begriff nicht den eigenen Eindruck beim Trinken, aber erst jetzt weiß ich, dass ich »cremige« Weine mag. Ulf hat mir gezeigt, dass diese Weinsprache nicht nur Getue ist, sondern dass ich mehr genießen kann, wenn ich die richtigen Worte dafür habe. Das muss man lernen. Wir wachsen nicht damit auf. Wir müssen auch lernen, darüber zu reden. Ich kann zwar im Stillen genießen, aber zumindest mir geht es so, dass ich es (mit)teilen will, wenn ich etwas genossen habe. Gib deiner Empfindung einen Namen und sie wird bleiben. Und du kannst sie leichter teilen. Nicht nur auf Instagram.
Während das kühle Feierabendbier sozial erwünscht ist (solange es nur eins ist und nicht elf sind) und Millionen Menschen festgefügte Meinungen über Bier haben, ist es bei, sagen wir, Weinspezis schon ganz anders. Essen gehen mit Menschen, der Weine nach dem Probeschluck tatsächlich zurückgehen lässt. Anstrengend! Peinlich! Uff! Dabei will der doch auch nur genießen! Es ist also einerseits ein Klassending, aber eben nicht nur. Ich zum Beispiel habe eine starke Rübenmeinung! Ich habe Meinungen zu Teltower Rübchen und Pastinaken! Beides wirklich keine Luxusartikel. Aber sich damit zu befassen, ist nicht unbedingt mehrheitsfähig.
Zum Glück verschwimmt die Bier-Wein-Linie: Seit einigen Jahren wächst das Interesse an unbekannteren Biersorten.
Dass Bier nicht nur süffig oder herb schmecken kann, spricht sich langsam herum. Man probiert sogenannte India Pale Ales (IPAs), die nach Zitrone und Maracuja schmecken. Derweil bieten Discounter immer mehr Feinkost an. Alltagslebensmittel wandeln sich zu Delikatessen. Genuss heißt nicht länger nur Kaviar und Hummer (auch wenn ich euch später noch die Lobster Roll, das Hummerbrötchen von der US-Ostküste, vorstellen muss). Wir können selbst entscheiden, was wir genießen wollen. Ich nehme ein Butterbrot ernst, ich nehme ein Knoppers ernst, ich finde, auch Limos haben eine ernsthafte Auseinandersetzung verdient.
Und ja, Genuss lässt sich auch alleine mit einem Buch haben, bei einem Spaziergang mit einem Freund, beim Sex mit dem richtigen Partner, dem Blick über den Comer See. Diese Genüsse sind gute Genüsse. Aber es gibt einen Grund, warum in Marcel Prousts Jahrhundertroman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« der Genuss einer in Tee getunkten Madeleine (einem muschelförmigen Kleingebäck) die Erinnerung des Ich-Erzählers triggert und damit den gesamten Roman. Es gibt einen Grund, warum sich der Großvater in dem alten Fernsehspot für Werthers Echte (die heute Werther’s Original heißen) daran erinnert, wie er als Kind sein erstes Karamellbonbon bekam – in Goldpapier eingewickelt, überreicht wiederum von seinem Großvater. Die Unmittelbarkeit des Sinneseindrucks beim Essen und Trinken verschafft sich eine besondere Aufmerksamkeit. Sich ihr bewusst zuzuwenden, heißt, genießen lernen. Und dafür ist es höchste Zeit, denn wir brauchen ein paar Dinge, die das Leben jetzt sofort schöner machen können. Insbesondere in der Corona-Krise, am Vorabend eines absehbaren Winters des Missvergnügens. Wir müssen uns um uns selbst kümmern, damit wir uns um andere kümmern können. Genuss ist Selbstfürsorge. Wir dürfen, wir müssen uns etwas gönnen.
Dabei will dieses Buch mithelfen. Wir werden über englischen Strawberry Shortcake reden und darüber, was Lasagne mit Jesus zu tun hat; es wird um Kaffee gehen (natürlich!); wir werden über die Lücke zwischen Fast Food und Fine Dining sprechen und warum sie so spannend ist; wir spüren nach, warum Backen gegen Übellaunigkeit hilft, sprechen über vegane Speisen, an die sich professionelle Gourmets zuerst erinnern und welche drei Gemüse man auf eine einsame Insel mitnehmen würde. Es wird um tolle Gerichte gehen aus Zutaten, die du daheim hast, aber auch um den Sumpfeibisch (die Marshmallow-Pflanze!).
Die Vergangenheit kann uns täuschen und die Zukunft kennen wir nicht. Analysen und Interpretationen können falsch sein oder schlicht unmöglich. Aber die Möglichkeit des Genusses ist jetzt. Genuss ist so unmittelbar und echt und wahr wie Schmerz, aber er tut halt nicht weh. Es ist Zeit, dass wir über Genuss reden.
Wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal getan? Du musst ja nicht gleich auf die Suche nach Flødeboller gehen. Du könntest aber zum ersten Mal einen Haferbrei machen, der so gut schmeckt, dass du ihn Freunden vorsetzen kannst. Und du wirst ihn vermutlich eher Porridge nennen wollen, weil es nicht ganz so oll klingt.
Dieser Haferbrei ist auch ein kleines Lehrstück, denn in ihm kann man mit einfachen Zutaten und ohne Aufwand das erzeugen, was alle guten Gerichte ausmacht: Kontraste. Heiß und kalt, weich und hart, süß, salzig und sauer. In diesem Porridge-Rezept passiert das alles gleichzeitig. Man braucht ein paar Anläufe, um es richtig hinzukriegen (wie bei vielen Rezepten), denn der Brei soll relativ fest sein, nicht zu flüssig, nicht zu schleimig. Die Menge der Milch spielt eine Rolle und wie lange man den Brei abkühlen lässt. Vor allem aber hängt das Ergebnis von den Haferflocken ab. Wenn man feststellt, dass Haferflocken nicht gleich Haferflocken sind, bekommt man Respekt selbst vor den einfachsten Zutaten. (Die für »Haferschleim« gedachten Flocken sind für dieses Rezept ungeeignet. Man kann sich gegen übermäßige Schleimigkeit auch behelfen, indem man einen Teil des Hafers gegen Buchweizen austauscht.) Das Salz muss grob sein, damit es den Crunch hat, der dem Gericht sonst fehlt. Die Butter muss kalt sein, damit es einen schönen Kontrast zu dem heißen Brei gibt, auf dem sie beim Essen langsam schmelzen kann. Das Rezept braucht keinen Zucker, weil der Ahornsirup in den Brei einsickert. Der Zitronensaft verhindert, dass das ganze zu süß wird. Eine einfache, runde Sache. Das Rezept basiert auf dem Oatmeal des Cafés »The Shop« in Providence, Rhode Island (USA). Probiere diesen Haferbrei jetzt aus und thank me later.
Haferbrei
Für eine Portion: 70 Gramm Haferflocken mit 150 Milliliter kochender Vollmilch übergießen, 5 Minuten zugedeckt stehen lassen. Dann Zimt und etwas Zitronensaft einrühren, zum Schluss 20 Milliliter Ahornsirup, ein Stück kalte Butter und etwas grobes Salz draufgeben, fertig.
Du schließt die Augen oder du rollst die Augen, du schüttelst den Kopf, weil es so gut ist. Du wirst dich fragen: warum erst jetzt? Und du wirst etwas zum ersten Mal gemacht haben, nämlich einen richtig guten Haferbrei. Es ist nur Haferbrei, aber was für einer! Nicht schlecht für den Anfang, oder?
2. Genuss für alle: Wie wir schleichend zu Gourmets (gemacht) werden
Warum es in Discountern immer mehr Feinkost gibt, wozu uns die Lebensmittelindustrie erziehen will und was das mit der Dritten Kaffeewelle zu tun hat. Plus: Ein Rezept für den besten Käsetoast
Wer den Animationsfilm »Ratatouille« gesehen hat, kennt die Schlüsselszene, in der das titelgebende Gericht (gekocht von einer Ratte!) einem übellaunigen Restaurantkritiker das Herz erweicht. Es erinnert ihn an seine Kindheit auf dem Land, an seine Mutter. So in etwa muss man sich die suggestiven Gerichte im Margaux vorstellen, einem Berliner Feinschmeckerlokal mit Michelin-Stern, das es nicht mehr gibt. Der Besitzer und Chefkoch Michael Hoffmann war Überzeugungstäter. Vor etwa zehn Jahren wollte er neben einem traditionellen Menü mit feinem Fleisch und Hummer ein vegetarisches Menü anbieten. Zum gleichen Preis. Aus Prinzip. Es lief aber nicht. Kaum jemand will über 100 Euro für ein Gemüsemenü bezahlen. Hoffmann führte daraufhin ein Mittagsmenü ein, zu absoluten Spottpreisen für ein solches Restaurant: 15 Euro für den ersten, zehn Euro für jeden weiteren Gang. Damals konntest du also im Herzen Berlins drei Gänge einer der besten Küchen der Stadt, vielleicht des Landes, essen – für 35 Euro. So billig bekam man nirgends Sterne-Essen.
Ich habe Hoffmanns Harakiri-Mittagsmenüs mehr als einmal gegessen. Wie der provenzalische Gemüseeintopf aus dem Film hatten die stärkste Wirkung die Gerichte, die sich um irgendein Gemüse, eine Knolle, ein Kraut oder einen Pilz gedreht haben. Zum Beispiel ein unscheinbares Mousse aus Pilzen und Bergpfirsich. Ich weiß leider nicht mehr, welche Pilze das waren, aber diese Speise hat etwas mit meinem Gehirn gemacht. Es hat mich an etwas erinnert, was ich noch gar nicht erlebt hatte. Oder wenigstens nicht bewusst. Ich hatte den Löffel noch im Mund und da lag es mir auf der Zunge, wortwörtlich, ich erinnerte mich, ich wusste nur nicht, woran. Es gibt Momente, da leistet die Spitzenküche Metaphysisches. Ihre besten Gerichte sind gleichzeitig Feiern des Erfindungsreichtums und Messen der Empfindsamkeit. Und natürlich sind solche Erlebnisse selten und das müssen sie auch sein. Die spektakuläre Wirkung stellt sich selbst in den besten Restaurants beileibe nicht immer ein. Aber wir haben begonnen, etwas aus dieser Küche, aus diesem Zugang, in den Alltag zu übernehmen. Und das aus zwei überraschenden Gründen.
1968 verlangte der US-Literaturwissenschaftler Leslie Fiedler in einem berühmten Aufsatz: »Cross the border, close the gap« (»überquert die Grenze, schließt die Lücke«). Fiedler wollte die Trennung zwischen Unterhaltungs- und Hochkultur einreißen, er wollte ein Ende der Hierarchisierung in der Kunst. Wir sind auf einem guten Weg, wenn auch an einer von Fiedler vermutlich nicht gemeinten Baustelle: der Gastronomie. Die spannendsten kulinarischen Entwicklungen finden nämlich in dem vormaligen Niemandsland zwischen Alltagsessen und Spitzenküche statt.
Margaux-Chef Hoffmann hat es schon 2013 im Berliner Stadtmagazin Zitty beschrieben: »Private Kochclubs und Salons, temporäre Pop-up-Restaurants oder der Street-Food-Market in der Markthalle Neun – alle haben eine hohe Qualität. Man muss also nicht mehr unbedingt ins Sterne-Restaurant gehen, um ein tolles kulinarisches Erlebnis zu haben.«
Die Markthalle Neun in Berlin-Kreuzberg ist der Apple Store unter den Wochenmärkten. Nicht Omas schlurfen auf der Suche nach Mirabellen durch die Gänge, es sind die beairmaxten zugezogenen Mittdreißiger, die hier ihr Agenturgehalt raushauen. Die Produkte kommen aus der Region, aber die Händler und Hersteller von überallher. Ja, hier wird noch selbst gebacken, aber der Bäcker heißt Alfredo Sironi und sein Brot ist aus Nudelteig. Am Barbecue-Stand schmurgelt Duroc-Bioschwein im Räucherofen, die Kundschaft bestellt auf Englisch. Und die Kreuzberger Markthalle ist nicht die einzige ihrer Art. Auch Streetfood-Märkte und Foodtrucks, bei denen man nicht mehr nur Currywurst kriegt, bezeugen das gestiegene Interesse an guter Küche – unter Umgehung klassischer Gourmetattribute wie Silberbesteck und Kristallgläsern. Und zu deutlich niedrigeren Preisen.
Wer all das als Hauptstadt-Hipsterscheiß abtut, übersieht womöglich, dass sich die gleiche Entwicklung auch in den Supermärkten vollzieht. Ende der Nullerjahre startete Rewe seine gehobene Produktreihe »Feine Welt«, die mittlerweile sogar Kaufland kopiert hat (»K-Exquisit«). Wie selbstverständlich gibt es bei Aldi Serranoschinken und Crème brûlée. Der Wettbewerb unter den Discountern wird mittlerweile eine Etage weiter oben geführt: Man will die Kundschaft gewinnen, die Neues ausprobieren möchte und gewillt ist, dafür mehr zu bezahlen. Ein Grund dafür sind die »Verfeinerungsstrategien«, mit der die Lebensmittelindustrie ihre Kund:innen erzieht.
Wie rechtfertigt eine Marke, dass ihr Produkt besser (und teurer) ist als ein anderes? Geschützte Herkunftsangaben wie Parmaschinken und Nürnberger Lebkuchen spielen hier eine wichtige Rolle. Oder es geht um ein aufwendigeres Herstellungsverfahren (mit Sauerteig!), eine umweltbewusstere Herstellungsweise, faireren Handel. Besonders hochwertige Produkte sind gar nicht im Supermarkt erhältlich, sodass speziell geschultes Personal die Herstellung des Produkts erläutern und auf die Besonderheit des Geschmacks hinweisen kann (man denke an Weinhandlungen oder kleine Kaffeeröstereien, dazu gleich mehr). Der Marketingprofessor Franz Liebl sagt, dass die auf diese Weise gegebene Orientierung nahtlos in Erziehung übergeht. Industrie und Handel erziehen sich ihre Kundschaft. Anstatt den Verbraucher:innen nach dem Maul zu reden, ist es für Liebl durchaus legitim, ihnen zu sagen, was für sie gut und richtig ist. Auch wenn sie das erstmal nicht verstehen. Auch wenn es polarisiert. Diese extreme Form der Orientierung reduziert die Komplexität, die heutige Verbraucher:innen fertigmacht. Andererseits schafft sie Exklusivität, sie ist kostenlose Nachhilfe in Acquired Taste, das heißt in erworbenem Geschmack. Irgendwann will man die billigen Sachen dann einfach nicht mehr, so die Hoffnung der Branche, und verschmäht womöglich gar den Supermarktkaffee, der meist ein Verschnitt verschiedener Sorten ist, zugunsten sortenreiner Kleinauflagen von namentlich bekannten Kaffeebauern. Anders gesagt: Wenn deine Eltern aus dir keinen Kaffeesnob gemacht haben, macht das jetzt eben die Industrie.
Überhaupt, Kaffee. An kaum einem anderen Alltagsprodukt lassen sich die Verfeinerungsstrategien der vergangenen Jahre besser ablesen. Kaum ein Viertel, in dem nicht zuletzt ein Café mit ernst dreinblickendem Barista aufgemacht hat. (Auch ein