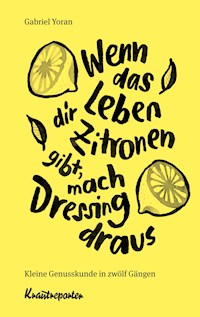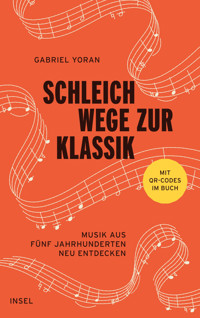
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Insel Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sieben Jahre Klavierunterricht, zwei Musikprofis als Eltern und trotzdem hat Gabriel Yoran klassische Musik lange nicht interessiert. Bis er seinen eigenen Zugang gefunden hat: Streaming statt Konzertsaal, weniger bekannte Werke statt der immer gleichen großen Namen, persönliche Metaphern statt komplizierter Theorie. Nun nimmt uns Gabriel Yoran mit auf seine Schleichwege zur Klassik.
Wieso wir Dirigent:innen immer ins Gesicht schauen sollten, weshalb Kissen mal zum Konzertsaal gehörten, was das schrulligste Instrument des Orchesters ist und warum man von Musik Gänsehaut bekommt. Mit diesem Buch – inklusive über 100 Musikbeispielen zum Streamen direkt über QR-Code – schlägt die Welt der klassischen Musik ganz neue Töne an.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 149
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Cover
Titel
Gabriel Yoran
Schleichwege zur Klassik
Musik aus fünf Jahrhunderten neu entdecken
Insel Verlag
Impressum
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
eBook Insel Verlag Berlin 2024
Der vorliegende Text folgt der Erstausgabe, 2024.Korrigierte Fassung, 2025.
Originalausgabe© Insel Verlag Anton Kippenberg GmbH & Co. KG Berlin, 2024
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung und Illustrationen im Innenteil von Christoph Rauscher, Berlin, unter Verwendung von Noten aus dem »Musikalischen Opfer« von Johann Sebastian Bach, 1747
eISBN 978-3-458-78138-7
www.insel-verlag.de
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Vorspiel
1
Warum Sie heute in die Welt der Klassik einsteigen sollten
2
Was Sie über Klassik nicht wissen müssen
3
Acht Stücke für Ihren Einstieg in die klassische Musik
1
Reinplatzen mit Bach
2
Herauswachsen mit Haydn
3
Hinauszögern mit Schubert
4
Verkorkste Kindheit mit Mahler
5
Gleich geht’s los mit Bacewicz
6
Rhythmus mit Adams
7
Jetzt sind Sie dran: Un-suk Chin
8
Eine schwierige Aufgabe meistern mit Bach
Zwischenspiel
:
Den Song mag ich!
4
Komponiert heute noch jemand klassische Musik? Allerdings!
Zwischenspiel
:
Die Sprache der Geliebten
5
Der Tod der Musik, wie wir sie kennen
Zwischenspiel
:
Maßgebliche Gefühle
6
Die Einsamkeit der Harfenistin
Zwischenspiel
:
Die liebliche Gegenwart
7
Eine ganz kurze Geschichte der Filmmusik
Zwischenspiel
:
Man will das nicht gut finden
8
»Wo man nur noch in Tönen atmet«
Zwischenspiel
:
Ein Gottesdienst aus Samples
9
Auf der Suche nach der ergreifendsten Musik aller Zeiten
Zwischenspiel
:
Das ist zu einfach
10
Musik für die Krise, Musik gegen die Krise
Zwischenspiel
:
Die Leute wollen einen echten Cramer!
11
Die Klassik-Formel
Nachspiel
:
Die wichtigen Fragen des Lebens
Danksagung
Register
Fußnoten
Informationen zum Buch
Vorspiel
Als ich neun war, kamen meine Eltern monatelang ungewöhnlich spät von der Arbeit nach Hause. Sie waren dann jedes Mal völlig erledigt und ächzten nur: »Mahler!« Das musste etwas wirklich Schlimmes sein, dachte ich mir damals, »Mahler«.
Meine Eltern waren Profimusiker im Radio-Sinfonie-Orchester Frankfurt (heute HR-Sinfonieorchester). Meine Mutter ist Harfenistin, mein Vater Cellist. Und damals hat das Orchester alle zehn Sinfonien des österreichischen Komponisten Gustav Mahler auf CD aufgenommen. So ein Projekt dauert Monate, vielleicht Jahre, und es geht an die Substanz.
Ich komme zwar aus einer Musikerfamilie, fand aber selbst erst spät zur klassischen Musik. Ich weiß, wie es ist, diese Musik nicht zu verstehen. Nach sieben Jahren widerwillig absolviertem Klavierunterricht haben meine Eltern entnervt aufgegeben: Du musst nicht mehr zum Unterricht gehen, haben sie gesagt. Aber wenn du jetzt aufhörst, wirst du es bereuen. Ich war vierzehn. Natürlich habe ich aufgehört, und natürlich habe ich es bereut.
Denn heute ist das Entdecken von klassischer Musik, auch jenseits der großen Namen, eines meiner Hobbys: Ich empfehle seit Jahren mehr oder weniger unbekannte Stücke auf Social Media. Und ich schreibe kleine Assoziationen dazu, die vielleicht helfen, einen Zugang zu der Musik zu finden. Nachdem ich darauf lange meist keine Reaktion bekommen hatte, änderte sich das schlagartig im Sommer 2018. Mehrere Leute baten mich um Playlists, über die sie einen Einstieg in die Klassik finden konnten. Diese vielfach geteilten Playlists wiederum führten zu dem Angebot des Onlinemagazins Krautreporter, eine kleine Einführung in die Welt der Klassik zu schreiben. Aus einem Artikel wurde eine ganze Reihe und daraus 2020 das Buch »Klassik verstehen«. Seit 2021 setze ich meine sehr subjektive Art der Musikvermittlung in dem persönlicheren Newsletter »Schleichwege zur Klassik« fort.
Ich bin kein Musikpädagoge, kein gelernter Musikvermittler, habe aber durch meinen frühen Kontakt mit der Klassikwelt keine Berührungsängste mit Konzertsälen und Opuszahlen. Gleichzeitig weiß ich, wie nervig es sein kann, zu etwas gezwungen zu werden, was man nicht mag, wie sich die Klassikszene selbst ein Bein stellt mit ihren Hörgewohnheiten, und da ich ziemlich genau nachzeichnen kann, wie ich von völligem Desinteresse zu großer Begeisterung kam, unternehme ich ebendiesen kleinen Versuch, anderen in diese Welt hineinzuhelfen. Und das geht natürlich nur mit der Musik selbst.
Deshalb habe ich die Texte in diesem Buch um Musikbeispiele herum geschrieben. Um sie anzuhören, richtet man einfach das Smartphone auf die QR-Codes. Dafür braucht man keine spezielle App, die normale Kamerafunktion reicht. Meist öffnet sich dann YouTube, so dass man kostenlos in die Musik reinhören und oft sogar dabei zuschauen kann, wie sie gemacht wird. Sollte ein Link kaputt sein, freue ich mich über eine Nachricht an den Verlag, wir können das dann korrigieren.
1Warum Sie heute in die Welt der Klassik einsteigen sollten
Warum ausgerechnet klassische Musik? Klassik ist doch Alte-Leute-Musik, heißt es, ein steifes, elitäres Unterfangen und sterbenslangweilig. Die Klassikszene bedient sich einer verrückten Geheimsprache, und wenn man nicht weiß, was Allegro, Adagio und Sonate bedeuten, wenn man mit Opuszahlen und Tonarten nichts anfangen kann, dann kann man es auch gleich lassen.
Ist Klassik nicht das, was einem schon als Kind im Musikunterricht ausgetrieben wird? Peter und der Wolf, Peter und der Wolf, noch ein Peter, noch ein Wolf. Klassik ist auf jeden Fall das, wo man nicht weiß, ob man klatschen darf oder nicht. Klassikkonzerte sind schweineteuer, und die Musik ist völlig überholt. Außerdem haben Sie keine passenden Klamotten. Und dies sind nur einige wenige der Ressentiments, auf die ich gestoßen bin.
Die Klassikszene ist nicht ganz unschuldig an dieser Wahrnehmung, aber elitäres Gehabe ist kein Spezialproblem der Klassik. Fragen Sie mal Leute, die sich damit auskennen, ob dies oder das noch Hip-Hop ist oder schon Pop. Die werden Ihnen auch was erzählen. Die Grenzen zwischen den Genres werden überall streng bewacht. Das Kennergehabe ist im Techno mindestens so schlimm wie in der Klassik, und die Türpolitik ist in jeder Provinzdisco strenger als in der Philharmonie.
Dennoch ist die Klassik kein Breitensport. Wer sie hört, hat einen höheren Bildungsabschluss als der Durchschnitt und verdient im Schnitt mehr. Der Zusammenhang ist relativ klar: Klassik hören kostet Zeit. Man kann es schlecht nebenher machen, zumindest nicht so richtig. Wer wegen Arbeit und Familie also kaum Freizeit hat, wer also keine Muße aufbringen kann, wird es schwer haben mit der Klassik.
Dennoch: Es war noch nie so aufregend, einfach und günstig wie heute, einen Einstieg in die klassische Musik zu finden. Denn heute kann man sich für rund zehn Euro im Monat durch praktisch die gesamte Musikgeschichte hören. Und das überall. Dank Smartphone und Musikstreaming steht eine ganze Welt offen.
Mit dem Siegeszug von MP3, der mit der Sharingplattform Napster Ende der 1990er begann, bekam ich plötzlich Zugriff auf Musik, die zwar eindeutig für Sinfonieorchester geschrieben war, aber die Namen der Komponisten – und Komponistinnen! – sagten mir nichts. Wie konnte das sein? Konfrontierte ich meine Eltern mit den Fundstücken, waren die Reaktionen meist die gleichen: Ich erfuhr im Wesentlichen, bei wem der Komponist »gefrühstückt«, also abgeschrieben hat. Warum das nur ein »Epigone« Mozarts war, also eine wenig talentierte Copycat. Warum man dies oder das »zu Recht« nicht kennt. Der einzige Zugang, den meine Eltern zu der Musik haben, die sie noch nicht kennen, ist durch den – meist abschätzigen – Vergleich mit dem, was sie schon kennen. Alles andere ist entweder »noch vor Bach«, »ein Schüler Beethovens«, »im Stile von Wagner« und so weiter. Nichts kann für sich stehen, alles ist in Wirklichkeit immer auf etwas anderes bezogen. Die Klassiker der Klassik sind sozusagen so klassisch, da kann nichts mithalten. Was natürlich nicht stimmt.
Barbara Hallama, die für iTunes, Google Music und Klassik Radio gearbeitet hat, sagt, dass wir früher erst von neuer Musik gelesen und sie dann angehört haben. Wir haben CDs gekauft und dann lange das Cover angeschaut und das Booklet gelesen, bevor wir überhaupt irgendwo waren, wo man sie abspielen konnte. Heute ist es umgekehrt: Sie können auf Streamingdiensten Musik entdecken, ohne irgendetwas über die Künstler, das Genre oder sonst etwas wissen zu müssen.
Empfehlungsalgorithmen machen es möglich. Erst im Nachhinein können Sie sich die Hintergründe anlesen, weitere Stücke aus derselben Feder entdecken, Hörhilfen in Anspruch nehmen und so weiter. Das Musikstreaming macht, dass tatsächlich die Musik wieder im Vordergrund steht und weniger ihr sozialer Kontext, die Distinktionsakrobatik der Leute, die in den jeweiligen Genres die Meinungen machen, oder die Verwertungsinteressen der Musikindustrie.
Sie können sich heute allein auf das konzentrieren, was Klassik so besonders macht: Es gibt wahrscheinlich keine menschliche Regung, kein noch so zartes oder starkes Gefühl, das nicht in die Form klassischer Musik gebracht worden wäre. Oder anders gesagt: Es gibt wahrscheinlich nichts, was Sie nicht irgendwo in der klassischen Musik wiederfinden können.
Aber: Einfach nur durchs Zuhören erschließt sich die klassische Musik nicht. Die romantische Vorstellung, Musik sei eine universelle Sprache, die jeder versteht, ist falsch. Berthold Seliger schreibt in dem 2017 erschienenen Buch Klassikkampf: »Hören wir uns sakrale Flötenmusik aus Neuguinea an oder haitianische Voodoo-Ritualmusik, oder den aserbaidschanischen Mugham eines Alim Qasımov. Verstehen Sie diese ›Sprachen‹?« Seligers Fazit ist ernüchternd: »Jedes Kind weiß, dass man eine Sprache lernen muss, dass man eine Sprache nicht ohne Weiteres versteht.«
Musik ist eine Sprache, die man lernen muss – wenn sie überhaupt eine Sprache ist. Und bei klassischer Musik gilt erst recht: Das Hören muss man lernen.
2Was Sie über Klassik nicht wissen müssen
Die Darstellung von klassischen Musikern im Film ist häufig eine Katastrophe. Meist sind es wahnsinnige Typen mit wehendem Haar, die nur die Kunst kennen und sich im echten Leben nicht zurechtfinden. Auf Profiniveau zu musizieren, ist aber in erster Linie sehr viel Arbeit. Vormittags Orchesterproben, nachmittags daheim üben und dann mehrmals die Woche abends Konzert. Die Berufskrankheiten sind schmerzhaft, denn die Arbeitsgeräte sind keine ergonomischen Glanzleistungen. Und wenn man Jahrzehnte neben den Posaunen, Hörnern und Trompeten auf der Bühne sitzt, ist zumindest ein Ohr irgendwann nicht mehr zu gebrauchen.
Und Musik nur zum Spaß hören – das können Profimusiker oft auch nicht mehr. Meine Eltern zählen mit, warten angespannt auf ihren Einsatz – selbst wenn da nur irgendeine Opernaufnahme in einem italienischen Lokal läuft. Musik hören von CDs oder Schallplatte hieß bei uns daheim »Musik abhören«, das sagt schon einiges. Diese sehr merkwürdige Arbeit, bei der du mit rund hundert Leuten stundenlang auf Bruchteile von Sekunden und vor Publikum immer perfekt abliefern musst – das hinterlässt Spuren.
Wenn es schon für die Profis schwer ist, wie sollen Laien da klarkommen? Tatsächlich ist die Frage, wie man den Weg in die Klassik ebnen kann, erst seit ein paar Jahren in Deutschland ein größeres Thema. Ein Grund dafür: Klassik bedeutete die längste Zeit auch Klasse. Ein furchtbarer Dünkel, ein nerviges Gewese um das Wesen dieser Musik. Als etwas, das sich einem entweder erschließt oder eben nicht. Als etwas, das man nicht vermitteln kann, wenn man da nicht reingewachsen ist. Die Klassik wird in Deutschland auch E-Musik oder Ernste Musik genannt (im Gegensatz zur U-Musik, der Unterhaltungsmusik). Diese Begriffe waren als GEMA-Tarifstufen entstanden, sind ziemlich verstaubt und nicht sehr hilfreich, aber ihre schiere Existenz verweist auf ein historisches Problem bei der Vermittlung klassischer Musik in Deutschland: das starke Bedürfnis, Linien zu ziehen, abzugrenzen. Zu sagen, was und wer dazugehört und was und wer nicht. Kein Wunder, dass viele Leute Klassik für eine Geheimwissenschaft halten.
Aber das soll uns jetzt egal sein.
http://kraut.re/VnY1Tatsächlich sind viele vom Bildungsbürgertum als Tradition hochgehaltene Kulturtechniken relativ jung. Die Musealisierung der klassischen Musik gehört dazu.So hat man erst im 19.Jahrhundert angefangen, in andächtiger Stille im Konzert zu sitzen. Davor waren Konzerte mehr oder weniger wilde Veranstaltungen , während derer geredet, gegessen oder mit Kissen geworfen wurde. Der Konzertsaal selbst ist eine Erfindung des 19.Jahrhunderts!
Und in ein Konzert zu gehen, muss nicht teuer sein. Popkonzerte sind im Schnitt viel teurer, zumindest in Deutschland, wo viele klassische Orchester bezuschusst werden. Es gibt wohl kein Land auf der Welt, wo man so gute Orchester und Ensembles so günstig hören kann wie in Deutschland. Und man muss meist nicht mal weit anreisen, denn es gibt fast überall Orchester. Die besten Musikschaffenden der Welt kommen nach Deutschland, weil es für sie das Gelobte Land ist. Und außerdem gibt es http://kraut.re/eBmuin letzter Zeit immer mehr informelle Konzerte, an ungewöhnlichen Orten, draußen, und natürlich (wie meist) ohne Kleiderordnung. In den Niederlanden kommt eine App namens Wolfgang zum Einsatz, die einem im Konzert live zur Musik anzeigt, was da gerade passiert. Und es gibt die Veranstaltungen professioneller Musikvermittler wie Arno Lücker. Er moderierte acht Jahre lang die Reihe »2×hören« am Konzerthaus Berlin. Dort werden Stücke zweimal gespielt und dazwischen eine knappe halbe Stunde darüber gesprochen. Lücker sagt, man sehe dem Publikum die gesteigerte Intensität beim wiederholten Anhören förmlich an. Und genau darum geht es: die Intensität des Zuhörens zu vergrößern.[1]
Was ich mit »Intensität des Zuhörens« meine? Ich kann gut nachvollziehen, wenn jemand sagt: Klassik finde ich langweilig. Natürlich ist etwas langweilig, das man nicht versteht. Was ist langweiliger als ein Buch in einer fremden Sprache? Und wenn ich mir hundertmal einen altaramäischen Text anschaue, wird er sich mir nicht erschließen. So ähnlich ist das mit der klassischen Musik. Wie soll man zu etwas eine intensive Beziehung aufbauen, das man gar nicht versteht?
Dazu kommt die vorherrschende Überzeugung, man müsse in einem klassikaffinen Haushalt groß geworden sein, um den Zugang zu bekommen. Aber das stimmt nicht: 43Prozent derjenigen, die heute klassische Musik hören, hatten als Kind gar keinen Kontakt dazu.
http://kraut.re/7G02http://kraut.re/3dSrhttp://kraut.re/abw9Studien belegen steigende Konzertbesucherzahlen . Und in der repräsentativen Umfrage der Zeitschrift Concerti aus dem Jahr 2016 antworteten 31Prozent der Befragten, dass sie klassische Musik »sehr gern« oder »auch noch gern hören«. Das kann natürlich auch einfach heißen, dass sie nicht sofort weiterskippen, wenn im Autoradio auf Klassik Radio der Imperial March aus Star Wars läuft. Und nichts gegen Star Wars! Filmmusik ist für viele der erste Berührungspunkt mit sinfonischer Musik, also Musik, die von einem rund hundert Personen starken Sinfonieorchester gespielt wird. Filmmusik ist zwar keine klassische Musik, aber ohne sie klänge auch Filmmusik ganz anders.
http://kraut.re/e88aTatsächlich sind die bekanntesten Filmmusiken meist Variationen romantischer und spätromantischer Musik. Klassische Musikerinnen und Musiker blicken deshalb manchmal etwas verächtlich auf Filmmusik, weil es oft Rip-offs sind. Wie viel von John Williams ist eigentlich Wagner, Korngold, Chopin oder Tschaikowski? Ziemlich viel .
http://kraut.re/bkwJVor allem aber hat Filmmusik mehrere unfaire Vorteile gegenüber der Klassik: Sie wird mit den besten Musikvideos ausgeliefert, die wir kennen, nämlich Kinofilmen. Wir denken, Filmmusik macht, dass wir uns gruseln oder uns freuen oder mit den Helden und Heldinnen mitfiebern. Aber ich glaube, es funktioniert andersrum: Filme machen, dass wir wissen, was wir bei der Musik empfinden sollen. Die Marimba-Akkorde am Anfang von American Beauty – beim ersten Sehen des Films bedeuten sie noch nicht viel, aber wenn wir den Film kennen und die Musik erneut anhören, werden die Bilder vor unserem inneren Auge wieder lebendig und mit ihnen die Konflikte, der Witz, das ganze Drama. Wir wissen dann, was wir fühlen sollen, woran wir uns erinnern sollen. Aber in der Klassik, wie soll das da gehen? Es gibt meist keine Handlung, keine Geschichte, in Konzerten meist auch keinen Gesang.
Ein Musikvideo würde sicher helfen, aber die gibt es nur selten und auch nur für einige wenige Superstars, die bei den großen Labels unter Vertrag sind. Man kann sich aber behelfen. Ich habe das durch Zufall herausgefunden. Was hilft, ist ein Satz, eine Formulierung.
Bei mir lief das so: Irgendwann zitierten meine Eltern beim Abendessen ihren damaligen Chef, den Dirigenten Eliahu Inbal, der bei einer Orchesterprobe sagte: »Bei Mahler guckt selbst bei den schönsten Stellen der Teufel um die Ecke.« Dieser Satz wurde mein Schlüssel erst zur Musik Gustav Mahlers und dann zur gesamten klassischen Musik.
Mahler gehört eigentlich nicht zur Klassik im engeren Sinn. Die (Wiener) Klassik ist in der Musik eine Epoche von ungefähr 1780 bis 1825. Danach begann die Romantik. Es sind zwei aufeinanderfolgende kunstgeschichtliche Epochen. (Es gibt diese Epochen auch in der Literatur und der Malerei, wo sie absurderweise zeitlich anders liegen, aber das ist eine andere Geschichte.) Mahlers Musik spielt am Übergang zwischen Spätromantik und Moderne, fast hundert Jahre nach dem Höhepunkt der Klassik.
Wer also sagt, Klassik ist vorbei, der hat auf eine Art Recht. Tatsächlich gibt es diesen Gedanken, es passiert da nichts mehr, weil schon alles gesagt ist. Nicht wenige klassisch ausgebildete Musikprofis glauben tatsächlich, dass alle Harmonien, alle Melodien, die wir in Europa als schön empfinden, bereits Anfang des 20.Jahrhunderts komponiert worden waren.
Ob das stimmt, lässt sich nicht sagen. Aber es gab zu diesem Zeitpunkt ein starkes Bedürfnis in der europäisch geprägten Musikwelt, etwas anderes zu machen. Es gab diese Phasen immer wieder in der Geschichte der klassischen Musik, aber was etwa ab 1908 passiert ist, erschließt sich den meisten Zuhörenden auch heute nicht ohne Weiteres.
Grob gesagt nennt sich diese Musik, die wir verstehen und die die meisten Zuhörenden irgendwie nachvollziehen können, inklusive der Popmusik, tonale Musik. In der tonalen Musik haben wir meist ein Gefühl dafür, wie ein Stück weitergeht. Das ist so, weil in der tonalen Musik bestimmte Töne wichtiger sind als andere, die Musik will förmlich dorthin, sie will »nach Hause«.
http://kraut.re/c8WPEs gibt jahrhundertealte Regeln dafür, wie Harmonien (also die Zusammenklänge bestimmter Töne) sich entwickeln müssen. Diese Regeln haben Komponisten im 20. Jahrhundert zu brechen begonnen. So erfand