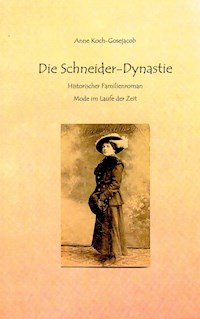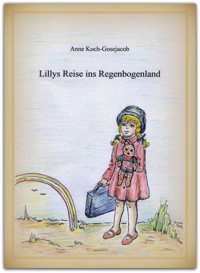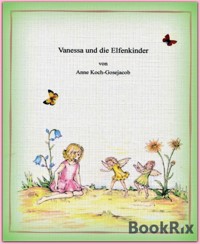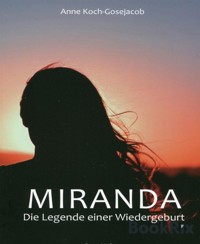2,49 €
Mehr erfahren.
Die Tochter, selber inzwischen Rentnerin, wird plötzlich vor die Aufgabe gestellt, ihre an Demenz und Parkinson erkrankte Mutter zu pflegen und sie bis zu ihrem Tod zu begleiten.
Konflikte und Probleme machen allen Familienangehörigen zu schaffen. Psychischer Druck und Aggressivität der Mutter verletzen, unerwartete Nähe ist beglückend.
Wer ist die Frau, die ihre Mutter ist? Die Tochter versucht, dies in kurzen Rückblenden und Geschichten zu ergründen.
Ein Buch, in dem sich viele Menschen, die in vergleichbare Situation geraten sind, wiedererkennen werden. Ihnen wird das Buch Orientierungshilfe sein, die Verfassung des Erkrankten, aber auch von sich selber und anderen Familienangehörigen zu verstehen.
Bewusst ist es nicht als Fachbuch gehalten, vielmehr als einfühlsamer Erzähltext geschrieben, in dem sich die unterschiedlichen Gefühls- und Erlebniswelten spiegeln und so verstanden werden können.
Für Betroffene ist diese Geschichte über Demenz und Parkinson vielleicht ein bisschen tröstlich, für Außenstehende sollte sie ein bisschen aufklärend wirken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Wenn die Dämmerung den Tag umfängt
Mit einem Vorwort der Deutschen Parkinson Vereinigung e.V.
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort
Deutsche Parkinson Vereinigung e. V., Bundesverband
Parkinson, eine Diagnose, die sicherlich viele Menschen zunächst einmal in Ratlosigkeit und in damit verbundene Ängste stürzt. Eine Diagnose, die im Hinblick auf die Aussage ‚Unheilbar’ ohne nähere Kenntnisse um Therapiemöglichkeiten Patienten verzagen lässt und auch bei den Angehörigen tiefe Ängste hervorruft.
Dennoch hat die Diagnose heute vieles von ihrem Schrecken verloren. Dank enormer medizinischer Fortschritte ist es gelungen, die Symptomatik dieser Erkrankung sehr positiv beeinflussen zu können und damit auch den Patienten einen Teil ihrer Lebensqualität, aber insbesondere auch ihres Lebensmutes wieder zurückzugeben. Viele Patienten finden dabei individuelle Wege, sich mit ihrer persönlichen Diagnose auseinanderzusetzen und neben einer rein medikamentösen Therapie auch im persönlichen Umgang mit Hobbys Möglichkeiten zu finden, der Erkrankung die Stirn zu bieten. Das vorliegende Buch bietet hierzu Raum, sich auch auf rein persönlicher Ebene dieser Diagnose zu nähern und damit die Möglichkeit zu bekommen, für sich persönlich als Patient, aber auch als Angehöriger Wege im Umgang mit dieser Krankheit zu finden.
Gleichzeitig liefert das Buch Anregungen, sich intensiv mit Diagnose und Therapieoptionen auseinanderzusetzen, um im Umgang mit der Erkrankung die eigenen Perspektiven abzustecken und Möglichkeiten der krankheitsbedingten Sicherung der Lebensqualität zu finden.
Wir hoffen, dass ein weiter Kreis von interessierten Patienten und Angehörigen sich durch dieses Buch angesprochen fühlt und Hilfe bei der Bewältigung der Diagnose bekommt.
RAF.-W. Mehrhoff, Geschäftsführer
Erzählgeschichte über Demenz und Parkinson
In den Tränen der Trauer
erzählt die Liebe
von unserer Hoffnung
einander wiederzusehen
„Mutter, deine weiße Bluse ist dreckig!“
„Ich weiß. Kommt morgen mit in die Wäsche.“
„Und warum isst du mittags nur noch trockene Kartoffeln mit Salat?“
„Weil es mir schmeckt. Salat ist gesund.“
Bis wir merkten, dass mit meiner Mutter etwas nicht stimmte, war schon fast ein Jahr vergangen. Ständig hatte sie passende Ausflüchte und alle erdenklichen Ausreden parat. Im Nachhinein wurde mir klar, dass sie oft die Waschmaschine nicht mehr bedienen konnte. Genauso verhielt es sich mit dem Essen. Sie hatte einfach vergessen, wie man kocht.
„Es gibt Bohnensuppe, deinen Lieblingseintopf! Willst du auch einen Teller voll?“
„Nur ein bisschen. Hab zu Hause auch gekocht. Bei uns gibt es Kassler mit Sauerkraut und Kartoffelbrei. Ist das Lieblingsessen von Burkhard.“
Burkhard ist mein Mann. Mein zweiter Mann, den Mutter widerstrebend akzeptiert hatte, da er in ihren Augen nicht den richtigen Glauben besitzt. Statt katholisch, ist er evangelisch. Ein wenig ausgleichen konnte er dies mit seinem Jurastudium, denn dadurch war er vergleichbar mit dem Pfarrer oder mit dem Doktor, zu denen man aufschauen konnte. Aus dem Küchenschrank holte ich mir einen tiefen Teller, nahm den Schöpflöffel aus der Schublade neben dem Herd, tat etwas Eintopf drauf und probierte. Es schmeckte wie Wassersuppe.
„Irgendwas fehlt an der Bohnensuppe. Hast du nicht Mettwurst oder Suppenfleisch mitgekocht?“
„Wenn du unbedingt Wurst essen willst, musst du dir ein Glas Wiener aufmachen.“
Mutter hatte tatsächlich nur Kartoffeln, Bohnen, Wasser und etwas Salz zusammen vermischt und gekocht. Als Nachtisch bot sie mir Blaubeerkonfitüre mit Dosenmilch an. Eine tolle Dessertkombination. Ich glaube, sie aß zu dieser Zeit bereits oft seltsame Zusammenstellungen oder überhaupt nichts. Das Trinken vergaß sie auch, obschon genügend Wasserflaschen bereitstanden.
Essen und Trinken bedeutet für gesunde Menschen ein Genuss, für demenzkranke Patienten aber eine Last. Hunger und Magenknurren können sie nicht richtig einordnen, vergessen zu essen. In den meisten Fällen nehmen sie dadurch – und zudem durch ihre Ruhelosigkeit, die viele Kalorien verbraucht – kontinuierlich ab. Aber das alles wusste ich zu der Zeit noch nicht.
Jetzt, bei der Rückerinnerung an diese Zeit des Umgangs mit der Demenz meiner Mutter, ist mir mein damals geführtes Tagebuch eine wichtige Hilfe. Viele Eindrücke wären sonst nicht mehr nachvollziehbar, da die emotionale Belastung in jener Zeit so hoch war, dass man selber nur noch von Tag zu Tag lebte, froh war, wieder einen Tag gemeistert zu haben.
18. Februar 2008 Das Telefon klingelte. Meine Tochter Tina war am Apparat. Sie lebte seit einiger Zeit in einem Haus, das mir gehört, und wohnte in der Parterrewohnung, Mutter in der ersten Etage. Die kleine Dachwohnung hatte ich an einen jungen Mann vermietet. Aufgeregt berichtete mir Tina: „Oma kam zu uns in die Wohnung und bat, ich solle doch mit nach oben kommen. Als wir bei ihr im Flur standen, forderte sie mich auf, ihr sofort die schwarze Geldbörse wiederzugeben. Wie ein kleines Mädchen stand ich vor ihr, und meine Stimme zitterte, als ich sagte: ‚Ich habe sie nicht genommen, Oma!’ Doch sie glaubte mir nicht. Ich habe dann in der ganzen Wohnung danach gesucht, aber die Geldbörse blieb verschwunden. Ich weiß auch nicht, wo Oma sie gelassen hat.“
„Nun beruhige dich erst einmal. Vielleicht hat Oma sie beim Einkaufen verloren. Wenn wir Glück haben, findet sie jemand. Oma hat doch immer hinten einen Zettel mit ihrer Adresse drin.“
Drei Tage später hatte Tina angeblich Mutters Schmerztabletten entwendet. Ich fuhr hin, um die Angelegenheit zu klären. Doch Mutter blockte ab, war wütend, drohte mit Auszug, fühlte sich in ihrer eigenen Wohnung nicht mehr sicher.
„Meine eigene Familie beklaut mich!“ Vorwurfsvoll sah sie mich mit Tränen in den Augen an.
„Niemand beklaut dich, nimmt dir etwas weg. Bestimmt hast du die Tabletten woanders hingelegt und findest sie nicht“, versuchte ich, sie zu beschwichtigen.
Doch sie schüttelte nur den Kopf und meinte: „Dass du immer alles besser weißt. Geh lieber, sonst reg ich mich noch mehr auf!“
Am nächsten Tag kam Mutter wieder nach unten zu meiner Tochter. Tina dachte, sie wolle sich entschuldigen. Doch weit gefehlt. Sie nahm ihre Enkelin in den Arm und flüsterte: „Ist ja nicht so schlimm, dass du die Schmerztabletten genommen hast. Ich gehe gleich zur Apotheke und kaufe mir neue.“
„Ich hab dir noch nie etwas weggenommen. Wie kannst du nur so etwas behaupten.“
Tina war natürlich aufgebracht, gleichzeitig beleidigt, dass Oma ihr so etwas unterstellte. Sie konnte mit der Situation nicht umgehen.
Fast jeden Tag hatte Mutter etwas verloren, fand es nicht wieder und verdächtigte Tina, die mich dann umgehend anrief und mir berichtete: „Heute Morgen kam Oma schon um sieben Uhr herunter, klopfte an die Tür, und als ich öffnete, fuhr sie mich gleich an: ‚Meine Scheckkarte ist weg. Wie kannst du nur eine alte Frau, die dazu noch deine Oma ist, beklauen?’ Ich ging sofort mit ihr hoch, suchte alles ab, aber vergeblich. Oma meinte, sie würde dich anrufen, denn so ginge das nicht weiter. Ich begann zu weinen, drehte mich um und ging.“
„Nimm es dir nicht so zu Herzen, Kind. Ich glaube, Oma spinnt“, versuchte ich sie zu trösten.
„Ich bin mal gespannt, wie der heutige Tag wird. Ob Oma noch mehr verlegt hat? Hoffentlich nicht. Meine Gedanken drehen sich nur noch um Oma. Dass sie dort oben lebt und meint, ich stehle ihr alles, tut ganz schön weh! Dabei habe ich gedacht, ich könnte ihr das Leben im Alter so angenehm wie möglich machen. Jedenfalls hoffe ich, dass sie wenigstens essen wird. Vielleicht kann ich nachher in den Kühlschrank schauen, ob überhaupt noch was drin ist.“
„Ich komme heute Nachmittag, suche die Sachen und werde mit Oma reden. Ist das in Ordnung?“
„Sicher, Mama.“
Mutter stritt natürlich alles ab, behauptete steif und fest, dass Tina ihr alles wegnehmen würde. Nach langem Suchen fand ich ganz hinten im Nachtschränkchen ihre Scheckkarte.
„Schau mal, was ich hier habe. Die musst du dort selber hingelegt haben.“ Schadenfroh hielt ich Mutter die Karte unter die Nase.
„Das kann nicht sein!“, entgegnete sie zornig, riss mir die Karte aus der Hand, verschwand im Wohnzimmer, warf sich in ihren Sessel und begann laut zu weinen.
All diese Symptome kamen mir schlagartig bekannt vor. Bei meiner Tante, Mutters Schwester, hatte es auch so begonnen. Kleinigkeiten, die so langsam anfingen, dass man sie zuerst nicht registrierte, nicht wahrhaben wollte. Dreimal am Tag ging Tante Marie zum Bäcker, um Brot zu kaufen. Ihre Schwiegertochter hätte die guten Tischdecken gestohlen, und ihr Portmonee mit viel Geld wäre auch plötzlich verschwunden. Mit meiner Mutter bin ich zur Tante gefahren. Wir haben die ganze Wohnung abgesucht und alles wiedergefunden. Das Portmonee hatte Tante Marie unter der Waschmaschine versteckt. Auf so ein Versteck kommt man nur zufällig. Den großen Kasten mit Waschpulver hatte ich auf die Maschine gesetzt, dabei festgestellt, dass sie kippelig stand. Daher schaute ich nach, woran es lag. Auf dem Rückweg meinte Mutter:
„Wenn ich anfange zu spinnen, sagt mir bloß früh genug Bescheid.“
Ich ahnte, nun war es so weit.
Am folgenden Sonntag lud Mutter meinen Mann und mich zum Mittagessen ein. Es gab panierte Schnitzel, Blumenkohl mit Holländischer Soße und Salzkartoffeln. Zum Nachtisch kredenzte sie richtigen Schokoladenpudding mit Schlagsahne. Doch die Schnitzel waren zäh, schmeckten nicht.
„Euch kann man es auch nie recht machen. Ihr seid einfach zu verwöhnt.“
Als ich sie fragte, wann sie das Fleisch gekauft hätte, antwortete sie eingeschnappt: „Vor 14 Tagen, und ich habe es gleich eingefroren. Zwei Schnitzel liegen noch im Gefrierfach.“
Ich stand auf, ging in die Küche und öffnete die Gefrierschranktür. Die beiden Schnitzel waren nicht in Folie verschweißt, lagen einfach flach nebeneinander im Fach und hatten Gefrierbrand. Kein Wunder, dass ihre Schnitzel trotz Sahnesoße nicht schmeckten. Mutter war mir nachgekommen, schob mich verärgert aus der Küche und schimpfte: „Neuerdings hast du an allem etwas herumzumeckern.“
Ihr Leben lang strickte Mutter für uns schöne bunte Wollsocken. Doch von heute auf morgen konnte sie sich nicht mehr erinnern, wie viele Maschen sie für den Hacken brauchte und wie er gearbeitet wurde. Sie strickte kleine viereckige Läppchen, meinte, die müssten eingenäht und die Maschen rundherum wieder aufgenommen werden.
Ich erklärte ihr, dass das unsinnig sei, wollte ihr helfen, doch sie reagierte aggressiv, wurde richtig ausfallend.
„Meinst du, ich bin blöde! Ich schaffe das schon alleine. Muss doch immer alles alleine machen.“
Entsetzt starrte ich sie an. War das noch meine Mutter? Wie konnte sie sich nur so verändern? Sie war doch stets ausgeglichen und rücksichtsvoll zu den Menschen in ihrer Umgebung gewesen.
Schon mit 22 Jahren war Mutter eine richtige Bäuerin geworden. Da keiner ihrer Brüder den elterlichen Hof wollte, übernahm sie ihn schließlich, musste ihn allein bewirtschaften.
Mein Vater, den sie im Krieg kennen und lieben gelernt hatte, war ein Schneider aus Wilhelmshaven. Als Großstädter hatte er keine Ahnung von Ackerbau und Viehzucht, wurde von meiner strengen Oma auch nie richtig anerkannt. Als Schwiegersohn hätte sie sich einen reichen Bauernsohn aus der Umgebung gewünscht. Zusätzlich enttäuscht war Oma, als ich Weihnachten 1946 im Schlafzimmer unseres Bauernhauses auf die Welt kam. Nicht mal einen Stammhalter brächte mein Vater zuwege.
Zwei Jahre später kam dann auch noch meine Schwester in der Osnabrücker Frauenklinik zur Welt. Damals lagen noch neun Wöchnerinnen auf einem Zimmer, die ungefähr zehn Tage miteinander auskommen mussten. Eingepackt in dicke Baumwolltücher schlummerten die Babys in ihren Bettchen im Säuglingszimmer, kamen nur zur Mutter, wenn sie gestillt wurden. Inzwischen sind viele Jahre vergangen. Vater ist schon gestorben. Er war immer ein fröhlicher Mann, obwohl er im Krieg seinen linken Arm verloren hatte. Alle anfallenden Arbeiten erledigte er so gut es ging.
Manchmal saß Vater mitten auf dem Küchentisch und nähte für einen der Nachbarn eine neue Jacke. Den Stoff klemmte er zwischen die Knie, so konnte er Futter und Knöpfe annähen. Sonntags überraschte er uns auch schon mal mit einem Topfkuchen, den er mit viel Mühe selbst gebacken hatte.
Nur wenn überhaupt nichts klappte, wenn Oma Anna wieder geschimpft hatte, dass er nicht mal den Garten umgraben könne, wurde er ungehalten, kam sich nutzlos und überflüssig vor, war mit sich und der ganzen Welt unzufrieden, sodass Mutter ihn trösten musste. Mutter war eine stolze, selbstbewusste Frau.
Von meiner Schwester kann man dies nicht behaupten. Bis zu ihrer Heirat war sie ein zartes, ängstliches Wesen. Wir beide sind sehr gegensätzlich. Alles, was ihr als Kind Angst bereitete, was sie hasste, fand ich interessant und aufregend.
Ich liebte unseren großen Wald: die lichten hohen Bäume mit dem sonnendurchfluteten Grün und das raschelnde Laub an trüben, nebligen Herbsttagen. Wenn die Muttertiere auf unserem Hof nachts ihren Nachwuchs bekamen, war ich stets hellwach. Neugierig sah ich zu, wie Oma den quiekenden rosa Schweinchen die ersten Zähne abkniff, um so zu verhindern, dass sie beim Saugen die Mutter bissen.
Heiß und innig liebte ich die vielen verschiedenfarbigen, wuscheligen Katzenkinder mit schwarzen Knopfaugen und Samtpfoten, die regelmäßig im Mai oder Juni geboren und oft von den Katzenmüttern versteckt wurden, damit wir sie nicht finden konnten.
Auf den Wiesen rund ums Haus roch es nach frischem Heu, nach Sonne und Freiheit und wir riefen: „Mutter, stell uns die große Zinkwanne auf die Bleiche!“ Als Kinder nutzten wir jede Gelegenheit, um nackig darin zu planschen.
Im Hochsommer duftete es im ganzen Haus nach Erdbeer- und Johannisbeermarmelade. Oma Anna kochte sie literweise. Der fertige rote Aufstrich kam in kleine und größere Einmachgläser. Zur Haltbarkeit streute Oma etwas Salizil obenauf, das Mutter aus der Apotheke im Dorf mitgebracht hatte. Dann nahm Oma das zugeschnittene runde Zellophanpapier, tauchte es in Wasser, legte das Stück über die dampfende Öffnung und spannte es mit einem Gummiband fest. Auf den sorgsam aufgeklebten Schildchen wurden der Inhalt und das Herstellungsjahr vermerkt.
Wir Mädchen halfen fleißig mit, brachten anschließend die abgekühlten Gläser in die große Vorratskammer. Dort sahen wir uns an, brachen in schallendes Gelächter aus und äfften Oma nach: „Kinder, ihr wisst doch, das neue Einmachgut kommt hinten aufs Bord. Zuerst muss der Rest vom letzten Jahr gegessen werden.“
Wenn der Herbst ins Land zog, die Tage kürzer und dunkler wurden, kroch der Duft von abgelagertem Eichenholz, das lodernd im Kamin knisterte, durchs Haus. Im Backofen brutzelten leckere Bratäpfel.
Mutter strickte warme Wollsocken, und Oma erzählte uns Kindern spannende Geschichten von früher, während Opa Ackergeräte ausbesserte. Vater half ihm dabei, gab sich redlich Mühe. Im Januar fiel gnadenlos die Kälte ins Haus ein. Es begann mit vielen bizarren Eisblumen am Fenster und klammen Federbetten. Wenn wir morgens die vereisten Fensterscheiben anhauchten, um nachzusehen, wie viel es geschneit hatte, gefror fast der eigene Atem. Ein einsames Bauernhaus, bedeckt von einer dicken, wärmenden Schneedecke.
Im März sah man die kleinen, gelben Blüten des Huflattichs an den steinigen, noch kargen Wegrändern ihren Kopf zu den ersten warmen Sonnenstrahlen hochrecken. Neues Leben begann. Viel Arbeit wartete jetzt auf Mutter. Das Pferd musste eingespannt, der Acker umgepflügt, geeggt und anschließend mit Korn eingesät werden. Vorgekeimte Früh- und Herbstkartoffeln warteten darauf, dass sie in die Erde kamen. Fast alles musste Mutter allein bewältigen, doch irgendwann schaffte sie es nicht mehr. Es musste eine Lösung gefunden werden.
Das Anwesen wurde verkauft, und wir zogen in ein neuerbautes Haus mitten im Dorf. Quadratisch, praktisch, gut. Der Kaufmann, die Kirche, die Schule, alles war in der Nähe. Alles war anders. Alles roch anders. War neu!
Irgendwann, nach vier Wochen, nach vier Monaten, schlenderte ich unbewusst, einer alten Gewohnheit folgend, den früheren Schulweg entlang. Ich spürte ein Zerren und Ziehen in der Brust, hatte Sehnsucht, Heimweh nach meinem ehemaligen Zuhause. Am Ziel angelangt, wurde ich von der älteren Bäuerin hineingebeten. Ich sah mich um. Nichts war mehr wie früher ... Keine blankgeputzten Böden, keine saubere Tischdecke, keine Blumen in der Vase.
Das zuckersüße Marmeladenbrot, das man mir anbot, wurde umschwärmt von vielen dicken Fliegen, die den langen, klebrigen Fliegenfänger verschmähten, der mitten über dem Tisch hing. Eklig!
Schlagartig war meine Sehnsucht gestillt, geheilt. Dies war nicht mehr meine Heimat. Ich begriff: Mein neues Zuhause war da, wo meine Familie, wo meine Mutter lebte.
War ich jetzt die Mutter meiner Mutter? Waren unsere angestammten Rollen vertauscht worden? Musste ich jetzt dauernd auf sie aufpassen? Ihr gutgemeinte Ratschläge geben, damit sie ihr Leben, ihren Alltag besser in den Griff bekam? Eine komische Situation, die mir so manche Nacht den Schlaf raubte.
Trotz Verbot meinerseits – konnte ich Mutter überhaupt etwas verbieten? – und ohne ihren Rollator, den sie sonst immer zum Einkaufen mitnahm, fuhr Mutter heimlich mit dem gelben Überlandbus in die Stadt.
„Was soll mir denn passieren? Wenn ich falle, heben mich die Leute schon wieder auf.“
Tolle Einstellung, und das bei starker Osteoporose! Ein paar einfache bunte Kindersocken und die neue blaue Strumpfwolle, die sie schließlich mitbrachte, gab es auch im Dorf zu kaufen.
„Die arme alte Frau musste ganz allein mit dem Bus zur Stadt fahren, dabei haben Kinder und Enkel ein Auto“, bekam ich Tage später über Umwege von den Nachbarn zu hören. Wenn ich versuchte, die Sachlage zu erklären, lächelten sie nur vielsagend.
In der nächsten Woche musste ich für ein paar Tage ins Krankenhaus. Aus einer Niere, in der sich eine winzige Verdickung befand, sollte eine Gewebeprobe entnommen und auf Krebs untersucht werden, da der behandelnde Arzt auf dem Ultraschallbild nicht erkennen konnte, ob es gut- oder bösartig war. Erforderlich für den Eingriff war eine Vollnarkose.
Am Tag zuvor besuchte ich Mutter. Freundlich begrüßte sie mich und wir gingen ins
Wohnzimmer. Ich setzte mich gemütlich in den Sessel und erwartete das Gleiche auch von ihr. Doch Mutter begann, ihre gelben Begonien und weißen Alpenveilchen auf der Fensterbank zu gießen. Zwischendurch zupfte sie welke Blüten und vertrocknete Blätter ab, brachte alles in Ordnung.
„Mutter, kannst du dich nicht für einen Moment zu mir setzen? Du weißt doch, ich muss morgen ins Krankenhaus.“ Sie reagierte nicht.
„Hast du nicht gehört, ich muss morgen ins Krankenhaus.“
„Ja, ja. Wird wohl nicht so schlimm sein. Nun stör mich nicht. Ich hab zu tun!“
Mutter beachtete mich nicht weiter, ging in die Küche und holte sich neues Gießwasser. Seltsame Reaktion! War ich für sie nicht von Bedeutung? War ich überflüssig? Was war, wenn bei dem Eingriff etwas schiefging, wenn sie mich nicht mehr wiedersehen würde? Sie war doch meine Mutter. Eine Mutter, von der ich erwartet hatte, sie würde mir Mut zusprechen und mich in den Arm nehmen. Aber wenn ihr ihre Blumen wichtiger waren – bitte sehr!
Eingeschnappt rief ich in Richtung Küche: „Ich gehe jetzt. Auf Wiedersehen, Mutter!“ Mit lautem Knall zog ich die schwere Etagentür hinter mir zu.
Sobald ich aus dem Krankenhaus kam, musste ich unbedingt mit Mutters Hausarzt sprechen. So ging das nicht weiter. Und zur Bank muss ich auch, überlegte ich. Mir war aufgefallen, dass sie in der letzten Zeit zu Geld überhaupt kein Verhältnis mehr hatte.
Jede noch so hohe Spendenanfrage wurde umgehend erfüllt. Alle möglichen Elektrogeräte, wie zum Beispiel Massagekissen oder Sprudeleinlagen für die Badewanne – eine Art Whirlpool –, ließ sie sich von fliegenden Händlern an der Haustür andrehen. Die Sachen wurden ausprobiert, einmal benutzt, als nicht brauchbar befunden und in den Keller befördert, gerieten dort nach und nach in Vergessenheit.
Mit Trinkgeldern war sie neuerdings auch sehr großzügig. Ihre Friseuse bekam vier bis fünf Euro.
„Was sind denn schon fünf Mark. Gönnst du es ihr nicht?“, entgegnete sie mir auf eine entsprechende Anmerkung.
„Die Mark gibt es schon lange nicht mehr. Und fünf Euro sind früher zehn Mark gewesen. Sonst hast du höchstens zwei Mark gegeben.“
„Mit meinem Geld kann ich machen, was ich will!“
„Sollst du auch, aber es muss Grenzen geben.“
Während ich im Krankenhaus lag, fuhr mein Mann mit Mutter zum Augenarzt, weil sie angeblich schlecht sehen konnte. Mutter fand natürlich ihre Krankenkassenkarte nicht. Die hätte ihr jemand weggenommen. Wahrscheinlich würde es einer aus der Familie machen, um sie zu ärgern. Schließlich fuhren sie ohne Karte zum Arzt. Mein Mann versprach der Arzthelferin, eine neue Krankenkassenkarte zu beantragen und sie nachzureichen. Das Testergebnis vom Arzt lautete: „Mit ihren Augen ist alles in Ordnung.“
Trotz leichter Narkose waren die Untersuchungen im Krankenhaus sehr unangenehm für mich. Eine Sonde wurde durch die Blase bis in die Niere hochgeschoben, eine winzige Probe abgenommen und ins Labor geschickt. Ob irgendwelche Bakterien oder Keime dabei in den Körper drangen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls bekam ich nach der Operation hohes Fieber, musste morgens, mittags und abends Antibiotika schlucken und eine Woche länger im Krankenhaus bleiben als geplant.
Manchmal dachte ich in jenen Tagen, ich würde das Ganze nicht überleben. Nachts konnte ich nicht schlafen, und wenn doch, dann hatte ich Albträume. Tisch und Stühle rückten Stück für Stück vor bis zum Bett. Das kratzende, schabende Geräusch auf dem Fußboden wirkte bedrohlich. Ich versuchte, aus dem Bett zu springen, aber es ging nicht. Wie erstarrt lag ich da, während sich Tisch und Stühle langsam über mich beugten. Wollten sie mich erdrücken, wollten sie mich umbringen? Ich bekam Angst, wurde von meinem eigenen Herzklopfen wach, fuhr schweißgebadet hoch, knipste die Nachttischlampe an und stellte fest, dass Tisch und Stühle auf ihrem angestammten Platz standen. Erleichtert atmete ich auf.
Doch sobald ich die Augen schloss, sah ich Gesichter vor mir. Schöne Gesichter, die sich langsam nach und nach verzerrten, zu Fratzen wurden und glühende Augen bekamen. Grauenvoll!
Unter äußerster Anstrengung öffnete ich die Augen. Das warme Licht der kleinen Lampe auf dem Nachttisch beruhigte mich allmählich. Ob ich wegen der starken Schmerzen Morphium bekommen hatte? Löste das meine Wahnvorstellungen aus? Vorerst traute ich mich nicht, die Augen zuzumachen. Ich war froh, als die Nachtschwester ins Zimmer kam und mir eine Schlaftablette brachte.
Zu den Mahlzeiten musste ich dicke Chlortabletten schlucken. Ich kam mir vor wie ein Schwimmbad im Hochsommer bei voller Auslastung.
Als ziemlich belastend empfand ich auch die vielen Telefonanrufe meiner Familie: „Oma hat dies, Oma hat das angestellt. Was sollen wir machen?“
Eigenartig, dass ich immer für alles verantwortlich sein sollte.
Als ich nach zehn Tagen wieder zu Hause war und es mir einigermaßen gut ging – der Labortest war Gott sei Dank positiv ausgegangen, kein Nierenkrebs –, bat ich um einen Termin bei Mutters Hausarzt.
Der Arzt war noch relativ jung, hatte vorher als Assistenzarzt im Krankenhaus gearbeitet. Vorsichtig deutete ich an, dass Mutter sich verändert hätte, vieles vergessen würde.
„In ihrem Alter doch völlig normal“, war die lapidare Antwort.
„Ich möchte aber, dass Sie Mutter untersuchen.“
„Gut, dann kommen Sie morgen Vormittag mit ihr vorbei.“
Widerwillig stimmte Mutter zu. Der Arzt fragte nach ihrem Geburtstag, welches Jahr wir hätten und wie spät es sei. Mutter wusste alles, wirkte völlig normal, während ich mir total deplatziert vorkam. Der Arzt verschrieb ihr Vitamin-Brausetabletten. Außerdem sollte sie viel Wasser oder frische Obstsäfte trinken. Das wäre immer gut.
Als meine Tochter ihr am nächsten Tag Mittagessen bringen wollte, sie hatte für Mutter mitgekocht, stand sie im Wohnzimmer auf der Trittleiter und putzte die Fenster. Die Gardinen wollte sie auch noch waschen, da ja bald Ostern wäre.
Tina konnte es nicht mit ansehen, nahm die Gardinen ab, steckte sie in die Waschmaschine und hängte sie auch später wieder auf. Doch statt „Danke“ meinte Mutter: „Du musst wohl sehr schlau sein, hast wieder meine Tabletten geklaut, obwohl ich sie gut weggelegt hatte. Ab jetzt brauchst du nicht mehr für mich mitkochen. Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben!“
Von den Nachbarn bekam ich zu hören: „Die arme alte Frau muss alles selber machen, und von der Enkeltochter wird sie auch noch schikaniert.“
Als ich nachhakte, stellte ich fest, dass Mutter sich bei den Nachbarn ausgeweint hatte. Wie schlecht wir doch alle zu ihr seien, und dass sie mit dieser furchtbaren Situation nicht leben könne. Sie würde ihr schönes Haus verkaufen, einen Teil der Kirche vermachen und sofort ins Altenheim ziehen. Dort würde sie garantiert anständiger behandelt.
Mit viel Geduld versuchte ich, die Angelegenheit zu klären. Aber glaubten mir außenstehende Menschen? Ich war mir nicht sicher.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: