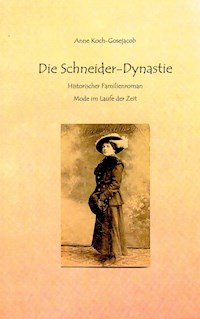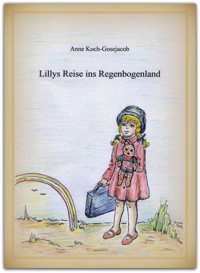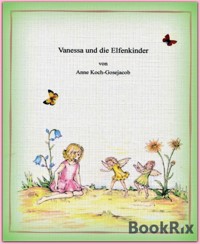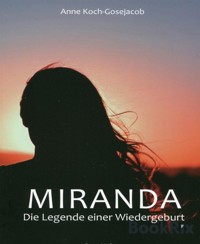2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Schöne Gedichte und viele außergewöhnliche und lustige Geschichten zu den verschiedenen Jahreszeiten, Heimatgeschichten, Liebesgeschichten, spannende Krimigeschichten und etliche Erzählungen, die leicht makaber sind, aber am Ende doch ein Lächeln auf das Gesicht des Lesers zaubern.
Ideal, um vor dem Einschlafen einen kurzen Text zu lesen, oder auch als Geschenk für viele Gelegenheiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Liebe, Mord und andere Fälle
Kurze Geschichten und Gedichte
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenGlocken
„Die Lebendigen rufen wir,
die Toten beklagen wir!“
Die alte Turmuhr am Eingang des verlassenen Friedhofs schlug zwölfmal. ‚Geisterstunde! Nein, so etwas gibt es nicht’, verscheuchte Alea ihre Ängste.
Das verrostete Eisentor quietschte, als sie es ein wenig öffnete und sich hindurchzwängte, um dann eilig die uralte Totenstätte zu durchqueren. Diese Abkürzung nahm sie nur, wenn sie den letzten Bus verpasst hatte, der sie sonst bis kurz vor die Haustür brachte. Nun, den hatte sie heute verpasst. Machte aber nichts. Am Ende des Friedhofs musste sie nur noch durch den kleinen Buchenhain gehen und schon war sie zu Hause. Ein winziges Einfamilienhaus, das sie vor ein paar Jahren von ihrem Großvater Viktor geerbt hatte.
Der leichte Nachtwind trug den silberhellen Klang einer Glocke zu ihr herüber. ‚Seltsam ... Hier gibt es doch nur die Glocke der Turmuhr auf der Friedhofskapelle … oder habe ich etwas nicht mitbekommen?’ Irritiert über den hellen Glockenklang ging sie weiter.
Manche der Gräber dieses alten Friedhofs waren zur Gänze mit Unkraut überzogen und eingefallen. Die alten Holzkreuze hingen so schief, dass man meinen konnte, sie würden jeden Moment kopfüber auf die Gräber stürzen. Der fahle Mond, der ab und zu hinter den dunklen Wolkenbergen hervorlugte, unterstrich die gespenstische Atmosphäre.
Alea hatte den Friedhof schon beinahe durchquert, als sie die Glocke ein zweites Mal zu vernehmen glaubte. Ganz fein war sie zu hören. Sie blieb stehen und lauschte, aber kein Klang war zu vernehmen.
„Ich glaube, ich spinne. Oder ich habe zu viele Caipirinhas getrunken“, murmelte sie vor sich hin. Zusammen mit ihren Freundinnen Greta, Ivonne und Nikola hatte sie in der angesagten italienischen Disco ‚La Marina‘ am heutigen Abend ihren Geburtstag gefeiert.
Doch da. Sie lauschte angestrengt in das Dunkel. ‚Da ... Da ist er wieder, dieser silberhelle Glockenton.‘ Er schien aus dem uralten Mausoleum der Grafenfamilie von Hohenkamp zu kommen, deren Nachfahren immer noch im Schloss am Stadtrand wohnten. Alea kannte sich von vielen Gängen hier auf dem Friedhof bestens aus. Wie oft hatte sie sich gerade die uralten Familiengräber schon angeschaut.
Versteckt zwischen dichten hohen Fliederbüschen schaute nur der kleine, mit grauen Schieferplatten belegte Zwiebelturm des Mausoleums heraus.
Zögerlich, Schritt für Schritt, folgte Alea dem zarten Klang, bog die dichten Büsche auseinander und sah, dass die schwere Eisentür der Grabstätte weit offen stand. ‚Soll ich weitergehen? Soll ich nicht lieber auf direktem Weg nach Hause gehen …?‘
Schließlich siegte ihre Neugierde. Im Schatten der Büsche schlich sie sich näher an die Grabstätte heran, lauschte immer wieder. Aber die Glocke schien mit einem Schlag wieder verstummt. Endlich erreichte sie die offene Eisentür. Mit angehaltenem Atem schaute sie vorsichtig in das Mausoleum hinein. Doch nichts war zu sehen. Mit tastendem Schritt betrat sie die Grabstätte. Die Neugierde vertrieb die vorhandene Angst. Durch das zerborstene Fenster an der Rückwand der Grabstätte fiel das Mondlicht direkt auf einen grauen Steinsarkophag. Sie presste die Hand vor den Mund. Warum war sie nur hierhergekommen?
Plötzlich vernahm sie ein leises, schabendes Geräusch. ‚Hatte sich der schwere Sargdeckel nicht gerade bewegt? Und hinten in der Ecke, kauerte da nicht jemand?’ Im selben Moment ertönte ein sirrendes, zirpendes Geräusch, und als etwas über ihren Kopf hinwegflog und sie dabei leicht berührte, bemerkte sie, wie sich ihr Körper mit einer Gänsehaut überzog. Sie wagte kaum noch zu atmen.
Angst gegen Neugierde. Diesmal siegte die Angst. Panikartig stürzte sie aus der Grabstätte, hetzte zum Ausgang des Friedhofs. Ihre Schritte verlangsamten sich erst, als sie den Buchenhain durchquert hatte. Sie atmete erleichtert auf, als sie unbeschadet die Haustür hinter sich schließen konnte.
Am nächsten Tag telefonierte sie mit ihrer Freundin Nikola, berichtete ihr von ihrem nächtlichen Erlebnis.
„Du hast sie doch nicht alle. Welcher vernünftige Mensch geht denn nachts über den Friedhof. Von unserem Geldgeschenk hättest du dir doch ohne Problem ein Taxi nehmen können!“, fuhr Nikola sie aufgebracht an. Doch dann lachte sie und meinte: „Du, der alte Friedhofswärter, der bei uns nebenan wohnt, hat mir neulich erzählt, dass neuerdings immer ein paar Penner im Mausoleum übernachten. Mit der Glocke geben sie ein Zeichen, damit die anderen Tippelbrüder wissen, dass das Mausoleum schon als Schlafstätte besetzt ist. Außerdem gibt es dort etliche Fledermäuse. Du weißt doch, diese verkappten Vampire, die sich in den Hals von hübschen Jungfrauen beißen und ihnen das frische rote Blut aussaugen. Als Untote geistern die armen Viecher nachts auf dem Friedhof herum, suchen sich ein Mausoleum aus, wo sie den nächsten Tag verbringen können. Vielleicht bist du ja auch so eine, wenn du dich in der Nacht von Friedhöfen und Mausoleen so angezogen fühlst.“
„Danke für deine aufklärenden Worte, meine Liebe,“ entgegnete Alea lachend, „aber ich werde mich heute Nachmittag in die Sonne legen und relaxen. Du weißt ja, Untote können das nicht!“
Das Geschenk
„Wir müssen dringend nach Nordhorn zum Friedhof“, rief Manfred seiner Frau zu, die gerade die Blumen auf der Küchenfensterbank mit Wasser versorgte.
„Das glaube ich auch. Das Grab sieht bestimmt wieder schlimm aus. Ist auch zu dumm, dass dein Vater unbedingt sein Grab unter der großen alten Buche haben wollte.“
„Da hast du vollkommen Recht! Ich frag mich nur schon seit Längerem, was wir in fünf Jahren mit dem Grab machen. Dann kann ich die weite Strecke bestimmt nicht mehr andauernd mit dem Auto fahren. Einen Gärtner hatten wir ja schon engagiert, aber da sah das Grab auch nicht viel besser aus als jetzt.“
„Können wir es nicht einebnen lassen?“, erkundigte sich seine Frau.
„Nein, das macht die Friedhofverwaltung in Nordhorn nicht. Und wenn doch, dann kostet es genauso viel, als würde es noch die nächsten zehn Jahre bestehen bleiben“, meinte Manfred ärgerlich. „Am besten, wir warten erst einmal ab. Wer weiß, was in den nächsten Jahren so alles passiert.“
Als Peter ein paar Tage später seinen Vater besuchte, fragte der seinen Sohn, ob er mit ihm nach Nordhorn, zum Grab der Großeltern fahren würde. Doch Peter hatte alle möglichen Ausreden parat, musste für die Firma noch einige Sachen erledigen, seine Frau abends von der Arbeit abholen und die Kinder zu einem wichtigen Fußballspiel in die nächste Stadt bringen.
„Heutzutage“, so meinte sein Sohn, „lässt man sich verbrennen und nicht in einem großen Familiengrab bestatten. Ich verstehe nicht, warum Opa unbedingt eine Erdbestattung wollte.“
„Opa war katholisch und bei denen ist es von früher her so üblich. Ich für meinen Fall ziehe ja auch eine Feuerbestattung vor. Nachdem wir uns im letzten Monat den Friedwald angesehen haben, hat deine Mutter dies auch so in ihrer Vorsorgevollmacht festgelegt“, erklärte Manfred seinem Sohn und fragte dann, um ein anderes Thema anzuschneiden: „Was ist eigentlich der Anlass deines heutigen Besuchs?“
„Na ja, in drei Wochen hast du Geburtstag. Biene und ich haben lange überlegt, was wir dir zum Siebzigsten schenken sollen, aber bisher ist uns nichts Passendes eingefallen.“
„Ihr braucht mir wirklich nichts schenken. Ich freue mich, wenn ihr mit den Enkelkindern zur Feier kommt.“
„Damit lässt sich Biene nicht abspeisen. Sie möchte dir unbedingt etwas Besonderes schenken!“, antwortete ihm Peter.
„Ich wüsste nicht was. Mutter und ich haben doch alles!“, sagte Manfred.
„Na gut, irgendetwas wird uns schon einfallen. Du bist ja immer für etwas Praktisches“, meinte Peter und fuhr schon rasch wieder nach Hause, um nicht doch von seinem Vater zu einem Grabbesuch in Nordhorn überredet zu werden.
An Manfreds Festtag saßen schon Nachbarn und Freunde am festlich gedeckten Kaffeetisch, als Peter reichlich spät mit seiner Familie ankam und das große Esszimmer betrat.
Kichernd stießen sich die beiden Jungen immer wieder mit dem von den Eltern erlaubten Sektglas an und forderten den Vater auf, Opa Manfred das Geschenk endlich zu überreichen, was Peter nach geraumer Weile auch tat.
Manfred nahm den hübschen Umschlag mit der dicken rotweißen Schleife dankend entgegen und sagte: „Kinder, ihr solltet mir doch nichts schenken!“ Dann löste er vorsichtig die Schleife, öffnete den Umschlag, nahm die Karte heraus und stutzte für einen Moment. ‚O Gott!‘, durchfuhr es ihn, was sich offensichtlich auch in seiner Mimik ausdrückte.
Schlagartig verstummten die Gespräche und alle Augen der Geburtstagsgäste richteten sich auf ihn, neugierig, warum er so erschrocken war über das Geschenk der Familie seines Sohnes. Was mochte er wohl von Peter bekommen haben?
Manfred war zuerst blass geworden, doch dann siegte sein Humor und er bekam einen Lachkrampf. Nachdem er sich beruhigt hatte, sagte er: „Es ist etwas für später. Ein Gutschein für ein Grab unter einem Baum im Friedwald bei Bramsche. Ich hoffe aber, dass ich nicht in der nächsten Zeit todkrank werde, verunglücke oder dass mich jemand umbringt, sodass meine Frau schon vorzeitig den Gutschein einlösen muss.“
Verrückte Welt
Ende Juni kam Martha Rottman kurz nach Mittag mit dem Fahrrad völlig aufgebracht zu uns. Mitten auf dem Hof ließ sie das Rad einfach fallen und rannte aufgeregt in die Küche, wo Mutter und Oma Gertrud gerade Erdbeermarmelade kochten. Neugierig schlich die kleine Margarete hinterher, blieb aber hinter der halb offenen Küchentür stehen und lauschte.
„Hört mal! Ich komme gerade mit dem Rad aus dem Dorf. Stellt euch mal vor, was mir unterwegs passiert ist!“
„Setz dich hin und beruhige dich erstmal, du bist ja ganz außer dir!“ Gertrud reichte Martha Rottmann ein Glas Wasser, das sie in einem Zug leer trank. Dann holte sie tief Luft und berichtete: „Kurz hinter Bauer Köhne sah ich ein Stück vor mir einen weißen VW-Käfer am Straßenrand stehen. Ich dachte, vielleicht ist dem Fahrer schlecht geworden. Also bin ich vom Rad abgestiegen, habe es geschoben, um notfalls gleich zu helfen. Als ich auf der Höhe des Wagens war, stieg ein Mann aus und sagte, er müsse mir etwas zeigen. Dabei öffnete er seinen hellen Sommermantel, wies auf seine offene Hose und wollte mit der anderen Hand nach dem Lenker meines Rades greifen. Ich war so erschrocken, dass ich es beinahe fallengelassen hätte. Geistesgegenwärtig bin ich aber schnell mit dem Rad ein Stück weitergerannt, wieder aufgestiegen und habe eilig die Abkürzung, das heißt den kleinen Weg mitten durch die Felder, genommen.“
„Du musst nochmal ins Dorf und bei der Polizei eine Anzeige machen“, sagte Mutter.
„Nein, auf keinen Fall. Ich fahr da nicht mehr lang! Wenn ich bedenke, was mir alles hätte passieren können. Bestimmt hätte keiner meine Hilfeschreie gehört.“
Martha Rottmann stand auf, schaute aus dem Fenster und fragte besorgt: „Ist eure Margarete denn schon von der Schule wieder da?“
Ehe Mutter oder Oma antworten konnte, kam Margarete in die Küche gerannt. Offensichtlich hatte sie das Gespräch durch die offene Tür mitbekommen, denn sie trötete nun lautstark: „Die Schule war heute eher aus und den Mann habe ich auch gesehen. Als er den Mantel aufgemacht und mir sein Ding gezeigt hat, habe ich nur gelacht und gesagt: ‚Vater seins ist viel größer.‘ Ich habe es nämlich schon mal gesehen, als er sich morgens angezogen hat. Der Mann hat ganz blöd geguckt und sich wieder ins Auto gesetzt. Ich bin dann schnell nach Hause gefahren.“
„O Herrgott, die Welt wird immer verrückter!“ Oma Gertrud schlug die Hände über dem Kopf zusammen, während Mutter und Martha Rottmann ganz blass wurden.
Margarete verstand die Aufregung der Erwachsenen nicht und dachte: ‚Na, besser wäre mal wieder gewesen, ich hätte nichts erzählt. Wie man es auch macht, so macht man es verkehrt.‘
Abends versuchte Mutter, ihrer Tochter das Ganze zu erklären, außerdem musste diese der Mutter versprechen, nie zu einem Fremden ins Auto zu steigen.
Martha Rottmann hat im Übrigen den Mann doch am nächsten Tag angezeigt, aber die Polizei hat den unbekannten Fremden nie erwischt.
Beerdigung im Schuhkarton
Ganz aufgeregt rief Elke am frühen Morgen bei ihrer Mutter Kerstin an und teilte ihr mit, dass sie nicht duschen könne, da das Wasser im Badezimmer kalt sei. Notgedrungen telefonierte Kerstin mit der Heizungsfirma, die für die Wartung zuständig war. Sie sollten umgehend kommen, den Fehler suchen und gleich beseitigen.
Kerstin zog sich nach dem Anruf bei der Firma in aller Ruhe an, um zu ihrer Tochter zu fahren. Als sie nach einer Stunde dort ankam, berichtete diese: „Der Monteur war da und hat gesagt, dass die Heizung nicht anspringt, weil die Sauerstoffzufuhr blockiert ist. Der Schornsteinabzug sei dicht. Der ganze Keller sei schon voll Kohlenmonoxid. Wir hätten ersticken können. Er hat sofort den Schornsteinfeger alarmiert, der auch sofort gekommen ist und gerade dabei ist, den Kamin zu reinigen.“
Kerstin ging in den Keller, um nachzusehen, wie weit der Schornsteinfeger mit seiner Arbeit war. Ihr kleiner Enkel wollte unbedingt mitgehen, denn seine Mama hatte ihm erzählt, dass es Glück bringt, wenn man den schwarzen Mann anfasst. Und so eine spannende und aufregende Sache konnte er sich nicht entgehen lassen.
Zusammen mit Oma im dunklen Keller angekommen, verließ den Kleinen allerdings rasch der Mut. Also musste Kerstin den schwarzen Mann fragen, ob ihr Enkel ihn anfassen dürfe. Schmunzelnd stellte sich der Schornsteinfeger in Positur. Zaghaft ging der Kleine näher und strich mit der rechten Hand über das nach Ruß stinkende Hosenbein des Mannes, während er sich mit der anderen Hand fest an Oma klammerte, da er dem schwarzen Mann, der tatsächlich sehr verwegen aussah, wohl nicht so recht traute.
Danach zeigte der Schornsteinfeger Kerstin einen Karton, der voll mit vielen kleinen Ästen und Stöckchen war, die er alle aus dem verstopften Kamin beziehungsweise Luftschacht herausgeholt hatte.
„Was ist das denn?“ Entsetzt zeigte der Enkel auf etwas Großes, Schwarzes, das hinter dem Karton lag.
„Das ist eine Dohle, ein Rabenvogel. Der ist tot“, antwortete der Schornsteinfeger dem Kleinen – und zu Kerstin gewandt: „Der Grund des ganzen Missgeschicks. Der Vogel hat wohl versucht, oben auf dem Schornstein ein Nest zu bauen, und ist dann samt Unterlage in den Kamin hineingerutscht und elendig zugrunde gegangen. Damit so etwas nicht noch einmal passieren kann, werde ich aufs Dach steigen und oben auf dem Schornstein ein Gitter anbringen.“
Auf Bitten ihres Enkels nahm Kerstin die große, schwarze Dohle mit nach oben, legte sie in einen mit viel Watte ausgepolsterten alten Schuhkarton, deckte den Vogel sanft mit einem weichen Tempotuch zu und verschloss den Karton. In Begleitung ihres Enkels begrub sie die Dohle hinten im Garten unter dem alten knorrigen Birnenbaum. Anschließend durfte sich der Junge aus dem Blumenbeet ein blühendes Vergissmeinnicht ausbuddeln und auf das kleine Grab pflanzen, da er wusste, dass das Familiengrab auf dem Friedhof auch immer mit schönen Blumen bepflanzt wurde. Zusammen mit seiner Mutter hatte er im Sommer oft die Blumen gegossen.
Ob das Anfassen des schwarzen Mannes tatsächlich Glück für den Kleinen bringen wird, steht noch in den Sternen.
MORDnacht
Ohne Krimi nie ins Bett
denn es ist besonders nett
sich vor dem Schlafen noch zu gruseln
wenn Diebe, Mörder um dich wuseln
Ein Schuss, ein Knall, ein Stich
darauf ein Schrei ganz fürchterlich
Das Opfer gleich zu Boden sinkt
röchelnd es im eignen Blut ertrinkt
Trotz Nacht und Nebel das ist klar
der Mörder nicht der Gärtner war
infrage kommt die Ehefrau
ihr Alibi ist ungenau
Die Tat wird schließlich aufgeklärt
vom Kommissar der sich bewährt
für Totschlag, Mord und andere Fälle
der Täter sitzt jetzt in der Zelle
Spannend so ein Krimi ist
die Zeit dabei man ganz vergisst
Geht dann im Traum auf Mördersuche
wie es steht im Krimibuche
Ohne Krimi nie ins Bett
denn es ist besonders nett
sich vor dem Schlafen noch zu gruseln
wenn Diebe, Mörder um dich wuseln
Onkel Erwins Jagdhütte
Willst du mit mir geh‘n, Licht und Schatten verstehn, dich mit Windmühlen drehn, willst du mit mir geh‘n…, sang Daliah Lavi im Radio, als Bernd sie fragte: „Willst du mit mir gehen?“
„Wohin soll ich mit dir gehen?“
„Das ist eine Überraschung!“
„Ich mag keine Überraschungen.“
„Nun stell dich nicht so an.“
„Was heißt hier anstellen? Das tust du doch. Du willst mir ja nicht sagen, wo ich mit dir hingehen soll.“
„Also gut. Ich möchte mit dir übers Wochenende in die alte Jagdhütte von Onkel Erwin fahren. Wir nehmen genügend an Essen mit und machen es uns dort gemütlich, gehen spazieren, baden im Waldsee und sitzen abends mit einem guten Glas Rotwein vor dem flackernden Kaminfeuer. Was hältst du davon?“
„Kommt ein bisschen plötzlich, oder? Aber von mir aus, bitte!“
„Gut, dann besorgen wir gleich noch den Wein und etwas zu knabbern, packen anschließend unsere Sachen ins Auto und fahren los.“
Karin überlegte: ‚Wann waren wir beide das letzte Mal dort? Ach ja, es muss kurz nach unserer Verlobung gewesen sein. Richtig, es war ein sehr romantisches Wochenende …‘
Sie erinnerte sich, dass sie die meiste Zeit im Bett verbracht hatten. Genau! Onkel Erwin hatte es zusammen mit ein paar anderen Möbelstücken neu angeschafft, nachdem er die Hütte renoviert hatte. Als sein Vater damals verstorben war, hatte er Erwin das Waldstück mit See und heruntergekommener Jagdhütte hinterlassen. Und jetzt wollte Bernd unbedingt mit ihr dorthin. ‚Komisch! Er schläft seit geraumer Zeit im Gästezimmer, da ich angeblich zu laut schnarche. In der Jagdhütte gibt es aber nur das eine große Doppelbett, sodass ich dann wieder neben ihm liegen muss.‘
Insgeheim freute sie sich allerdings schon auf das Wochenende. Sie würde das neue dünne Nachthemd mitnehmen und hoffen, dass es wieder so sein würde wie damals nach ihrer Verlobung.
Und so geschah es dann auch. Bernd gab sich redlich Mühe, war sehr liebevoll und zärtlich zu ihr, sodass sie anschließend traumlos bis zum anderen Morgen durchschlief, erst vom frischen Kaffeeduft geweckt wurde, aus dem Bett sprang, in die Küche lief und sich hocherfreut an den von Bernd schön gedeckten Frühstückstisch setzte.
Nach dem Essen räumten sie den Tisch nicht gleich ab, sondern nahmen ihre Badesachen und gingen hinunter zum kleinen See, der mitten in einer von der Sonne beschienenen Buchenlichtung lag.
Bernd hoffte, dass jetzt der Augenblick gekommen war, wo er sich seiner Ehefrau ein für alle Mal entledigen könnte, denn an manchen Stellen war der grünlich schimmernde See ziemlich tief. In der Morgendämmerung, als seine Frau noch schlief, hatte er die Umgebung erkundet. Dabei war ihm aufgefallen, dass im Wasser etliche vom letzten Sturm abgerissene dicke Äste und Zweige schwammen. Damit würde er sie unter Wasser drücken bis sie erstickt beziehungsweise ertrunken sein würde. Anschließend würde er das grüne Gewirr von Ästen und Zweigen über sie ziehen, sodass es aussähe, als hätte sie sich darin verfangen, nicht mehr freigekommen und ertrunken wäre.
Als er zwanzig Minuten später über dicke Baumwurzeln stolpernd und ziemlich genervt zur Jagdhütte zurücklief, war sein Plan aufgegangen. Sie hatte zwar um sich geschlagen, lauthals geschrien, doch in diesem abgelegenen Teil des Waldes hatten nur Hasen und Rehe sie gehört und die konnten schwerlich als Zeugen vernommen werden. Somit waren die starken Abwehrreaktionen seiner Frau völlig umsonst gewesen.
Bernd wartete noch gut eine Stunde, dann rief er bei der örtlichen Polizei an und erklärte dem Beamten mit zittriger Stimme: „Meine Frau ist von ihrem morgendlichen Bad im See nicht zurückgekommen. Ach, ich habe schon die ganze Umgebung nach ihr abgesucht. Bitte kommen Sie schnell! Ich komme fast um vor Sorge, dass ihr etwas zugestoßen sein könnte!“
Während er auf die Polizisten wartete, machte er Planungen: ‚Wenn alles gut geht, werde ich in zwei bis drei Wochen unsere gemeinsame Wohnung auflösen und endlich zu Erika nach Brasilien reisen können.‘
Tatbestand
Vorgestern ist der schreckliche
Mord geschehen
der Pathologe
hat sich die
Leiche
angesehen
die Kripo
sucht den Täter
und findet ihn dann später
Nach der
Urteilsverkündung
kam der Mann ins Gefängnis
so wurde der Mord
dem Täter zum
Verhängnis
Die Moral
von der Geschicht‘
morden lohnt sich
zumeist nicht
(Verfasser unbekannt)
Rostrote Winterastern
Ach ja..., die Winterastern! Im späten Frühjahr, ich glaube, es war so um den 20. Mai herum, habe ich sie gepflanzt und sie sind tatsächlich angewachsen. Dank der guten Bodenbeschaffenheit und der vielen Würmer blühen sie heute, Mitte Oktober, überreichlich.
Die rostrote Farbe der Blüten habe ich gewählt, weil sie mich an geronnenes Blut erinnern, wiederum sind sie nicht so auffällig wie knallrote Blüten.
Apropos Knall ... Ein Schuss aus seiner Dienstpistole hat seinem Leben ein jähes Ende bereitet.
Sie fragen warum? Ein ganzes Leben lang hat mich mein Ehemann gequält, gedemütigt. Ich konnte es einfach nicht mehr ertragen. Es war kein geplanter Mord. Nein, nein ...! Es war sozusagen eine Tat im Affekt, wie jeder Richter sicherlich urteilen würde.
Wie es dazu kam, wollen Sie wissen?
Nach einem gemeinsamen Frühstück wollte er zur Arbeit. Eine vierzehntägige Dienstreise nach Hamburg stand an. Ich begleitete ihn durch den Garten zur alten Eisenpforte, die zur großen Garage führte, wo sein Dienstwagen stand, um dann, wenn er weggefahren war, das Garagentor wieder ordnungsgemäß zu schließen. Wie so oft hatte er etwas an mir und an meiner Kleidung auszusetzen. Selbst die Farben der neu angepflanzten Sommerblumen – gelbe Tagetes und rosa Eisbegonien – gefielen ihm nicht.
Sie überlegen auch …? Stört Sie vielleicht die Farbauswahl?
Sie wollen mir doch wohl nicht unterstellen, ich hätte die Blumen abwechselnd nebeneinander ins Beet gepflanzt? So etwas Unharmonisches käme mir nie im Leben in den Sinn! Meinem Mann waren die Pflanzen außerdem wieder mal viel zu teuer, dabei hatte ich sie extra günstig im Baumarkt statt bei Münsterland oder in irgendeiner guten Gärtnerei gekauft. Seine ungerechten Vorhaltungen bewirkten, dass ich schon am frühen Morgen heftige Magenschmerzen bekommen hatte.
Als er dann so schimpfend vor mir herging, hakte plötzlich irgendetwas aus in meinem Kopf. Und da er ja schon seine Uniformjacke über dem Arm trug, die Pistole offen im Halfter stecken hatte, brauchte ich nur von hinten zuzugreifen, sie zu entsichern, wie er es mir vor einiger Zeit großspurig erklärt hat, und abzudrücken. Es geschah irgendwie ganz automatisch. Wie ein nasser Sack fiel er vornüber auf den gestern frisch geharkten Gartenweg und rührte sich nicht mehr. Einfach so und aus.
Über mich selbst erschrocken, bin ich schnell zum Holzschuppen gelaufen, habe den alten Spaten geholt, eilig mitten im Beet ein tiefes Loch gegraben und ihn darin verscharrt. Mit klopfendem Herzen bin ich zum Baumarkt nach Belm gefahren, habe die besagten rostroten Winterastern gekauft und die Pflanzen eilig auf die leicht erhöhte Stelle zwischen dem weiß blühenden Flieder und dem hohen, gelb blühenden Ginsterbusch gepflanzt.
Anschließend habe ich mich im Internet auf eine Kfz-Such-Anzeige gemeldet und den Firmenwagen meines Mannes an einen dubiosen Automechaniker verkauft, der ihn noch am gleichen Tag abgeholt und für irgendwelche Käufer nach Süd-Russland verschickt hat.
Als etwa fünfzehn Tage verstrichen waren, habe ich meinen Mann als vermisst gemeldet, da er von seiner Dienstreise nicht nach Hause zurückgekommen wäre, wie ich den Polizisten erklärte.
Später nahm die Polizei an, dass er in der Großstadt Hamburg, wahrscheinlich auf Sankt Pauli – man fand heraus, dass er dort auf seinen Dienstreisen gelegentlich einschlägig bekannte Lokale besucht hatte – wohl Opfer eines Verbrechens geworden sei.
Ich war entsetzt, wie Sie sich denken können, wollte aber auf keinen Fall bestreiten, dass dies die Erklärung für sein Verschwinden war.
Die rotblonde Schönheit
Bei dem hochsommerlichen Wetter konnte es Albert nur im Schatten unter der alten knorrigen Rotbuche aushalten. Er hatte sich quälen müssen, um den schweren Liegestuhl von der Terrasse, die voll im hellen, gleißenden Sonnenlicht lag, bis zum Schattenplatz zu schleppen.
Das durchgeschwitzte karierte Oberhemd hatte er längst ausgezogen und lag nun, nur mit einer Shorts bekleidet, völlig geschafft im Liegestuhl.
Sein blasses Gesicht war inzwischen gerötet. Kleine Schweißperlen standen auf der Stirn. Träge wischte er sie ab und zu mit der flachen Hand weg. Die Schwüle machte ihm sehr zu schaffen. Sogar hier im Schatten kam er sich vor wie in einer finnischen Dampfsauna.
Albert versuchte einzuschlafen, aber es gelang ihm nicht. Ärgerlich setzte er sich wieder auf und schaute auf seine Armbanduhr. Unendlich langsam quälten sich die goldenen Zeiger von einer Minute zur nächsten.
Wie er sie doch hasste, diese eintönigen, nicht enden wollenden Sonntagnachmittage. Womit sollte er sich beschäftigen? Er wusste es nicht. Außerdem war es einfach viel zu warm, um etwas zu unternehmen.
Er hätte sich lieber in seinem Arbeitszimmer aufhalten sollen. Das war der einzige Raum im ganzen Haus, der einen Fliesenboden hatte. Das Arbeitszimmer lag nach vorne, zum Norden hin, wo die Morgensonne nur ein klein wenig hereinschaute. Also ein relativ kühler, angenehmer Ort. Da er aber die ganze Woche über in dem Raum arbeiten musste, wollte er ihn am Sonntag nicht auch noch betreten.
Die Hitze flirrte. Kein Lüftchen regte sich. Albert schaute zum Himmel. Es würde bestimmt noch ein Gewitter kommen. Die Wolken hatten sich schon zu hohen Bergen aufgetürmt, sahen fahl und gelblich aus.
Ein richtiger Gewitterregen täte dem Garten gut und würde ihm die lästige Gießerei der Blumenbeete und das Rasensprengen am Abend ersparen.
Gelangweilt schweifte sein Blick hinüber zum Nachbargarten, versuchte, die dichte grüne Hecke, die als Grenze diente, zu durchdringen. Aber er konnte nichts erkennen.
Die Nachbarn hatten wohl draußen auf der Terrasse Kaffee getrunken, denn er hörte Geschirr klappern. Kinderstimmen schwirrten mal leise, mal lauter zu ihm herüber.
Plötzlich sah er sie! Sah nur ihre Umrisse. Dort, wo die Hecke etwas dünner war und man mit etwas Mühe hindurchblicken konnte, stand sie.
Wie alle Kleinen war sie sehr wissbegierig, neugierig. Der Blick durch die grüne, mit vielen Blättern bewachsene Hecke reichte ihr nicht. Vorsichtig zwängte sie sich durch die enge Lücke und sprang auf die oberste Latte des Holzzauns, saß in einiger Entfernung ruhig da und schaute immer wieder zu ihm hin.
Sie war schlank, zartgliedrig. Man konnte sie mit einer Ballerina vergleichen. Nach einiger Zeit traute sie sich herunterzuspringen, setzte behutsam einen Schritt vor den anderen, um zaghaft ein wenig näher zu kommen.
Sie war nicht nur hübsch. Nein, sie war schon fast eine Schönheit. Rothaarig, gemischt mit Orange und Goldblond. Und erst ihre strahlenden grünen Augen, hell und klar wie ein kühler Bergsee. Faszinierend ...!
Albert konnte seinen Blick nicht von ihr abwenden, fühlte, wie seine Hände vor Erregung feucht wurden.
Sie war einfach umwerfend, diese Kleine. Dabei wusste sie nicht einmal, was sie bei ihm anrichtete. Jetzt stand sie vor ihm und schaute keck zu ihm hoch.
„Möchtest du mit bei mir im Liegestuhl sitzen?“, fragte er, hob sie vorsichtig hoch, und da sie keinen Widerstand leistete, nahm er sie auf den Schoß.
Sie war leicht wie eine Feder. Er spürte ihre Körperwärme durch den Stoff seiner dünnen Shorts. Wie unter Zwang begannen seine Hände, sie sanft zu streicheln. Sie schmiegte sich an ihn und er meinte, sein Herz würde gleich vor Glück zerspringen, da es viel zu laut und schnell in seiner Brust klopfte. Lange hielt er diesen Zustand nicht aus. Es war Liebe auf den ersten Blick, doch gleichzeitig merkte er, wie Hass in ihm aufstieg.
Diese hier war bestimmt genauso wie die anderen. Wenn es nicht nach ihrem Willen und ihren Wünschen ging, zeigten sie schnell totale Ablehnung, was er überhaupt nicht verstand.
Albert dachte an letztes Jahr im August. O Gott ... Es war schrecklich gewesen!
Er hatte auch so ein hübsches, zierliches Wesen auf dem Schoß gehabt. Als er sie fest an sich drücken wollte, hatte sie maunzend aufgeschrien, sich gewehrt, ihm mit der Pfote ins Gesicht geschlagen, sodass ein tiefer Kratzer entstanden war.
Das war unter seiner Würde. Ihn schlug keiner. Dafür musste sie büßen. Soweit würde er es aber nie wieder kommen lassen, das hatte er sich damals geschworen.
Bei dem Gedanken daran schüttelte er sich und seine Verliebtheit war mit einem Mal wie ein winziger Hauch Parfüm verflogen. Widerwillig nahm er sie vom Schoß und stellte sie vor sich hin.
Irritiert schaute sie ihn mit ihren grünen Augen an, sagte aber nichts.
‚Sie muss weg, einfach weg! Zwar ist sie noch sehr jung, aber das ändert sich schnell. Und dann ...?’
Das Risiko, wenn sie wieder zu ihm herüberkäme, das wollte er nicht eingehen. Nicht schon wieder!
„Möchtest du etwas trinken, meine Kleine?“, fragte er hinterhältig, stand auf, ging zum Haus und in die Küche.
Im Kühlschrank stand noch der Rest Milch von seinem Kakao, den er sich zum Frühstück gemacht hatte. Das war genau das Richtige für sie!
Doch wo hatte er im letzten Jahr nur die verflixten Tropfen hingestellt? Er überlegte…
Ach ja…! Oben auf dem alten Bord im Besenschrank standen sie. Er hatte sie in die äußerste Ecke verbannt und musste sich nun auf Zehenspitzen stellen, um sie herunterzuholen. In seiner Hast fiel ihm die kleine Flasche beinahe aus der Hand.
Er zählte ab: „1, 2, 3, 4, 5, 6 ,7 … “ und weiter. Zehn Tropfen von dem Gift mussten genügen. Sicherheitshalber gab er noch drei Tropfen dazu. Eine absolut tödliche Mischung.
Eilig begab sich Albert zurück in den Garten und dachte: ‚Hoffentlich ist sie noch da!’ Er horchte in sich hinein, spürte aber keinerlei Mitleid mit der kleinen Katze.
Am dunklen, wolkenverhangenen Himmel zuckten inzwischen bedrohlich die ersten Blitze und ein paar vereinzelte dicke Regentropfen fielen zur Erde. Die Schwüle war jetzt unerträglich. Man konnte sich vorstellen, dass es so ähnlich in der Hölle sein musste, von der Pastor Maier oft sonntags in der Kirche predigte. Es sollte stets eine Warnung für die Gläubigen sein, damit sie die Zehn Gebote beachteten und zusätzlich viel Gutes taten.
Albert hatte Glück. Die kleine Katze stand tatsächlich noch neben dem Liegestuhl. Sie wirkte ein wenig verloren. Vielleicht hatte sie auch Angst vor dem nahenden Gewitter. Eilig reichte Albert ihr den Teller mit der Milchmischung.
Während sie trank, sah er mit Genugtuung, dass das Gift sofort wirkte. Nach einigen Sekunden brach sie zusammen, zuckte noch ein paar Mal, lag dann mit offenen Augen wie erstarrt auf dem sich mit Regentropfen füllenden Rasen.
Albert wartete noch einen Augenblick, schaute verstohlen zum Nachbargrundstück, nahm eilig die Katze hoch und trug sie auf die andere Hausseite. Dann marschierte er zum alten Geräteschuppen, holte einen Spaten und begann, hinten unter den dichten Büschen ein tiefes Loch zu graben. Er hoffte, dass ihn niemand sehen würde.
Hastig legte er die Katze hinein, warf ihr noch einen letzten, verächtlichen Blick zu und füllte hektisch das kleine Grab mit Erde auf.
Der heftige Wind peitschte bereits die herunterhängenden Äste und Zweige der hohen Büsche hin und her, sodass sie seine Arbeit erheblich behinderten, da er den Boden noch festtreten musste.
Endlich war alles zu seiner Zufriedenheit erledigt. Erschöpft sah Albert im Licht der grell zuckenden Blitze auf die frische Grabstelle. Vorsichtshalber legte er noch einen der dicken Steine, die am Geräteschuppen aufgestapelt waren, auf das Grab.
Gewitter, Sturm und der Regen würden bis zum Abend die restlichen Spuren beseitigt haben. Nichts konnte ihn verraten. Er wischte den verdreckten Spaten auf dem nassen Rasen ab und brachte ihn zurück in den Schuppen.
Vor Nässe triefend rannte er zurück zum Wohnhaus. Als er die Eingangstür aufschloss hörte er, wie sich nebenan in der Villa ein Fenster öffnete. Eines der Kinder rief sorgenvoll nach der kleinen Katze.
Selbstbewusst
Bin kein braves Bürgerkätzchen
auf dem Dach da ist mein Plätzchen
laure dort auf Meisen Spatzen
fange sie mit meinen
Tatzen
Bin kein braves Bürgerkätzchen
auf der Straße ist mein Plätzchen
verkaufe mich für eine Maus
an den Kater
Stanislaus
Bin kein braves Bürgerkätzchen
auf dem Tisch da ist mein Plätzchen
zwischen Wurst und Spiegelei
erwischt man mich gibt es
Geschrei
Bin ein braves Bürgerkätzchen
auf dem Schoß da ist mein Plätzchen
schnurre wohlig vor mich hin
dass jeder sieht wie
lieb ich bin
Der Duft des Todes
Die kleine malerische Burg aus dem späten Mittelalter war umgeben von einem breiten, gefüllten Wassergraben, auf dem einige Enten ihr Dasein verbrachten. Diesen tiefen Graben mussten Eroberer oder heutzutage Einbrecher überwinden, wenn sie an der uneinsehbaren Rückfront in das Gebäude eindringen wollten.
Doch sie hatte es geschafft. Unbemerkt war sie über die schmale vorgebaute Terrasse und weiter durch die offen stehende Tür eingedrungen, schaute sich ein wenig um und versteckte sich dann hinter der dichten, bunt gemusterten Übergardine, die vor der breiten Fensterfront des Schlafzimmers hing und den hohen Raum in ein diffuses Licht tauchte.
Auf dem breiten Bett, das mit einem weißen Leinentuch bedeckt war, lag ein nackter Mann und wälzte sich unruhig im Schlaf hin und her. Vielleicht hatte er einen Albtraum, sah sich einen steilen Abhang hinunterfallen oder in einem reißenden Fluss ertrinken. Wahrscheinlicher aber war, dass ihm die extreme Wärme des Zimmers zu schaffen machte, obschon er sich nicht mit dem zweiten Leinentuch zugedeckt hatte, das ordentlich zusammengefaltet zu seinen Füßen lag.
Auch die weit geöffnete Tür brachte keine Erleichterung, da in dieser schwülen, warmen Sommernacht kein einziger kühler Lufthauch von draußen hereinkam.
Sie dagegen mochte die Wärme, und nachdem sie für ein paar Minuten zur Ruhe gekommen war, kam sie leise hinter der bodenlangen Übergardine hervor und betrachtete den braunen, gut durchtrainierten Körper des Mannes. Ein dünner feuchter Film lag auf seiner Haut, hing wie winzige Perlen an den vielen feinen Haaren seines Körpers, der leicht nach Schweiß und Herrenparfum roch. Ein herrlicher Duft, der sie magisch anzog. Sie konnte nicht mehr warten. Es musste geschehen ... Jetzt! Sofort!
Fast lautlos näherte sie sich dem Bett, setzte sich auf ihn und stach zu.
Der Mann erschrak, saß mit einem Satz aufrecht im Bett. Schlug nach ihr! Der Schlag war so heftig, dass sie von ihm herunterfiel, blutend auf dem weißen Betttuch lag und – ohne noch einen Ton von sich zu geben – verstarb.
Im Halbschlaf hatte der Mann ein leises, sirrendes Geräusch vernommen. Sofort war er hellwach geworden und hatte die arme kleine Mücke ins Jenseits befördert.
Der Tod
Ein einfältiger Narr und
drei Zeichen im Sand
eine bleiche Magd
sich vor ihm befand
und hinter ihnen nur
das brausende Meer
Einen silbernen Becher
in ihrer zarten Hand
gefüllt mit Wein
bis oben zum Rand
samtig rot schimmert der Tod
doch der Abschied fällt schwer
Stumme Münder
lauernde Stille
die Sonne verhüllt
der letzte Wille
er soll geschehen
der Becher ist leer
Verlöschendes Licht
streichelnde Hand
verwehte Zeichen
im warmen Sand
die Augen so weit und leer
und hinter ihnen nur
das brausende Meer
in Anlehnung an eine Ballade von Georg Trakl
Einladung ins Herrenhaus
Verwundert schaute Lady Harriet Thorn-Canforth auf die Post in ihrer Hand, eine bunte Briefkarte von ihrem Cousin Lord Canforth, der sie bat, zu ihm zum Tee zu kommen. Kopfschüttelnd überlegte sie, was wohl diesmal der Grund seiner Einladung sein könnte: ‚Eine Verlobung? Oder hat er sich mit Pferdewetten verschuldet? Zuzutrauen ist es ihm ja. Es kann natürlich auch sein, dass ich wieder mal für seine Schulden aufkommen und ihm eine größere Summe Geld leihen soll. Oder er will womöglich Großvaters Herrenhaus verkaufen und benötigt meinen Rat.’
Weil Harriet an diesem Wochenende nichts Besonderes vorhatte, teilte sie ihrem Cousin per SMS mit: „Ich werde am Samstag um 16 Uhr bei dir sein. Gruß Harriet.“ Sie freute sich darauf, wieder einmal durch die vielen großen Zimmer und die langen, verwinkelten Flure des alten Herrenhauses zu schlendern, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte.
Am Samstagmittag legte Harriet ein paar Kleidungsstücke und Kosmetikartikel in ihre Reisetasche, verließ ihre geräumige Penthouse-Wohnung und fuhr mit dem Fahrstuhl nach unten in die Tiefgarage. Dort setzte sie sich in ihr Lieblingsauto, ein weißer MG mit roten Ledersitzen, und lenkte den Wagen auf die Straße, wo sie sich in den fließenden Stadtverkehr einfädelte. Schnell erreichte sie die Autobahn 380, die von Exeter in Richtung Süden führte. Wie in jedem Sommer wunderte sie sich, dass trotz der vielen Abgase auf beiden Seiten der Straße eine Vielzahl in Gelb und Rot blühender Montbretien wuchsen und die Grashänge in ein flammendes Farbenmeer tauchten.
Bei Paignton verließ Harriet die Autobahn und fuhr weiter auf der schmalen, von hohen Hecken gesäumten Landstraße bis Brixham. Kurz hinter der Kleinstadt bog sie auf die sanft hügelige Küstenstraße, wo sich auf der linken Seite die steil abfallenden weißen Kreidefelsen befanden, während sich auf der rechten Straßenseite grüne saftige Wiesen wie eine Kette aneinanderreihten, getrennt durch dornige Hecken oder kleine, aufgeschichtete graue Steinmauern.
Schon tauchte die große Einfahrt zum Herrenhaus Canforth Manor vor ihr auf. Der Kies unter den Rädern ihres MGs knirschte leise, als sie die lange Kastanienallee bis zum Haus befuhr und den Wagen vor der breiten Freitreppe parkte. Sie zog den Schlüssel ab, griff nach ihrer Reisetasche und stieg aus. Dabei fiel ihr Blick auf das große Rondell in der Mitte des Platzes, in dem sich ein paar vereinzelte rosa Buschrosen bemühten, etwas Farbe in das verwilderte Beet zu bringen.
‚Er könnte dringend einen Gärtner gebrauchen, aber für Gartenpflege hat Charles ja noch nie etwas übrig gehabt.’ Leicht verärgert über den hässlichen Anblick des Rosenbeets ging Harriet die paar Meter bis zur Treppe, stieg die breiten Sandsteinstufen hoch und dachte dabei, dass das Efeu an der Hausfassade auch dringend geschnitten werden müsste.
In diesem Moment wurde auch schon die dicke Eichenholztür geöffnet und James, der Butler, bat sie herein. „Guten Tag, Lady Harriet. Schön, Sie wieder einmal hier auf Canforth Manor begrüßen zu können. Bitte gehen Sie durch die große Halle und nehmen Sie im Kaminzimmer Platz. Ich werde Lord Canforth Bescheid geben, dass Sie angekommen sind. Während Sie warten, wird Ihnen Molly schon mal Tee und Kuchen servieren.“ James nahm ihr die relativ leichte Kroko-Reisetasche ab und trug sie nach oben ins Gästezimmer.
Unter den strengen Blicken ihrer Ahnen, die als große Gemälde an den vier Wänden der Eingangshalle hingen, durchquerte Harriet den dunklen, mit dicken Teppichen ausgelegten Raum und marschierte ins Kaminzimmer. Dort roch es noch genauso eigentümlich muffig wie zu ihrer Kinderzeit. Die Wände waren von leicht verschlissenen Seidentapeten bedeckt und vor den hohen Fenstern hingen noch immer die schweren roten Brokatvorhänge aus der Kinderzeit ihrer Großeltern.
‚Wenn ich hier leben würde, hätte ich die Räume schon längst modernisiert. Aber leider hat Großvater das Herrenhaus Charles vermacht und nicht mir.’
Kurz vor seinem Tod hatte Sir Henry sein Testament geändert und Bargeld nebst Aktien Harriet vererbt, da er wusste, dass Charles das umfangreiche Barvermögen in seinem Leichtsinn schnell ausgegeben hätte.
Und so war es auch gekommen. Im letzten Jahr hatte Charles so lange gebettelt, bis Harriet ihm eine größere Summe Geldes geliehen hatte, die er für angeblich dringende Umbauten am Haus benötigte.
Als Harriet ihren Wagen auf dem Vorplatz geparkt hatte, hatte sie weder ein Gerüst noch Arbeiter entdeckt. Aber vielleicht wurden ja im hinteren Teil des Hauses, den Charles bewohnte, Zimmer renoviert. Jedoch konnte sie sich auch das nur schwer vorstellen, würden solche Renovierungsmaßnahmen sein Budget doch beträchtlich übersteigen. Bis heute hatte er es auch nicht für notwendig gehalten, die monatlichen Raten an sie zu zahlen. Vielleicht war das der Grund, warum er mit ihr reden wollte?
Abwarten und Tee trinken, sagt man wohl in solchen Fällen … Und genau das wollte Harriet jetzt tun, denn das Hausmädchen hatte ihr gerade eine Kanne frisch aufgebrühten schwarzen Tee mit Milch und Zucker sowie ein dickes Stück Himbeertorte serviert.
Kurz darauf betrat Charles den Raum. Ein Playboy-Typ mit grau melierten Haaren, ähnlich George Clooney. Stets war er modisch gekleidet, gab sein Geld vorrangig für Freizeitvergnügungen aus, hielt sich in diversen Nachtclubs auf und hatte zahlreiche Frauenbekanntschaften. Eigentlich war er ein schmarotzender Nichtstuer.