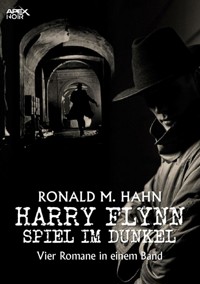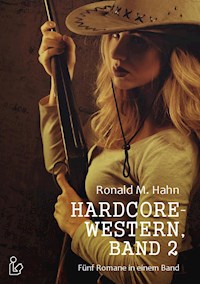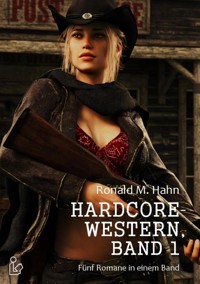4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
1870: In der Nacht eines stürmischen Blizzards beobachten zwei Trapper in der eisigen Wildnis Alaskas den Absturz eines seltsamen fliegenden Objekts.
1900: Als der Abenteurer Smoke Bellew und sein Gefährte Jack Short in einem Saloon in der Goldgräberstadt Dawson von einem geheimnisvollen Stamm weißer Indianer hören, die Töpfe voller Gold horten, brechen sie in den Norden auf, um das Rätsel dieser Menschen zu lösen. Sie werden von Indianern gefangen genommen, die von einem mysteriösen Weißen regiert werden und bemerken bald, dass er ein unglaubliches Geheimnis hütet...
Manfred Orlowski, DEUTSCHE-SF.DE:
»Die Handlung wird zügig und flott erzählt... Aus dem Blickwinkel des 19. Jahrhunderts heraus bleibt der Roman abenteuerlich und phantastisch. Im Vordergrund steht aber der Abenteuergeist der Goldgräber, so wie ihn schon vielfach Jack London in seinen Geschichten geschildert hatte. Hahn hat sich gut dem Stil Jack Londons angepasst und trifft auch dessen Ton. So schafft er es, ein wenig Abenteuerlust und wilde Romantik auf den Leser zu übertragen... Das Werk lässt Nostalgie auf die frühe Zeit der SF aufkommen, was ich durchaus in Ordnung finde.«
Der Roman Auf der Erde gestrandet von Ronald M. Hahn basiert auf der Erzählung The Wonder of Woman von Jack London
Der Roman erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe WESTERN-COLT, ergänzt um ein Vorwort von Christian Dörge.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
RONALD M. HAHN
Auf der Erde gestrandet
Roman
Western-Colt, Band 26
NordheimBücher
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
...alles Weitere ist Exegese - Ein Vorwort von Christian Dörge
AUF DER ERDE GESTRANDET
Prolog
Erstes Kapitel
Zweites Kapitel
Drittes Kapitel
Viertes Kapitel
Fünftes Kapitel
Sechstes Kapitel
Siebtes Kapitel
Achtes Kapitel
Neuntes Kapitel
Zehntes Kapitel
Elftes Kapitel
Zwölftes Kapitel
Dreizehntes Kapitel
Vierzehntes Kapitel
Das Buch
1870: In der Nacht eines stürmischen Blizzards beobachten zwei Trapper in der eisigen Wildnis Alaskas den Absturz eines seltsamen fliegenden Objekts.
1900: Als der Abenteurer Smoke Bellew und sein Gefährte Jack Short in einem Saloon in der Goldgräberstadt Dawson von einem geheimnisvollen Stamm weißer Indianer hören, die Töpfe voller Gold horten, brechen sie in den Norden auf, um das Rätsel dieser Menschen zu lösen. Sie werden von Indianern gefangen genommen, die von einem mysteriösen Weißen regiert werden und bemerken bald, dass er ein unglaubliches Geheimnis hütet...
Manfred Orlowski, DEUTSCHE-SF.DE:
»Die Handlung wird zügig und flott erzählt... Aus dem Blickwinkel des 19. Jahrhunderts heraus bleibt der Roman abenteuerlich und phantastisch. Im Vordergrund steht aber der Abenteuergeist der Goldgräber, so wie ihn schon vielfach Jack London in seinen Geschichten geschildert hatte. Hahn hat sich gut dem Stil Jack Londons angepasst und trifft auch dessen Ton. So schafft er es, ein wenig Abenteuerlust und wilde Romantik auf den Leser zu übertragen... Das Werk lässt Nostalgie auf die frühe Zeit der SF aufkommen, was ich durchaus in Ordnung finde.«
Der Roman Auf der Erde gestrandet von Ronald M. Hahn basiert auf der Erzählung The Wonder of Woman von Jack London
Der Roman erscheint als durchgesehene Neuausgabe in der Reihe WESTERN-COLT, ergänzt um ein Vorwort von Christian Dörge.
...alles Weitere ist Exegese -
Ein Vorwort von Christian Dörge
»Jetzt darfst du deinen Mann mit Schnee bedecken,
damit er frisch bleibt bis ich wiederkomme.
Er darf nicht begraben werden, bis ich das Geld kassiert habe.«
Loco in: LEICHEN PFLASTERN SEINEN WEG
(Sergio Corbucci, 1968)
Denke ich an Jack London, so denke ich an – Schnee. Jede Menge davon. Okay, an manchen Tagen denke ich auch an Raimund Harmsdorf, wie er – verbissen auf einem krummen Glimmstängel herumkauend – eine (freilich nur vorgeblich) rohe Kartoffel in der bloßen Faust zu Püree zerdrückt. Seit ich jedoch Ronald M. Hahns erstaunlichen Roman Auf der Erde gestrandet gelesen habe, mieteten sich in Jack Londons Assoziations-Wohngemeinschaft noch zahlreiche weitere Merkwürdigkeiten ein; Merkwürdigkeiten, die Kaptain Wolf Larsen erwiesenermaßen reichlich blass aussehen lassen (was andererseits auch am lausigen Wetter liegen mag).
Sie, liebe Lesende, werden wissen, was ich meine, sobald Sie die Lektüre besagten Buches beendet haben werden.
Es ist also Winter, Freunde, das Klima ist rau, »im Wald heulten die Wölfe den Silbermond an« und das Leben selbst ist alles Mögliche - nur eben kein gottverdammtes Honigschlecken. Denn schon der Prolog von Auf der Erde gestrandet macht klar, wie der Husky läuft (Blitzmerker werden Ähnliches ohnedies bereits anhand des Titels und der Umschlaggestaltung deduziert haben...).
Mal unter uns Spätgeborenen: John G. Chaney, der alte Sozi, konnte auch anders: Sein Roman The Jacket dürfte jedem, den es zum Schlittenhund zieht, einigermaßen den Pulverschnee aus der Denkmurmel fegen – ganz so, als hätte der Herr Kaleun die Ghost torpediert.
Warum ich das so ausdrücklich erwähne? Ganz einfach: Jack London und echt Merkwürdiges fordern einander – so meine Theorie am frühen Morgen – geradezu heraus, bedingen einander, wenn’s gut läuft. Freilich muss man sich vor jenem bösen Geist aus der Fabulierflasche mit Namen Beliebigkeit hüten.
Ronald M. Hahn, ein wahrlich großer Routinier vor dem Herrn (und nicht nur vor dem!), setzt sich dem Risiko der Beliebigkeit keine Sekunde lang aus. Was vermutlich daran liegt, dass Ronald M. Hahn eher der Typ Humphrey van Weyden ist. Denn wohl überlegt muss er sein, ein solcher Crossover-Roman, Sinn ergeben, der Selbstzweck-Flak nach Kräften auszuweichen verstehen. Vermutlich schreibt man so richtig gute Science Fiction-Romane.
Auf der Erde gestrandet verknüpft mit beispielhaftem Geschick Elemente klassischster Science Fiction mit denen des klassischstem Goldgräber-Abenteuer-Schmökers; und zwinkert das Auge, dann zwinkert’s, weil es zwinkern kann. Darum können in diesem Roman eine gewisse Tragik und ein echt seltsamer, im zehnten Kapitel konkretisierter X-Files-Moment vortrefflich miteinander harmonieren, derweil Jack London – in Vorzeichen-invertierter Weise – auf H.G. Wells trifft, ohne jemals so unterkühlt des Weges gestapft zu kommen, wie es das beinahe fühlbar eisige Setting nahezulegen vermeint. Doch wie bei jedem wirklich guten SF-Roman steht das Individuum (hier: der Mensch) im Fokus des Geschehens, und wirklich gute SF widersteht der Versuchung, exotisch und plakativ zu sein – stattdessen ist sie einfach nur folgerichtig.
Ich glaube, früher nannte man solches Tun Virtuosität.
Und deshalb ist Auf der Erde gestrandet ein Science Fiction-Roman im allerbesten Sinne.
Alles Weitere, liebe Lesende, ist Exegese.
»Ach, scheiß der Hund drauf.« (R. M. Hahn)
Christian Dörge
- München, im August 2016
AUF DER ERDE GESTRANDET
Der Roman basiert auf der Erzählung
The Wonder of Woman von Jack London,
die 1912 in Cosmopolitan Magazine erschien.
Prolog
Der eisige Polarwind sang sein nächtliches Klagelied, draußen beugte sich der Wald dem Wüten des Blizzards, im Kamin knackten dicke Holzscheite und verbreiteten wohlige Wärme, und Alistair McDougall saß, eine dünne Zigarre zwischen den Zähnen, in der Blockhütte am Tisch und las in einem abgegriffenen Buch von Edgar Allan Poe, dem es irgendwie gelungen war, die zehn Jahre, in denen er sich nun schon in der arktischen Wildnis herumtrieb, zu überleben.
McDougalls Partner Joey Sherman, gerade achtzehn Jahre alt geworden, geboren auf einer amerikanischen Weizenfarm, saß blond, blauäugig und deprimiert in einem rotkarierten Hemd, einer blauen Leinenhose und löchrigen grauen Socken vor dem Feuer, hielt eine halb geleerte Flasche Ballantine’s in der Rechten und sang leise und traurig vor sich hin.
»Kay-kay-kay-Kathy... beautiful Kathy... you’re the only girl that I adore... When the moon shines... over the cow-shed... I’ll be waitin’ at the kitchen door...«
Joey war hoffnungslos in eine dralle Blondine aus Fort Yukon verliebt, die jedoch zu seinem Unglück einem Mann angetraut war, der nicht nur gut mit dem Gewehr, sondern auch mit den Fäusten umgehen konnte und es nicht mochte, wenn verliebte Jünglinge ihr schöne Augen machten. Im Sommer hatte er Joey zu verstehen gegeben, dass es schlecht um seine Zähne stünde, wenn er ihn noch einmal in der Nähe seiner Frau erblickte. Nun klagte der Junge schon seit geraumer Zeit dem prasselnden Feuer und dem brennenden Whisky sein Leid, doch allzu viel hatte es nicht erbracht. McDougall konnte ihm nicht helfen, er hätte sich eher die Zunge abgebissen, als ihm zu sagen, dass die Blondine, die er halb betrunken besang, eine Schlampe war. Er seufzte. Joey musste erst noch erwachsen werden. Und zum Erwachsenwerden gehörte es laut seiner Meinung, dass man Enttäuschungen hinnahm, um an ihnen zu reifen.
Der Abend war kalt, das Thermometer vor der Tür zeigte dreißig Grad unter Null. Im Schuppen neben der Blockhütte kuschelten sich die Schlittenhunde zusammen, und im Wald heulten die Wölfe den Silbermond an. McDougall schüttelte sich bei der Vorstellung, bei diesem Wetter ins Freie gehen zu müssen. Doch dazu gab es keinen Grund: Sie hatten genug Proviant, Feuerholz und Streichhölzer für sechs Wochen. Und abgesehen von Joeys Liebeskummer gab es sonst keinen Grund zur Klage: Ihre Schlitten bogen sich unter den Pelzen, die sie noch vor dem ersten Wintersturm aus ihren Fallen geholt hatten.
Sie würden den Winter gesund überstehen. In zwei, drei Wochen wollten sie nach Fort Yukon aufbrechen, die Ausbeute an den Agenten der Hudson Bay Company verkaufen und mit dem reichhaltigen Erlös in die Heimat zurückkehren - in die Wärme, zu den Palmen, zu den hübschen Frauen, den gepflegten Getränken und sauberen Betten.
»Hast du das gehört, Alistair?«, sagte Joey plötzlich.
McDougall hob erstaunt den Kopf. »Was?«
Joey hatte sich auf dem Schemel herumgedreht. Seine blauen Augen waren groß. Er stellte die Flasche auf dem Boden ab, legte den Kopf schief und schaute zur Decke hinauf. »Das Heulen...«
»Heulen?«
McDougall hatte das Wort kaum ausgesprochen, als er ein so lautes Krachen vernahm, dass ihm vor Schreck das Buch aus der Hand fiel. Gleich darauf hörte er ein furchtbares Knirschen, als knicke der Blizzard eine Hundertschaft von Fichten um, als brächen sie unter dem Ansturm seiner Gewalt.
Die Hunde im Schuppen gebärdeten sich wie toll.
Joey sprang auf. »Mein Gott! Was war das?«
»Ein Blitz?« McDougall stand auf, ging an die Tür und öffnete sie. Der tobende Blizzard wehte einen Schwall dicker, weißer Flocken zu ihm herein und die Kälte biss in sein Gesicht.
Ihm genau gegenüber, über dem mächtigen Nordlandwald, raste eine rote Flammenzunge dahin - durch die Luft. Ihre Länge konnte er nicht abschätzen, aber sie war sehr lang.
»Was...«
Joey war plötzlich neben ihm. Der Sturm blies so heftig, dass McDougall große Mühe hatte, die Tür aufzuhalten. Da war nicht nur die Flammenzunge. Da bewegte sich auch etwas - hoch über den Bäumen. Es schien zu fliegen; ein merkwürdig geformter Körper, der ihn an einen Brummkreisel denken ließ. Er war riesengroß, strahlte silbergrau im Schein der Flammenzunge und der Sterne und wies am Äquator viele gelbe runde Lichter auf.
»Was... ist das, Alistair?«, keuchte Joey erschreckt.
McDougall spürte, dass sich seine Nackenhaare langsam aufrichteten und ein unerklärliches Zittern seine Glieder befiel. Es ist der Schreck, dachte er, es ist nur der Schreck. Mutter Gottes, steh uns bei...
Fiel da etwas vom Himmel? Nein, es schwebte über den Bäumen - unsicher, Lärm erzeugend, flammend. Brannte es? Nein... Es wirkte irgendwie hilflos, als suche es nach einem Landeplatz. McDougall schätzte, dass das Ding etwa fünfhundert Meter von ihnen entfernt war. Es war so groß wie ein Haus mit drei oder vier Stockwerken. Und es schien aus Metall zu sein. Ein Haus aus Metall, das durch die Lüfte flog...
Er holte tief Luft. Er spürte die Kälte nicht mehr. Sein Körper war erhitzt, seine Wangen vor Erregung gerötet. Er warf Joey einen schnellen Blick zu und sah den Unglauben und die Furcht vor dem Unbekannten in seinem Gesicht, aber auch die Faszination, Zeuge eines Geschehens zu werden, das seine unausgebildeten Sinne nicht erfassen konnten.
Das Ding kreiste verwirrt über den Bäumen, die runden Lichter am Äquator gingen aus, an und wieder aus. Der große summende Körper sackte plötzlich wie ein Stein in die Tiefe und tauchte zwischen den Bäumen ein. Ein Krachen und Bersten erfüllte die Luft. Schneewolken stoben auf, weißten die Schwärze des Himmels. Bäume knirschten und knackten. Im hellen Licht des Mondes konnte McDougall sehen, dass die großen Fichten sich wie Schilfrohre neigten und brachen.
Dann war alles still.
»Zieh deine Stiefel an«, sagte er und griff ohne nachzudenken nach seiner Jacke. »Und hol dein Gewehr.«
Minuten später stapften sie, dick angezogen, die Ohren von den Kapuzen ihrer fellgesäumten Parkas geschützt und mit festen indianischen Mokassins angetan, durch den beinahe kniehohen Schnee in den Wald. Der Wind wehte ihnen mit unverminderter Heftigkeit entgegen, und es schneite so heftig, dass McDougalls Schnauzbart und seine Brauen schon nach zehn Sekunden vereist waren. Trotzdem verschwendete er keinen Gedanken an die Naturgewalten. Nicht weit von ihnen, das wusste er, war etwas vom Himmel gefallen, das noch keines Menschen Auge erblickt hatte. Etwas Unerklärliches, etwas Mysteriöses; etwas, das weder er noch Joey sich in ihrer Phantasie je ausgemalt hatten.
Er hatte keine Erklärung für das Geschehene; am ehesten glaubte er noch daran, dass ein Komet auf die Erde gefallen war. Er hatte von solchen Dinge gelesen. Doch war er sich nicht im geringsten sicher; es konnte auch ein Meteorit gewesen sein, oder - wie die ungebildeten Trapper sagten, eine »Sternschnuppe.« Wenn man eine Sternschnuppe sah, durfte man sich angeblich etwas wünschen; wenn man seinen Wunsch für sich behielt, sollte er in Erfüllung gehen. McDougall glaubte nicht an solche Kinkerlitzchen; er hatte in seiner Heimat auf der anderen Seite des Ozeans eine Schulbildung erhalten, denen man in diesen Gefilden nicht allzu oft begegnete.
Sie waren kaum hundert Meter in den Wald eingedrungen, als sie mit atemlosem Erschrecken feststellten, dass der Gegenstand, den sie vom nachtdunklen Himmel hatten fallen sehen, kolossal gewesen sein musste: Er schien vor dem Absturz zwischen die Bäume geraten zu sein, denn er hatte eine Schneise von mindestens zwanzig Metern Breite in sie hineingerissen. Vor ihnen war der Schnee bis zum Untergrund geschmolzen. Der Boden, der in diesen Breitengraden nicht einmal im Sommer gänzlich auftaute, sondern noch in vierzig Zentimeter Tiefe vom Permafrost vereist war, war schneefrei - und dampfte. Dunstige Schwaden wehten von ihm auf, und da und dort erblickten sie große Wasserpfützen.
Joey, der schnaufend neben ihm zum Halten kam, packte seinen Arm und rasselte: »Alistair... Ich... habe Angst.«
McDougall drehte sich zu seinem jungen Gefährten um, musterte ihn mit einem eingehenden Blick, sah tatsächlich Furcht in seinen nun gar nicht mehr angetrunken wirkenden Augen und erwiderte: »Bleib ruhig, Joey...«
Alles war totenstill.
Sie gingen vorsichtig weiter.
Dann wanderte McDougalls Blick langsam durch die breite Schneise, an deren Ende, etwa hundert Meter vor ihnen, ein frisch aufgeworfener Erdhügel aufragte. Auch er war völlig schneefrei; der schwarze Boden war aufgewühlt, umgeknickte Baumstämme lagen kreuz und quer herum, mächtige Kiefern streckten knorrige Wurzeln in die Luft, und die Temperatur schien mit jedem Meter, den sie zurücklegten, anzusteigen.
McDougall spürte, dass das Eis in seinem Bart taute. Das Eis in seinen Brauen verwandelte sich in klares Wasser und lief über seine Wangen. Er lauschte dem Schlagen seines, wie er glaubte, immer lauter werdenden Herzens, hörte das dumpfe Rauschen des Blutes in seinen Ohren und fragte sich, warum er mit seinen fünfundzwanzig Jahren eigentlich immer ein Vorbild für Joey abgeben musste. Ihm war nicht anders zumute als seinem Gefährten; auch er verspürte angesichts dieses nie geschauten Ereignisses Furcht. Aber es war seine angeborene Neugier, die ihn antrieb; er hatte schon immer wissen wollen, was hinter dem nächsten Hügel lag. Deswegen war er auch nach Alaska gekommen.
Joey blieb plötzlich stehen.
»Alistair...«
»Hm?«
McDougall hörte ihm zu, ohne den Blick von dem Erdwall zu nehmen, der nun etwa zwanzig Meter vor ihnen aufragte.
Grauweißer Dunst wirbelte in feinen Schlieren über ihm dahin. Es war nun so warm, dass er nach Luft schnappte und die Kapuze nach hinten schlug. Sein Haar war nass, und als er einen Blick auf seine Finger warf, die das Gewehr fest umklammert hielten, stellte er fest, dass sie von Schweiß glänzten.
»Warum ist es so heiß hier, Alistair?«
»Ich weiß nicht«, sagte McDougall. »Die Wärme ist vielleicht durch die Reibungshitze des Meteors entstanden. Die hält bestimmt nicht lange an.«
»Me... teor?«
Der Junge hatte keine Ahnung. Er war auf einer Farm groß geworden und konnte weder lesen noch schreiben. Er war, wie viele seiner Art, hauptsächlich durch Gottes Wort »gebildet« worden und hielt die Erde möglicherweise für eine Scheibe. McDougall wusste es nicht. Sie hatten nie über solche Dinge gesprochen.
»Ein großer Stein«, erklärte er. »Aus dem Weltraum. Er ist auf die Erde gefallen.«
»Ach«, sagte Joey. Er schien aufzuatmen. Doch dann: »Und die... Lichter?«
Er hat sie also auch gesehen, dachte McDougall.
»War wahrscheinlich ‘ne optische Täuschung.«
McDougall holte tief Luft, legte den Zeigefinger auf den Abzug seiner Waffe und ging weiter. Irgendwo in ihrer Nähe ertönte ein Rauschen, dem ein lautes Klatschen folgte, so dass sie wie ein Mann zusammenzuckten. Doch dann sahen sie, dass sich nur eine riesige Kiefer vom Rest ihrer Schneelast befreit hatte. Dann hörte er ein leises Knistern und spürte, dass sich sein Herzschlag erneut beschleunigte. In der Luft lag plötzlich ein eigenartiger Schmorgeruch.
McDougall hob sein Gewehr und bestieg den Erdwall.
Joey, der sich offenbar nicht traute, zögerte, doch dann schien er Mut zu fassen und folgte ihm. Als sie kurz vor dem Kamm des hohen Walles waren, der zweifellos den Rand des Kraters bildete, in den der Meteor gestürzt war, hörten sie das leise Schaben von Metall auf Metall und glaubten, das Herz müsse ihnen stehenbleiben.
»Alistair...«, hauchte Joey mit bebender Stimme. »Da ist...«
McDougall schloss die Augen, lauschte dem eigenartigen Geräusch und versuchte sich vorzustellen, was dieses Schaben erzeugt haben könnte. Eisen an sich, das wusste jeder Hanswurst, war unbelebt; Meteoriten, die vom Himmel fielen, das wusste zumindest er, mussten nicht unbedingt nur aus Gestein bestehen. Sie konnten auch aus Metall sein oder zumindest einen Metallanteil haben. Aber unbelebte Materie, ob Stein oder Metall, erzeugte keine Geräusche; jedenfalls nicht so lange, wie es nicht von menschlichen Händen bewegt wurde.
Aber Menschen... flogen doch nicht durch die Lüfte.
Fürchtet euch nicht.
Erstes Kapitel
La Perle, der Abenteurer
Seit Chris Bellew in das wilde Nordland gekommen war, hatte er in den Hütten der Sauerteige, die schon zehn und zwanzig Jahre vor ihm hier gewesen waren, mehr phantastische Geschichten gehört, als er zählen konnte. Doch das, was er an diesem Abend zu hören bekam, sollte sein Leben von Grund auf ändern.
Zwar wimmelte es im Yukon-Territorium von eigenartigen Käuzen, die - wollte man all dem Glauben schenken, was sie angeblich erlebt hatten - hundert Jahre alt sein mussten, aber dennoch zog es ihn immer wieder in ihre Hütten. Und wenn er dann an einem warmen Feuerchen saß und den alten Knaben lauschte, während draußen der Wind heulte, empfand er einen eigentümlichen Zauber, den man in den feinen Salons von San Francisco niemals spürte. Die Burschen, die einem im Norden ihre Geschichten auftischten, hatten wirklich viel erlebt. Manche hatten die verrücktesten Abenteuer überlebt, ohne sich recht bewusst zu sein, wie knapp sie mit dem Leben davongekommen waren. Andere hatten Wunder geschaut, die ihnen ganz gewöhnlich vorgekommen waren, da sie mit der Natur lebten und nicht über sie nachdachten; wieder andere nahmen die phantastischsten Erlebnisse so stoisch auf, dass sie nicht einmal das Bedürfnis verspürten, sie anderen mitzuteilen.
Ja, hier oben, wo die Tage kurz und die Nächte endlos waren, passierte mehr, als sich der Geist eines Journalisten vorzustellen vermochte, und das war auch der Grund, warum es Bellew, obwohl er nicht zu den Glücklichen zählte, die sich einen goldhaltigen Claim hatten abstecken können, nicht nach Kalifornien zurück zog. Er liebte die Hütten und kaminbeheizten Saloons von Dawson, wo sich die Sauerteige in den dunklen Stunden bei einem Drink versammelten und haarsträubende Geschichten zum Besten gaben. Sie sprachen oft von der alten Zeit, als Dawson noch nicht existiert hatte, als man noch nach Circle City hatte marschieren müssen, um eine Menschenseele zu treffen - von der Zeit, in der die vom Gold angelockten Cheechakos daheim ihren bürgerlichen Berufen nachgegangen waren.
Seit Carmacks großem Goldfund am Bonanza Creek war viel passiert. Inzwischen hatte sich eine riesige Schar von Abenteurern aus aller Herren Länder ins Klondike-Gebiet ergossen, die ausnahmslos hofften, in kurzer Zeit reich zu werden. Doch wie zu Hause hatte das Glück sie auch hier im Stich gelassen: Hier galt die Maxime, dass man ohne Plackerei keine Mahlzeit bekam. Und manchmal gab es auch trotz Plackerei keine Mahlzeit.
In diesem Winter hatten sich über vierzigtausend Menschen in Dawson niedergelassen, und längst nicht jeder hatte das Vergnügen, sein müdes Haupt in der Nacht auf ein Kissen zu betten. Zahllose Goldsucher schliefen in Zelten, in denen pausenlos die Yukon-Öfen bullerten, und manch einer musste die Kälte, die seine Knochen klappern ließ, zusätzlich mit einem kräftigen Schluck betäuben.
Chris Bellew hingegen hatte, wenn man es richtig besah, Glück gehabt. Zwar hatte er kein Gold gefunden, aber einen treuen Partner namens Jack Short. Sie hatten zusammen manch einträgliches Geschäft gemacht und sich mit den Gewinnen aus diesen Geschäften an den Claims anderer beteiligt.
An diesem Abend, als Bellew und Short im Moosehorn-Saloon bei einem Glas Whisky saßen, hatten sich dicke Schneewolken über Dawsons Dächern zusammengezogen. Im Saloon und auf den Straßen herrschte Stille, als bereiteten sich die Menschen auf einen Blizzard vor. Niemand war auf der Straße zu sehen. Im Kamin knisterten dicke Scheite. Der Barmann langweilte sich am Tresen und spülte Gläser, die längst blitzsauber waren. Das elektrische Piano war schon lange verstummt. An der Theke standen ein paar Goldgräber und unterhielten sich in leisem Tonfall. Die Mädchen saßen gelangweilt in einer Ecke und strickten.
Chris Bellew und Jack Short, die seit geraumer Zeit wortlos vor sich hin rauchten und in sechs Monate alten Zeitungen blätterten, saßen mit drei bärtigen Sauerteigen am Kamin und zuckten plötzlich zusammen. Einer der älteren Herren, der französische Bonanza-König René d’Avoine, seufzte leise und murmelte »Ach, ja...«
Bellew faltete den San Francisco Chronicle zusammen, klemmte sich einen Zigarillo zwischen die Zähne und warf seinem Partner einen Blick zu. Shorty nahm eine bequemere Haltung ein. Ein erwartungsvolles Lächeln legte sich auf seine Züge. Er war, im Gegensatz zu seinem Freund, kräftig und untersetzt, hatte schwarzes Haar, dunkle Augen und das Gemüt eines Bernhardiners.
Wenn d’Avoine wieder mal sein »Ach, ja...« vor sich hin murmelte, das wusste er, bekam man binnen kurzem eine außergewöhnliche Geschichte zu hören.
»Los, René, erzähl schon«, sagte Shorty und rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Die Neugier hatte ihn gepackt. Bellew sah es deutlich. Er schmunzelte.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: