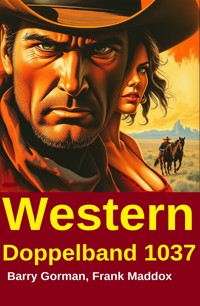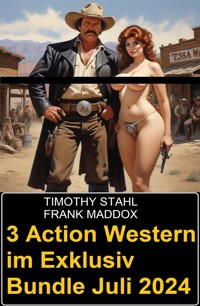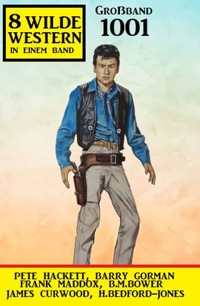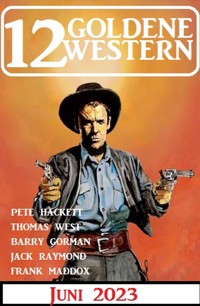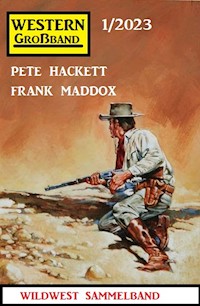Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieser Band enthält folgende Western: Gunlock und der Oregon-Trail (Pete Hackett) Jim Silver und die kämpfenden Vier (Max Brand) Grainger und das Duell im Saloon (Frank Maddox) Die First National Bank of Elkdale wurde an einem frühen Frühlingstag um halb drei Uhr nachmittags ausgeraubt. Es war noch so früh in der Saison, dass man an den unteren Hängen der Hügel einen Hauch von Grün erkennen konnte, und der Gipfel des Iron Mountain in der weiteren Ferne war bis auf die Breite der Schultern mit Schnee bedeckt. Es war ein ruhiger, stiller Nachmittag, an dem sich dünne Wolken fröhlich über den Himmel jagten und die Luft über der Erde völlig unbeweglich war, bis auf einen kleinen Strudel, der in der zunehmenden Hitze entstand und eine wirbelnde Staubpyramide aufsaugte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 413
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Western Dreierband 3045
Inhaltsverzeichnis
Western Dreierband 3045
Copyright
Gunlock und der Oregon-Trail
Jim Silver und die kämpfenden Vier: Wichita Western Roman 149
Grainger und das Duell im Saloon
Western Dreierband 3045
Frank Maddox, Pete Hackett, Max Brand
Dieser Band enthält folgende Western:
Gunlock und der Oregon-Trail (Pete Hackett)
Jim Silver und die kämpfenden Vier (Max Brand)
Grainger und das Duell im Saloon (Frank Maddox)
Die First National Bank of Elkdale wurde an einem frühen Frühlingstag um halb drei Uhr nachmittags ausgeraubt. Es war noch so früh in der Saison, dass man an den unteren Hängen der Hügel einen Hauch von Grün erkennen konnte, und der Gipfel des Iron Mountain in der weiteren Ferne war bis auf die Breite der Schultern mit Schnee bedeckt.
Es war ein ruhiger, stiller Nachmittag, an dem sich dünne Wolken fröhlich über den Himmel jagten und die Luft über der Erde völlig unbeweglich war, bis auf einen kleinen Strudel, der in der zunehmenden Hitze entstand und eine wirbelnde Staubpyramide aufsaugte.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Bathranor Books, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
© dieser Ausgabe 2024 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Gunlock und der Oregon-Trail
Pete Hackett
Spencer Patty, der Spieler, deckte seine Karten auf und sagte: „Full House, Gentlemen. Drei Achten und zwei Buben. Hat jemand von euch ein besseres Blatt?“ Patty grinste in die Runde. Im Pot lagen fast zweihundert Dollar, und er sah sich bereits als Besitzer des Geldes.
Wayne Clement, ein einunddreißigjähriger, dunkler Mann mit stechenden, braunen Augen, knallte seine Karten auf den Tisch, fluchte und stieß schließlich hervor: „Ich steige aus! Das geht nicht mit rechten Dingen zu. Zur Hölle, ich habe meinen halben Vorschuss verspielt.“
John Corbin, er war zwei Jahre jünger als Clement und seine Haare sowie sein Bart waren von rötlicher Farbe, warf ebenfalls seine Karten weg, doch er fluchte und wetterte jedoch nicht, sondern zischte: „Ich denke, Patty, dass du uns betrogen hast. Und wenn du jetzt deine Hand nach dem Geld im Pot ausstreckst, nagle ich sie damit fest.“ Er griff unter seine Jacke, zog einen Dolch hervor und rammte ihn in die Tischplatte.
Spencer Patty kniff die Augen zusammen. Der vierte Mann, der mit ihm, Clement und Corbin am Tisch saß und die Karten noch in den Händen hielt, schaute betreten von einem zum anderen. Der Verdruss war plötzlich greifbar.
„Ich habe nicht betrogen“, erklärte Spencer Patty ruhig. „Ihr habt heute einfach Pech.“ Er eiste den Blick von Corbin los und richtete ihn auf den vierten Spieler. „Kannst du mich schlagen, Cliff?“
Der Mann zuckte zusammen und schaute Patty an wie ein Erwachender. „Nein.“ Er legte die Karten mit den Bildern nach oben vor sich hin. „Zwei Paare. – Auch ich steige aus. Fortuna scheint es heute in der Tat nur mit dir gut zu meinen, Spencer.“
Er erhob sich, nahm sein Geld, stopfte es in die Jackentasche und beeilte sich, wegzukommen.
„Es ist nicht Fortuna, die ihre Hände im Spiel hat“, knirschte John Corbin und seine Augen zeigten eine unheimliche Drohung. „Es sind seine fixen Hände, mit denen er sich selbst die Gewinnerkarten zuschiebt. Darum werden wir jetzt den Pot unter uns aufteilen. Und du wirst dich ruhig verhalten, Patty.“
Im Saloon war man aufmerksam geworden und das Stimmendurcheinander, das Lachen, Grölen und Johlen versiegte. Die Atmosphäre war plötzlich angespannt und gefährlich. Einen Mann des Falschspiels zu bezichtigen war ein schwerwiegender Vorwurf. Konnte man allerdings den Beweis erbringen, dass der Vorwurf gerechtfertigt war, dann musste der Ertappte gewärtig sein, geteert und gefedert zu werden.
In dem Moment, als John Corbin mit beiden Händen den Pot zu sich heranziehen wollte, griff Spencer Patty unter die Jacke. Doch nun reagierte Wayne Clement. Sein rechter Arm schnellte herum und der Schlag kam mit einer derartigen Wucht, dass der Spieler samt seinem Stuhl umgefegt wurde. Und schon ruckte auch Clement hoch, stand breitbeinig über Spencer Patty, und als der den Oberkörper aufrichtete, donnerte ihm Wayne Clement die Faust mitten ins Gesicht. Mit einem gequälten Aufschrei fiel der Spieler zurück. Aus seiner Nase schoss das Blut, und es sickerte auch aus seinen aufgeplatzten Lippen.
„Du hast mit den Karten gezaubert, Patty!“, giftete Clement, packte den Spieler mit beiden Händen an den Aufschlägen der Jacke und zerrte ihn auf die Beine. „Du wolltest uns um unser ehrlich verdientes Geld betrügen. Du miese, kleine Ratte! Dafür werde ich dich jetzt zurechtstutzen. Und wenn ich mit dir fertig bin, werfe ich dich auf die Straße.“
„Zur Hölle“, keuchte der Spieler, „ich habe nicht betrogen. Ich – ich hatte einfach nur Glück, und ihr …“
Ein Kopfstoß brachte ihn zum Schweigen. Und mit dem nächsten Atemzug hämmerte ihm Clement die Faust in den Leib, sodass sich Patty krümmte. Weit traten ihm die Augen aus den Höhlen, und ein Laut, der tief aus seinem Innersten zu kommen schien, brach aus seinem weit aufgerissenen Mund. Ein Haken, den Clement gegen seine Schläfe donnerte, warf ihn um. Er lag am Boden, röchelte und seine Beine zuckten unkontrolliert.
Jetzt kam John Corbin um den Tisch herum und fauchte: „Dieser stinkende Coyote hätte uns um unseren gesamten Vorschuss betrogen, wenn wir ihm nicht auf die Schliche gekommen wären. Das Stück Dreck ist die Luft nicht wert, die es atmet!“ Mit dem letzten Wort versetzte er dem Spieler einen derben Tritt in die Seite.
Spencer Patty schrie auf und krümmte sich am Boden.
Die Gäste waren zurückgewichen und beobachteten alles mit gemischten Gefühlen. Sie wussten nicht, was sie davon halten sollten. Die meisten von ihnen kannten Spencer Patty, der erst vor wenigen Tagen nach Santa Fe gekommen war, nur vom Sehen. Die beiden Kerle, die keinen Pardon zu kennen schienen, hatten sie vorher noch nicht hier gesehen.
Vorsichtshalber mischte sich niemand ein. Die beiden waren mit Revolvern bewaffnet, Brutalität und Härte standen ihnen in die Gesichter geschrieben, und ihr rabiates Vorgehen war den Gästen Warnung genug, um sich hier herauszuhalten. Diese Kerle waren unberechenbar und gefährlich. Und vielleicht hatte der Spieler tatsächlich betrogen …
„Das war erst der Anfang, Hurensohn!“, schnappte John Corbin. „Stell ihn auf die Beine, Wayne. Ich will ihm zeigen, was es heißt, sich mit uns anzulegen. Das, was ich von ihm übrig lasse, können sie an die Schweine verfüttern, die ich vor der Stadt in einem Koben gesehen habe. - Vielleicht schlage ich dich sogar tot, elender Betrüger, um zu verhindern, dass du weitere Zeitgenossen beim Spiel schnöde um ihr Geld bringst.“
Corbin knallte seine rechte Faust in die geöffnete linke Hand, dass es klatschte. Eine wilde Vorfreude leuchtete in seinen Augen und um seinen Mund lag ein brutaler Zug. Seine Mundwinkel waren leicht nach unten gebogen, was seine Entschlossenheit, Spencer Patty mit seinen Fäusten zu zertrümmern, deutlich zum Ausdruck brachte.
„Ja“, grollte Wayne Clements Organ, „zeigen wir es dem Stinktier.“ Er packte Patty und zerrte ihn in die Höhe.
Da erklang eine klirrende Stimme: „Ich denke, Sie haben es ihm bereits gezeigt, Gentlemen. Nun aber ist Schluss damit. Nehmen Sie ihre Hände von ihm. Ich sage das nicht zweimal!“
*
Der Mann, der dies gerufen hatte, kam langsam von der Eingangstür her näher. Er war hochgewachsen und hager, und er hielt ein Schrotgewehr mit beiden Händen schräg vor der Brust. An seiner Weste war der Stern eines Deputy Sheriffs befestigt.
Die Aufmerksamkeit der Anwesenden richtete sich nun auf ihn. Einige Männer, die zwischen ihm und dem Tisch standen, an dem Clement und Corbin den Spieler in die Mangel nahmen, traten schnell auf die Seite. Zwei Schritte vor dem Tisch hielt der Hilfssheriff an und fixierte Wayne Clement mit einem klaren Blick, der jetzt die Härte von Bachkieseln annahm. „Haben Sie etwas an den Ohren?“
Diese Frage hatte Wayne Clement gegolten, der den Spieler nach wie vor mit beiden Fäusten gepackt hielt und den Gesetzeshüter unter zusammengeschobenen Brauen hervor finster musterte.
„Halten Sie sich raus, Deputy“, stieß John Corbin hervor. „Der Hurensohn hat uns betrogen. Und wenn wir ihm nicht auf die Schliche gekommen wären, würde er uns ausgenommen haben wie zwei Weihnachtsgänse. Er verdient eine Tracht Prügel.“
Der Deputy schaute den Spieler an, der wie ein Häufchen Elend in den Fäusten Clements hing, den eine Welle der Benommenheit nach der anderen hinwegschwemmte und der wohl gar nicht mehr richtig in der Lage war, einen klaren Gedanken zu fassen und die Zusammenhänge zu begreifen. Er war übel angeschlagen und hatte gegen große Not anzukämpfen.
„Haben Sie falsch gespielt, Mister?“, fragte der Ordnungshüter.
Patty entrangen sich einige unzusammenhängende Laute. Er war wie betäubt, sein Verstand war lahmgelegt und das machte es ihm unmöglich, sich vernünftig zu artikulieren. Und als ihn Wayne Clement jetzt losließ, brach er auf die Knie nieder und sein Kinn sank auf die Brust. Ein blitzschneller, knallharter Kniestoß Clements gegen das Ohr warf ihn zu Boden. Die Brutalität Wayne Clements schien keine Grenzen zu kennen.
Der Deputy fixierte Wayne Clement mit einer Mischung aus Widerwillen und Zorn. „Sie sind wohl verrückt geworden“, knirschte er. „Wenn ich mit dem Mann spreche können sie ihn doch nicht einfach umschlagen, allein schon im Hinblick darauf nicht, dass er völlig hilflos ist. Wenn Sie ihn noch einmal anfassen, werden Sie’s bereuen.“ Der Deputy ließ seinen Blick über die Anwesenden schweifen. „Hat jemand das Spiel beobachtet? Kann einer von euch bestätigen, dass der Mann falsch gespielt hat?“
Einige der Männer schüttelten den Kopf, einer knurrte: „Er spielt seit vier Tagen jeden Abend hier, Deputy. Von Falschspiel war bis jetzt allerdings noch nie die Rede. Gestern zum Beispiel hat er mehr als hundertfünfzig Bucks verloren.“
Jetzt heftete der Deputy den Blick wieder auf Clement: „Haben Sie gesehen, dass er mit den Karten gezaubert hat?“
„Er hat fast jedes Spiel gewonnen“, brummte Clement. „Und das ist nicht normal. Also muss er falsch gespielt haben.“
„Haben Sie ihn beobachtet, als er betrog?“ So richtete sich der Deputy an John Corbin.
„Er war drauf und dran, uns den gesamten Vorschuss, den wir erhalten haben, abzunehmen.“
„Welchen Vorschuss? Wofür haben Sie ihn erhalten?“ Die Stimme gewann an Schärfe. „Verdammt, Leute, wenn ihr nicht verlieren könnt, dürft ihr euch nicht an den Spieltisch setzen.“ Der Deputy schaute von Corbin zu Clement. Härte und Unnachgiebigkeit in seinem Blick milderten sich nicht. Der Ordnungshüter zeigte nicht die Spur von Verständnis.
„Wir sollen einen Auswanderertreck nach Fort Laramie und von dort aus auf den Oregon Trail führen“, erklärte Clement, der sich durch den zwingenden Blick des Ordnungshüters aufgefordert fühlte, zu antworten. „Jeder von uns hat zweihundert Dollar Vorschuss erhalten. Die Hälfte davon hat uns diese Ratte abgenommen …“
„Sie behaupten also nur, dass er falsch gespielt hat.“ Der Deputy schwang die Schrotflinte herum und legte sie an. Die Doppelmündung pendelte zwischen Corbin und Clement hin und her. „Eine Behauptung, die durch nichts fundamentiert ist. Ich verhafte Sie wegen Körperverletzung, Unruhestiftung und Nötigung. Und da ich gehört habe, wie Sie drohten, den Mann totzuschlagen, wird es vielleicht sogar eine Anklage wegen versuchten Mordes. Hände hoch und umdrehen!“
Jetzt schienen die Gesichter der beiden Kerle zu versteinern. „Ich höre wohl nicht recht!“, keifte Wayne Clement. „Versuchter Mord! He, Deputy, findest du nicht, dass du dir ein paar zu große Stiefel angezogen hast? Nimm die Bleispritze runter und zieh Leine. Wir haben dem Hurensohn eine Lektion erteilt, und damit hat es sein Bewenden. Wo kämen wir denn hin …“
In diesem Moment schien Spencer Patty seine Betäubung überwunden zu haben, denn er stemmte ächzend seinen Oberkörper vom Boden weg und röchelte: „Ich – ich habe nicht falsch gespielt, Deputy. Die beiden …“
John Corbin verlor die Nerven und riss seinen Colt aus dem Holster. Hilfssheriff Robert Collins, der von Patty abgelenkt worden war, reagierte nicht schnell genug. Als er begriff, brüllte der Colt schon auf und er erhielt einen fürchterlichen Schlag gegen die linke Schulter. Die Schrotflinte entfiel seinen Händen, er taumelte rückwärts, ein Stöhnen brach aus seiner Kehle, und er griff reflexartig nach seinem Sechsschüsser.
Jetzt aber donnerte der Colt Wayne Clements. Er hatte in dem Moment gezogen, in dem der Revolver seines Gefährten dröhnte. Und seine Kugel traf den Deputy mitten in die Brust. Er bäumte sich auf, drehte sich halb um seine Achse und krachte dann der Länge nach auf den Dielenboden.
Zwei – drei Sekunden lang herrschte im Saloon Atemlosigkeit. Der Pulverdampf zerflatterte und der ätzende Geruch des verbrannten Pulvers breitete sich aus. Clement und Corby standen mit flackernden Augen zwischen den Gästen und bedrohten sie mit ihren Revolvern.
Zunächst ging ein gepresstes Raunen ging durch den Schankraum, dann aber brach tumultartiger Lärm los. Und ungeachtet der Schießeisen in den Fäusten der beiden stürzten sich die Gäste auf sie. Die Angst, von der aufgebrachten Meute am nächsten Baum aufgehängt zu werden, die die beiden kalt und stürmisch wie ein Blizzard befiel, hinderte sie, abzudrücken. Sie wurden niedergerungen, harte Hände packten sie und zerrten sie wieder in die Höhe, jemand brüllte: „Hinaus mit ihnen! Holt Stricke! Wir hängen sie auf.“
Der Schrei nach einem Strick für die beiden wurde aus verschiedenen Kehlen wiederholt. Die Rotte drängte, Clement und Corbin zwischen sich, zum Ausgang. Der Tumult war unbeschreiblich. Richter Lynch war wieder einmal im Begriff, die Regie zu übernehmen …
Die beiden wurden auf die Straße hinaus und in Richtung Stadtrand gezerrt.
Da hetzten drei Männer mit Gewehren heran. Es waren der Sheriff und zwei Deputys. Der Sheriff feuerte zweimal in die Luft. „Stopp, Leute!“ Die Meute geriet ins Stocken, der Lärm sank herab und der Gesetzeshüter ergriff noch einmal das Wort, indem er schrie: „Wir hörten die Schüsse, und jetzt brüllt ihr nach einem Strick. Klärt mich auf, Leute, was euch so in Rage bringt.“
Der hängelüsterne Mob stand schließlich. Mehrere Stimmen brüllten durcheinander. Dennoch konnte sich der Sheriff einen Reim aus dem machen, was sie schrien. „Ruhe!“, brüllte er. „Zur Hölle, seid endlich still!“ Und als der Lärm so ziemlich versiegt war, stieß er mit einer Stimme, die sich anhörte wie brechender Stahl, hervor: „Okay, Leute, die beiden werden hängen. Aber es wird nach Recht und Gesetz geschehen. Bringt sie zum Office. Ich sperre sie ein und klage sie zu gegebener Zeit an. Ein Lynchmord wäre fatal. Darum überlasst es dem Gericht.“
*
Der Mann, der den Auswanderertreck organisiert hatte, trug den Namen Jacob DuVall. Er war zweiundfünfzig Jahre alt, grauhaarig, mittelgroß und untersetzt. Er wollte nach Oregon, das noch immer als das gelobte Land angepriesen wurde. Vor einem halben Jahr hatte er verschiedene Zeitungsverlage in New Mexiko, Texas und Arizona angeschrieben und sie gebeten, eine Ausschreibung zu veröffentlichen, mit der er Interessierte einlud, sich mit ihm auf den Trail zu begeben. Treffpunkt sollte spätestens am 31. Juli des Jahres 1880 in Santa Fe sein.
Dreizehn Familien waren seinem Aufruf gefolgt hatten sich mit ihren Planwagen, auf denen alles verladen war, was sie mit auf die Reise nehmen wollten, eingefunden. Einige brachten auch Schafe, Ziegen und Rinder mit. Zusammen mit dem Prärieschoner DuValls waren es also vierzehn Fuhrwerke, die nach Fort Laramie und von dort aus auf den Oregon Trail ziehen wollten.
DuVall hatte soeben erfahren, dass der Sheriff seine beiden Scouts wegen des Mordes an einem Deputy Sheriff verhaftet hatte. Es war früher Morgen und auf den Gräsern lag noch der Tau.
DuVall tobte. Nicht nur, dass er den beiden jeweils zweihundert Dollar Vorschuss ausbezahlt hatte: Er stand nun ohne Kundschafter da, und schon am folgenden Tag wollten sie aufbrechen. DuValls Gattin sagte: „Mir haben diese beiden Kerle gleich nicht gefallen. Denen steht die Verkommenheit in die Gesichter geschrieben. Aber du hast ja nicht auf mich gehört, denn deiner Meinung nach können Männer, die einen Treck bis nach Oregon führen sollen, gar nicht hart genug sein. Du hast Härte mit Skrupellosigkeit verwechselt, Jacob. Und das ist nun die Quittung.“
„Du stellst doch nicht etwa meine Entscheidung in Zweifel“, stieß Jacob DuVall drohend hervor und fixierte seine Frau unter zusammengezogenen Brauen hervor. Er wirkte jetzt unduldsam und autoritär.
Seine Gattin wich seinem düsteren Blick aus. „Das würde mir nie in den Sinn kommen, Jacob“, murmelte sie und zog die Schultern an, als würde es sie frösteln.
„Dann ist es ja gut.“ Das Gesicht des Auswandererführers hellte sich wieder etwas auf. „Ich muss mit dem Sheriff sprechen!“, knurrte er. „Klar, die beiden kann ich abschreiben, und die vierhundert Bucks wahrscheinlich ebenfalls. Aber der Sheriff kann mir sicher einen Rat geben, wen ich als Scout anheuern soll. Wir brauchen einen Mann, auf den Verlass ist und der Erfahrung hat.“
„Sicher, versuch dein Glück, Jacob. Und solltest du jemand finden, dann schau ihn dir dieses Mal genau an.“
„Ich will mir Mühe geben, einen guten Mann zu engagieren. Mit Clement und Corbin hatte ich eben Pech. Das kann dem Klügsten passieren. Allerdings kann ich nicht allzu viel Zeit mit der Suche vergeuden. Ich habe den dreizehn Familien zugesagt, dass wir morgen aufbrechen. Und sie können es kaum erwarten, auf den Trail zu gehen.“
„Sie werden einsehen, dass wir einen guten Kundschafter brauchen“, mischte sich nun Kathleen, die hübsche, blondhaarige Tochter des Ehepaares ein. Sie war allenfalls achtzehn Jahre als. „Schon in Colorado besteht die Gefahr, dass uns Indianer den Weg verlegen. Keiner von uns hat die nötige Erfahrung im Umgang mit ihnen. Wenn du heute keinen Scout findest, Dad, dann müssen wir eben solange suchen, bis der passende Mann gefunden ist.“
„Überlass das mir, Tochter, ja!“
Das Mädchen senkte den Blick und wandte sich ab. DuVall hielt es für Ergebenheit und Demut. Er sah nicht, das trotzige, vielleicht sogar gehässige Glitzern in den Augen Kathleens.
„Ich will jetzt die Leuten darüber aufklären, dass wir keine Kundschafter mehr haben“, knurrte DuVall. „Und dann spreche ich mit dem Sheriff.“
Eine Stunde später betrat er das Sheriff’s Office. Der Sheriff saß hinter seinem Schreibtisch und schrieb etwas in eine Kladde. Ein Deputy hatte sich einen Stuhl ans Fenster gestellt und beobachtete die Straße. Es war ein trüber Tag, Regenwolken zogen von Westen heran und alles wirkte unfreundlich, grau und wenig einladend.
Die beiden Ordnungshüter musterten den Eintretenden. DuVall grüßte brummig, der Sheriff erwiderte den Gruß, der Hilfssheriff nickte nur. „Was kann ich für Sie tun, Sir?“, fragte der Sheriff und legte den Federhalter in die dafür vorgesehene Rinne neben dem Tintenfass.
„Mein Name ist Jacob DuVall, und ich bin der Führer der Auswanderer, die sich am nördlichen Stadtrand eingefunden haben. Unser Ziel ist Oregon. Es sind insgesamt vierzehn Fuhrwerke, die morgen auf den Trail gehen möchten.“
„Ich verstehe“, gab der Sheriff zu verstehen. „Sie sind wegen der beiden Scouts hier.“ Sein Gesicht verschloss sich. „Nun, die beiden haben einen meiner Hilfssheriffs erschossen, und ich werde sie wohl wegen Mordes anklagen. Mit ihnen können Sie nicht mehr rechnen.“
„Kann ich mit den beiden sprechen?“, fragte DuVall.
„Sicher. Falls Sie eine Waffe am Mann haben, legen Sie sie auf den Schreibtisch. Ich werde Sie dann in den Zellentrakt begleiten.“
„Ich bin unbewaffnet.“
„Craig, überprüfe es.“
Der Deputy erhob sich, trat vor DuVall hin und klopfte ihn von oben bis unten ab. „Es ist in Ordnung“, erklärte er.
Der Sheriff nahm einen Schlüsselbund aus dem Schreibtischschub, erhob sich, schloss die Tür zum Zellentrakt auf und öffnete sie. „Bitte.“ Mit einer einladenden Handbewegung trat er zur Seite und ließ DuVall an sich vorbei. Der Treckführer schritt mit grimmigem, düsterem Blick an ihm vorüber. Clement und Corbin befanden sich gemeinsam in einer der Zellen. Es gab insgesamt acht Käfige. In einem der anderen lag ein bärtiger Bursche auf der primitiven Lagerstatt und schnarchte.
Wayne Clement hatte auf dem Rand seiner Pritsche gesessen. Auf der anderen lag John Corbin und hatte die Hände flach hinter den Kopf geschoben. Nun erhob sich Clement und kam zur Gitterwand, seine Hände schlossen sich um zwei der zolldicken Eisenstangen, und sein Bass grollte: „Verdammt, DuVall, es war ein Unfall, eine Verkettung unglückseliger Umstände. Wir wollten den Deputy nicht töten. Aber als er uns festnehmen wollte und von versuchtem Mord sprach, sind John die Gäule durchgegangen. Und als der Hilfssheriff nach dem Schießeisen griff, handelte ich wie im Rausch. Ich – ich habe einfach die Nerven verloren …“
„Die beiden haben einen Spieler brutal zusammengeschlagen“, erklärte der Sheriff, der DuVall in den Zellentrakt gefolgt war. „Der Grund dafür war ein ziemlich profaner: Sie haben beim Pokern verloren. Als sie mein Gehilfe zurückpfiff, kam es zu der Schießerei. Ich werde die beiden wohl wegen gemeinschaftlichen Mordes anklagen.“
„Ihr Narren!“, knirschte DuVall und maß die beiden mit vernichtenden Blicken. „Ich stehe jetzt ohne Scouts da.“
„Der Deputy bedrohte uns“, murmelte Corbin, der sich erhoben hatte und näherkam. „Nur, weil wir dem Gambler etwas die Flügel gestutzt haben, kann man uns doch nicht wegen versuchten Mordes anklagen. Aber der Deputy zielte mit der Shotgun auf uns und …“
„… ihr habt ihn umgelegt“, vollendete DuVall und ein mitleidloser Zug brach sich Bahn in sein Gesicht. „Dafür müsst ihr nun die Konsequenzen tragen. Wenn das Gericht zu dem Schluss kommt, dass es Mord war, wird man euch am Hals aufhängen.“ Der Treckführer winkte ab. „Was aus euch wird, ist mir im Grunde meines Herzens egal. Da ich mit euch nicht mehr rechnen kann, will ich die zweihundert Dollar Vorschuss, die ich jedem von euch ausbezahlt habe, zurück.“
Clements Kiefer mahlten. Jäher Hass glitzerte in seinen Augen. „Es ist Ihnen egal“, keuchte er. „Ihnen geht es nur um die verdammten vierhundert Bucks? Zur Hölle mit Ihnen, DuVall, ich hielt Sie für einen Christenmenschen …“
„Ich habe nichts übrig für Totschläger und Mörder!“, schnarrte DuVall und schnitt Clement brüsk das Wort ab. „Haben Sie das Geld? Wenn ja, dann her damit.“
„Clement hatte noch siebzig Dollar in der Tasche“, sagte der Sheriff, „bei Corbin fanden wir nicht ganz achtzig. Den Rest haben sie wahrscheinlich verspielt, vielleicht auch in Whisky umgesetzt. Ich habe das Geld in Verwahrung, kann es Ihnen allerdings nicht aushändigen, Mister, denn dies bedürfte einer gerichtlichen Anordnung. Und die bekomme ich auf die Schnelle nicht.“
„Ich verstehe“, brummte der Treckführer. „Nun ja, ich muss das wohl oder übel akzeptieren. Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, Sheriff, wen ich fragen könnte, ob er den Auswanderertreck nach Oregon führt. Ich würde dem Mann für jeden Meile des Trails einen Dollar zahlen.“
„Wie viele Meilen sind es?“, fragte der Sheriff.
„Zwischen elfhundert und zwölfhundert. Wir würden ungefähr drei Monate unterwegs sein. Ein Cowboy müsste für diesen Sold an die vierzig Monate hinter Kuhschwänzen herjagen.“
„Das ist in der Tat viel Geld“, knurrte der Sheriff nachdenklich und fügte sogleich hinzu: „Ich kenne einen Mann, der sie vielleicht führen könnte. Ich will mal mit ihm sprechen. Wann wollen Sie denn auf den Trail gehen?“
„Der Aufbruch war für morgen Früh bei Sonnenaufgang vorgesehen.“
„Es sieht nach Regen aus“, knurrte der Sheriff.
„Wenn Regen in den nächsten drei Monaten unser einziges Problem bliebe, Sheriff, dann würde ich Gott bis ans Ende meiner Tage dankbar sein.“
„Sicher, Sie haben recht. Es gibt viele namenlose Gräber am Oregon-Trail, DuVall. Hoffentlich kommen keine neuen hinzu. - Der Mann, von dem ich spreche, wird von allen nur Gunlock genannt. Er hat schon Rinder nach Montana getrieben und Wagenzüge der Armee als Scout geführt. Gunlock hat Erfahrung sowohl mit Apachen, als auch mit Sioux und Cheyennes und anderen Präriestämmen. Wenn Sie ihn als Scout kriegen, können Sie sich die Finger bis zu den Ellenbogen lecken. Falls er nicht gleich von vorneherein ablehnt, schicke ich ihn zu Ihnen.“
„Hat er auch einen richtigen Namen?“, fragte DuVall.
„Ich glaube, den hat er vergessen. Nennen Sie ihn Gunlock, ganz einfach nur Gunlock.“
*
Gunlock war wach, neben ihm im Bett lag Monique Vincent, eine rassige, zweiunddreißigjährige Frau, die im Last Chance Saloon am Black Jack-Tisch die Bank hielt. Auch die Frau hatte die Augen geöffnet. „Wie lange wirst du dieses Mal in Santa Fe bleiben, Gunlock?“, fragte sie. „Die Tage, Wochen und oftmals Monate, in denen du unterwegs bist, sind für mich Tage, Wochen und Monate voller Ängste und Sorgen deinetwegen. Ich weiß nie, ob du zurückkehrst. Während ich voll Sehnsucht auf dich warte, bleichen deine Knochen vielleicht schon irgendwo in der Wildnis und ich werde nie erfahren, was aus dir geworden ist.“
„Bis jetzt bin ich ja immer wieder zurückgekommen“, versetzte Gunlock grinsend, richtete sich etwas auf und beugte sich über sie. Sein Gesicht war nur wenige Handbreit über dem ihren. „Kennst du das Sprichwort: Unkraut vergeht nicht? Ja? Nun, es ist auf mich anwendbar.“
„Du bist kein Unkraut, Darling.“ Jetzt lächelte auch sie. „Und du wärst sicher ein ganz brauchbarer Hombre, wenn du dich endlich einmal entscheiden könntest, an einem Platz zu bleiben, dir einen vernünftigen Job zu suchen, eine Familie zu gründen und …“
Jemand klopfte an die Tür und Monique verstummte.
Gunlock wälzte sich auf den Rücken, stemmte mit beiden Ellenbogen den Oberkörper etwas in die Höhe und rief: „Wer ist da?“
„Der Sheriff. Sind Sie einen Moment zu sprechen, Gunlock?“
Der Abenteurer drehte den Kopf zu Monique herum und flüsterte: „Wir – hm, unterhalten uns gleich weiter, Sweetheart. Aber wenn der Sheriff persönlich zu mir kommt, dann hat das sicher einen ganz besonderen Grund.“ Mit erhobener Stimme rief er: „Einen Moment, Sheriff, ich ziehe mir nur etwas an.“
Er stieg aus dem Bett, schlüpfte in Unterhose und Hose, schloss sie, ging zu Tür, entriegelte und öffnete sie und stand dem Sheriff gegenüber. Der konnte über Gunlocks Schulter hinweg einen Blick auf die Frau im Bett erhaschen und lüftete mit einer Geste der Verlegenheit seinen Hut.
„Worum geht es, Sheriff?“
„Um einen lukrativen Job, Gunlock. Am nördlichen Stadtrand stehen vierzehn Prärieschoner, die morgen Früh nach Fort Laramie auf den Trail gehen, um von dort aus ins gelobte Land zu ziehen.“
„Ins gelobte Land?“, knurrte Gunlock. „Sie meinen Oregon, Sheriff, nicht wahr?“
„Ja. Dort sollen bekanntlich Milch und Honig fließen.“ Der Gesetzeshüter zuckte mit den Schultern. „Vielleicht ist das wirklich so. Ich weiß es nicht. Nun, die beiden Kerle, die der Treckführer als Scouts angeheuert hat, sitzen im Gefängnis, denn sie haben gestern Abend einen meiner Deputys erschossen. Nun brauchen die Auswanderer jemand, der den Treck führt. Einen erfahrenen Mann, dessen Dienste sie sich auch etwas kosten lassen. Für jede Meile zahlen sie einen Dollar.“
„Was heißt das unter’m Strich?“, fragte Gunlock.
„Zwischen elf- und zwölfhundert Bucks“, antwortete der Sheriff.
„Nicht schlecht“, entfuhr es Gunlock.
„Denken Sie darüber nach“, meinte der Sheriff. „Sollten Sie interessiert sein, wenden Sie sich an einen Mann namens DuVall. Er ist der Treckführer. Aber denken Sie nicht zu lange drüber nach, Gunlock. Die Prärieschoner sollen morgen Früh schon auf den Weg gebracht werden.“
„So ein Angebot kriegt man nicht alle Tage“, murmelte Gunlock. „Ich glaube, ich habe mich schon entschieden.“
„Wie gesagt, Gunlock: Der Mann heißt DuVall. Die Fuhrwerke stehen am nördlichen Stadtrand. Ich glaube, das sagte ich bereits. Nun, Sie wissen Bescheid. Einen schönen Tag noch, Gunlock.“
„Danke, auch Ihnen einen schönen Tag, Sheriff.“ Gunlock drückte die Tür zu und wandte sich der schönen Frau im Bett zu. Doch ehe er etwas sagen konnte, stieß sie hervor:
„Du wirst also wieder für viele Wochen weg sein, Darling. Fällt es dir denn wirklich so schwer, einmal auch nein zu sagen? Weißt du überhaupt, worauf du dich einlässt?“
„Sicher.“ Er ging zu dem Stuhl, über dessen Lehne sein Hemd und der Gehrock hingen, zog Hose und Unterhose aus und glitt nackt zum Bett. „Lass uns die kurze Zeit noch nutzen, die uns bleibt. Denn es wird ein paar Dinge zu regeln geben mit diesem DuVall.“
Er beugte sich über sie, seine Lippen fanden die ihren, der Kuss gewann an Leidenschaft, wurde fordernd und Gunlocks Hände begannen den Körper der Frau abzutasten, fanden die erogenen Zonen und stimulierten sie.
Monique begann leise zu stöhnen; Zeichen dafür, wie gut ihr seine Berührungen taten. Seine Lippen lösten sich von ihrem Mund, zogen eine feuchte Spur über ihren schlanken Hals, ihre Brust, küssten ihren flachen Leib und suchten sich wieder einen Weg zurück zu ihrem Mund. Sie hatte die Augen geschlossen und ließ sich in dem wohligen Gefühl, das seine Hände und seine Lippen verursachten, treiben.
Seine Hand suchte einen Weg zwischen ihre Oberschenkel, sein Mittelfinger legte sich zwischen ihre vor Wollust geschwollenen Schamlippen, die feucht und empfangsbereit waren, und dann begann seine Fingerkuppe ihren Kitzler zu reiben, was ihr Stöhnen intensivierte. Ihre Beine begannen zu zucken, denn das Prickeln, das sein Finger verursachte, war regelrecht elektrisierend und ließ die Nerven in ihrem gesamten Körper vibrieren.
Sein Vorspiel brachte sie an den Rand des Höhepunkts, ehe es jedoch so weit war, kniete er zwischen ihren Beinen und drang in sie ein. Seine Männlichkeit war zur vollen Größe ausgefahren und hart wie ein Stück Holz. Die Geilheit produzierte in ihrer Scheide ein Übermaß an Flüssigkeit, sodass sein steifes Glied ohne jede Behinderung tief in sie hineinglitt.
Gunlock begann zu stoßen. Langsam, genüsslich, dennoch rhythmisch und mit Intensität. Eng umschloss ihre Vagina seinen Penis, er spürte das Spiel der Muskulatur ihrer Scheidenwände und wollte dieses Lustempfinden so lange wie nur möglich hinauszögern.
Ihre Finger verkrallten sich in seinem Rücken, tief bohrten sich ihre Nägel in seine Haut. Er ignorierte den Schmerz. Seine Stöße wurden schneller und härter, Monique begann kurze, spitze Schreie auszustoßen und klammerte sich an ihn. Immer wieder trieb er seinen Freudenspender tief in sie hinein und brachte etwas in ihr zum Schwingen, das sie wie eine Flutwelle überspülte und mit sich fortriss. Ihr Orgasmus war wie eine Eruption und auf besondere Art befreiend, und in das abflauende Hochgefühl hinein entlud er sich. Es war, als würde der Überdruck einem Dampfkessel entweichen. In mehreren Stößen pulsierte sein Sperma in sie hinein, und jede Entladung wurde von einem heftigen Juckreiz begleitet, der Gunlock ächzen ließ. Schließlich rollte er von ihr herunter.
„Ich werde es vermissen“, murmelte Monique. „Aber ich glaube, es hat keinen Sinn, dich zu bitten, den Job nicht anzunehmen.“
„Wie gut du mich kennst“, antwortete er, drückte sich hoch und küsste sie. Dadurch, dass sie seine Küsse erwiderte, signalisierte sie, dass sie bereit war, das Liebesspiel fortzusetzen. Gunlock schien nicht müde zu werden, und Monique konnte nicht genug kriegen von ihm.
Ein Abschied für längere Zeit stand bevor, und beide gaben alles, was sie zu geben vermochten.
*
Es war Mittag, als Gunlock das Camp der Auswanderer aufsuchte. Die Prärieschoner standen in Reih und Glied, die Ochsen, Maultiere und Pferde, die die Fuhrwerke ziehen sollten, weideten in getrennten Corrals, es gab aber auch provisorische Koppeln und Pferche für die Rinder, Schafe und Ziegen. Hühner gackerten in großen Kisten, auf denen als Deckel aus Latten gefertigte Rahmen lagen, die mit Drahtgeflecht bespannt waren, damit das Federvieh Licht und Luft bekam.
Kochfeuer brannten. Über den Flammen waren eiserne Dreibeine aufgestellt. Von ihnen hingen an Ketten verrußte Kochplatten, auf welchen Töpfe oder Pfannen standen, in denen die Mahlzeiten brieten oder garten. Der Geruch von kochendem Gemüse und bratendem Fleisch zog durch das Camp.
Der große Mann im weißen Hemd unter dem schwarzen Gehrock, mit dem schwarzen, flachkronigen Stetson auf dem Kopf und den beiden schweren, langläufigen Coltrevolvern am Patronengurt erregte Aufsehen. Er zog die Blicke aller an wie ein Magnet. Bei einer etwa dreißigjährigen Frau, deren lange, dunkelblonde Haare am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengesteckt waren und an deren Feuer ein etwa achtjähriger Junge und ein etwas jüngeres Mädchen saßen, erkundigte sich Gunlock nach Jacob DuVall. Die hübsche Lady sagte: „Es ist das letzte Fahrzeug in der Reihe.“ Dabei wies sie in die Richtung, in die Gunlock gehen musste, um zu dem Fuhrwerk zu gelangen. „Sie sind sicher der Mann, den der Sheriff fragen wollte, ob er an dem Kundschafterjob, den wir zu vergeben haben, interessiert ist“, sagte sie und lächelte.
„So ist es“, antwortete er, griff nach dem Hut und lüftete ihn ein wenig. Was er sah, gefiel ihm, und unwillkürlich hielt er Ausschau nach dem Mann, der zu der Frau und ihren Kindern gehören mochte. „Man nennt mich Gunlock, Ma’am.“
„Und, Gunlock, sind Sie interessiert?“
Jetzt lächelte auch er. Es war, als wäre ein Funke übergesprungen. „Ich denke schon. Aber ehe ich mich entscheide, werde ich mich mit Mister DuVall unterhalten. Wir werden sehen.“
Er griff wieder an den Hut, dann ging er weiter. Ihr Blick folgte ihm. Sie hatte sich innerhalb kürzester Zeit ein Bild von ihm gemacht. Sein Gang war aufrecht, der Blick seiner blauen Augen war ihr regelrecht unter die Haut gegangen, und sie sagte sich, dass er sicherlich über ein hohes Maß an Energie und Durchsetzungsvermögen verfügte und dass man ihm in jeder Situation Vertrauen schenken konnte. Unwillkürlich keimte in ihr die Hoffnung, dass er den Job annahm. Sie kannte ihn nicht, spürte aber, dass er stark war, Sicherheit verlieh und Ruhe vermittelte.
Bei dem bezeichneten Fuhrwerk traf Gunlock auf den grauhaarigen Zweiundfünfzigjährigen, von dem ihm der Sheriff erzählt hatte und zu dem ihm die hübsche, beachtenswerte Lady eben den Weg gewiesen hatte. Am Feuer saßen auch eine blondhaarige junge Frau, mehr noch eine Halbwüchsige, und die etwas ältere Ausgabe von ihr, und Gunlock musste nicht raten, um zu wissen, dass es sich um die Gattin und die Tochter des Treckführers handelte. Und wieder griff er nach dem Stetson, lüftete ihn und grüßte, dann sagte er: „Sie sind sicher Mister DuVall. Mein Name ist Gunlock.“
Einen Augenblick lang maß ihn der Treckführer von oben bis unten, schien ihn einzuschätzen, forschte kurz in seinem Gesicht, dann erwiderte er: „Freut mich, Gunlock. Der Sheriff hat sie mir als einen Mann mit Trailerfahrung geschildert. Ihr Habit allerdings erinnert eher an einen Spieler. Nehmen Sie’s mir nicht krumm, aber ich sage immer, was ich denke.“
„Lassen Sie sich nicht von meiner Kleidung täuschen, Sir. Es ist tatsächlich so, dass ich über die nötige Erfahrung verfüge, um einen Treck zu führen. Es ist sicherlich auch nicht notwendig, Ihnen aufzuzählen, wie oft ich schon verschiedene Trecks sicher ans Ziel gebracht habe. Pro Meile einen Dollar – das ist das Angebot. Bleibt es dabei?“
„Natürlich.“
„Dann bin ich Ihr Mann, es sei denn, sie trauen es mir wegen des Gehrocks nicht zu, den Wagenzug zu führen. Sie können mich als Scout haben, wenn Sie mich wollen. Wenn nicht, gehe ich wieder. Sie sagen doch immer, was Sie denken. Also halten Sie auch jetzt nicht mit Ihrer Meinung hinter dem Berg, Sir.“
Erneut forschte der Treckführer eine ganze Weile in Gunlocks Gesicht. Und er glaubte erkennen zu können, dass dieser Mann hielt, was er versprach. Daher nickte er und sagte: „Es ist in Ordnung. Sie sind unser Mann. Einen Dollar pro Meile, außerdem verpflegen wir Sie. Morgen Früh, wenn es hell wird, brechen wir auf. Ist das für Sie in Ordnung, Gunlock?“
„Ich werde da sein.“ Gunlock wandte sich um und schritt wieder stadteinwärts.
Joana DuVall nickte und sagte: „Das ist kein Mann vieler Worte. Mit dem haben wir, glaube ich, einen guten Fang gemacht. Ich bin zufrieden.“
Verträumt schaute die achtzehnjährige Kathleen DuVall dem großen Mann hinterher. Ihrem Vater entging es nicht und seine Brauen schoben sich finster zusammen.
*
Am Morgen, als sich Gunlock beim Aussiedlercamp einfand, regnete es. Es war kühl und der schneidende Westwind verstärkte dieses Empfinden noch. Die Fuhrwerke bildeten jetzt eine lange Reihe. Ochsen, Maultiere und Pferde waren schon eingeschirrt, die kleinen Rinder-, Schaf- und Ziegenherden wurden von einigen Halbwüchsigen zusammengehalten.
Die Auswanderer waren abmarschbereit. Nachdem er einige Worte mit DuVall gewechselt hatte, setzte sich Gunlock mit seinem Rappen vor den Zug.
Der Boden war aufgeweicht vom Regen der vergangenen Nacht. Tief sanken die eisenumreiften Wagenräder ein. Die Peitschen der Wagenlenker knallten wie Revolverschüsse. Neben den Fuhrwerken schritten Frauen und Kinder. Die Frauen hatten sich die Hüte mit Tüchern, die sie unter dem Kinn verknotet hatten, festgebunden, damit sie ihnen der scharfe Wind nicht vom Kopf riss.
Da die Erde nass war, wirbelten sie keinen Staub auf. Das schmierige, aufgeweichte Erdreich würde von den Gespanntieren das Doppelte an Kraft und Ausdauer fordern. Von den tiefziehenden Wolken verborgen stieg im Osten die Sonne über den Horizont.
Fast zwölfhundert Meilen, gepflastert mit tödlichen Gefahren, lagen vor den Menschen, die der Traum von Frieden und einer soliden Existenz im fernen Oregon leitete und lenkte. Meilen, auf denen Gefahr und Tod allgegenwärtig waren.
Das Poltern der Räder, das Quietschen der Achsen, das Ächzen der Wagenaufbauten und das Schlagen der Planen entfernten sich langsam, und die wenigen Menschen, die gekommen waren, um den Abmarsch des Auswanderertrecks zu beobachten, kehrten in die Stadt zurück.
Die Berge der Sange de Cristo Kette im Osten waren dunkle, drohende Silhouetten vor bleigrauem Hintergrund. Der Morgendunst hüllte die Bäume und Sträucher ein, zwischen denen weiße Nebelschwaden hingen. Es war ein Wetter, in dem man keinen Hund vor die Tür jagte.
Die Fuhrleute feuerten die Gespanne mit ihren Peitschen und den Zügelleinen an. Heisere Rufe vermischten sich mit dem Rumpeln der Fuhrwerke und dem Stampfen der Hufe. Ein schmaler Creek tauchte vor ihnen auf und Gunlock ritt ohne anzuhalten hinein, erkundete die Tiefe des Flüsschens bis zum anderen Ufer und winkte schließlich von drüben.
Jacob DuVall schwang die Peitsche und die Maultiere stampften in das Flussbett hinein. Der Wagen neigte sich nach vorn, als die vorderen Räder die niedrige Uferböschung hinunterrollten und ein Ruck ging durch das Gefährt. Ein zweiter Ruck folgte, als auch die hinteren Räder das abschüssige Stück hinunterrumpelten. Dann umspielte das Flusswasser die Felgen und Speichen bis hinauf zur Nabe, staute sich und bildete kleine Wirbel.
Der Fluss war nicht sehr breit. Bald hatten sich alle Wagen auf der anderen Seite eingefunden.
Dann ging es weiter. In kerzengerader Linie nach Norden. Im Westen tauchten teilweise bewaldete Höhenzüge auf …
Sie schafften an diesem Tag ungefähr fünfzehn Meilen. Und als es düster wurde, bildeten sie bei einem schmalen Fluss eine Wagenburg. Die Zugtiere wurden ausgeschirrt und in einen Seilcorral geführt, der zum Creek hin offen war.
Die Schatten der Abenddämmerung breiteten sich sehr schnell in dem Tal zwischen den Gebirgszügen aus. Feuer wurden angezündet, eiserne Dreibeine aufgestellt.
Gunlock band seinen Hengst an eines Räder von DuValls Conestoga-Schoner, ging zu dem Siedlerführer hin, der beim Feuer kauerte, und sagte: „Bis zur Grenze von Colorado sind es noch gut siebzig Meilen. Wenn wir weiterhin nur fünfzehn Meilen am Tag schaffen benötigen wir knapp fünf Tage.“
„Wir werden es in vier Tagen schaffen, Gunlock“, versicherte DuVall. „Morgen machen wir Tempo. Mit Rothäuten müssen wir ja noch nicht rechnen. Haben Sie eine Ahnung, wie es in Colorado sein wird?“
„Was meinen Sie? Die Wegverhältnisse oder die Indianer?“, fragte Gunlock.
„Der Weg ist beschwerlich, denn wir befinden uns mitten in den Rockys. Darüber brauchen wir kein Wort zu verlieren. Ich spreche von den Rothäuten.“
„Wir könnten es mit einigen aufrührerischen Jicarillas zu tun kriegen, weiter nördlich möglicherweise auch mit renitenten Cheyenne oder Arapahos. Normalerweise aber sind alle diese Stämme befriedet, leben in Reservaten und lassen die Weißen in Ruhe.“
„Die Menschen hier verlassen sich auf Sie, Gunlock. Auch ich setze mein Vertrauen in Sie.“
„Ich werde Sie nicht enttäuschen, DuVall.“
Während er mit dem Treckführer sprach, ließ Kathleen den Revolvermann nicht einen Moment aus den Augen. Sie war hübsch, sympathisch, hatte blonde Haare, die in weichen Locken auf ihren Rücken und ihre Schultern fielen, und es war offensichtlich, dass sie an dem großen Mann mit den schwarzen Haaren und den blauen Augen Gefallen fand.
DuVall schien es nicht zu entgehen, denn er schoss seiner Tochter einen strafenden Blick zu und über sein Gesicht schien ein düsterer Schatten zu huschen.
„Ich mache mich mal mit den Leuten bekannt“, gab Gunlock zu verstehen, tippte mit dem Zeigefinger an die Krempe seines Stetsons und entfernte sich.
DuVall stapfte zu Kathleen hin, die am Rand des Feuerscheins beim Fuhrwerk stand, und sagte: „Schlag dir diesen Mann aus dem Kopf, Tochter. Er ist ein Revolverschwinger und Abenteurer und eine Frau wird mit dieser Sorte Mann nur unglücklich. Außerdem bist du Rick versprochen. Vergiss das nicht.“
Kathleen errötete und wandte sich schnell ab.
Gunlock ging von Feuer zu Feuer, sprach mit den Leuten, machte ihnen Mut und gelangte schließlich zum Fuhrwerk jener Frau, die ihm am Vortag den Weg zu DuValls Fuhrwerk gewiesen hatte. Sie saß mit ihren beiden Kindern am Feuer, über dem ein Kessel hing, in dem sie Gemüse gekocht hatte. Es war jetzt ziemlich düster und die Flammen erzeugten am Boden ein unruhiges Licht- und Schattenspiel. In den Augen der Frau spiegelte sich das Feuer wider. „Hallo“, grüßte Gunlock. „Wir kennen uns bereits.“ Er griff zum Hut und lüftete ihn, dabei schaute er sich um. „Wie schon gestern sehe ich auch jetzt keinen Mann bei ihrem Schoner. Fahren Sie denn alleine mit ihren Kindern?“
Sie nickte. „Mein Name ist Parrish – Karen Parrish. Mein Mann ist tot. Er starb vor vier Jahren.“
„Oh, das tut mir leid.“
„Wir hatten eine Farm in Texas“, gab sie zu verstehen. „Nachdem Jim tot war, versuchte ich, sie alleine zu bewirtschaften. Nach über drei Jahren aber stellte ich fest, dass es nicht zu bewältigen war. Außerdem gab es einen Rancher, der mir das Leben schwer machte. Also bin ich dem Aufruf DuValls gefolgt, habe alles verkauft, und nun will ich versuchen, mit meinen Kindern in Oregon neu zu beginnen.“
„Das imponiert mir“, sagte Gunlock und er meinte es ehrlich. „Es wird aber nicht leicht werden für Sie, Ma’am. Der Trail wird von jedem von uns das Letzte fordern, und er macht keinen Unterschied zwischen Mann und Frau, stark oder schwach. Sollten Sie Hilfe benötigen, dann lassen Sie es mich wissen. Ich werde dann zur Stelle sein.“
„Danke, Gunlock. Wenn es notwendig werden sollte, komme ich gerne auf ihr Angebot zurück.“ Sie lächelte ihn an und er spürte ganz deutlich, wie sehr er sich zu ihr hingezogen fühlte. Sie hatte etwas an sich, das ihn faszinierte, das ihn in ihren Bann zog. Diese Frau schien mit beiden Beinen im Leben zu stehen. Die Entscheidung, mit zwei Kindern das Wagnis einzugehen, zwölfhundert Meilen härtesten Trails auf sich zu nehmen, um irgendwo in Oregon sozusagen wieder von Null anzufangen, war ihr sicher nicht leicht gefallen. Es nötigte ihm großen Respekt ab.
„Ich bitte darum“, sagte er, dann ging er weiter. Als es schon finster war, kehrte er zum Fuhrwerk DuValls zurück. „Ich habe mit den Leuten gesprochen“, sagte er. „Und alle scheinen zu wissen, was auf sie zukommt. Das ist gut. Denn der Trail wird alles andere als ein Zuckerschlecken.“
„Dahingehend habe ich keinem von denen, die mit uns fahren, falsche Hoffnungen gemacht“, knurrte DuVall. „Jeder von den Leuten ist fest entschlossen, sich durchzubeißen.“
„Setzen Sie sich, Gunlock“, rief Joana, die Gattin des Siedlerführers. „Sie sind sicher hungrig. Ich bringe Ihnen einen Teller voll Stew.“
Bald erloschen die Feuer und im Camp kehrte Ruhe ein. Der nächste Tag würde wieder hart werden und den Menschen viel an Kraft und Energie abverlangen. Zwei Männer mit Gewehren patrouillierten um die Wagenburg. In den Hügeln heulten Wölfe und Coyoten einen schauerlichen Choral.
*
Als der Tag anbrach, waren sie wieder auf dem Trail. Ein warmer Wind aus dem Süden hatte die Wolken vertrieben und der Himmel zeigte sich in strahlendem Blau.
Die Zugtiere trotteten in stupider Gleichmäßigkeit vorwärts. Das Gelände stieg stetig an. Um sie war die bizarre Bergwelt der Rocky Mountains. Auf den Gipfeln lag ewiger Schnee.
Gunlock trieb die Wagenlenker zur Eile an. Ein Steilhang vor ihnen musste in voller Fahrt überquert werden. Die Fuhrwerke durften nicht aus dem Schwung kommen, daher galt es zu verhindern, dass die Tiere ins Schritttempo zurückfielen. Denn wenn der Zug erst ins Stocken geriet und möglicherweise sogar zum Stehen kam, würden sie viele Stunden, vielleicht sogar einen ganzen Tag verlieren.
Mit heiserem Gebrüll trieben die Männer auf den Böcken die Ochsen, Pferde und Maultiere an. Die Räder drehten sich kaum schneller. Aber die Tiere legten sich in die Geschirre und stemmten die Hinterbeine wie Säulen gegen das Gefälle. Peitschenschnüre knallten über ihren Rücken, die Leinen waren zum Zerreißen gespannt und knarrten bedenklich in den Sielen.
„Vorwärts! Nicht nachlassen! Treibt sie an! Sie dürfen nicht stehenbleiben!“ Gunlock schrie sich fast die Seele aus dem Leib.
Unerbittlich wurden die Tiere vorangepeitscht. Schaum trat vor ihre Nüstern und tropfte zu Boden. Die Fuhrwerke schaukelten, rumpelten und knarrten, und die Männer auf den Wagenböcken wurden durch und durch geschüttelt.
Schließlich erreichte das erste Fuhrwerk den Kamm der Anhöhe. Es donnerte darüber hinweg und wurde auf dem sich anschließenden Plateau sofort zur Seite gelenkt, um Platz für das nächste zu schaffen.
Der Prärieschoner mit Karen Parrish auf dem Wagenbock polterte an Gunlock vorbei. Die Frau hielt die langen Zügel mit beiden Händen fest umklammert. Jeder Zug in ihrem Gesicht verriet Anspannung, unablässig ließ sie die Leinen auf die Rücken der Maultiere klatschen, die vor ihren Schoner gespannt waren. „Lauft, lauft!“, brüllte sie schrill und wurde hin und her geworfen. Von ihren beiden Kindern war nichts zu sehen. Sie befanden sich auf der Ladefläche.
Aber die Maultiere wurden langsamer, denn einer der Vierbeiner begann, aus der Reihe zu tanzen und zu scheuen. Gunlock sah es, trieb sein Pferd neben das Fuhrwerk, schüttelte die Steigbügel von den Füßen und schwang sich trotz der nach wie vor wilden Fahrt hinüber auf den Wagenbock. „Geben Sie mir die Zügel!“, schrie er. Dann hielt er die schweren Lederleinen in den Fäusten und peitschte damit die Tiere, breitbeinig und geduckt auf dem Bock stehend, von dem Willen beseelt, auf jeden Fall zu verhindern, dass der Wagenzug hier auf dem Hang zum Stehen kam.
Das störrische Maultier kam wieder zur Vernunft, und sie schafften es. Mit weit aufgerissenen Mäulern kamen die Zugtiere oben an. Gunlock reichte Karen die Leinen, für einen Moment schauten sie sich dabei in die Augen und er las etwas, das möglicherweise Dankbarkeit zum Ausdruck brachte, vielleicht aber auch mehr. Er versetzte ihr einen leichten, aufmunternden Klaps gegen den Oberarm, lächelte und sprang dann vom Fuhrwerk, lief zu seinem Pferd, das daneben hergaloppiert war und kam mit einem kraftvollen Satz in den Sattel. Er ritt zurück, um die anderen Gespanne anzufeuern.
Schließlich war auch der letzte Wagen oben. Obwohl es kühl war schwitzten Menschen und Tiere. Die Zugtiere röchelten und röhrten. Nach einer Stunde Pause ging es weiter. Unermüdlich zogen sie, bis die Nacht kam, dann fuhren sie die Gefährte in einem Hochtal zu einem engen Kreis zusammen und schließlich schloss sich auch die letzte Lücke.
Auch diese Nacht verlief ruhig und ohne Zwischenfälle. Die Menschen lagen in einem totenähnlichen Schlaf. Sie waren erschöpft. Die Strapazen waren schon am zweiten Tag härter geworden, verlangten von jedem das Letzte und gingen an die Substanz.
Am übernächsten Tag wand sich die Schlange der Fuhrwerke in eine Schlucht hinein, durch die der Rio Grande seine Wasser nach Süden wälzte. Sie wollten dem Fluss bis zur Mündung des Rio Chama folgen, um sich schließlich zwischen den beiden Flüssen in gerade Linie nach Norden zu wenden.
An den Felswänden waren noch die Schlammspuren zu sehen, die verrieten, wie hoch die Schmelzwasser im Frühjahr noch die Schlucht überschwemmt hatten. Von den Bergen heruntergespültes Geröll lag überall herum und musste oftmals erst zur Seite geräumt werden, damit die schwerfälligen, kaum zu manövrierenden Gefährte passieren konnten. Sie zogen auf dem natürlichen Weg zwischen dem tosenden und schäumenden Fluss und der zerklüfteten Felswand rechter Hand entlang.
Noch war die Schlucht ziemlich breit und problemlos passierbar. Die Kolonne aus Planwagen und Tieren folgte Gunlock. Den Schluss bildeten die Herden. Schließlich floss der Rio Grande um eine Krümmung und eine Felswand schob sich bis an das Ufer heran. Angeschwemmte Äste, von denen die Rinde längst abgefallen war, lagen auf der sandigen Uferbank zwischen dem Geröll und erinnerten an ausgebleichte Gebeine.
Der gerade Weg war ihnen versperrt. Nach rechts aber öffnete sich eine Schlucht, in die Gunlock kurz entschlossen das Pferd trieb und den Windungen zwischen den Felsen und Hügeln folgte. Irgendwann schwenkte er wieder nach links ein, und sie zogen die Route parallel zum Rio Grande, von dem den Wagenzug unüberwindbar anmutende Felsketten trennten, nach Norden. Die lange Planwagenkette folgte Gunlock in einigem Abstand.
Der Abend nahte. Die Konturen wurden unscharf, denn grauer Dunst verzerrte die Umrisse der Felsen, die den Trail säumten. Dahinter erhob sich grau in grau die schweigende Bergwelt.
Als sie in einer Senke lagerten, war die Sonne hinter dem bizarren Horizont im Westen verschwunden und der Himmel schien in ihrem Widerschein zu bluten. Rötliches Licht lag auf den Westhängen und den Felswänden der Sange de Cristo Kette, die sich wie ein unüberwindliches Bollwerk östlich von ihnen erstreckte.
Sie hatten die Fuhrwerke wieder zu einem Kreis zusammengefahren. Gunlock ritt von Wagen zu Wagen. Die Menschen waren erschöpft, doch keiner klagte. Beim Prärieschoner Karen Parrish’ angekommen saß der Revolvermann ab. Sie hatte ein Feuer entfacht und das Dreibein aufgestellt. Die hintere Bordwand des Fuhrwerks war heruntergeklappt. Karen benutzte sie wie einen Tisch, auf dem sie das Abendessen für sich und ihre Kinder zubereitete.
Die Kinder standen bei ihr und schauten ihr zu. Als sich Gunlock näherte drehten sich die drei zu ihm herum und in Karens braunen Augen blitzte es erfreut auf. „Ah, Gunlock, vielen Dank für Ihre Hilfe heute. Diese störrischen Viecher wollten einfach nicht so wie ich.“
Sie wirkte ein wenig hilflos und verlegen.
„War doch selbstverständlich“, gab er zu verstehen, nachdem sie schwieg, und fügte sogleich hinzu: „Sie schlagen sich tapfer Ma’am. Meine Hochachtung. Wir haben gestern und heute an die vierzig Meilen geschafft. Wenn wir das Tempo beibehalten können, sind wir tatsächlich übermorgen am späten Nachmittag oder gegen Abend in Fort Laramie.“
„Möchten Sie mit uns zu Abend essen, Gunlock? Es gibt Gemüse mit Fleisch.“ Sie schaute ihn an und zögerte, die nächsten Worte auszusprechen, schließlich aber stieß sie dennoch hervor: „Ich würde mich freuen.“
„Ich nehme Ihre Einladung gerne an, Karen. Darf ich Karen zu Ihnen sagen?“
Sie lächelte. „Natürlich. Lassen wir die Förmlichkeiten einfach weg.“
Gunlock führte den Hengst zu einem der Räder und band ihn an. Der achtjährige Jimmy näherte sich ihm, schaute an dem Mann in die Höhe und sagte: „Den würde ich gerne einmal reiten, Mister. Glauben Sie, dass er mich auf seinem Rücken duldet?“
„Wenn ich es ihm sage – sicher“, antwortete Gunlock lächelnd und strich dem Knaben über die blonden Haare. „Morgen nehme ich dich ein Stück mit. Einverstanden?“
„Ja, ja! Ma, hast du gehört, ich darf ein Stück mit Gunlock reiten.“ Der Junge war außer sich vor Freude.
Karen hatte das Gesicht in die Richtung ihres Sohnes und Gunlocks gedreht, und der Blick, den Gunlock jetzt auffing, enthielt einen Ausdruck, der ihm zu denken gab. War es Wärme gewesen, die er darin zu lesen glaubte, Schmermut, Hoffnungslosigkeit, oder - Sehnsucht? Er konnte diesen Blick nicht deuten, doch er ging ihm nicht mehr aus dem Kopf.
Er lockerte den Bauchgurt des Sattels, um auch seinem Pferd etwas Bequemlichkeit zu verschaffen, dann drehte er sich eine Zigarette und rauchte. Karen wandte ihm jetzt wieder den Rücken zu. Er beobachtete sie und musste sich eingestehen, dass sie ihn heute noch mehr faszinierte als an den vorangegangenen Tagen, und er begann sich vorzustellen, wie es wäre, sie in den Armen zu halten.
Als hätte sie seinen forschenden Blick gespürt drehte sie den Kopf und schaute ihn an. Und wieder konnte er diesen seltsamen Ausdruck in der Tiefe ihrer Augen wahrnehmen …
*
Es war dunkel, als Gunlock zum Fuhrwerk DuValls kam. Er führte sein Pferd am Kopfgeschirr. Das Feuer war heruntergebrannt und der Siedlerführer sowie seine Gattin waren schon in dem Zelt verschwunden, das neben dem Prärieschoner aufgestellt worden war.
Gunlock nahm dem Rappen den Sattel ab, band das Pferd an einem Strauch fest und hobbelte ihm die Beine. Es gab in der Bergwildnis Pumas und Wölfe, und wenn so ein Raubtier in die Nähe des Rappen kommen würde, gäbe es selbst für dieses kluge Tier kein Halten mehr. Indem er, Gunlock, dem Tier die Vorderbeine so zusammenband, dass es nur kleine Schritte machen konnte, verhinderte er eine panische Flucht.
Gunlock legte den Sattel unter das Fuhrwerk und breitete seine Decke aus. An die zwölf Stunden im Sattel forderten auch von ihm seinen Tribut. Er nahm den Revolvergurt ab, zog den Gehrock und die Stiefel aus und rollte sich in die Decke.
Als er am Einschlafen war, hörte er jemand unter den Wagen kriechen. „Gunlock!“, wisperte eine Stimme.
Es war Kathleens Stimme. „Was ist? Warum schlafen Sie nicht, Kathleen? Der Tag morgen …“
„Darf ich mich neben dich legen, Gunlock?“
„Es wäre nicht gut, wenn Sie Ihr Vater hier unten bei mir antreffen würde“, murmelte Gunlock. „Ich glaube nicht, dass er begeistert …“
Plötzlich spürte er Kathleens Lippen auf den seinen; mit ihrem Kuss verschloss sie ihm regelrecht den Mund. Aber er machte sich mit sanfter Gewalt frei, drückte sie von sich weg und stieß hervor: „Lassen Sie das, Kathleen. Ich will keinen Ärger mit Ihrem Vater. Den bekomme ich aber, wenn er uns beide hier unten erwischt.“
„Ich habe dich gesehen, als du gekommen bist, um dich bei meinem Vater vorzustellen, und war vom ersten Moment an in dich verliebt.“ Wieder versuchte sie ihn zu küssen, und er spürte ihre Hand auf der Stelle, an der sein bestes Stück in der Hose ruhte.
„Bitte, Kathleen, lassen Sie das. Ich will es nicht. Ihr Vater …“
„Er schläft, Gunlock. Warum willst du es nicht? Du bist doch ein Mann, ein richtiger Mann. Ist es wegen der Frau mit den beiden Kindern? Du warst den ganzen Abend bei ihr und …“
„Komm sofort unter dem Wagen hervor, Kathleen!“, erklang das zornige Organ Jacob DuValls. „Willst du mir und deiner Mutter Schande bereiten? Komm sofort hervor, steig auf den Wagen und bleib dort oben.“
Kathleen stieß scharf die Luft durch die Nase aus.
„Gehen Sie schon!“, gebot Gunlock.
„Ich komme wieder“, raunte sie ihm zu, dann kroch sie davon.
„Verdammt, Tochter!“, hörte der Revolvermann den grollenden Bass des Siedlerführers. „Kannst du es denn nicht lassen? Musst du dich jedem Kerl, der dir über den Weg läuft, an den Hals werfen? Denkst du denn nicht an Rick, der dich liebt und der nach Oregon kommen wird, sobald sein Dienst beendet ist?“
„Rick! Rick! Rick!“, keifte sie. „Ich will ihn nicht, und ich habe dir das schon hundertmal zu verstehen gegeben. Er soll bleiben, wo er ist. Ich suche mir den Mann, den ich heiraten will, selbst aus. Du kannst mir mit deinem dämlichen Rick gestohlen bleiben.“
Gunlock hörte über sich Rumoren und glaubte daraus entnehmen zu können, dass Kathleen auf die Ladefläche des Fuhrwerks geklettert war, wo sie ihr Nachtlager eingerichtet hatte.
„Gunlock!“, rief DuVall leise.