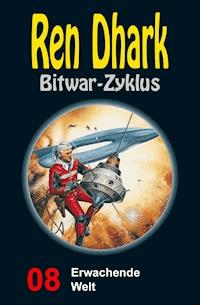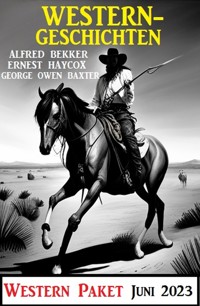
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alfredbooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dieses Buch enthält folgende Western: Alfred Bekker: Entscheidung am Salt Lake Alfred Bekker: Dunkler Prediger Alfred Bekker: Die Wahl des Bürgermeisters Alfred Bekker: Der Goldgräber Alfred Bekker: Der Regenmacher Alfred Bekker: Der späte Sieg des roten Mannes Alfred Bekker: Das heiße Spiel von Dorothy Ernest Haycox: Wild genug Ernest Haycox: Wenn du den Stern trägst Ernest Haycox: Nachricht an den General George Owen Baxter: Sein Kampf um Gnade "Du spielst falsch, Hombre!" Der Blick des Einäugigen war eisig. Noch hatte er die Rechte auf dem Tisch und nicht am tiefgeschnallten Revolverholster. Rechts und links von ihm saßen zwei seiner Kumpane, mit denen zusammen er am Mittag aus der Postkutsche gestiegen war. Sie trugen - ebenso wie der Einäugige - dunkle, etwas abgeschabte Anzüge. Und Revolver. Gunslinger waren sie, Männer die sich für ein paar Dollars von jedem anheuern ließen, der bereit war, für ihre Dienste zu bezahlen. Der Einäugige warf die Karten auf den Tisch. Er spuckte geräuschvoll aus. Der vierte Mann in der Spielrunde erbleichte. Es handelte sich um Saul Jackson, einen einfachen Cowboy aus der Gegend. Jackson kniff die Augen zusammen. "Ich habe nicht falsch gespielt!", behauptete er. "Doch, du hast!", widersprach der Einäugige. Seine Stimme klirrte wie Eis. Am Schanktisch von Eddie Camerons Saloon stand ein weiterer Mann, der mit dem Einäugigen aus der Postkutsche gestiegen war. Er trug einen mehrfach geflickten Anzug. Unter der Jacke sah man die Griffe seiner beiden Colts, die nach vorn zeigten. Seine Shotgun hatte er auf den Schanktisch gelegt. Jetzt nahm er sie an sich, lud sie demonstrativ durch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alfred Bekker, Ernest Haycox, George Owen Baxter
Westerngeschichten Juni 2023: Western Paket
Inhaltsverzeichnis
Westerngeschichten Juni 2023: Western Paket
Copyright
Entscheidung am Salt Lake
Dunkler Prediger
Die Wahl des Bürgermeisters
Der Goldgräber
Der Regenmacher
Der späte Sieg des Roten Mannes
Das heiße Spiel von Dorothy
Wild genug
Wenn du den Stern trägst
Nachricht an den General
Sein Kampf um Gnade
Westerngeschichten Juni 2023: Western Paket
Alfred Bekker, Ernest Haycox, George Owen Baxter
Dieses Buch enthält folgende Western:
Alfred Bekker: Entscheidung am Salt Lake
Alfred Bekker: Dunkler Prediger
Alfred Bekker: Die Wahl des Bürgermeisters
Alfred Bekker: Der Goldgräber
Alfred Bekker: Der Regenmacher
Alfred Bekker: Der späte Sieg des roten Mannes
Alfred Bekker: Das heiße Spiel von Dorothy
Ernest Haycox: Wild genug
Ernest Haycox: Wenn du den Stern trägst
Ernest Haycox: Nachricht an den General
George Owen Baxter: Sein Kampf um Gnade
"Du spielst falsch, Hombre!"
Der Blick des Einäugigen war eisig. Noch hatte er die Rechte auf dem Tisch und nicht am tiefgeschnallten Revolverholster.
Rechts und links von ihm saßen zwei seiner Kumpane, mit denen zusammen er am Mittag aus der Postkutsche gestiegen war. Sie trugen - ebenso wie der Einäugige - dunkle, etwas abgeschabte Anzüge. Und Revolver. Gunslinger waren sie, Männer die sich für ein paar Dollars von jedem anheuern ließen, der bereit war, für ihre Dienste zu bezahlen.
Der Einäugige warf die Karten auf den Tisch.
Er spuckte geräuschvoll aus.
Der vierte Mann in der Spielrunde erbleichte.
Es handelte sich um Saul Jackson, einen einfachen Cowboy aus der Gegend. Jackson kniff die Augen zusammen.
"Ich habe nicht falsch gespielt!", behauptete er.
"Doch, du hast!", widersprach der Einäugige.
Seine Stimme klirrte wie Eis.
Am Schanktisch von Eddie Camerons Saloon stand ein weiterer Mann, der mit dem Einäugigen aus der Postkutsche gestiegen war. Er trug einen mehrfach geflickten Anzug. Unter der Jacke sah man die Griffe seiner beiden Colts, die nach vorn zeigten. Seine Shotgun hatte er auf den Schanktisch gelegt.
Jetzt nahm er sie an sich, lud sie demonstrativ durch.
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books, Alfred Bekker, Alfred Bekker präsentiert, Casssiopeia-XXX-press, Alfredbooks, Uksak Sonder-Edition, Cassiopeiapress Extra Edition, Cassiopeiapress/AlfredBooks und BEKKERpublishing sind Imprints von
Alfred Bekker
© Roman by Author
COVER A.PANADERO
© dieser Ausgabe 2023 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
Die ausgedachten Personen haben nichts mit tatsächlich lebenden Personen zu tun. Namensgleichheiten sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Alle Rechte vorbehalten.
www.AlfredBekker.de
Folge auf Facebook:
https://www.facebook.com/alfred.bekker.758/
Folge auf Twitter:
https://twitter.com/BekkerAlfred
Erfahre Neuigkeiten hier:
https://alfred-bekker-autor.business.site/
Zum Blog des Verlags!
Sei informiert über Neuerscheinungen und Hintergründe!
https://cassiopeia.press
Alles rund um Belletristik!
Entscheidung am Salt Lake
von Alfred Bekker
.
Joe Carey ist auf der Flucht und gelangt in die Hölle der großen Salzwüste von Utah. Nach einem Überfall von Indianern bleibt er schwer verletzt zurück und wird von Mormonen gefunden. Doch als Carey sich am Salt Lake in eine ihrer Frauen verliebt, ist das Verhängnis vorgezeichnet...
Copyright
Ein CassiopeiaPress Buch: CASSIOPEIAPRESS, UKSAK E-Books und BEKKERpublishing sind Imprints von Alfred Bekker
© by Author; Titelbild Firuz Askin
© dieser Ausgabe 2015 by AlfredBekker/CassiopeiaPress, Lengerich/Westfalen
www.AlfredBekker.de
1
Ich war auf dem Weg nach Süden. Dieses Jahr war ich dafür etwas spät dran, aber irgendetwas kommt immer dazwischen. Den Sommer hatte ich in Montana verbracht und auf einigen Ranches gearbeitet.
Im Sommer lässt es sich dort oben wunderbar leben, aber wer dort den Winter verbringt, ist ein Dummkopf - oder hat keine andere Wahl.
Aber ich hatte eine andere Wahl und so hatte ich mich auf den Weg gemacht, ohne genau zu wissen, wohin eigentlich. Nur die Richtung, die stand fest.
Ein Tag ging wie der andere dahin und das Wetter wurde täglich schlechter.
Ich weiß nicht genau, wie lange ich brauchte, um den Nordwesten von Utah zu erreichen. Jedenfalls war es kein Pappenstiel - und ich bin allerhand gewöhnt.
Schließlich verdiene ich mein Geld damit, im Sattel zu sitzen.
Der Winter hatte in diesem Jahr früh eingesetzt. Die erste dünne Schneedecke hatte sich über die Hügel gelegt, und es war lausig kalt.
Es war später Nachmittag, als ich den Mann am Lagerfeuer sah, das er im Schutz einer Gruppe blattloser und verkrüppelter Bäume entzündet hatte.
Es war sicher mühevoll gewesen, in diesem feuchten Wind ein Feuer zu entfachen.
Im ersten Moment stutzte ich.
Ich sah einen Mann, aber fünf Pferde.
Die Gegend war weithin zu übersehen und so erschien es mir ausgeschlossen, dass noch weitere Männer sich irgendwo in der Nähe verborgen halten konnten.
Ich kam heran und grüßte ihn freundlich.
Wenn man hier draußen in der Wildnis nach Tagen oder gar Wochen wieder auf einen Menschen trifft, dann reitet man nicht einfach weiter, ohne ein Wort miteinander zu wechseln. Aber im selben Moment, als ich mit zwei Fingern der Rechten zur Hutkrempe ging und ihm zunickte, da griff mein Gegenüber nach dem Winchestergewehr, dass er in Reichweite an seinen Sattel gelehnt hatte.
Nun schaute ich direkt in eine Gewehrmündung, aber das konnte mich nicht aus der Ruhe bringen. Vielleicht hätte ich an seiner Stelle ebenso gehandelt. Hier draußen muss man auf der Hut sein.
Leider sieht man es einem Menschen nicht an der Nasenspitze an, ob er ein Schurke oder ein anständiger Kerl ist. Ich winkte ab, dabei bewegte sich meine Rechte allerdings unmerklich in die Nähe meiner Hüfte, dort wo der Griff meines Revolvers unter dem Jackensaum hervorschaute.
"Bleiben Sie ganz ruhig, Mister, ich will Ihnen nichts tun!", hörte ich mich selbst sagen.
Ich studierte die Züge meines Gegenübers, dessen Gesicht durch einen schwarzen Bart und aufmerksame, intelligente Augen gekennzeichnet war, die einen gehetzten Eindruck machten.
Dieser Mann hatte Angst, soviel war für mich klar. Er musterte mich einige Augenblicke lang aufmerksam und schien unschlüssig zu sein. Dann entspannte er sich ein wenig.
"Was wollen Sie von mir?"
"Sie sind der erste Mensch, den ich seit zwei Wochen sehe." Ich zuckte wie beiläufig mit den Schultern. "Da dachte ich mir, ich sag' mal guten Tag. Da ich das nun getan habe, werde ich jetzt wohl besser weiterreiten!" Ich zog meinen Gaul am Zügel herum und schickte mich an, ihn davontraben zu lassen.
"Augenblick, Mister!"
Der Mann war bereits in meinen Rücken. Ich drehte mich zu ihm um, wobei ich ich mir der Tatsache bewusst blieb, dass er die ganze Zeit über den Lauf seiner Winchester nicht einen Millimeter gesenkt hatte.
"Was ist noch? Ich denke zwischen uns ist alles geklärt. Also leben Sie wohl, Sir!"
"Gehören Sie zur Mannschaft der McCrane-Ranch?"
"Nein."
"Sie arbeiten nicht für Noah McCrane?" Ich schüttelte den Kopf.
"Nein. Ich kenne keinen Mann, der so heißt."
"Das glaube ich nicht!"
"Sie können mir glauben oder nicht. Das ist mir ziemlich gleichgültig!"
"Hm..."
Er wirkte jetzt nachdenklicher als zuvor und tatsächlich senkte sich der Lauf seiner Winchester nun.
Dann murmelte er: "Wollen Sie einen Kaffee, Mister..."
"Carey. Joe Carey ist mein Name", stellte ich mich vor. "Und Ihre Einladung nehme ich gerne an." Ich ließ mein Pferd ein paar Schritt herankommen und stieg dann aus dem Sattel.
Dann standen wir uns Auge in Auge gegenüber, während die Schneeflocken auf uns herabrieselten.
Ich reichte ihm die Hand.
"Mit wem habe ich die Ehre?"
"Mit Chip Barrows", kam es zurück.
Wäre ich in diesem Moment zurück zu meinem Gaul gegangen, um dann im schnellen Galopp ein paar Meilen zwischen mich und diesen Mann zu legen - ich hätte mir eine Menge Ärger ersparen können.
Aber in diesem Augenblick hatte ich noch keine Ahnung von dem, was noch geschehen würde. Der Geruch des warmen Kaffees lockte mich, der über dem Feuer hing und die Aussicht, mich mit jemandem unterhalten zu können.
Und so blieb ich.
"Haben Sie eine Tasse?", fragte er.
"Ja."
"Das ist gut, wir hätten uns sonst meine teilen müssen." Ich machte meinen Gaul bei den anderen fest, nahm ihm den Sattel vom Rücken und holte den Blechnapf aus dem Sattelpack. Kurze Zeit später kauerte ich mich ans Lagerfeuer und ließ mir von Chip Barrows heißen Kaffee eingießen.
Das tat gut.
Das Gebräu wärmte mich von innen wieder auf.
Wir tauschten einen Blick, der schwer zu deuten war. Ich wusste noch nicht, was es war, aber ich hatte es bereits deutlich im Gefühl: Mit Chip stimmte irgendetwas nicht. Ich hätte auf meinen Instinkt hören sollen, aber hinterher ist man immer schlauer.
Ich deutete auf die Pferde.
"Sind Sie Abdecker?"
Er wirkte etwas zornig.
"Sehen die Tiere vielleicht so aus?", schimpfte er.
"Nein. Sollte ein Scherz sein."
"Hm... War aber kein besonders guter!"
"Was sind Sie dann? Pferdehändler?" Er nickte, wenn auch zögernd.
"Ja, so kann man es ausdrücken..." Er lachte still in sich hinein.
Dann blickte er auf und in seinen Augen war plötzlich ein helles Blitzen.
"Wollen Sie mir einen von den Gäulen abkaufen? Ich mache Ihnen einen guten Preis!"
Ich schüttelte den Kopf.
"Nein, danke."
Ich warf noch einen Blick auf die Pferde. Es waren gute Tiere, aber ich musste mit meinem Geld haushalten. Es sollte schließlich für eine ganze Weile reichen.
2
Die Dämmerung legte sich grau über das Land. Wir hatten uns ein bisschen über belanglose Dinge unterhalten, Chip Barrows und ich. Damit war die Zeit dahingegangen.
Dann waren wir unsere Vorräte durchgegangen und hatten uns etwas zu Essen gemacht.
Es war nicht gerade ein fürstliches Mahl, aber hier draußen stellt man keine großen Ansprüche. Der Schneefall wurde stärker und ich dachte mit Sorgen an den Weg, den ich noch vor mir hatte.
Der Wind pfiff jetzt eiskalt über die Hügel. Einmal war mir, als hörte ich das Getrappel schnell galoppierender Pferdehufe.
Aber dann erschien es mir als ein Irrtum.
Als dann das gute Dutzend Reiter hinter einer nahegelegenen Hügelkette auftauchte, wusste ich, dass ich mich nicht getäuscht hatte.
Die Männer wirkten aus der Entfernung wie graue Schatten, aber sie kamen rasch näher.
"Wir bekommen Besuch", meinte ich lakonisch und trank meinen Kaffee aus.
Chip hatte es unterdessen auch bemerkt. Er griff sofort zu seiner Winchester und lud sie mit einer energischen Bewegung durch.
"Was soll das!", zischte ich ihm zu. Aber Chip schien wie von Sinnen vor Angst.
Und dann begriff ich.
Für ihn waren das keine Fremden, die da herangeprescht kamen. Er musste wissen, um wen es sich bei dem Trupp handelte.
In diesem Augenblick hätte ich zu gerne gewusst, weshalb er so eine Höllenangst vor diesen Männern hatte.
Ich erhob mich und dann waren die Kerle auch schon heran. Einige hatten ihre Gewehre aus den Sätteln gezogen. Nein, es konnte keinen Zweifel geben: Sie waren nicht gekommen, um sich mit uns zu einem Plausch ans Lagerfeuer zu setzen!
Die Hände gingen zu den Revolvern.
"Sieh an, Chip Barrows!", rief einer der Kerle, dem Augenschein nach ihr Anführer. "Diesmal mit einem Komplizen, was?" Er lachte rau.
Es handelte sich um einen äußerst hageren Mann mit hervorspringenden Wangenknochen und wettergegerbter Haut. Er war schon etwas älter, das Haar, das unter dem breitkrempigen Hut hervorschaute war bereits ergraut.
Aber in seinen Zügen lag etwas Kompromissloses, Hartes, das es mir ratsam erschien, ihn nicht unnötig zu provozieren.
"Scheint, als wären Sie mit diesen Leuten gut bekannt, Chip!", raunte ich ich zu ihm hinüber.
Ich hatte nicht die geringste Lust dazu, mich in irgendwelche Händel hineinziehen zu lassen, die mich nichts angingen.
Aber manchmal wird einem keine Wahl gelassen. Chip war noch unschlüssig darüber, was er tun sollte. Er hielt das Gewehr schussbereit in der Hand, aber noch war keine Kugel auf den Weg geschickt worden - von keiner Seite. Der Anführer der Meute verzog den Mund.
"Endlich haben wir dich, Chip, du Ratte!" Einer der Männer sprang aus dem Sattel und lief zu den Pferden.
"Hey, Todd! Unsere Markierungen!"
Todd, der Anführer ließ ein müdes Lächeln auf seinem Gesicht erscheinen.
"Hast du etwas anderes erwartet?"
Jetzt war alles klar. Chip Barrows war ein Pferdedieb und das machte die Sache nicht gerade leichter.
Ich überlegte.
Ein Dutzend Rohre gegen eines. Oder zwei, je nachdem. Beides war glatter Selbstmord.
"Die Waffe weg, Barrows!", rief der hagere Todd. "Sonst nutzen wir die günstige Gelegenheit, Sie in Notwehr zu erschießen!"
Chip Barrows schien verzweifelt. Er wandte sich kurz hilfesuchend an mich, aber ich hatte wenig Neigung für einen verdammten Pferdedieb meinen Hals zu riskieren. Wer anderen Leuten die Gäule stiehlt, muss wissen, welches Risiko er eingeht.
"Legen Sie das Gewehr weg, Chip es hat keinen Sinn", meinte ich.
"Dein Komplize scheint mehr Grips im Gehirn zu haben!", meinte Todd.
"Ich bin nicht sein Komplize", erklärte ich. "Wir haben uns vor kaum einer Stunde zum erstenmal gesehen." Todd spuckte verächtlich aus.
"Das ist eine selten dumme Ausrede!", meinte er. "Es reicht nicht, dass ihr beide die Frechheit hattet, Mr. McCranes Pferde zu stehlen... Jetzt entpuppt sich unser Freund hier auch noch als ausgemachter Feigling!"
Todds Gedankengang war absolut logisch, auch wenn er nicht der Wahrheit entsprach. Vielleicht hätte ich an seiner Stelle den selben Schluss gezogen.
Warum auch nicht?
Es passte ja alles zusammen.
Es würde nicht einfach sein, Todd von meiner Version der Dinge zu überzeugen. Vielleicht sogar unmöglich. Aber ich versuchte es trotzdem, denn ich wusste, was im Allgemeinen mit Pferdedieben geschah.
Oft genug wurden sie einfach an Ort und Stelle aufgeknüpft.
"Ich bin kein Pferdedieb!", rief ich, aber Todd winkte ab.
"Hören Sie auf, Sie langweilen mich mit ihrem Geschwätz!" Er gab seinen Leuten ein Zeichen und wenige Augenblicke später waren Chip Barrows und ich gefesselt und vollständig entwaffnet.
Einen kurzen Augenblick lang hatte ich erwogen, mich zu wehren. Ich bin ein schneller, sicherer Revolverschütze. Aber ich konnte leider unmöglich ein Dutzend Kugeln auf einmal und in verschiedene Richtungen abfeuern und so wehrte ich mich nicht.
Anders dagegen Chip.
Er strampelte heftig mit den Beinen und schlug wild um sich, als die Männer ihn packten. Aber das half ihm nichts. Er bekam einen Haken, der ihn fürs Erste ins Land der Träume versetzte. Sie ließen ihn der Länge nach auf die dünne Schneedecke fallen.
Am Ende saßen wir aneinandergeschnürt drei Schritt vom Lagerfeuer entfernt. Chip hing wie ein nasser Sack in seinen Fesseln. Er war noch nicht wieder beieinander.
Einer der Kerle hatte neues Holz hineingelegt.
"Hey, Vormann!", wandte sich ein anderer dann an Todd, der etwas abseits stand und den dunkelgrauen Himmel mit gerunzelter Stirn betrachtete.
"Was gibt's, Billy?"
"Warum machen wir soviel Umstände mit den Beiden? Die paar Bäume hier sind zwar ziemlich morsch, aber für die beiden Halunken wird es vielleicht noch reichen..."
"Du warst doch dabei, als Mr. McCrane seine Anordnungen gegeben hat, oder?"
"Ja..."
"Der Boss will selbst entscheiden, was mit Chip Barrows passiert..."
"... und mit seinem Komplizen, Todd!" Der Vormann nickte.
"Ja, mit dem auch."
Billy machte eine verzweifelte Geste.
"Steht das nicht längst fest?" Der Cowboy fuhr sich mit der Handkante den Hals entlang und grinste. Eine eindeutige Geste, die mich schlucken ließ.
"Ich halte mich an die Anordnungen vom Boss!", meinte Todd unmissverständlich. "Mr. McCrane hat sich klar ausgedrückt und da er mich bezahlt, tue ich, was er sagt." Billy schien nicht zufrieden damit.
Aber für mich und Chip bedeutete dies eine Gnadenfrist. Und das war immerhin etwas.
Todd deutete zum Himmel.
"Da zieht ein übles Wetter auf...", meinte er. "Heute Nacht kampieren wir hier. Das ist ein guter Lagerplatz!"
3
Ich hörte den Gesprächen der Männer zu und erfuhr auf diese Weise, dass der Trupp schon den dritten Tag hinter Chip Barrows herhetzte.
Er schien ein guter alter Bekannter von ihnen zu sein, den sie aber bisher nie hatten schnappen können. Diesmal hatte er offensichtlich den Bogen überspannt.
Unterdessen war es dunkel geworden.
Langsam kam der Pferdedieb wieder zu sich.
"Sie haben mich in eine schlimme Lage gebracht, Chip!", zischte ich ihm ärgerlich zu.
"Tut mir leid", meinte er.
"Das nützt mir kaum etwas!", versetzte ich. "Die denken, dass ich Ihr Komplize bin und wahrscheinlich gibt es nichts, was sie von dieser Meinung abbringen könnte!"
Es war sinnlos, zu lamentieren.
Es änderte nichts.
Irgendwie musste es mir gelingen, hier 'rauszukommen. Immerhin blieb mir etwas Zeit, bis wir McCrane, dem Boss dieser Männer vorgeführt würden.
Ich beobachtete aufmerksam die Männer am Lagerfeuer, die sich die Hüte ins Gesicht gezogen hatten. Ich musste auf meine Chance warten, ruhig abwarten, bis der richtige Augenblick gekommen war, um einen Fluchtversuch zu unternehmen. Jetzt hieß es, kühlen Kopf bewahren.
"Die werden uns eiskalt aufhängen, nachdem sie uns ihrem Boss vorgeführt haben", murmelte Chip.
Verzweiflung sprach jetzt aus seiner Stimme. "Ich kenne diesen McCrane. Das ist ein harter, kompromissloser Mann!", fuhr er fort. "Was er sagt, ist Gesetz in dieser Gegend!" Ich verzog das Gesicht.
"Scheint, als hätten Sie sich den Falschen für einen Händel ausgesucht!", zischte ich ärgerlich. Das Gezeter dieses Mannes ging mir ziemlich auf die Nerven. Er hatte sich seine Lage nicht nur in vollem Umfang selbst zuzuschreiben, sondern auch mich in diese lebensgefährliche Sache hineingezogen. Todd, der Vormann, wandte sich in diesem Augenblick zu uns um und warf uns einen unfreundlichen Blick zu.
"Quatscht nicht!", rief er unmissverständlich. "Entweder ihr seid still und haltet die Klappe, oder ihr bekommt Knebel in eure vorlauten Mäuler gestopft!"
Er kniff die Augen zusammen, als er uns mit seinem Blick fixierte.
"Es wird mir ein Vergnügen sein, euch Halunken persönlich aufzuknüpfen!", meinte er.
4
Die Nacht war ziemlich kalt, besonders für jemanden, der gefesselt war und sich nicht bewegen konnte.
Die Männer kauerten sich noch eine Weile um das Lagerfeuer herum, dann rollten sie sich einer nach dem anderen in ihre Decken. Zuvor waren noch einmal frische Holzscheite in das Feuer gelegt worden, so dass es hell aufloderte. Es knisterte und rauchte, denn das Holz war natürlich nass.
Todd hatte Wachen eingeteilt.
Die Männer nahmen leise murrend die Reihenfolge zur Kenntnis, die der Vormann bestimmte.
Immer nur ein Posten auf einmal!, dachte ich. Das war keine schlechte Voraussetzung!
Aber da blieben diese verdammten Fesseln, die mich zudem noch an Chip, diesen dummen Hund, ketteten!
Ich versuchte, trotz der Kälte ein bisschen zu schlafen. In der ersten Nachthälfte würde aller Wahrscheinlichkeit nach ohnehin nichts zu machen sein.
Diese Männer waren tagelang hinter einem Pferdedieb hergehetzt und hatten sich vermutlich dabei nicht mehr Schlaf gegönnt, als unbedingt notwendig.
Sie mussten also müde sein.
Und sehr wahrscheinlich würden sie sich dieser Müdigkeit auch hingeben, denn schließlich hatten sie ihr Ziel erreicht. Vielleicht lähmte das ein wenig ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffte es zumindest. Auf irgendetwas muss man seine Hoffnung schließlich setzen, selbst wenn eine Sache noch so aussichtslos scheint.
Sonst kann man gleich aufgeben.
Aber das liegt mir nicht.
5
Ich erwachte aus kurzem, traumlosen Schlaf.
Ich weiß nicht mehr genau, was mich weckte. Vielleicht war es eine Art Ahnung oder mein innerer Zeitsinn, der mir sagte, das jetzt der richtige Moment war.
Möglicherweise war es auch einfach nur die verdammte, klirrende Kälte, die alles zu durchdringen schien. Das Feuer war schon ziemlich heruntergebrannt. Der eingeteilte Posten saß etwas abseits an einen der knorrigen Bäume gelehnt und hatte den Hut tief ins Gesicht gezogen.
Die Decke hatte er eng um die Schultern geschlungen. Der Lauf einer Winchester ragte irgendwo aus diesem Bündel heraus.
Wahrscheinlich war es seine Aufgabe gewesen, neues Holz auf das Feuer zu legen. Er hatte es bis jetzt nicht getan. Vielleicht schlief er also. Zumindest schien er vor sich hin zu dösen.
Die anderen Männer schnarchten laut in die Nacht hinein. Der Schneefall hatte sich verstärkt, ebenso wie der der eisige Wind.
"Na, wieder wach?", hörte ich Chip Barrows' Stimme. Ich verfluchte ihn innerlich.
"Mundhalten!", zischte ich. "Oder wollen Sie das ganze Lager wecken!"
Vermutlich hatte Chip kein Auge zugedrückt. War auch ein Kunststück, bei der Kälte. Diese Hunde hatten uns keine Decken gegeben. Wahrscheinlich dachten sie, dass der Aufwand für uns nicht mehr lohnte.
Schließlich spielt es kaum eine Rolle, ob man sich vor dem Gang zum Galgen noch eine Lungenentzündung holt. Tot ist schließlich tot.
Ich ließ noch einmal meinen Blick über das Lager schweifen und taxierte die Lage.
Es war alles noch ziemlich vage, aber mittlerweile hatte ich eine Art Plan.
Wenn es glatt ging, würde er mich und diesen nichtsnutzigen Pferdedieb vor dem Strick retten. Wenn nicht, dann hatte ich eben Pech gehabt.
Keiner von uns beiden hatte irgendetwas zu verlieren
"Hey, Chip", flüsterte ich.
"Ja?"
"Wir rollen uns jetzt zusammen in Richtung des Lagerfeuers!"
"Aber..."
"Tun Sie einfach, was ich sage, Chip!"
"Okay..."
Wir taten es und versuchten dabei, möglichst keinen Lärm zu machen. Das gelang uns auch einigermaßen.
Mit zwei Fingern kriegte ich ein glühendes Stück Holz zu fassen und versuchte damit, mir die Handfesseln zu durchschmoren.
Es tat höllisch weh, aber ich biss die Zähne zusammen. Wenn das eigene Leben davon abhängt, kann man eine ganze Menge aushalten.
Als ich die Hände frei hatte, rieb ich mir die schmerzenden Gelenke und tat etwas Schnee auf die Brandblasen. Der Rest war dann eine Kleinigkeit.
Ein paar schnelle Handbewegungen und ich hatte auch meine Füße befreit. Dann war Chip an der Reihe. Während ich mich mit seinen Fesseln befasste, warf ich einen Blick hinüber zu dem Wachposten, der die ganze Zeit über als kleines, in sich zusammengesunkenes Bündel verharrt hatte.
Aber genau in diesem Augenblick bewegte er sich und ich hielt mitten in der Bewegung inne.
Wenn er jetzt den Kopf hob und den Hut etwas aus dem Gesicht schob, dann war unsere Flucht bereits zu Ende, noch bevor sie so richtig begonnen hatte.
Aber er tat es nicht.
Stattdessen drehte er sich etwas zur Seite und schnaufte. Er schien tatsächlich ein wenig eingenickt zu sein. Ich löste die restlichen Fesseln von Chip Barrows und dann erhoben wir uns vorsichtig.
Ich tauschte mit dem Pferdieb einen kurzen Blick und deutete dann hinüber zu den Pferden. Dort befanden sich auch unser Sattelzeug und unsere Waffen.
Wir schlichen über die schlafenden Cowboys der McCrane-Mannschaft. Ein falscher Schritt, eine zu hektische Bewegung, ein gefrorenes Aststück unter dem Stiefel, das im falschen Moment knackte und alles war verloren. Zunächst hatte ich Sorgen gehabt, was meinen unfreiwilligen Gefährten anging. Aber die stellten sich rasch als unbegründet heraus.
Chip Barrows verstand sich vortrefflich darauf, auf leisen Sohlen in einem feindlichen Lager umherzuschleichen. Für einen Pferdedieb war diese Fähigkeit auch sicherlich recht nützlich.
Mit vorsichtigen Bewegungen nahm ich meinen Revolver an mich und steckte ihn in das leere Holster an meiner Seite. Ich reichte Chip seine Waffen und nahm dann meine Winchester und meinen Sattel.
Eines der Pferde wieherte.
Mochte der Teufel wissen aus welchem Grund, jedenfalls wieherte es und schnaubte dann ziemlich lautstark. Wir erstarrten beide mitten in der Bewegung und ließen den Blick über die schlafende McCrane-Mannschaft gleiten. Einer der Kerle drehte sich im Schlaf herum, aber es schien keiner der Männer geweckt worden zu sein.
Glück gehabt.
Mehr kann man dazu nicht sagen. Aber nach dem haarsträubenden Pech, dass ich in diese unselige Sache verwickelt hatte, war es vielleicht auch nicht mehr, als eine Art ausgleichende Gerechtigkeit.
Während ich mein Pferd suchte und schließlich auch fand und dem Tier dann den Sattel auf den Rücken legte, sah ich fasziniert zu, wie Chip Barrows dasselbe mit seinem Gaul machte.
Der Kerl war ziemlich geübt in diesen Dingen. Selten zuvor habe ich einen Mann mit derartiger Geschwindigkeit ein Pferd satteln sehen!
So war es dann auch kein Wunder, dass Chip viel früher fertig war, als ich.
"Wollen Sie hier Wurzeln schlagen, Joe?", feixte er.
"Maulhalten!", zischte ich ärgerlich. Ich hatte keinen Sinn für seine Art von Humor. Nicht in dieser Lage.
Schließlich war auch ich soweit. Ich schob meine Winchester in den Sattelschuh und dann schwangen wir uns annähernd gleichzeitig in den Sattel. Chip hatte damit gewartet, bis auch ich soweit war. Und das hatte seinen guten Grund, einen Grund, den er als Pferdedieb natürlich kannte.
In dem Moment, in dem wir uns auf die Pferderücken hievten, kam Unruhe unter den anderen Gäulen auf.
Und das blieb diesmal nicht ohne Folgen. Unter den Schlafenden regte sich etwas.
Als Erster war der Posten auf den Beinen, der eigentlich hatte Wache halten sollen. Er schnellte hoch, blinzelte kurz verschlafen in die Nacht hinein und legte dann sein Gewehr an.
Er kam allerdings nicht mehr dazu, einen Schuss aus seiner Winchester abzufeuern.
Ich bin ein ganz passabler Revolverschütze. Blitzschnell hatte ich das Eisen aus dem Holster gerissen und ihm eine Kugel in die Brust gejagt.
Er taumelte zurück gegen den knorrigen Baumstamm, an dem er zuvor gelehnt hatte und rutschte an diesem hinunter in den Schnee.
Er hatte gerade noch genug Zeit für einen kurzen, etwas unterdrückten Todesschrei, der zusammen mit dem Schuss sicher den letzten Schläfer im Lager geweckt hatte.
"Los, vorwärts!", rief Chip und trieb seinem Reittier die Sporen brutal in die Weichen.
Ich folgte ihm so schnell ich konnte und wir preschten in die Nacht hinein.
Ein paar Kugeln wurden uns hinterdrein geschickt, aber in der Dunkelheit konnten die Kerle kaum gezielte Schüsse abgeben.
6
Der Schnee wurde uns vom eisigen Wind jetzt direkt ins Gesicht geblasen. Es waren jetzt dicke, volle Flocken, die einem kalt in den Jackenkragen krochen.
Ich folgte einfach dem Pferdedieb, heftete mich so gut es ging an den wehenden Schweif seines Gauls.
Was blieb mir auch anderes übrig?
Ich gestehe mir so etwas nicht gerne ein, aber in diesem Augenblick wäre ich ohne ihn vermutlich verloren gewesen. Niemand hätte mich dann davor bewahrt, einfach im Kreis zu reiten oder vielleicht auf direktem Wege zurück in die Fänge jener hungrigen Wölfe, die uns beide - Chip und mich hängen sehen wollten. Schließlich kannte ich mich hier überhaupt nicht aus. Ich musste Chip also vertrauen, auch wenn er alles in allem ein windiger Typ war.
In jedem anderen Fall hätte es mir den Magen umgedreht, einem solchen Menschen auf diese Weise ausgeliefert zu sein. Aber jetzt blieb mir keine andere Wahl.
Zunächst hörten wir hinter uns das Galoppieren von Pferden, ihr angestrengtes Schnaufen und die Stimmen von Männern. Aber das verstummte mehr und mehr, was vielleicht bedeutete, dass wir ein klein wenig mehr in Sicherheit waren. Eine ganze Weile lang ritten wir einfach so dahin, ohne uns umzudrehen und ohne etwas von unseren Feinden zu hören. Wir legten einfach Meter um Meter zwischen uns und sie. Und das so schnell wie es nur irgend möglich war.
"Hey, Chip! Wohin reiten wir eigentlich?", rief ich dann schließlich nach einer Weile.
Chip drosselte etwas das Tempo. Und er wusste sicher, was er tat, denn ich hatte den untrüglichen Eindruck, dass er nicht nur Pferde stahl, sondern auch einiges von ihnen verstand. Es hatte keinen Sinn, die Tiere voranzutreiben, bis sie vor Erschöpfung umkippten. Sie hatten noch einen langen, langen Weg vor sich, denn es war nicht anzunehmen, dass das Wolfsrudel in unserem Rücken so schnell abdrehen würde...
"Na sag's schon!", rief ich ärgerlich. "Wohin geht diese verdammte Reise? Oder hast du am Ende auch keine Ahnung?" Chip atmete tief durch. Es dampfte vor seinem Mund.
"Wenn ich mich nicht irre, reiten wir westwärts."
"Und was, wenn du dich irrst?"
"Irgendwann müssten wir jetzt die Berge erreichen", meinte er. "Wenn nicht, dann habe ich mich geirrt."
"Was ist hinter den Bergen?"
"Wüste", meinte er. "Salzwüste..."
"Klingt nicht gut", meinte ich.
"Im Moment klingt es aber wohl besser als der Name McCrane, oder?" Er lachte rau. "Östlich der Berge muss man weit reiten, sehr weit reiten, um einen Flecken Erde zu finden, der nicht diesem Mann gehört!"
7
Der Morgen dämmerte bereits, als vor uns riesige schwarze Schatten aus dem finsteren Nichts heraus auftauchten und sich gegen das schwache Licht der aufgehenden Sonne abhoben, wussten wir, das wir in die richtige Richtung geritten waren. Diese Schatten waren nichts anderes, als die Berge, von denen Chip gesprochen hatte.
Chip kannte sich wirklich gut hier aus. Nicht einmal die Dunkelheit schien sein Orientierungsvermögen maßgeblich einzuschränken.
Aber wenn jemand es wagte, Leuten wie dem Rancher McCrane auf der Nase herumzutanzen, dann musste er sich schon einigermaßen auskennen und wissen, wo man sich verstecken konnte.
Doch jetzt wurde es sehr rasch heller.
Kaum hatten wir die ersten Hänge hinter uns gebracht, da da deutete Chip hinab.
Ich rieb mir die Augen und blinzelte etwas.
Dann versetzte es mir einen Stich.
Auf den schneebedeckten Hügeln waren ein paar schwarze, sich bewegende Punkte zu sehen, die sich rasch näherten. Die Meute hatte die Fährte nicht verloren!
Ich ballte unwillkürlich die Hand zur Faust.
Sie waren zäh, diese Hunde! Verdammt zäh! Und wir hatten es noch keineswegs geschafft!
Das Tageslicht bedeutete, das wir uns jetzt leichter orientieren konnten.
Aber das galt in gleicher Weise für das Wolfsrudel, das uns verfolgte. Unmöglich zu sagen, zu wessen Vorteil das im Endeffekt wirken würde...
Wir sahen zu, dass wir vorwärts kamen.
"Es gibt einen Pass", meinte Chip Barrows zwischendurch. "Den müssen wir nehmen..."
"Und ich nehme an, Sie wissen, wie wir dort hingelangen", vermutete ich.
"Natürlich weiß ich das! Aber die McCrane-Leute kennen sich hier ebenfalls aus! Die werden denselben Pass nehmen!"
"Was schlagen Sie vor, Chip?"
"Uns bleibt keine andere Wahl."
"Wir müssen schnell sein. Schneller als sie!" Er deutete nach hinten. "Und vielleicht hilft uns irgendein Wunder!" Wir taten unser Bestes, aber trotzdem kamen wir nicht so schnell vorwärts, wie wir gehofft hatten.
Die steilen Hänge waren jetzt glatt und rutschig. Zum Teil mussten wir von den Pferden steigen und die Tiere hinter uns herziehen.
Ein Königreich für einen Maulesel!, durchfuhr es mich auf einer dieser glitschigen Rutschbahnen.
Mit Mauleseln wären wir jetzt besser dran gewesen, als mit Pferden. Die waren zwar langsamer, waren aber dafür sichere Kletterer, die auch ein bisschen Schnee und Eis nicht aus dem Tritt bringen konnten.
Aber wir waren gezwungen, die Dinge so zu nehmen, wie sie nun einmal waren.
Ein schwacher Trost, dass es unseren Feinden nicht besser ergehen würde.
Schließlich hatten wir den Pass erreicht, von dem Chip gesprochen hatte und von da an ging es etwas besser vorwärts - was nicht bedeutete, dass wir eine ausgebaute und befestigte Straße vor uns hatten!
Keineswegs!
Aber zumindest konnten wir uns wieder in den Sattel schwingen und brauchten nicht mehr zu Fuß vor unseren Gäulen herzulaufen, um die oft widerstrebenden Tiere mitzuziehen. Der Schneefall hörte auf, aber der Himmel blieb grau und unfreundlich. Aber zumindest kroch einem nicht dauernd diese kalte Nässe in den Kragen.
Wir blickten mehrfach nach hinten, aber bis jetzt zeigte sich keiner unserer Verfolger.
Das war ein gutes Zeichen.
Ein offener Kampf konnte kaum anders, als zu unseren Ungunsten ausgehen. Wir mussten alles tun, um soetwas zu vermeiden.
Die Pferde dampften und es war fraglich, wie lange sie diese Tortur noch durchhalten würden. Wir trieben die Tiere energisch vorwärts. Jeder Meter, jede Meile, die wir zwischen uns und sie legten, konnte uns am Ende vielleicht das Leben retten.
Am frühen Nachmittag schließlich hatten wir den Bergpass überwunden.
Das, was jetzt vor uns lag, ließ mich erst einmal tief durchatmen.
Die große Salzwüste...
Eine derartige Ödnis hatte ich noch nie zuvor zu Gesicht bekommen. Die Sierra Madre in New Mexico wirkt dagegen wie ein Garten Eden.
8
Gott musste dieses Land in einer boshaften Laune geschaffen haben. Im Sommer war es hier unsagbar heiß und trocken. Die öden Ebenen waren dann bedeckt von feinem Salzstaub. Salz, das anderswo ein kostbarer Stoff war, gab es hier im Überfluss.
Ein tödlicher Überfluss.
Das Salz tötete fast alles, wenn man von einigen Kakteen oder besonders widerstandsfähigen Dornbüschen absah. Vor allem vergiftete es das Wasser.
Jetzt war alles eine weißgraue Fläche aus Schnee und Eis. Und Schnee lag auch auf den Kakteen.
Ein seltsamer Anblick.
Der Winter war kalt hier und von ebenso grausamer Lebensfeindlichkeit wie der Sommer.
Am Ausgang des Passes fanden wir Skelette von Zugtieren, die noch immer ihr Joch am Nacken trugen, mit dem sie einen Wagen gezogen haben mussten.
Viele hatten vor uns versucht, diese Wüste zu durchqueren und wir würden aller Wahrscheinlichkeit nach noch oft auf solche Spuren von Menschen stoßen, die daran gescheitert waren.
Wenn man in diesem Land eine Chance zum Überleben haben wollte, dann musste man entweder ein Paiute-Indianer oder ein Kaktus sein.
Die bessere Chance hatte natürlich der Kaktus. Wir hatten kurz angehalten, um diesen Anblick von beängstigender Hoffnungslosigkeit in uns aufzunehmen. Ich deutete auf die Skelette am Passausgang.
"Glauben Sie wirklich, dass unsere Chancen besser sind, wenn wir jetzt geradeaus reiten, Chip?"
"Keine Ahnung!", zischte er verbissen. Und das war ehrlich. Ich hoffte nur, dass er wusste, wie man dort draußen überleben konnte.
Eine schnelle Kugel in den Kopf oder verenden wie die Tiere zu unserer Seite. Eine Wahl, an der ich keinen Gefallen finden konnte.
Hinter uns hörten wir dann das Geräusch galoppierender Pferde, das zwischen den felsigen Hängen widerhallte.
"Na los!", meinte ich. "Worauf warten wir noch?" Chip lachte rau.
"Auf in die Hölle!", rief er.
9
Wir preschten über die öde, weißgraue Ebene, so schnell uns die Hufe unserer Pferde nur zu tragen vermochten. Bis zu ein paar einsamen Felsmassiven am Horizont gab es keinerlei Deckung, nicht einen Ort, an dem man sich verstecken oder Schutz vor einer Kugel finden konnte. Wenn die Meute erst einmal den Pass hinter sich gelassen hatte, dann würden wir für unsere Verfolger wie auf einem Präsentierteller sein.
Wir blickten uns immer wieder um.
Und dann war es soweit.
Die schwarzen Punkte tauchten in unserem Rücken auf und bewegten sich langsam hinter uns her.
Sie konnten sich Zeit lassen.
Sie konnten geduldig warten, bis wir nicht mehr konnten, bis unsere Pferde unter uns vor Erschöpfung zusammenbrachen... Sie konnten uns hetzen, wie ein Rudel Wölfe seine Beute hetzt: unerbittlich.
Noch waren wir weit außer Schussweite, aber mir war natürlich klar, dass es ein regelrechtes Preisschießen geben würde, wenn es den Kerlen gelang, näher heranzukommen. Die Punkte wurden größer und verwandelten sich in kleine Reiter. Sie holten auf, und was wir auch versuchten: Es schien kein Mittel dagegen zu geben.
Wir hatten unseren Pferden das Letzte abverlangt. Kein Wunder, dass sie langsam aber sicher nachließen. Vielleicht konnten wir die Felsen am Horizont gerade noch erreichen. Dort hatten wir zumindest ein wenig Deckung für unser vermutlich letztes Gefecht.
Ich war jedenfalls für meinen Teil wild dazu entschlossen, mich so teuer wie möglich zu verkaufen! Todd und seine Leute würden wenig Vergnügen an mir haben!
Sollten sie sich zumindest blutige Nasen holen, wenn ihnen so sehr daran gelegen war, uns unter die Erde zu bringen!
Sie holten weiter auf.
Schon versuchten die ersten von ihnen ihr Glück und ballerten einfach mal drauf los.
Natürlich ohne Erfolg, aber es war eine Warnung. Die Bleikugeln gingen irgendwo in diesen grauen, unfreundlichen Himmel. Aber es würde nicht mehr allzu lange dauern, dann waren sie nahe genug heran, um auch zu treffen...
Unterdessen begann es wieder zu schneien und auch der Wind frischte erneut auf.
Er schnitt eisig durch die Kleider, aber das kümmerte mich im Moment wenig. Der Himmel wurde jetzt sehr düster. Ich hätte nicht im Traum daran gedacht, dass von dort oben unsere Rettung kommen sollte!
10
Unsere Verfolger holten noch ein wenig auf, aber das Wetter wurde von Minute zu Minute schlechter.
Schließlich hatten wir einen ausgewachsenen Schneesturm. Der Wind wurde stärker und wir konnten vor lauter Schneetreiben kaum noch die Hand vor Augen sehen. Wir ritten einfach weiter, in der Hoffnung, dass wir uns noch immer in die richtige Richtung und nicht direkt in die Arme unserer Verfolger bewegten.
Ich warf zwischendurch einen flüchtigen Blick nach hinten, aber von den McCrane-Leuten war nichts mehr zu sehen. Der Schneesturm hatte sie verschluckt.
Chip ritt ein paar Meter vor mir.
Ich sah ihn als schemenhaften Umriss und musste mir ziemliche Mühe geben, ihn nicht zu verlieren.
So ging dass noch eine ganze Weile, aber dann zügelte Chip sein Pferd.
"Was ist?", rief ich.
Es dauerte einen Moment, bis ich Antwort bekam.
"Es hat keinen Zweck!", meinte Chip schließlich. Ich hörte von seiner Stimme kaum mehr als ein erbärmliches Krächzen. Der mörderische Eiswind verschluckte alles.
Ich nickte.
"Okay!", rief ich, ohne zu wissen, ob Chip mich verstand. Es spielte auch kaum eine Rolle.
Wir stiegen aus den Sätteln und zogen die Pferde an den Zügeln hinter uns her.
Wir hatten keine Ahnung, in welche Richtung es uns verschlagen hatte oder wie weit unsere Verfolger noch von uns entfernt waren.
Vielleicht hatten sie auch abgedreht.
So zogen wir durch den Schnee, ohne eigentlich zu wissen, wohin. In einem solchen Chaos ist es unmöglich, die Orientierung zu behalten.
Stundenlang kämpften wir uns auf diese Weise vorwärts, irrten wir durch das Schneegestöber. Der Sturm ließ in seiner Heftigkeit kaum nach.
Als die Dämmerung einsetzte erreichten wir dann ein paar Felsen, die uns etwas Schutz geben konnten. Dort blieben wir, kauerten uns hin und warteten auf eine Wetterbesserung. Ein flüchtiger Blick zum Himmel machte uns jedoch sofort klar, dass die noch etwas auf sich warten lassen würde. Die Nacht über war an Schlaf kaum zu denken.
Wir hatten genug damit zu tun, dafür zu sorgen, dass uns die Pferde nicht in heller Panik davonrannten.
11
Als der Morgen graute, war dann alles ruhig, so als hätte es nie einen Sturm gegeben.
Ich blickte hinaus über eisige Ebene. Von unseren Verfolgern war nirgends etwas zu sehen.
Immerhin hatten wir noch unsere Pferde. Und das war schon etwas. Mit einem Pferd unter dem Hintern lohnte es sich, den Kampf gegen die Wüste aufzunehmen.
Ohne Pferd konnte man gleich versuchen, sich in dem gefrorenen Boden ein Grab auszuheben.
"Na, ist irgendwo einer von der McCrane-Meute zu sehen?", meinte Chip.
Ich schüttelte den Kopf.
"Die werden abgedreht sein", vermutete ich. "Jedenfalls, wenn sie noch einen Funken Verstand in ihren Hirnen haben!"
"Ich hoffe, Sie haben Recht, Joe!"
"Warum sollte ich nicht? Die werden nicht so dumm sein, das Risiko einzugehen, sich in der Salzwüste zu verirren - nur um entlaufen Pferdediebe einzufangen. Schließlich geht es nicht um ihr Leben, sondern um unseres. Es geht noch nicht einmal um die Pferde dieser Männer, sondern um die Pferde eines gewissen McCrane!"
Chip nickte.
"Ja, vielleicht haben Sie Recht. Wenn ich an Stelle dieser Männer wäre, würde ich mich auch nicht bis zum letzten für die Pferde von meinem Boss einsetzen!"
Er grinste.
"Eine Ahnung, wo wir uns befinden?" Chip zuckte mit den Schultern. Und das war alles andere, als ein gutes Zeichen.
"Sie vielleicht?"
"Lassen Sie Ihre schlechten Witze!", versetzte ich. Ich war immer noch ein wenig ärgerlich auf ihn, weil er mich in diese Sache hineingeritten hatte. Naja, wenn ich ehrlich bin, dann muss ich heute der Gerechtigkeit halber zugeben, dass meine Dummheit auch ihren Teil dazu beigetragen hatte.
"Wir sind ziemlich scharf geritten", meinte Chip.
"Vielleicht sind wir dreißig Meilen direkt in die Wüste hineingeritten, aber das lässt sich schwer sagen..." Ich schaute nach dem Stand der Sonne.
"Dort ist ungefähr Nordosten", meinte ich. "Ich schlage vor, dass wir dorthin reiten!"
"Daher sind wir gekommen", erklärte Chip.
"Richtig."
"Und Sie meinen, dass der schnellste Weg ist, um aus dieser Einöde wieder herauszukommen, nicht wahr?" Ich nickte.
"Ja."
"Es ist ebenso gut möglich, dass Sie sich täuschen, Joe!"
"Natürlich. Aber irgendwohin müssen wir uns wenden."
"Ja, das stimmt." Dann wandte er sich zu den Pferden. "Wir sollten den Tieren noch ein bisschen Ruhe gönnen. Sonst brechen sie uns noch zusammen!"
Aus ein paar Dornbüschen, die in der Nähe der Felsen wuchsen, versuchten wir mit einiger Mühe ein kleines Lagerfeuer zu machen, was uns schließlich auch gelang. Nicht nur unsere Pferde hatten eine Ruhepause dringend nötig. Für uns galt genau dasselbe.
12
Nach ein paar Stunden machten wir uns auf. Wir hatten die Hoffnung, bald wieder in Gebiete zu kommen, in denen das Überleben leichter war.
Aber das war nicht so einfach.
Wir kannten unsere Position nicht und so konnte es gut sein, dass wir mitten in die Hölle hineinritten. Aber das Risiko mussten wir eingehen. Das Schlimmste, was wir tun konnten, war einfach dazusitzen und abzuwarten. Eine offene Frage blieb auch, was mit den McCrane-Leuten war. Vielleicht hatte der Schneesturm sie auseinandergesprengt oder zum Umkehren bewegen können. Aber es war ebenso gut möglich, dass sie irgendwo eine Stelle gefunden hatten, an der man ausharren konnte und nun ihre Verfolgung fortsetzten.
Was das Schicksal unserer Verfolger anging, so sollte sich das später klären, doch soviel sei jetzt schon gesagt: Sie hatten das schlechtere Los gezogen.
Einen halben Tag waren wir geritten, ohne genau zu wissen, wohin uns unser Weg letztlich führen würde, da stießen wir auf Hufspuren im Schnee.
"Verdammt!", meinte Chip. "Das muss die McCrane Meute sein!" Er schluckte. "Die Spuren sind noch nicht alt..." Ich schüttelte den Kopf.
"Ich glaube nicht, dass das die McCrane-Leute sind", murmelte ich.
Chip runzelte die Stirn.
"Weshalb nicht?"
Ich zügelte mein Pferd und besah mir die Spuren. Dann ließ ich mich aus dem Sattel gleiten, um sie besser studieren zu können.
Ich ging ein paar Meter auf und ab.
"Hey, Joe, was soll das? Machen Sie sich nicht lächerlich, wer sollte sonst in dieser Gegend herumstreunen?" Ich blickte auf.
"Indianer, Chip. Leben hier nicht die Paiutes?"
"Aye, Paiutes. Hin und wieder hört man auch von Schwarzfüßen. Aber..."
"Dies hier" - ich deutete auf die Spuren - "waren nicht nur Reiter, sondern auch Fußgänger. Einige Pferde haben offensichtlich Lasten auf Stangen hinter sich hergeschleift..."
Chips Gesicht veränderte sich. Er schien nachdenklich zu werden.
"Hm..."
"Und noch etwas!", fuhr ich fort. "Einige der Pferde sind beschlagen, andere nicht!"
Das konnte alles mögliche bedeuten. Bei Indianerpferden erwartet man eigentlich, dass sie unbeschlagen sind. Vielleicht handelte es sich um Beutepferde.
Ich schwang mich wieder in den Sattel und wir setzten unseren Ritt in gemäßigtem Tempo fort, um unsere Gäule zu schonen. Sie hatten das nötig und wir wussten nicht, wozu wir die Kraft und Schnelligkeit der Tiere noch brauchen würden.
13
Wir verloren die Spuren wieder aus den Augen. Und natürlich hatte keiner von uns beiden Lust, mit jenen zusammenzutreffen, die sie verursacht hatten: Mochten es nun die McCraneLeute oder kriegerische, halbverhungerte Paiute-Indianer sein.
Am Abend tauchten einige Bergketten auf, aber es waren aller Wahrscheinlichkeit nicht die Berge, die wir auf unsere Flucht bereits passiert hatten.
Bei Einbruch der Dämmerung erreichten wir die ersten schroffen Felsmassive, in deren Schutz wir die Nacht verbrachten.
Als wir dann am folgenden Tag durch enge Schluchten und an steilen Abhängen entlangritten, konnte ich mich des unguten Gefühls nie ganz erwehren, dass wir beobachtet wurden. Ich sagte Chip das, aber der lachte nur darüber.
"Sie scheinen nichts gewöhnt zu sein!", spottete er. "Ein paar Tage in so einer Einöde und schon versagt Ihr gesunder Menschenverstand, Joe!"
Ich erwiderte nichts.
Es lohnte keinen Streit. Außerdem wäre mir nichts lieber gewesen, als Unrecht zu behalten. Aber mein Instinkt ist ziemlich untrüglich. Ich kann mich ganz gut darauf verlassen und so blieb ich wachsam.
Manchmal war es mir, als würde sich auf einem der hochgelegenen Felsplateaus, weit über unseren Köpfen, irgendetwas bewegen.
Aber das mochte auch Täuschung sein. Ich war mir nicht sicher.
Nach weiteren Stunden sah ich dann eine in Felle gehüllte Gestalt, die hoch oben auf einem Felsen stand und sich gegen den hellgrauen Himmel abhob, in der Hand ein Gewehr. Ich zügelte mein Pferd und deutete hinauf.
"Sehen Sie sich den da oben an, Chip!" Chip verzog das Gesicht.
"Könnte Ärger geben!", meinte er.
"Ein Paiute?", fragte ich.
Chip nickte.
"Vermutlich."
Die Gestalt verschwand und für die nächsten Stunden sahen wir keinen mehr von den Roten. Aber das konnte niemanden uns wirklich beruhigen.
Weitere Stunden gingen dahin, ohne, dass etwas Außergewöhnliches geschah. Erst als wir das Bergland mit seinen schroffen Felshängen und abgrundtiefen Schluchten schon fast hinter uns gelassen hatten, brach die Hölle über uns herein.
Wir hatten wohl beide nicht damit gerechnet, dass es so schlimm kommen würde.
14
Bei einem Felsvorsprung tauchte plötzlich eine Gestalt wie aus dem nichts auf, legte ein Gewehr an und schoss. Die Kugel pfiff dicht über unsere Köpfe hinweg und gleich darauf folgte ein Geschosshagel aus verschiedenen Richtungen. Um uns herum waren Felsen. Unsere Gegner waren also in der denkbar günstigsten Lage.
Sie hatten Deckung, waren in der Übermacht und konnten nun ein regelrechtes Preisschießen auf uns veranstalten. In diesem Moment konnten wir nur dafür beten, dass sie nicht allzu reichlich mit Munition ausgestattet waren und daher sparsam damit umgehen mussten.
Aber im Augenblick war davon noch nichts zu merken. Meine Hand ging sofort zum Revolver, aber ich kam zunächst gar nicht dazu, einen Schuss abzugeben.
Mein Gaul stieg hoch, stellte sich wiehernd und mit den Vorderbeinen strampelnd auf die Hinterhand und ich hatte zunächst alle Mühe, das Tier wieder unter meine Kontrolle zu bringen.
Dann erst konnte ich zum ersten Schuss ansetzen, der einen der Indianer von den Felsen holte. Er stürzte getroffen den steilen Hang hinab und wenn ihn meine Kugel nicht umgebracht hatte, dann bestimmt der anschließende Aufprall auf den hartgefrorenen, steinigen Boden, über dem die Schneedecke äußerst dünn war.
Ich wirbelte im Sattel blitzschnell herum und gab auch in die andere Richtung einen Schuss ab. Irgendwo stieß jemand einen unterdrückten Schrei aus, der zwischen den Felswänden widerhallte.
Vielleicht hatte ich getroffen.
Ich hatte keine Gelegenheit, das näher zu überprüfen. Ein kurzer Seitenblick ging zu Chip Barrows, der ebenfalls seinen Colt in der Hand hatte.
Chip ballerte wild herum, ohne dabei viel Erfolg zu haben. Er mochte ein guter Pferdedieb sein, ein besonders guter Schütze war er jedenfalls nicht.
"Weg hier!", rief ich und wollte meinem Gaul, den ich gerade wieder vollends unter meiner Gewalt hatte, die Hacken in die Seiten treiben, da hörte ich, wie Chip ein unterdrücktes Stöhnen über Lippen kam.
Dann fluchte er lauthals.
Ich sah zu ihm hin.
Er hatte eine Kugel in die Schulter bekommen, die Waffe war seiner Hand entglitten und fiel nun in den Schnee. Genau in diesem Augenblick erwischte es ihn dann zum zweiten Mal. Und diesmal tödlich.
Die Kugel kam von hinten und wenn sie durch seinen Körper durchgeschlagen wäre, wäre ich ebenfalls ein toter Mann gewesen.
Mit starren Augen sackte er aus dem Sattel.
Von hinten kam ein Indianer zu Pferd herangeprescht, vermutlich der Schütze. Er legte sein Gewehr erneut an und schoss ohne lange zögern.
Ein gezielter Schuss von mir ließ ihn aus dem Sattel fallen. Dann ließ ich mein Pferd vorwärts schnellen. Ich presste mich dabei so eng es ging an den Rücken des Tieres. So ein Pferd musste für die Rothäute hier draußen einen gewissen Wert besitzen.
Ich vermutete also, dass sie alles daransetzen würden, es lebend zu bekommen und nicht durch einen ungeschickten Schuss zu töten.
Ich ritt wie der Teufel und versuchte, das Letzte aus meinem Gaul herauszuholen.
Für Chip Barrows konnte ich nichts mehr tun, aber wenn mir das Glück ein wenig half, dann gab es für mich vielleicht so etwas wie den Hauch einer Chance, dem Tod noch einmal von der Schippe zu springen.
Einen von den Indianern schoss ich noch aus den Klippen heraus, dann gelangte ich offenes, ebenes Land. Ich wusste nicht, wohin ich ritt.
Ich achtete auch kaum darauf. Ich wusste nur, dass hinter mir ein paar Rothäute her waren, die mir vermutlich mein Pferd und meine Sachen wegnehmen wollten und die keinen Augenblick zögern würden, mich dafür umzubringen. Ein flüchtiger Blick nach hinten verriet mir, dass drei Reiter mich verfolgten.
Ein vierter Indianer hatte sich wohl ebenfalls auf den Rücken seines Pferdes begeben, aber der hatte bereits einen ziemlichen Rückstand.
Sein Pferd schien auch nicht das Schnellste zu sein, so dass dieser Rückstand immer größer wurde, bis er schließlich am Horizont verschwand.
Aber die drei anderen würden mir Probleme bereiten. Sie waren hervorragende Reiter und holten stetig auf. Meinem Gaul war in der letzten Zeit einiges abverlangt worden und das machte sich nun bemerkbar. Er dampfte wie eine Lokomotive und hatte Schaum vor dem Mund.
Das Tier ließ merklich nach und es gab nichts, was ich dagegen tun konnte.
Aber es war deutlich zu spüren. Unverkennbar sah man es daran, wie die Rothäute hinter mir aufholten.
Ich hörte das johlende Geschrei meiner Verfolger. Sie schienen sich ihres Triumphs sicher zu sein, aber ich hatte keine Lust, mich einfach so in das zu fügen, was unausweichlich schien.
Schon donnerten die ersten Schüsse in meine Richtung. Ich duckte mich tief, obwohl ich natürlich wusste, dass mich das auf die Dauer nicht retten konnte.
Mit dem Revolver ballerte ich zurück.
Das Meiste ging daneben, aber einmal hatte ich Glück. Ich traf eines der Pferde und schoss es seinem Reiter förmlich unter dem Hintern weg.
Das war nicht unbedingt meine Absicht gewesen, aber es nützte mir. Das Pferd wieherte laut auf, strauchelte und ging dann mitsamt seinem Reiter zu Boden, der sich schnell in den Schnee abrollte, um nicht unter dem Tier begraben zu werden. Für die weitere Verfolgung fiel er natürlich aus, aber das hieß nicht, dass die beiden anderen jetzt aufgaben.
15
Eine ganze Weile zog sich die Hetzjagd noch hin. Sie kamen näher heran, aber noch hatten sie mich nicht. Sie waren nur zu zweit, aber das Kriegsgeschrei, dass sie veranstalteten, konnte einem den letzten Rest Verstand aus dem Hirn treiben!
Sie waren gut bewaffnet.
Das zeigte mir schon die rasche Folge, in der sie mir ihre Kugeln hinterherjagten. Das mussten Winchesters sein, keinesfalls aber altmodische Vorderlader! Mochte der Teufel wissen, woher sie die Waffen hatten!
Jedenfalls pfiff mir gerade mal wieder ein Kugelhagel um die Ohren.
Plötzlich merkte ich, dass mit meinem Gaul etwas stimmte. Ich sah das Blut, das den Schnee verfärbte.
Das Tier taumelte noch ein paar Schritt nach vorn, bevor es getroffen zu Boden ging.
Bevor ich absprang und mich am Boden abrollte, gelang es mir gerade noch, mein Winchester-Gewehr aus dem Sattelschuh zu ziehen.
Das war auch dringend notwendig! Mein Revolver war nämlich leergeschossen und so hatte ich ihn in Holster zurückgesteckt. An ein Nachladen war im Moment natürlich überhaupt nicht zu denken!
Ich rollte mich im Schnee herum, während links und rechts von mir die Kugeln einschlugen.
Die Verfolger kamen in rasendem Tempo und wild um sich schießend heran. Das waren wirklich tollkühne Reiter, die auch im vollen Galopp keine Probleme damit hatten, ein Gewehr anzulegen und einigermaßen ruhig zu halten!
Sie preschten heran ich konnte von Glück sagen, bisher noch kein Blei im Körper zu haben. Ich rappelte mich kurz auf, um mich dann wieder mit einem Hechtsprung in den Schnee zu werfen.
Deckung gab es hier nirgends.
Ich riss die Winchester hoch und feuerte.
Daneben.
Dann rollte ich herum. Dort, wo ich gerade noch gelegen hatte sah ich ein Geschoss einschlagen.
Der Schütze war bis auf wenige Dutzend Meter herangekommen und legte nun erneut an. Aber blitzschnell hatte ich die Waffe hochgerissen und zwei Schüsse abgegeben. Einer traf ihn in die Schulter, der andere direkt in den Kopf. Er wankte kurz und sackte dann vom Rücken seines Pferdes. Ich wirbelte herum, um den Zweiten zu erwischen. Eine Kugel pfiff mir knapp über den Kopf und riss mir den Hut herunter.
Ich feuerte zurück und jagte ihm eine Kugel in den rechten Arm. Er schrie und fluchte laut in einer Sprache, die ich nicht verstand. Das Gewehr war seiner Hand entfallen und lag nun im Schnee.
Mit Ausnahme des Gewehrs hatte er keine Schusswaffen bei sich, zumindest nicht soweit ich sehen konnte. Ich sah nur den Griff eines Messers aus einem Lederfutteral ragen. Ich stand auf und dann starrten wir uns einige Augenblicke lang an.
Sein Gesicht war starr vor Schreck geworden. Er hielt sich den Arm, der stark blutete.
Ich lud die Winchester durch. Falls er zum Messer griff, um es gegen mich zu schleudern, würde ich schießen müssen. Aber ich hoffte inständig, dass es nicht dazu kam.
Ich trat einige Schritt auf ihn zu. Er ließ sein Pferd etwas zurückweichen.
Sein Leben war in meiner Hand und wir beide wussten das. Aber ich bin kein feiger Mörder, der auf Wehrlose schießt. Ich töte nur, wenn mir keine andere Wahl gelassen wird. So bückte ich mich kurz, um sein Gewehr aufzuheben, ohne dabei den Blick von meinem Gegenüber zu nehmen. Dann öffnete ich das Magazin und ließ eine Patrone nach der anderen in den Schnee plumpsen. Als ich fertig war, warf ich ihm die Waffe zu und er fing sie mit der unversehrten Linken.
Er sah mich etwas ungläubig an.
Ich nickte ihm zu.
Dann zog er sein Pferd am Zügel und drehte ab. In gemäßigtem Tempo ritt er davon, ohne sich noch einmal nach mir umzudrehen.
Ich sah dem Indianer noch einen Moment lang nach, dann ging ich zurück, hob meinen Hut wieder vom Boden auf und wandte mich dann dem Gaul des Getöteten Indianers zu. Das Tier war einigermaßen zutraulich.
Es fiel mir auf, dass der Sattel eindeutig nicht indianischer Herkunft war. Es war ein ganz gewöhnliches Stück, wie es Cowboys für gewöhnlich verwandte. Dann sah ich die Markierung.
Es waren Tiere der McCrane-Ranch. Sie trugen dieselbe Markierung, wie jene Pferde, die Chip Barrows gestohlen hatte!
Ich schluckte.
Damit war das Schicksal meiner Verfolger wohl geklärt, wie im Übrigen auch die Frage, woher die Paiutes die Winchester-Gewehre hatten...
Irgendwo mussten die McCrane-Leute ihnen in die Arme gelaufen sein...
Ich nahm dem Pferd den Sattel herunter und legte ihm meinen eigenen auf den Rücken. Dann schwang ich mich hinauf und ritt davon.
16
In den folgenden Tagen sah ich keinen Menschen, weder weiß noch rot. Und wenn ich an das dachte, was hinter mir lag, dann war mir ein bisschen Einsamkeit ganz recht. Um Chip Barrows tat es mir leid.
Er war ein Pferdedieb und Schurke. Und ihm verdankte ich den Schlamassel, in dem ich saß. Aber ein solches Ende hatte er wirklich nicht verdient!
Nein, wirklich nicht.
Ich irrte also allein durch das Ödland, durch diese Leere, in der es nichts nichts gab, buchstäblich nichts, oft sogar kaum etwas, dass sich verbrennen und zu Lagerfeuer machen ließ.
Meine Vorräte gingen langsam aber sicher zu Ende. Ich hatte mich zwar auf eine längere Reise eingestellt, hatte aber angenommen, durch Gebiete zu kommen, in denen etwas zu Jagen gab.
Ich hatte noch das Geld, dass ich während des Sommers gespart hatte. Für manche Leute nur ein Trinkgeld, aber für mich war es schon eine erhebliche Summe.
Aber im Moment half es mir nicht im Mindesten weiter. Eines Nachts hatte ich es mit einem Steppenwolf zu tun. Der alte Räuber war sicherlich genauso hungrig wie ich es war, aber deshalb konnte ich ihm noch lange nicht erlauben, mich oder mein Pferd zu verspeisen.
Ein großes Tier, dachte ich. Wenn auch vielleicht nicht gerade ein Hochgenuss, aber wer kann in so einer Lage schon wählerisch sein? Sein Fleisch würde so gut oder schlecht sein wie das Fleisch von jedem anderen Tier.
Der Gaul wurde nervös, als der Räuber um mein Lager strich. Alles, was ich von meinem Gegner die meiste Zeit über sah, war ein schattenhafter Umriss.
Mit ein paar gezielten Schüsse aus der Winchester versuchte ich ihn zur Strecke zu bringen. Aber es klappte nicht. Ich ballerte daneben und das Tier war weg. Die Sicht war einfach zu schlecht.
Am nächsten Tag erwischte ich dann irgendein kleines Nagetier. Mehr Knochen als Fleisch, aber es schmeckte mir unter diesen Umständen vorzüglich.
17
Die Tage und Nächte gingen dahin und ich hatte noch immer keinen Weg aus dieser menschenfeindlichen Ödnis gefunden. Aber immerhin lernte ich, mich etwas besser an die Verhältnisse hier anzupassen und zu überleben.
Eines Nachts erwachte ich dann, weil das Pferd unruhig war. Ich hatte mein Lager im Windschatten einiger Felsen errichtet.
Mein Griff ging zum Revolver und ich ließ den Blick umherschweifen. Hier und dort meinte ich, eine Bewegung zu sehen, einen Schatten...
Doch dann war ich mir nicht mehr sicher, ob ich mich nicht getäuscht hatte...
Fast wollte ich den Colt schon wieder wegstecken, da brach die Hölle los.
Schemenhafte Gestalten tauchten aus der Dunkelheit heraus auf und dann sah ich das Mündungsfeuer einer Waffe. Schüsse peitschten durch die Nacht und Stimmen schrien durcheinander. Es waren indianische Kriegsschreie.
Offensichtlich war ich erneut in den Bereich irgendeiner streunenden Horde nomadisierender Rothäute geraten. Sicher hatten sie mich den ganzen vorherigen Tag über beobachtet und nun auf ihre Chance gewartet, mir das Pferd und die Waffen wegnehmen zu können.
Ich rollte mich zur Seite, während dort, wo ich gerade noch gelegen hatte, die Bleikugeln einschlugen und meine Decke durchlöcherten.
Ich feuerte zurück. Eine der Gestalten schrie kurz auf und sackte getroffen zusammen, aber die anderen hatten sich längst über das Pferd hergemacht und zogen es mit sich. Einer von ihnen feuerte in meine Richtung und erwischte mich an der Seite.
Es tat höllisch weh, aber ich biss die Zähne zusammen. Ich feuerte noch einmal, aber diesmal ohne Erfolg. Sie hatten ihre Pferde in der Nähe, und wenige Augenblicke später preschten sie davon. Und meine Sachen und mein Pferd führten sie mit sich!
Ich rannte keuchend ein Stück hinter ihnen her und sandte ihnen ein paar Kugeln hinterdrein.
Aber das war alles sinnlos.
Der Spuk war so schnell vorbei, wie er gekommen war und dann stand ich allein im kalten Nachtwind und hielt mir die blutende Seite.
Erst jetzt merkte ich, wie böse es mich erwischt hatte.
18
Ich schleppte mich zurück zum Lagerplatz.
Die Roten hatten wirklich gut aussortiert. Alles, was irgendwie für das Überleben in diesem Landstrich wichtig sein konnte, hatten sie mitgenommen.
Ich fluchte innerlich, aber es war jetzt nicht mehr zu ändern. Sie waren auf und davon und ich konnte froh sein, dass ich noch atmete.
Meine Satteltaschen mit den Vorräten hatten sie mit sich genommen, ebenso das Winchester-Gewehr.
Der Sattel hingegen lag noch da.
Ich seufzte.
Es war ein schönes Stück und ich hatte lange dafür schuften müssen, um es mir leisten zu können.
Aber ich konnte es nicht mitnehmen.
Ich versuchte meine Wunde notdürftig zu versorgen und die Blutung zu stoppen. Aber das war leichter gesagt als getan. Da musste dringend ein Doc dran, aber hier gab es weit und breit keinen.
Den Rest der Nacht über versuchte ich, etwas Schlaf zu finden, was mir kaum gelang. Die Schmerzen waren zu groß. So machte ich mich am frühen Morgen auf den Fußmarsch. Ich hatte keine Ahnung wohin. Aber es war besser, sich auf irgendeinen, noch ungewissen Weg zu machen, als einfach dazusitzen und auf das Ende zu warten.
Es wurde ein grauer, kalter Tag.
Wie automatisch setzte ich einen Fuß vor den anderen. Es war gegen Mittag, als ich langsam merkte, dass es nicht mehr weiter ging.
Ich schleppte mich noch einige Schritt vorwärts, dann sackte ich zusammen. Ich spürte, wie Kraft aus meinem Körper floh. Die Beine versagten mir einfach den Dienst. Ich sank in den Schnee und hörte mein eigenes Keuchen. Mir schwindelte. Alles begann sich zu drehen. Dann wurde es finster.
19
Dunkelheit und gnädige Bewusstlosigkeit hatten mich lange Zeit umfangen. Jetzt hörte ich Stimmen.
"Schau nur, da liegt ein Mann im Schnee!" Es war eine junge Frauenstimme.
"Ich sehe es auch, Kind. Aber was kümmert er uns?" Die zweite Stimme gehörte einem Mann und klang wie ein Reibeisen.
"Er ist verletzt!"
"Na, und?"
"Wir können ihn nicht so liegenlassen!" Ein Wagen wurde angehalten, die Bremsen quietschten etwas.
"Er ist keiner von uns", meinte der Mann.
"Woher willst du das wissen?"
"Ich würde ihn kennen. Ich kenne jeden hier im Tal und weiß, wer dazugehört und wer nicht!"
Ich kam langsam ein bisschen mehr zu mir, aber noch brachte ich es nicht fertig, mich zu bewegen. Dann kamen auch die Schmerzen zurück, die Schmerzen von der Schusswunde an meiner Seite.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich hier so im Schnee gelegen hatte.
Nun hörte ich Schritte. Erst flinke, leichte. Dann, etwas später, schwerere.
"Er wird sterben, wenn wir ihn hier zurücklassen", meinte die Frau.
"Ja, das wird er wohl...", murmelte die Reibeisenstimme. Und dann, nachdenklicher: "Ich frage mich, wie er es bis hier her geschafft hat - ohne Pferd!"
"Vielleicht ist er von Indianern überfallen worden!"
"Schon möglich..."
"Bitte, lass ihn uns mitnehmen!"
"Was hätten wir davon, Kind?"
"So darf man nicht fragen! Er ist ein Mensch!" Mit etwas belegter Stimme fuhr sie fort: "Ihr habt mich auf ähnliche Weise gefunden! Und ihr habt mich nicht in der Wüste verenden lassen wie ein Tier!"
"Hm..."
In dem Gehirn, das zu der Reibeisenstimme gehörte, schien es zu arbeiten.
Ich versuchte unterdessen die Muskeln anzuspannen, versuchte, mich irgendwie bemerkbar zu machen.
Aber es gelang mir nicht.
Die Kraft war schon zu sehr aus meinem geschundenen Körper geschwunden.