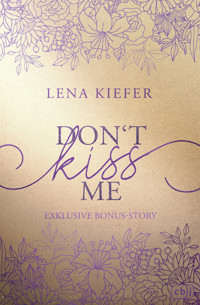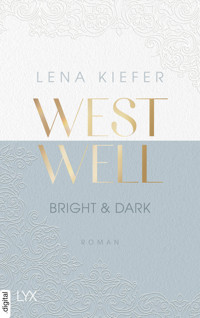9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Westwell
- Sprache: Deutsch
Unsere Geschwister starben, weil sie sich liebten. Jetzt sind wir dazu bestimmt, einander zu hassen. Aber was, wenn das unmöglich ist?
Als Helena Weston nach New York zurückkehrt, hat sie nur ein Ziel: den Ruf ihrer Schwester wiederherstellen, koste es, was es wolle. Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Valerie und ihre große Liebe Adam nach einer Partynacht tot in ihrer Hotelsuite aufgefunden wurden, und seitdem lässt Adams Familie keine Gelegenheit aus, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Einzig Helena glaubt fest an die Unschuld ihrer Schwester, und sie setzt alles daran, herauszufinden, was in jener schicksalhaften Nacht wirklich geschehen ist. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Jessiah Coldwell - Adams jüngerer Bruder - in die Quere. Helena weiß, dass sie Jess eigentlich mit jeder Faser ihres Seins hassen müsste. Und doch weckt er Gefühle in ihr, gegen die sie schon bald machtlos ist ...
"WESTWELL vereint alles, was ich an New Adult liebe - große Gefühle, dramatische Wendungen und die richtige Menge an Spannung. Es ist unmöglich, nicht mit Helena und Jess mitzufiebern!" SARAH SPRINZ
Band 1 der WESTWELL-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lena Kiefer
Band 1: Westwell - Heavy & Light
Band 2: Westwell - Bright & Dark (26.10.2022)
Band 3: Westwell - Hot & Cold (22.02.2023)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 606
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Motto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lena Kiefer bei LYX
Impressum
LENA KIEFER
WESTWELL
HEAVY & LIGHT
Roman
Zu diesem Buch
Zweieinhalb Jahre ist es her, dass Helena Weston New York verlassen musste, nachdem ihre ältere Schwester Valerie und deren Verlobter Adam nach einer Party tot in der Suite eines New Yorker Luxushotels aufgefunden wurden. Bis heute weiß niemand, was in jener schicksalshaften Nacht wirklich geschehen ist, doch seit-dem hat Adams Familie keine Gelegenheit ausgelassen, Valerie die alleinige Verantwortung am tragischen Tod der beiden zu geben. Jetzt ist Helena zurück, und sie hat nur ein Ziel: herauszufinden, was damals wirklich geschehen ist und endlich Valeries Unschuld zu beweisen. Aber auf der Suche nach der Wahrheit kommt ihr ausgerechnet Jessiah Coldwell in die Quere. Adams jüngerer Bruder hasst New York und wünscht sich nichts sehnlicher, als der Stadt ein für alle Mal den Rücken zu kehren. Umso weniger begeistert ist er von der Upper-Class-Prinzessin, die plötzlich überall zu sein scheint und viel zu viele Fragen stellt – und in deren Augen er dieselbe Wut und dieselbe Trauer erkennt, die er auch empfindet. Und obwohl die beiden sich eigentlich mit jeder Faser ihres Seins verabscheuen müssten, weckt die Nähe des jeweils anderen in ihnen Gefühle, gegen die sie schon bald machtlos sind …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die triggern können. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Steffi,
danke für all dein Vertrauen.
Playlist
Westwell Theme – technokrates
Everything That Isn’t Me – Lukas Graham
You Said You’d Grow Old With Me – Michael Schulte
Don’t Kill My Vibe – Sigrid
Style – Taylor Swift
Tiny Riot – Sam Ryder
The One – Backstreet Boys
What Other People Say – Demi Lovato, Sam Fischer
Perfectly Imperfect – Declan J Donovan
Catch Me When I Fall – Ashlee Simpson
Save me from the Monster in my Head – Welshly Arms
Love Story (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Beautifully Unfinished – Ella Henderson
Rewrite the Stars – Zac Efron, Zendaya
Marina del Rey – Lola Rhodes
Can’t Help Falling in Love – Kina Grannis
Safest Place to Hide – Backstreet Boys
If I Could Fly – One Direction
Waking Up Slow (Piano Version) – Gabrielle Aplin
Falling Apart – Michael Schulte
»Love is heavy and light,
bright and dark,
hot and cold,
sick and healthy,
asleep and awake –
it’s everything except what it is!«
William Shakespeare, »Romeo & Juliet«
1
Helena
Home is where the heart is.
Ich hatte diesen Spruch immer albern gefunden. Leere Worte, die man auf kitschige Valentinskarten druckte oder sich als Tattoo stechen ließ, weil sie gut klangen, obwohl sie rein gar nichts aussagten. Nachdem man mich jedoch fortgeschickt hatte, war mir klar geworden, dass dieser Satz eine Menge Wahrheit enthielt. Und als ich jetzt, zweieinhalb Jahre später, aus dem Taxifenster einen Blick auf die Skyline von New York erhaschen konnte, fühlte ich mich von diesen Worten auf gewisse Weise verstanden. Nicht genug, um ins nächste Tattoo-Studio zu fahren. Aber es reichte, um einen Kloß im Hals zu spüren.
»Zum ersten Mal hier?«, fragte der Taxifahrer und riss mich damit aus meinen Gedanken.
»Nein«, antwortete ich ihm. »Ich bin in New York geboren und aufgewachsen. Allerdings war ich eine Weile weg.« Mein halbes Leben, zumindest fühlte es sich so an.
In dieser Zeit hatte ich gelernt, was Heimat bedeutete. Oder wie es war, wenn man sie verlassen musste. Solange man sich am richtigen Ort befand, spürte man nämlich nicht dieses merkwürdige Ziehen im Magen, das einem sagte: Du kannst hier nicht glücklich sein. Denn du gehörst nicht hierher.
Ein Blick aus dem Rückspiegel traf mich. »Und, sind Sie froh, wieder da zu sein?«
»Ja. Mehr als das.« Alles in mir hatte genau diesen Tag herbeigesehnt, an dem ich endlich nach New York zurückkehren durfte. Aber gleichzeitig hatte ich Angst. Sosehr ich diese Stadt liebte, ich kannte sie nur mit ihr. Mit Valerie.
Wie würde es hier ohne sie sein?
Die Frage blieb in meinem Kopf, während wir über die Robert-F.-Kennedy-Brücke nach Manhattan hineinfuhren. Gebannt sah ich aus dem Fenster, als wäre ich genau die Touristin, für die mich der Taxifahrer gehalten hatte. Ich registrierte jedes einzelne Gebäude, das wir in den Häuserschluchten passierten, die Menschen in ihren Klamotten von todschick bis abgerissen, die Hot-Dog-Stände, die Zeitungsverkäufer. Und mit jedem Meter merkte ich, wie in mir gleichzeitig etwas aufriss und heilte. Es war eine Wunde, die schrecklich tief war und sich nie ganz schließen würde. Denn ein Teil meines Herzens fehlte, und er würde immer fehlen. Aber immerhin der Rest war wieder da, wo er hingehörte.
Zwei Kreuzungen und drei Ampeln, dann bogen wir in die Park Avenue ein. Um diese Zeit am Sonntagvormittag war weniger Stau als sonst, deswegen dauerte es nur ein paar Minuten, bis der Fahrer in einer Lücke einige Häuser von der richtigen Adresse entfernt hielt. Ich bezahlte mit meiner Kreditkarte, anschließend lud er mein Gepäck aus und ich bedankte mich.
»Willkommen zurück in New York.« Er nickte mir zu, stieg ein, und nur wenige Augenblicke später war das Cab bereits in dem nie endenden Strom aus gelben Wagen untergetaucht.
Ein Blick auf meine Uhr sagte mir, dass es kurz nach zehn war. Perfektes Timing, genauso, wie ich es geplant hatte. Ich atmete noch einmal die kalte Februarluft ein, packte den Griff meines Koffers und ging auf den vertrauten Eingang mit dem dunklen Vordach zu, über dem der Schriftzug 740 Park Avenue zu sehen war. Ein junger Mann mit grauem Sakko und schwarzer Krawatte öffnete mir die Tür, als ich näher kam. Im Foyer empfing mich wohlige Wärme.
»Guten Morgen, Miss«, begrüßte mich der Portier hinter dem Tresen mit einem höflichen Lächeln, das etwas distanziert wirkte.
»Guten Morgen«, gab ich zurück, weil ich ihm noch nie begegnet war und daher keine Ahnung hatte, wie er hieß. Früher hatte ich jeden gekannt, der in unserem Wohnhaus arbeitete. Aber zweieinhalb Jahre waren in einer Stadt wie dieser eine lange Zeit.
»Zu wem möchten Sie bitte?« Er nahm das Telefon am Tresen zur Hand.
Ich war bemüht, mir meine Verwunderung über seine Frage nicht anmerken zu lassen. Der Portier war offenbar neu und ich einen Tag zu früh dran, da konnte ich nicht erwarten, dass er Bescheid wusste. Zumal ich gerade sicher nicht so aussah, wie man es von mir erwartete.
»Zu den Westons«, sagte ich freundlich.
»Zu den Westons? Haben Sie einen Termin?« Er ließ den Hörer wieder sinken, nun eindeutig skeptisch. Sein Blick glitt über meine abgewetzte Lederjacke und die Jeans, als fragte er sich, ob ich irgendwo eine Waffe versteckt hatte, mit der ich die ehrwürdige Familie Weston wahlweise erpressen, entführen oder kaltmachen wollte. Gerne hätte ich ihm genau das gesagt, aber die Art Humor war in diesem Haus nicht angebracht. Hinter dem Schalter befand sich ein Rufknopf für die Polizei, wie es ihn auch in Banken gab. Und ich wollte meinen Neustart in New York sicher nicht mit einer Verhaftung beginnen.
»Ich bin Helena Weston«, blieb ich bei der Wahrheit. »Die Tochter.«
»Die Tochter?« Er war immer noch skeptisch.
»Ja, genau.« Mit einem Seufzen wühlte ich in meiner Tasche und zog mein Portemonnaie hervor, um den Führerschein des Staates New York herauszuholen, den ein drei Jahre altes Bild von mir zierte. Als ich es sah, verzog ich das Gesicht. Dieser Pony war wirklich keine gute Idee gewesen.
Ich legte den Führerschein auf den Tresen und deutete auf meinen Namen. »Brauche ich immer noch einen Termin?«
Sofort veränderte sich der Ausdruck auf dem Gesicht des Portiers. »Oh, bitte entschuldigen Sie, Miss Weston, ich hatte keine Ahnung … Man sagte mir, Sie würden erst morgen ankommen.« Und andere Klamotten tragen, schien sein erschrockener Gesichtsausdruck hinzufügen zu wollen. Schließlich kannte man mich in New York ausschließlich in Designerkleidung und meine Haare nur mit 500-Dollar-Schnitt statt zu einem einfachen Zopf gebunden, so wie jetzt.
»Schon gut. Darf ich nun nach oben?«
»Natürlich«, sagte er eifrig. »Soll ich Sie ankündigen?«
»Nein«, ich schüttelte den Kopf. »Es soll eine Überraschung sein.«
Kurz schien den Portier die Sorge zu durchzucken, dass ich doch eine Profikillerin sein könnte – und er damit spätestens morgen auf den Titelseiten der Klatschblätter landen würde. Aber dann deutete er auf meinen Koffer.
»Soll ich mich um Ihr Gepäck kümmern?«
»Nicht nötig, ich nehme es selbst mit rauf.«
Er nickte. »Einen schönen Tag, Miss Weston. Willkommen zurück.«
»Danke … Wie heißen Sie eigentlich?«
»Lionel, Miss.«
»Dann danke, Lionel.« Ich lächelte, nahm meinen Koffer und rollte ihn zu einem der beiden Fahrstühle.
Als ich in die mit Marmorfußboden und Mahagoniholz ausgekleidete Kabine trat, die noch genauso nach Politur, Parfüm und dem leichten Aroma von Zigarren roch wie zu früheren Zeiten, überfiel mich eine ganze Horde an Erinnerungen. Wie ich als Kind am ersten Schultag an der Hand meines Vaters nach unten gefahren war, stolz bis in die Haarspitzen. Wie ich mit sechzehn hier drin mit Parker Harrison rumgemacht hatte, bis wir von den Gregorys aus dem vierten Stock gestoppt worden waren. Wie Valerie und ich uns im Aufzug umgezogen hatten, bevor wir heimlich auf eine Party in Brooklyn gegangen waren statt zu irgendeinem Dinner der High Society. Und wie sie mir in diesen engen vier Wänden erzählt hatte, dass sie der Liebe ihres Lebens begegnet war.
Die Trauer wollte mich überrollen und in den Abgrund ziehen, aber ich atmete tief ein und wieder aus, wehrte mich mit aller Macht dagegen. Freude. Das war es, was ich jetzt empfinden wollte. Freude darüber, dass ich meine Familie gleich bei ihrem traditionellen Brunch überraschen würde. Nein, bei unserem Brunch. Denn jetzt gehörte ich wieder dazu. Ab heute durfte ich jeden Sonntag am Tisch im Esszimmer sitzen, erstklassigen Kaffee genießen und mit meinem Bruder Lincoln darüber streiten, wer das letzte Croissant aus der französischen Bäckerei an der Madison bekam. Mir lief schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich nur daran dachte.
Der Fahrstuhl hielt in der richtigen Etage, und ich stieg aus, schritt auf die einzige Tür in diesem Flur zu und klingelte. Unser Butler Vincent legte allerhöchsten Wert darauf, dass ein Besucher niemals länger als zehn Sekunden vor der Tür warten musste, deswegen zählte ich langsam herunter, wie ein Countdown zu meinem neuen alten Leben.
10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Nichts passierte. Auch nicht kurz danach oder etwas später.
Hatte ich den Knopf nicht fest genug gedrückt? Oder diskutierten Dad und Lincoln mal wieder so heftig über irgendwelche Politikfragen, dass Vincent die Klingel gar nicht gehört hatte? Ich versuchte es noch einmal, ohne Erfolg.
Mit sinkender Stimmung kramte ich meinen Schlüssel aus der Tasche über meiner Schulter und schob ihn ins Schloss. Aber auch als ich den großzügigen Eingangsbereich unserer zweistöckigen Wohnung betrat, hörte ich nichts. Keine Stimmen, kein Geklapper von Besteck auf Tellern. Es war vollkommen still.
»Hallo?«, rief ich die geschwungene Treppe hinauf und kam mir dabei nur ein kleines bisschen dämlich vor. »Seid ihr da?«
Endlich regte sich etwas im Stockwerk über mir, und einige Momente später kam jemand herunter. Jemand mit Absätzen, die auf den Stufen leise klackten.
»Helena?« Meine Mutter sah erstaunt zu mir hinunter. »Was in aller Welt tust du hier? Wir haben dich erst morgen erwartet.« Ihr britischer Akzent klang vertraut in meinen Ohren. Kein Wunder, ich hatte die letzten Jahre ja kaum etwas anderes gehört.
»Hi, Mom«, lächelte ich. »Überraschung. Ich dachte, ich komme etwas eher, um mir den Brunch nicht entgehen zu lassen.«
Ein Brunch, der offensichtlich gar nicht stattfand, denn der Tisch im Esszimmer, den ich durch die offene Doppeltür sehen konnte, war vollkommen leer. Keine Croissants, kein dampfendes Rührei, kein Milchkaffee. Und auch der Aufzug meiner Mutter – dunkelblaues Etuikleid, sorgsam hochgesteckte Frisur, Pumps – passte nicht zu unserem Sonntagsritual, bei dem wir ausnahmsweise alle in Pyjama, Jogginghose oder Morgenmantel am Tisch saßen.
Meine Laune sackte eine weitere Etage tiefer. Bald würde ihr nur noch der Keller bleiben.
»Wie bist du hergekommen?« Sie schaute mich streng an.
»Ich bin mit dem Taxi gefahren«, antwortete ich ehrlich und wusste in derselben Sekunde, dass es ein Fehler gewesen war.
»Mit dem Taxi?« Die Stimme meiner Mutter wurde eine Nuance schriller. Bei ihr ging das schon fast als Hysterie durch. »Bist du von allen guten Geistern verlassen? Was sollen denn die Leute denken, wenn du am helllichten Tag vor diesem Haus aus einem Taxi steigst?«
Ich atmete ein. »Jeder Mensch in dieser Stadt fährt mit dem Taxi, Mom.«
»Du bist aber nicht jeder Mensch, Helena. Wir können es uns nicht erlauben, dass jemand glaubt, du wüsstest nicht, was sich gehört.«
»Mich hat doch niemand gesehen«, murmelte ich kleinlaut. Fast hätte ich etwas anderes geantwortet: Es ist mir völlig egal, was die Leute über mich denken. Valerie hätte das schließlich auch nicht interessiert. Aber es war nicht schlau, mich schon am ersten Tag mit meiner Mutter anzulegen. Dass ich wieder hier sein durfte, verdankte ich ihr. Und ich musste sie milde stimmen, wenn sie diese Entscheidung nicht bereuen sollte. »Ich habe mir nichts dabei gedacht, entschuldige. In Cambridge bin ich auch einfach Taxi gefahren.«
»New York ist nicht Cambridge, Schatz. Das solltest du doch eigentlich wissen.« Sie stieß die Luft aus und war fünf Sekunden später wieder Blake Weston, die unerschütterliche Mitherrscherin über das Imperium, das die Vorfahren meines Vaters aufgebaut hatten. Manche glaubten im ersten Moment, dass meine Mutter die typische Frau an der Seite eines erfolgreichen Mannes war, die seine Kinder großzog und ihm den Rücken freihielt. Aber eine halbe Stunde mit ihr und ihrem scharfen Verstand – und sie waren von diesen Vorurteilen kuriert.
»Warum ist denn niemand hier?«, fragte ich. »Normalerweise frühstücken wir am Sonntag doch alle zusammen.« Mein älterer Bruder wohnte zwar schon länger nicht mehr zu Hause, trotzdem war er immer dabei gewesen.
»Tut mir leid, dass du extra deswegen früher gekommen bist.« Meine Mom trat zu mir und umarmte mich endlich, wenn auch nur flüchtig. »Aber ich habe jetzt einen Termin beim Denkmalverein, und dein Vater ist geschäftlich bis Dienstag in Washington. Heute gibt es keinen Brunch.«
Nur heute? Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen war das nicht die ganze Wahrheit. Aber vielleicht hatte ich mich in den vergangenen Monaten auch zu viel mit nonverbalen Signalen, Mimik und Körpersprache beschäftigt. Schließlich war das Teil der Vorbereitung für meinen Plan gewesen. Der Plan, der direkt morgen starten sollte.
»Okay, dann eben nächste Woche«, sagte ich und versuchte, an ihrer Miene etwas abzulesen. Aber die war jetzt undurchdringlich. Allerdings nur, was das Thema Brunch anging. Der Blick, den sie meinem langen dunklen Pferdeschwanz zumaß, war eindeutig.
»Du brauchst dringend einen Haarschnitt. Ich lasse gleich morgen einen Termin bei Cara machen. Und was hast du da eigentlich an?« Sie befühlte mit nach unten gezogenen Mundwinkeln meine Jacke, die ich mir vor ein paar Monaten in einem kleinen Laden in Cambridge gekauft hatte. Wenn Mom gewusst hätte, dass sie secondhand war, hätte sie vermutlich sofort ein schönes Bad in Desinfektionsmittel genommen, Denkmalverein hin oder her.
»Die ist vintage. Das trägt man jetzt drüben auf der Insel.«
»Hier aber nicht«, gab sie mir zu verstehen. »Ich möchte nicht, dass dich jemand in diesem Aufzug in der Stadt sieht. Bitte entsorg sie so schnell wie möglich.«
Nur über meine Leiche, dachte ich.
»Sicher«, sagte ich und lächelte noch dazu. »Wo ist denn Vincent? Ich würde ihm gerne Hallo sagen.«
»Er ist eine Weile in Chicago, weil seine Schwester krank ist. Wir wissen noch nicht, wann er zurückkommt. Oder ob überhaupt.«
Davon hatte ich keine Ahnung gehabt. Wieso hatten sie das nicht erwähnt? Der Butler war schließlich ein Teil unserer Familie.
»Und der Rest des Personals?«
»Sie haben ihren freien Tag, weil wir dachten, dass eh niemand zu Hause sein würde.« Meine Mutter nahm ihre Handtasche und ihren Mantel. »Ich muss jetzt los. Pack du doch erst mal deine Sachen aus, in Ordnung? Es ist schön, dass du wieder da bist.« Sie strich mir über die Wange und ihre Worte klangen eher nach: Bittelassmichnichtbereuen,dassichmichbeidieserSachegegendeinenVaterdurchgesetzthabe. Der hätte nämlich gerne gesehen, dass ich bis zum Ende meines Studiums in England blieb. Oder eher bis zum Ende meines Lebens.
Ich nickte, immer noch lächelnd. Aber kaum war die Tür hinter ihr ins Schloss gefallen und ich stand vollkommen allein in der Eingangshalle, spürte ich das volle Gewicht der Enttäuschung in meinem leeren Magen. Ich hatte mir meine Rückkehr wirklich anders vorgestellt. Vom ersten Tag an, als man mich gegen meinen Willen nach England ins Internat geschickt hatte, war dieser Moment in meinem Kopf und meinem Herzen gewesen. Der Moment, wenn ich zurückkommen durfte. Nicht als braves, zur Untätigkeit verdammtes Mädchen, das seine Schwester verloren hatte. Sondern als fest entschlossene junge Frau, die Valeries Ruf wiederherstellen würde. Das hier war dieser Moment. Wieso fühlte er sich so fürchterlich an?
Ich ging zur Treppe, hob einen Fuß, stellte ihn dann aber doch nicht auf die erste Stufe. Da oben war mein Zimmer und das von Valerie, und ich hatte riesige Angst davor, was es mit mir machte, wenn ich es betrat und die volle Ladung Erinnerungen abbekam. Ein Teil von mir wollte genau das, mich mit ihren Sachen umgeben und meine Schwester wieder fühlen. Das, was sie ausgemacht hatte und was sie für mich gewesen war. Aber meine Angst gewann. Also ließ ich die Treppe links liegen und ging in den Wohnbereich.
Viel hatte sich nicht verändert, seit ich zum letzten Mal hier gewesen war. Es waren dieselben Antiquitäten, Brokattapeten, Chesterfield-Sofas aus Leder und schweren Teppiche – und natürlich standen überall frische Blumen. Das große Gemälde im Esszimmer war neu, irgendeine düstere Schlachtszene eines alten Meisters. Die Vorliebe meiner Eltern für Kunstwerke des Barock hatte ich nicht vermisst, mein Geschmack ging in eine ganz andere Richtung. Nicht umsonst stand ein Besuch im Museum of Modern Art auf der Liste der Dinge, die ich in New York unternehmen wollte. Ich hatte sie vor zwei Jahren geschrieben, als mir klar geworden war, dass ich so bald nicht in die USA zurückkehren würde.
Meine Eltern hatten nicht einmal erlaubt, dass ich zu Weihnachten herkam, stattdessen war die ganze Familie nach England geflogen. Sie hatten solche Panik davor gehabt, dass ich so enden könnte wie Valerie, dass sie mich mit aller Macht von dieser Stadt ferngehalten hatten.
Was auch immer das bedeuten sollte, so enden wie sie. Glücklich? Erfüllt? Verliebt? Denn all das war sie gewesen, als sie gestorben war.
Wieder war da dieser Kloß in meinem Hals, erneut schluckte ich ihn herunter. Dann beschloss ich, nicht länger hierzubleiben, wenn ohnehin niemand zu Hause war. Home is where the heartis? So fühlte es sich gerade nicht an. Aber vielleicht brauchte mein Herz etwas Nachhilfe und es wurde besser, wenn ich vor die Tür ging. Meine Heimat war schließlich nicht nur hier drinnen, sondern vor allem da draußen. Meine Heimat war New York City.
Ich gab mir einen Ruck und lief zurück in den Flur. Dort schnappte ich meine Tasche und ging zur Tür.
Es war höchste Zeit für ein bisschen frische Luft.
2
Jessiah
Der Strand von Rockaway Beach war grau und leer, als ich an diesem Morgen aus dem Wasser kam und mein Board ablegte. Ich ließ mich daneben auf den harten Sand fallen, drehte mich auf den Rücken und versuchte, zu Atem zu kommen.
Die Wellen waren heute Früh perfekt gewesen – heftig und unberechenbar, genau wie ich sie mochte –, aber auch eine Herausforderung. Das Meer war um diese Jahreszeit eiskalt, und jeder Abgang vom Brett fühlte sich an, als würde man von einem Tiefkühlschrank erschlagen. Ich kam trotzdem her, sooft ich konnte. Surfen bei fünf Grad Wassertemperatur war beschissen, aber immer noch besser als nichts. Ich brauchte Bewegung wie Sauerstoff, und ich hätte mir eher ein Bein abgehackt, als mich auf ein Laufband in einem Fitnessstudio zu stellen. Und auch wenn meine Fantasie nicht ausreichte, um mir vorzustellen, das hier wäre die australische Küste, hatte ich auf dem Board doch wenigstens die Illusion von Freiheit. Das half mir, nicht durchzudrehen.
Ich blieb noch ein paar Minuten liegen, bis ich merkte, wie langsam wieder Gefühl in meinen Körper kam und das Brennen in meiner Lunge nachließ. Dann stand ich auf, nahm mein Board und ging zu dem schwarzen Pick-up, der direkt hinter einem mit Schnee bedeckten Streifen auf dem Parkplatz stand. Wozu brauchst du so ein riesiges Auto, Jess?, hatte ich meinen Freund Balthazar im Ohr. Wir sind schließlich in New York. Ja, eben, dachte ich. Ich besaß dieses Auto, damit ich wenigstens das Gefühl hatte, jederzeit aus dieser verdammten Stadt verschwinden zu können. Es war nur eine Wunschvorstellung, aber sie rettete mir oft genug den Tag.
Zwei andere Surfer hatten ihren Campervan in der Nähe geparkt, und ich grüßte sie flüchtig, bevor ich mein Board auf der Ladefläche festzurrte und nach hinten auf meinen Rücken griff, um den Neoprenanzug zu öffnen. Eilig schob ich ihn über die Arme nach unten bis zur Hüfte und biss die Zähne zusammen, als der eisige Wind auf meine feuchte Haut traf. Gott, wie ich die Kälte hasste. Das hatte ich schon immer, obwohl ich in New York City geboren war. Ich wusste nicht, was in meinen Genen glaubte, ich käme aus wärmeren Gefilden, aber es schien absolut keinen Bock zu haben, sich an meine momentane Lage anzupassen.
Vom Beifahrersitz angelte ich meine Hoodie-Jacke und zog sie an, schob mir die Kapuze über die nassen Haare und nahm die Trainingshose. Einige routinierte Handbewegungen später hatte ich trockene Klamotten an, warf den Anzug zum Board auf die Ladefläche und stieg ins Auto, drehte die Heizung auf höchste Stufe. Vielleicht hatte ich Glück und spürte meinen Körper wieder vollständig, bis ich in der Stadt ankam.
Am Sonntag war der Verkehr nicht so eine Katastrophe wie sonst, aber ich brauchte trotzdem fast eine Stunde, bis ich zurück in Manhattan war – und auf der Williamsburg Bridge war Stau wegen einer Baustelle. Ich überlegte, ob ich den direkten Weg nehmen oder lieber über den Drive fahren sollte, als mein Handy klingelte. Kurz zögerte ich, als ich den Namen auf dem Display sah. Dann nahm ich den Anruf an.
»Hi, Trish«, begrüßte ich meine Mutter über die Freisprechanlage. Ihr einen guten Morgen zu wünschen wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Schließlich hatten wir nach neun an einem Sonntag. Um die Uhrzeit war diese Frau schon zehn Kilometer gejoggt, hatte drei neue Projekte geplant und vermutlich wieder einmal ihre Assistentin gefeuert.
»Jess, wo bist du gerade?«, fragte sie mich. Heute also ohne Begrüßung. Das bedeutete, sie hatte miese Laune, und vermutlich war ich der Grund dafür. Mit den Jahren hatte ich gelernt, fließend Trish Coldwell zu sprechen.
»Auf dem Weg vom Strand nach Hause.« Ich verdrehte die Augen, weil hinter mir schon wieder jemand hupte. Es geht nicht schneller, nur weil du Lärm machst und damit deinen Mitmenschen auf den Sack gehst. Was hatten die Leute in dieser Stadt eigentlich für ein Problem? »Warum fragst du? Ist mit Eli alles okay?«
»Ja, ja, deinem Bruder geht es gut«, sagte sie ungeduldig. »Aber ich habe Indigo gestern Abend mit einer Auswahl an Kleidung zu deiner Wohnung geschickt, und du warst nicht da.« Sie klang so vorwurfsvoll, als wäre ich mit ihrer Assistentin verabredet gewesen und hätte sie versetzt. Typisch Trish. Die ganze Welt hatte ihr zu Diensten zu sein.
»Dann solltest du mir vielleicht vorher sagen, wenn du jemanden vorbeischickst«, antwortete ich und gab mir keine Mühe, den genervten Tonfall zu verstecken. »Außerdem habe ich Klamotten für heute Abend.«
»Nein, hast du nicht. Das ist ein wirklich bedeutender Anlass, und alle werden da sein. Du kannst dort nicht mit einem Smoking auftauchen, den du schon einmal getragen hast.«
Oh ja, richtig, weil die Herren und Damen der feinen Gesellschaft natürlich den einen schwarzen Smoking von einem anderen schwarzen Smoking unterscheiden konnten – wie auch immer sie das schafften. Vielleicht machten sie ja heimlich Fotos oder schrieben sich die Details in ein kleines Notizbuch, als wären sie Geheimagenten für Arme. Was man eben so tat, wenn man den ganzen Tag nichts Besseres zu tun hatte, als sich einen Kopf darum zu machen, wer gerade gegen die Etikette verstieß. Komisch, dass mir bei dem Gedanken ein bestimmter Name in den Kopf schoss. Wobei, nein, eigentlich war es gar nicht komisch.
»Alle werden da sein?«, hakte ich nach. »Auch die Westons?«
Meine Mutter ließ ein zischendes Geräusch hören, das mir verriet, was die Erwähnung dieser Familie in ihr auslöste. »Sicher nicht. Oder glaubst du im Ernst, sie sitzen da und applaudieren, wenn mir ein Preis für besondere Verdienste an der Baukultur von New York City verliehen wird?«
»Wenn sie mit ihrer Abwesenheit Gerüchte provozieren würden, vielleicht schon«, sagte ich. Schließlich war diesen Leuten ja nichts wichtiger als ihr Ansehen und ihr Ruf. Aber ich hatte nicht deswegen gefragt, weil ich eine Begegnung mit den Westons scheute, denn das tat ich nicht – auch wenn sie mich jedes Mal mit dem konfrontierten, was ich verloren hatte. Vor allem Mrs Weston erinnerte mich durch die Ähnlichkeit mit ihrer Tochter immer daran, wem ich es zu verdanken hatte, dass mein Bruder tot war.
Meine Finger krampften sich um das Lenkrad. Wieso hatte Valerie sich nicht irgendeinen anderen Kerl aussuchen können? Warum hatte es Adam sein müssen?
»Sollen sie nur kommen«, sagte meine Mutter grimmig. »Solange du einen neuen Smoking trägst, ist mir das völlig egal.«
»In Ordnung«, gab ich mich geschlagen. »Ich komme einfach vorher zu euch und ziehe mich dort um.« Dann konnte ich immerhin meinen kleinen Bruder sehen und der Abend war nicht vollends verschwendete Zeit. »Trish, ich muss jetzt Schluss machen, ich habe einen Termin und will vorher noch nach Hause.«
»Einen Termin bei einem deiner Projekte?«, fragte sie, in erster Linie missbilligend.
»Ja, genau.« Ich ignorierte den Unterton. »Es ist ein Laden in SoHo.«
»Wo genau?«
»Sullivan, Ecke Bleecker.«
»Erstklassige Lage«, sagte sie. »Wie bist du da rangekommen?«
»Wie immer.« Ich hob die Schultern, obwohl sie das natürlich nicht sehen konnte. »Ich habe bei der Eröffnung des Karma im Herbst mit ein paar Leuten gesprochen und jemand wusste, dass der Vorbesitzer darüber nachdenkt aufzuhören. Also habe ich mit ihm geredet und irgendwann war er einverstanden, es an zwei junge Frauen zu verpachten, die ein veganes Bistro eröffnen wollen.«
Meine Mutter seufzte. »Du bist wirklich eine aufsehenerregende Verschwendung von Talent«, kommentierte sie meine Erklärung. »Wann wirst du endlich etwas Sinnvolles aus deinen Begabungen machen? Du weißt, dass ich dir jeden Posten in der Firma schaffen würde, den du willst.«
Ich verkniff mir eine bissige Erwiderung. Natürlich wusste ich das, sie erwähnte es schließlich ständig. Und ich wusste auch, dass der Verlust von Adam diesen Wunsch zu einer Art Mission hatte werden lassen.
Aber sosehr ich mich bemühte, alles zusammenzuhalten, dazu konnte ich mich nicht überwinden. Ein Job bei CW Buildings würde mich umbringen, genau wie dauerhaft in New York leben zu müssen.
»Wann soll ich heute Abend da sein?«, fragte ich, ohne auf ihre Worte einzugehen. Es hätte nichts gebracht, ihr zu erklären, warum ich niemals in der Firma arbeiten würde. Ich hatte es oft genug versucht.
»Um sieben«, informierte meine Mutter mich. »Sei bitte pünktlich. Und mach was mit deinen Haaren. Diese Surfermähne ist unmöglich.«
»Vergiss es«, sagte ich nur. »Bis später, Trish.«
Trotz meiner Abfuhr warf ich einen prüfenden Blick in den Rückspiegel, fand jedoch keinen Grund für ihre Beschwerde. Meine blonden Haare waren von Wind und Salzwasser zwar gerade wirklich etwas durcheinander, aber sehr viel kürzer als noch bei meiner Rückkehr vor zweieinhalb Jahren. Momentan konnte ich sie nicht einmal zusammenbinden. Das war eines der vielen Zugeständnisse an die Rolle, die ich hier erfüllte, allerdings hatte selbst meine Opferbereitschaft Grenzen. Also würde sie damit leben müssen.
Zum Glück hörte der Verkehr hinter der Brücke auf zu stocken, und ich fuhr meinen üblichen Weg bis ins West Village. Vor dem Haus, in dem ich wohnte, war ein Parkplatz frei, und ich wagte, das als gutes Zeichen für den Rest dieses Sonntags zu sehen. Der Abend würde kein Vergnügen werden, das wusste ich jetzt schon, aber bis dahin waren es ja noch ein paar Stunden.
Ich lief die vier Stockwerke nach oben und freute mich bereits auf eine Dusche, als ich den Schlüssel ins Schloss schob. Kaum war ich in der Wohnung, zog ich mir die Klamotten aus und warf sie achtlos auf den Boden. Die Sitzheizung im Auto hatte zwar ein bisschen geholfen, aber ein heißer Wasserstrahl war einfach noch mal etwas anderes. Deswegen war der Boiler im Badezimmer gerade in den kalten Wintermonaten mein bester Freund.
Zwanzig Minuten später trat ich aus dem Dampf heraus und wickelte mir ein Handtuch um die Hüften, bevor ich rüber ins Wohnzimmer ging. Wobei die Bezeichnung nicht ganz korrekt war, denn in dem Loft war eigentlich alles ein Zimmer. Die Küche mit Mittelblock und Theke grenzte direkt an den Wohnbereich mit der großen Couch und einem Tisch aus unbehandeltem Eichenholz, an dem bis zu acht Leute sitzen konnten. Eine Eisentreppe führte zu dem offenen Zusatzstockwerk, das man mit Stahlträgern im hinteren Teil des fünf Meter hohen Raums errichtet hatte und auf dem sich mein Bett befand.
Ich steuerte die Tür neben dem Badezimmer an und zog frische Klamotten aus einem der Regale. Dabei ignorierte ich wie immer die Tatsache, dass der Großteil des Raumes – eigentlich ein Ankleidezimmer und keine Abstellkammer – mit Pappkartons vollgestellt war, und schlug die Tür eilig wieder zu. Ich hätte Adams Sachen längst sortieren sollen, aber ich drückte mich seit Ewigkeiten davor. Seit zwei Jahren und acht Monaten, um genau zu sein. Denn da war ich in die Wohnung meines Bruders gezogen. Adam hatte einmal im Scherz gesagt, dass ich die Wohnung bekommen sollte, falls er irgendwann das Zeitliche segnete, damit ich merkte, dass es auch in New York Orte gab, wo ich mich zu Hause fühlen konnte. Als er gestorben war, hatte ich diesem Wunsch entsprechen wollen.
Erst war es mir trotz seiner Worte total falsch vorgekommen, in den vier Wänden zu wohnen, die Adam für sich gekauft und nach seinen eigenen Vorstellungen eingerichtet hatte. Ich hatte gedacht, dass es mich fertigmachen würde, jeden Tag mit seinem Tod konfrontiert zu werden – von den Schuldgefühlen ganz zu schweigen. Und so war es auch gewesen. Es hatte Tage gegeben, da hatte ich kaum atmen können, weil mich die Trauer erstickte. Dann war ich rausgegangen, um zu laufen, und hatte mich oft stundenlang nicht zurück in die Wohnung getraut. Aber irgendwann hatte ich gemerkt, dass es mich Adam auf gewisse Weise näherbrachte. Zu leben, wo er gelebt hatte. Zu essen, wo er gegessen hatte. Zu schlafen, wo er geschlafen hatte. Es schaffte eine Verbindung, wo es eigentlich keine mehr geben konnte. Und wenn es wehtat, dann beschwerte ich mich nicht.
Ich atmete aus und lenkte meine Gedanken von meinem Bruder weg, zog mir einen schwarzen Kapuzenpullover über und schnappte mir die dunkle Jeans, die von gestern noch auf der Sofalehne lag. Dann warf ich die Sachen von meiner Rückfahrt in den Wäschekorb und hörte, wie mein Magen fast schon empört knurrte. Meine letzte Mahlzeit war das gestrige Abendessen gewesen. Es war höchste Zeit fürs Frühstück, bevor ich nach SoHo zu meinem Termin musste.
Ich nahm Eier, Tomaten und Frühlingszwiebeln aus dem Kühlschrank und ließ mein Handy eine von meinen ruhigeren Pop-Playlists über das Soundsystem im Wohnzimmer abspielen, während ich die Eier aufschlug, in einer meiner Edelstahlschüsseln verrührte und mit Pfeffer und Salz würzte. Doch noch bevor ich die Zwiebeln in schmale Ringe schneiden konnte, klingelte mein Telefon. Ich wischte mir die Hände ab, nahm den Anruf an und stellte auf Lautsprecher.
»Morgen, Thaz«, begrüßte ich meinen Freund grinsend. Wie ich ihn kannte, war er erst vor zehn Minuten aus dem Bett gefallen. Und es war nicht sein eigenes gewesen. »Na, schon wach?«
»Gerade so«, verkündete Balthazar am anderen Ende, begleitet von einem herzhaften Gähnen. »Die Nacht war lang. Lass mich raten, du warst bereits am Strand.«
»Verdammt richtig.«
»Du hast aber schon mitbekommen, dass wir Winter haben, oder? Nicht die richtige Zeit für Surferidylle, wenn du mich fragst.«
Ich zerteilte die Tomaten und schnitt sie in kleine Würfel. »Was, echt?«, fragte ich sarkastisch. »Und ich dachte, ich ziehe den Neoprenanzug nur an, weil der so schick ist, nicht weil das Meer fünf Grad hat.«
Thaz lachte auf. »Sorry, ich wollte kein Salz in die Wunde streuen.«
»Hast du nicht.« Mit Schwung kippte ich die Eier in die Pfanne. »Was gibt’s, Mann? Du rufst sicher nicht am Sonntagvormittag an, weil du mich vermisst.«
»Doch, das auch, aber ich habe eine Einladung zu einer Party heute Abend«, sagte er. »Und ich dachte, du willst vielleicht mitkommen. Ist eine Club-Eröffnung in Downtown, ich hab an der Kampagne mitgearbeitet. Das könnte gut werden.«
Ich drehte die Hitze am Herd etwas herunter und behielt das Omelette im Auge. »Ein Club? Welcher?« Wahrscheinlich einer dieser High-Society-Läden, wo die Leute nur hingingen, um gesehen zu werden und ihre sauteure Garderobe spazieren zu tragen.
Du gehörst auch zur Upper Class, erinnerte mich eine Stimme in meinem Kopf.
Ja, aber nicht freiwillig, antwortete ich trotzig. Und ich habe wirklich alles versucht, um es zu verhindern.
»Das Down Below unten an der Church.«
»An der Church? Du meinst dieses ehemalige Steak-Restaurant?« Der Laden war schon seit Jahren geschlossen und hatte keinen neuen Mieter gefunden. Was mich nicht wunderte, denn die Lage war nicht die beste. Ich hätte niemandem geraten, dort einen Club zu eröffnen.
»Ja, ich weiß – es ist gewagt«, sagte Thaz.
»Wohl eher ein Himmelfahrtskommando«, merkte ich trocken an.
»Deswegen sollst du ja kommen.« Ich hörte das Grinsen in seiner Stimme.
Ich verdrehte gutmütig die Augen, als mir klar wurde, was er meinte. »Also ist das gar keine Einladung eines Freundes, sondern ein Job.«
»Ein Job mit Spaß«, gab mein Kumpel zu bedenken. »Das Konzept ist großartig, Jess. Gediegen, elegant, aber nicht zu abgehoben. Und die zwei Jungs, die es betreiben, sind gute Leute. Sonst würde ich dich nicht fragen.« Es war nicht das erste Mal, dass er mich in irgendeine Location lotste und vorher das Gerücht streute, ich würde dort auftauchen. Eine reine Marketingaktion, denn jeder wusste, wenn ich zu einer Eröffnung ging – ob Restaurant, Bar oder Club –, dann musste der Laden vielversprechend sein. Das war Teil meines Erbes als Sohn von Christopher Coldwell und das Ergebnis der letzten zwei Jahre Arbeit.
Ich atmete seufzend aus und nahm die Pfanne vom Herd. »Und was bekomme ich dafür?«
»Drinks aufs Haus und meine ewige Dankbarkeit.«
»Die habe ich schon lange.«
»Man kann nie genug meiner ewigen Dankbarkeit haben.«
Er hatte mich längst überzeugt, aber da war noch mein anderer Termin. »Ich muss allerdings heute Abend zu einer Preisverleihung mit meiner Mutter«, sagte ich und wendete das Omelette mit einer geübten Handbewegung in der Pfanne. »Die geht vermutlich so bis zehn. Ich könnte nachkommen.«
Thaz machte ein missbilligendes Geräusch. »Wie lange dauert dein Dienst als Trishs Geleitschutz eigentlich noch an? Was steht in deinem Vertrag dazu? Sie hat dich doch bestimmt einen unterschreiben lassen.«
Ich stellte den Herd aus. »Das ist schon okay.«
»Ist es nicht. Du hasst diese Veranstaltungen wie die Pest, die Leute dort und das Getue. Früher hast du alles getan, um nicht mitgehen zu müssen. Und wenn du trotzdem genötigt wurdest, hast du in neun von zehn Fällen für einen Skandal gesorgt.«
Oh ja, ich erinnerte mich. Ziemlich gut. Aber ich war jetzt dreiundzwanzig, nicht mehr sechzehn, und Rebellion nicht länger Teil meiner Agenda.
»Die Zeiten haben sich geändert, Thaz. Du weißt, warum ich das mache.«
»Das weiß ich, aber du kannst deine Mutter nicht für alle Zeiten begleiten, nur weil du Angst davor hast, wen sie stattdessen dazu zwingen könnte.« Er klang mit einem Mal sehr ernst.
»Ja, das ist mir klar«, antwortete ich nur.
»Dann sag Trish, dass sie ab jetzt allein zu diesen Langweilerveranstaltungen gehen soll. Die versnobten Schwerreichen wissen deinen Charme nicht zu schätzen. Ich schon.«
Als er das sagte, musste ich lachen. Trotzdem ließ ich mich nicht darauf ein. »Ich schaue, dass ich dort so schnell wie möglich wegkomme, okay?«
»Okay. Wir sehen uns heute Abend.«
»Bis später, Mann.« Ich beendete das Gespräch und nahm mir einen Teller für das Omelette vom Regal, bevor ich mich damit an den Tresen setzte. Die Playlist spielte gerade »Everything that isn’t me« von Lukas Graham.
Wie passend.
Während ich aß, zog ich den Stapel Post zu mir heran, der unangetastet auf der äußersten Ecke des Tresens gelegen hatte. Ich sortierte die Briefe nach Rechnungen und unwichtiger Werbung – und geriet plötzlich ins Stocken, als ich den letzten Umschlag ansah. Es war jedoch nicht der Inhalt, der mich die Luft anhalten ließ, denn der schien aus Weinreklame zu bestehen, sondern der Name im Adressfeld. Adam Coldwell.
Der Brief war an meinen Bruder adressiert.
Ich stieß den Atem aus und spürte, wie mein Herz schmerzhaft gegen meine Rippen schlug. Dabei war es nicht ungewöhnlich, dass Post an ihn hierher gesendet wurde. Nach meinem Einzug war das dauernd passiert. Und jeden Monat hatte ich mich einmal hingesetzt, die Sachen durchgesehen und E-Mails geschickt oder Schreiben aufgesetzt, um den Absendern dieser Briefe, meistens Werbefirmen, mitzuteilen, dass mein Bruder nicht mehr lebte. Es war wie ein Ritual gewesen, eine wiederkehrende Qual, von der ich mir eine Erleichterung erhofft hatte, die nie eingetreten war. Aber in den letzten Monaten war nichts mehr für Adam in meinem Briefkasten gelandet, und ich hatte gedacht, es wäre vorbei. Wie dämlich von mir.
Als würde es jemals vorbei sein.
Ich knüllte den Brief zusammen und warf ihn mit aller Gewalt so weit wie möglich von mir weg. Aber er blieb an der Kante der Couch hängen und fiel auf das Polster, helles Weiß vor dunklem Grün. Ich hatte das Gefühl, als würde mich dieses verdammte Stück Papier vorwurfsvoll anstarren. Also stand ich auf und holte es zurück, um es in den Müll zu befördern. Aber als ich danach weiter aß, schmeckte das Omelette plötzlich nach Pappe und meine Gedanken waren düsterer denn je.
Ich hatte meinen Vater verloren, als ich vierzehn gewesen war, und geglaubt, damit hätte ich das dunkelste Tal in meinem Leben durchschritten. Weit gefehlt. Adams Tod hatte mich auf eine Weise von den Füßen gefegt, die viel schlimmer gewesen war als alles zuvor. Vielleicht, weil er schon der zweite geliebte Mensch war, der zu früh hatte gehen müssen. Vielleicht auch, weil ich nicht da gewesen war, um zu verhindern, dass er diesen fatalen Fehler beging. Den Fehler, sich zu verlieben – in die Frau, die ihn erst in ihre Welt hineingezogen und dann in einen tödlichen Abgrund gerissen hatte.
Valerie Weston.
3
Helena
New York begrüßte mich draußen vor der Tür mit eisigem Wind, aber ich nahm es ihr nicht übel – raues Wetter war typisch für diese Jahreszeit, und selbst das hatte ich auf verrückte Art vermisst. Statt also den Rückzug anzutreten, nahm ich meine Mütze und zog sie über den Kopf, bevor ich den Weg in Richtung Central Park einschlug.
Es dauerte keine halbe Minute, bis in meiner Nähe ein Auto hupte und irgendjemand mit noch mehr Gehupe darauf antwortete. Ich wich einem Dogsitter aus, der gleich zehn verschiedene Hunde an der Leine hatte, von denen keiner besonders gut erzogen zu sein schien. Mich störte das nicht, eine ältere Dame allerdings schon, die dem Typen ihre Meinung empört mitteilte. Ich musste lächeln. New York war für manche zu groß, zu laut, zu viel. Aber ich liebte das. Ich liebte es, dass man hier vollkommen allein inmitten einer Menschenmenge sein konnte. Dass jede Kultur, jede Nationalität, jeder einzigartige Charakter ein Teil der Vielfalt war, die diese Stadt so lebendig machte.
Cambridge war idyllisch und für viele sicherlich ein absoluter Traumstudienort, aber ich hatte mich dort nie wohlgefühlt. Ich war in New York aufgewachsen und der festen Überzeugung, dass ich mein ganzes Leben hier verbringen konnte, ohne mich auch nur einen Tag zu langweilen. Früher war ich oft allein auf Streifzüge gegangen und hatte dabei irgendwann die unbekannten Ecken der Stadt für mich entdeckt – die kuriosen Geschäfte und versteckten Parks, die kleinen Oasen, die Manhattan bei all der Schnelllebigkeit zu bieten hatte. Und mich dadurch noch mehr verliebt.
Ich schlenderte am Guggenheim Museum vorbei und verspürte den Drang hineinzugehen, verschob es jedoch gedanklich auf später und überquerte die Fifth Avenue, um in die grüne Lunge des Central Parks einzutauchen. Grün war hier gerade zwar nicht viel – die Rasenflächen bedeckte eine dünne Schneeschicht und die Bäume waren absolut kahl. Aber bald würde es hier anfangen zu sprießen und zu blühen, und ich freute mich schon jetzt darauf, endlich wieder im Gras zu sitzen und mit Valerie …
Ich stockte. Der Schmerz dauerte nur kurz, er war jedoch heftig genug, um mich nach Luft ringen zu lassen. Es passierte nicht mehr oft, dass mein Hirn so tat, als wäre meine Schwester noch am Leben. Fast drei Jahre waren viel Zeit, um den Verlust eines Menschen zu verarbeiten … und doch nicht genug. Es war niemals genug. Wie sollte ich auch darüber hinwegkommen, wenn jeder Gedanke an sie mit dem himmelschreienden Unrecht verbunden war, das man ihr angetan hatte? Wenn jedes Mal, wenn mir ihr Name in den Sinn kam, auch die Erinnerungen daran wach wurden, wie abfällig Adams Familie ihn ausgesprochen hatte?
Wie aufs Stichwort sah ich in die Ferne zu den Hochhäusern von Midtown, die im Gegensatz zu den stilvollen Gebäuden der Upper East und West Side angeberisch in den Himmel ragten. Manche sagten, sie wären die Weiterentwicklung der Stadt, die Zukunft von New York. Für mich waren sie die reinste Verschandelung und bloße Prahlerei. Vor allem der Wolkenkratzer, der höher als alle anderen in der Mitte stand und mit seiner weißlich leuchtenden Fassade protzte.
Coldwell House war also endlich fertig, trotz der Bemühungen meiner Eltern und vieler anderer, den Bau zu verhindern. Es wunderte mich nicht. Denn Trish Coldwell kannte weder Anstand noch Regeln, sie manipulierte sich alles zurecht, wie es ihr passte – als bösartige Eiskönigin, die über Leichen ging. Es gab keine Person, die ich mehr hasste als diese Frau, die meiner Schwester die Schuld am Tod ihres Sohnes gab und alle Register gezogen hatte, damit auch der Rest der Welt es glaubte. Aber das würde sie bereuen, so viel stand fest. Denn ich war nicht wie meine Eltern, die der Ansicht waren, es wäre unter unserer Würde, öffentlich über Valerie zu sprechen. Nein, ich würde die Wahrheit herausfinden und sie anschließend in jede Kamera brüllen, so wie Trish es mit ihren Lügen getan hatte. Und ich würde Valeries Ruf wiederherstellen. Genau dafür war ich schließlich zurückgekommen.
Für heute hatte ich allerdings etwas anderes vor. Also zeigte ich Coldwell House – was für ein lächerlicher Name war das bitte? – fürs Erste nur den Mittelfinger und ging dann weiter durch den Park, am zugefrorenen See vorbei und zum Belvedere Castle, das ich als Kind geliebt hatte. Von dort sah ich eine Weile auf die Stadt hinaus, bevor ich den Weg Richtung Westausgang einschlug. Als ich schließlich an der Kreuzung zur 82th Street herauskam, war ich ziemlich durchgefroren, daher änderte ich spontan meinen Plan und beschloss, jemanden zu besuchen. Statt mir also in der Magnolia Bakery an der Columbus ein Frühstück zu holen, kaufte ich einen Kaffee zum Mitnehmen im nächsten Coffeeshop, zusätzlich einen Cappuccino und ein paar Donuts. Wahrscheinlich strahlte ich die Bedienung etwas zu sehr an, als ich bezahlte, aber es tat einfach so gut, wieder den typischen New Yorker Akzent zu hören. In den letzten Jahren in Cambridge hatte sich bei mir wahrscheinlich ein bisschen Britisch eingeschlichen, ich war jedoch sicher, dass ich das wieder verlieren würde – jetzt, wo ich zurück war.
Mein Ziel, ein unscheinbarer Bau, dessen Betonwände von Wind und Wetter längst schwärzlich gefärbt waren, stand ein paar hundert Meter weiter. Aber nur die leicht unheilvolle Aura und die schwarzen Buchstaben links neben der Tür verrieten Passanten, was sich dahinter befand – das Police Department des 20. Bezirks von New York City. Wenn man hierherkam, hatte man meist ein Problem mit dem Gesetz oder einen anderen unerfreulichen Grund dafür. Ich war wohl die Einzige, die ein vorfreudiges Kribbeln im Bauch hatte, als ich die Tür aufstieß und hineinging.
Ein breiter Gang mit fleckigem Linoleumboden führte mich direkt in den Hauptraum. Es schien ein ruhiger Tag zu sein, denn außer einigen Beamten in Uniformen, die an ihren Schreibtischen saßen, waren keine Leute zu sehen – abgesehen von einem einzelnen Typen in Handschellen, der hinter der Abtrennung auf einer Bank saß. Ich stellte den Kaffee und die Papiertüte mit den Donuts auf dem Tresen ab.
»Hi, ich würde gerne etwas melden«, sagte ich zu dem jungen Mann, der dahinter saß. Als er aufsah, lächelte ich ihn an. »Es geht um eine Vermisstenanzeige – für Helena Weston. Ich wollte nur kurz Bescheid geben, dass sie wieder aufgetaucht ist.«
In dem Moment flog ein Kopf weiter hinten herum, und ein Stuhl drehte sich ruckartig in meine Richtung. Die junge Frau darauf starrte mich ungläubig an, bevor sie aufstand.
»Len?!«, rief sie, völlig unbeeindruckt davon, dass sich alle auf dem Revier – inklusive des Typen in Handschellen – zu ihr umwandten. Dann klappte sie die Abtrennung des Tresens auf und umarmte mich, ohne mich zu Wort kommen zu lassen. »Was tust du denn hier, Süße? Ich dachte, du würdest anrufen, wenn du wieder da bist.«
Ich erwiderte die Umarmung, so fest ich konnte.
»Ich wollte dich überraschen«, grinste ich, als sie mich losließ. Immerhin Malia schien sich darüber zu freuen, dass ich wieder da war.
»Das ist dir gelungen.« Sie sah sich zu ihren Kollegen um, dann zeigte sie zu einer Tür. »Komm, wir gehen in den Pausenraum, da ist gerade niemand.«
»Kannst du hier einfach so weg?« Ich hatte ihr eigentlich nur was vorbeibringen und Hallo sagen wollen. Schließlich wusste ich, dass sie Dienst hatte und vermutlich keine Zeit für mich.
»Klar, mein Captain ist cool«, winkte sie ab. »Außerdem ist heute nicht viel los, wie du siehst.«
Ich folgte ihr zögerlich hinter den Tresen und weiter durch zwei Türen, bis wir in einem fensterlosen Raum ankamen, der außer der Kaffeemaschine wenig zu bieten hatte. Malia schob ein paar Zeitschriften auf einem Tisch beiseite und fing meinen musternden Blick auf.
»Was ist?«, fragte sie.
»Nichts.« Ich schüttelte lächelnd den Kopf. »Du siehst toll aus. Die Uniform steht dir.« Als ich aus New York verschwunden war, hatte sie gerade ihre Ausbildung begonnen. Jetzt war sie bereits im Dienst.
Malia drehte sich einmal, knickste dann und setzte sich. »Du siehst aber auch klasse aus, Len.« Sie lehnte sich vor und berührte meine Lederjacke. »Der neue Style gefällt mir. Sehr erwachsen.«
»Ich bin ja auch fast drei Jahre älter als bei unserer letzten Begegnung.« Damals war ich siebzehn gewesen und für Malia in erster Linie die kleine Schwester ihrer besten Freundin. Valeries Tod hatte das jedoch geändert. All die Zeit hatten wir Kontakt gehalten, wofür ich mehr als dankbar war. Nicht nur, weil sich sonst kaum jemand aus meinem früheren Leben dafür interessiert hatte, wie es mir ging. Sondern auch weil Malia bei der Polizei war und somit Zugriff auf Informationen hatte, die wichtig für mich waren.
»Das stimmt. Gut, dass du dir nicht wie angedroht die Haare abgeschnitten hast.« Sie lächelte.
»Um meiner Mutter direkt nach meiner Ankunft einen Herzinfarkt zu bescheren? Das würde ich nie wagen.« Früher hatte ich öfter daran gedacht, an meinen Haaren etwas zu ändern, weil ich sie langweilig gefunden hatte, aber mittlerweile mochte ich die langen dunkelbraunen Wellen, denn sie waren das Einzige, was ich mit Valerie gemeinsam hatte. Ich kam mit meinen blauen Augen, der schmalen Nase und dem markanten Gesicht mehr nach meinem Dad, während meine Schwester das wunderschöne dunkeläugige Disney-Prinzessinnen-Ebenbild von Mom gewesen war.
Malia kramte in der Papiertüte, holte einen Donut heraus und hielt sie dann mir hin. »Was hat deine Familie denn dazu gesagt, dass du schon wieder da bist?«, fragte sie und biss in ihr Exemplar mit pinker Zuckerglasur.
Ich nahm einen mit Streuseln. »Noch nicht viel. Ich wollte heute Morgen beim Brunch als Special Guest auftauchen, aber der fand gar nicht statt. Mom hatte einen Termin, Dad ist wohl in Washington, und mit Lincoln habe ich noch nicht gesprochen.« Mein Bruder wohnte ein paar Blocks weiter in einer unserer anderen Wohnungen.
»Sie sind also echt einverstanden, dass du wieder hier lebst?«, fragte Malia. Sie wusste, dass ich lange vergeblich darum gekämpft hatte, zurückkehren zu dürfen. »Woher der Sinneswandel?«
Ich hob die Schultern. »An Weihnachten habe ich mit Mom darüber gesprochen, wie sehr ich New York vermisse und dass ich glaube, es wäre genug Zeit vergangen, seit das mit Valerie passiert ist. Sie war erst nicht sehr begeistert von der Idee, aber unter bestimmten Vorgaben hat sie sich darauf eingelassen.«
Malias rechte Augenbraue wanderte ein gutes Stück nach oben. »Vorgaben? Noch mehr als ohnehin schon? Eure ganze Familie besteht nur aus Regeln.«
»Ja, und jetzt sind noch ein paar dazugekommen.« Ich zählte auf. »Bis zum Abschluss meines Studiums muss ich bei ihnen wohnen, ich darf mich mit niemandem treffen, der früher mit Val zu tun hatte – dich natürlich ausgenommen –, und Partys sind nur in Absprache gestattet. Außerdem muss ich an allen gesellschaftlichen Anlässen teilnehmen, zu denen sie mich mitnehmen wollen. Dafür darf ich an der Columbia studieren und hier leben.«
»Willkommen im Kloster«, scherzte Malia. »Vielleicht nenne ich dich ab jetzt einfach Schwester Helena. Oder darfst du dich etwa mit Jungs treffen?«
Ich grinste. »Eigentlich hatte ich geplant, den erstbesten Kerl von der Straße mit nach Hause zu nehmen, um Sex mit ihm zu haben, während meine Eltern unten im Salon den Bürgermeister empfangen. Glaubst du, das ist erlaubt?«
»Hm. Klingt nach Grauzone.«
Wir lachten beide, obwohl das eigentlich nicht zum Lachen war. Aber ich hatte keine andere Wahl gehabt, als die Bedingungen meiner Eltern zu akzeptieren. In England konnte ich schließlich nichts tun, um Valeries Ruf wiederherzustellen.
»Dann hast du wohl nicht vor, den schönen Ian anzurufen?« Malias Augenbrauen begannen erneut, ein Eigenleben zu führen. »Er musste fast drei Jahre auf dich warten, denkst du nicht, er will wissen, dass du wieder da bist?«
»Wenn er tatsächlich auf mich gewartet hat, dann tickt er nicht ganz richtig. Außerdem studiert er an der Westküste, soviel ich weiß.« Ich schüttelte den Kopf.
Ian war mein Ex, meine erste Liebe, wenn man es so ausdrücken wollte. Wir waren fünf Monate zusammen gewesen, als Valerie gestorben war – und mein Leben, wie ich es gekannt hatte, beendet gewesen war. Meine Eltern hatten mich in einer Nacht-und-Nebel-Aktion nach England verfrachtet, und Ian war von da an nur noch ein Kontakt auf dem Smartphone gewesen. Wir hatten zwar ein paarmal telefoniert, aber er war von meiner Trauer völlig überfordert gewesen, also hatte ich es beendet und bald nicht mehr an ihn gedacht. »Mein Beuteschema hat sich auch ein kleines bisschen gewandelt seitdem.«
Malia lachte. »Ach ja? Stehst du jetzt etwa nicht mehr auf die lieben netten Jungs in gebügelten Hemden, die deine Mutter für dich aussucht?«
»Diese Frage kann ich wohl nur mit einem eindeutigen ›Nein, zur Hölle‹ beantworten. Cambridge war in dieser Hinsicht mehr als hilfreich.« Ich lachte ebenfalls und nahm mir noch einen Donut, während mich Malia aufmerksam musterte.
»Len, bist du wirklich nur hier, weil du New York vermisst hast?«, fragte sie mich schließlich, und ich ahnte, worauf sie hinauswollte. Schließlich hatte ich sie schon vor einigen Monaten von England aus dazu überredet, mir Polizeiinformationen über die Nacht zu besorgen, in der Valerie und Adam gestorben waren.
»Was meinst du?«, gab ich unschuldig zurück. »Das hier ist mein Zuhause, also …« Ich brach ab, weil ein junger Officer hereinkam, der sich einen Kaffee holen wollte. Er grüßte Malia, dann fiel sein Blick auf mich und wandelte sich von freundlich zu interessiert.
»Hast du alles, Ramirez?«, fragte meine Freundin in diesem Ton, mit dem sie vermutlich auch Dealer dazu bringen konnte, alles zu gestehen.
»Was? Ja, klar.« Er lächelte mir zu, dann ging er.
Malia sah zu mir. »Keine Sorge, ich gebe ihm deine Nummer nicht.«
»Schade, ich dachte, er wäre was für diese Sache mit dem Bürgermeister«, witzelte ich, obwohl mir nicht nach Scherzen zumute war.
Malia wohl auch nicht. »Also, was hast du vor?«, hakte sie nach. »Und bitte verkauf mich nicht für dumm, okay?«
Ich atmete aus und gab nach. Wenn ich in Zukunft auf die Freundin meiner Schwester zurückgreifen wollte, musste ich ihr die Wahrheit sagen. »Ich will Valeries Ruf wiederherstellen. Und herausfinden, was in der Nacht passiert ist.«
»Du weißt doch, was in der Nacht passiert ist«, sagte Malia. Sie war nicht auf der Party gewesen, weil sie zu der Zeit einige Monate im Ausland verbracht hatte, aber natürlich hatte sie die Akte gelesen. »Alle wissen es.«
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, ich weiß nur, was in den Zeitungen und im Polizeibericht stand. Dass die beiden ihre Verlobung in einer Suite des Vanity Hotels gefeiert und getrunken haben, dass sie Kokain genommen haben, das mit Lidocain gestreckt war und deswegen zum Herzstillstand geführt hat.« Ich holte tief Luft, weil ich diese Informationen nicht aussprechen konnte, ohne wütend zu werden. Auch auf mich, weil ich nicht auf dieser Party gewesen war, sondern krank im Bett gelegen hatte. Hätte ich doch nur ein paar Ibuprofen eingeworfen und wäre hingegangen. »Und dass die ganze Welt glaubt, Valerie hätte die Drogen angeschleppt. Dabei hat sie nie welche genommen, niemals. Sie ist nicht schuld daran, dass Adam und sie tot sind.«
»Und nun willst du was? Denjenigen finden, der tatsächlich schuld ist?«
»Genau das. Und dann werde ich allen beweisen, dass meine Schwester zu Unrecht in den Dreck gezogen wurde.«
Malia stieß geräuschvoll die Luft aus, und ich ahnte, was jetzt kam. »Len, hör mir zu. Ich weiß, dass du sauer bist, weil die Coldwells diese Sachen über Valerie verbreitet haben, aber –«
Meine Stimme wurde zum Zischen, als ich sie unterbrach. »Die haben behauptet, Valerie hätte ihn dazu angestiftet! Dass sie Adam überredet hätte, das Zeug zu nehmen! Das ist Schwachsinn!« Ich wusste Wort für Wort, was Trish Coldwell damals gesagt hatte. Ich war von Anfang an gegen diese Beziehung, weil ich genau wusste, dass diese Frau meinen Sohn mit ihrem lasterhaften Lebenswandel ins Unglück stürzen würde. Nun ist er tot, und das ist allein ihre Schuld.
Aber nicht nur sie, sondern auch Adams Bruder, sein Stiefvater und sämtliche seiner Freunde hatten dabei mitgemacht. Sie hatten die Talkshows bevölkert, die Blogs, die Zeitungen – mit immer neuen Geschichten über meine Schwester, in denen sie als gewissenloses Dummchen dargestellt wurde, als luxus- und partybesessener Mensch, dem alles außer ihr selbst völlig egal gewesen war. Und ich hatte in England gesessen, geschockt und hilflos angesichts dieser Lügen. Ich hatte nichts tun können, um Valerie zu helfen. Bis jetzt.
»Mir wäre es lieber, du würdest dich nicht mit den Coldwells anlegen.« Malia schüttelte den Kopf. »Du hast bei Val gesehen, wie sie jemanden medial vernichten können. Ich will nicht, dass sie das Gleiche mit dir machen.«
»Du denkst, ich könnte es nicht mit Trish Coldwell aufnehmen?«, fragte ich trotzig.
»Nein, ich weiß, dass du es nicht kannst. Diese Frau ist gefährlich, Helena. Die ganze verdammte Stadt kuscht vor ihr. Nicht einmal deine Eltern haben sich öffentlich gegen sie gestellt, als sie Valerie durch den Dreck gezogen hat.«
Damit hatte sie recht. Meine Eltern hatten zwar rechtliche Schritte unternommen, um gegen die Behauptungen vorzugehen, aber sie hatten sich nie offiziell dazu geäußert. Das ist nicht unser Stil, hatten sie gesagt, als ich sie aus dem Internat angerufen hatte, um zu fragen, wieso sie das einfach geschehen ließen. Wieso sie nicht für ihre Tochter kämpften, die so mit Schmutz überhäuft wurde. Mein Bruder hatte zwar ein paar Interviews gegeben, aber auch ihn hatten meine Eltern zurückgepfiffen in der Hoffnung, man würde bald über etwas anderes reden.
»Ich bin nicht die ganze Stadt«, sagte ich selbstsicherer, als ich mich fühlte. »Und wenn ich die Wahrheit herausfinde, kann sie machen, was sie will. Gegen handfeste Beweise ist sie machtlos.« Wie ich mich auf den Tag freute, an dem ich dieser Familie zurückzahlen konnte, was sie meiner angetan hatte.
»Und wie willst du an Beweise rankommen?«, fragte Malia. »Das NYPD hat damals alles untersucht, genau wie private Ermittler, beauftragt von deiner und Adams Familie. Die haben nichts gefunden, das Trishs Behauptungen widerlegt.«
»Ja, aber keiner von denen hat versucht, Valerie zu entlasten. Die wollten nur wissen, ob es ein Verbrechen war oder nicht. Und als das geklärt war, hat sich niemand darum gekümmert, herauszufinden, was genau passiert ist. Also werde ich das machen.« Ich hatte mich fast ein Jahr in England darauf vorbereitet, hatte mir Zugang zu den Fallakten verschafft, ohne dass meine Eltern etwas mitbekamen, hatte alle Fakten zusammengetragen und geplant, wie ich vorgehen würde. Und ein Teil dieses Plans war Malia. »Allerdings könnte ich dabei ab und zu die Hilfe einer jungen, engagierten Polizistin brauchen, die irgendwann Detective werden will.«
Ihre Augen wurden groß. »Du willst, dass ich dir helfe?«, fragte sie mit gesenkter Stimme. »Len, im Ernst: Glaubst du wirklich, dass das zu etwas führt? Ich weiß nicht, ob Valerie gewollt hätte, dass du dich so in diese Sache verbeißt.«
»Im Gegenteil – Valerie hätte genau das Gleiche für mich getan. Deswegen kann ich das nicht auf sich beruhen lassen. Ich muss diese Lügen entkräften und die Wahrheit ans Licht bringen. Und ich werde es tun, ob mit oder ohne deine Hilfe.«
Malia erwiderte meinen Blick einige Sekunden lang, dann lehnte sie sich zurück und atmete hörbar aus. »Das ist irre. Nein, du bist irre. Hast du überhaupt einen Plan? Irgendeinen Ansatzpunkt, wo du anfangen sollst?«
»Den habe ich. Und ich erzähle dir sehr gerne davon, wenn ich weiß, dass du im Boot bist. Es geht nicht um viel, eventuell mal eine Information oder ein bisschen Schützenhilfe. Ich werde dich nicht in die Bredouille bringen, ich verspreche es.« Ein hoffnungsvolles Lächeln stahl sich auf mein Gesicht. »Hilfst du mir? Zwing mich bitte nicht, dich anzubetteln.«
»Ich werde das so was von bereuen.« Malia schüttelte den Kopf und seufzte tief. »Aber ja, ich helfe dir. Allerdings werde ich nichts machen, das meinen Job gefährdet, und ich unterstütze nichts, das dich in Gefahr bringt. Sind wir uns da einig?«
»Ja.« Ich nickte und meinte es auch so.
»Gut. Und jetzt … erzähl mir von deinem Plan.«
4
Jessiah
»Guten Abend, Mr Coldwell.« Die junge Concierge in schwarzer Uniform nickte mir freundlich zu, als ich den verschwenderisch dimensionierten Eingangsbereich betrat.
Mich fröstelte augenblicklich, als die Atmosphäre mich umfing, diese kühle Eleganz ohne jede Gemütlichkeit. Man hätte denken können, dass ich mich in der Lobby eines minimalistischen Luxushotels befand – schwarzer Marmorboden, so weit das Auge reichte, dazu Barcelona Chairs und Eames-Lounge-Sessel als Sitzgelegenheiten, und der Tresen war so lang, dass daran zehn Leute arbeiten konnten. Aber das hier war kein Hotel.
»Guten Abend, Lara.« Ich lächelte sie höflich an. Sie konnte schließlich nichts dafür, dass ich schon Beklemmungen bekam, wenn ich nur durch die Tür schritt.
»Soll ich Ihrer Mutter Bescheid sagen, dass Sie da sind?«, fragte sie.
»Nein, nicht nötig. Sie erwartet mich.« Ich ging weiter, drehte mich dann aber noch mal um. »Allerdings könnten Sie mir einen Gefallen tun und, wenn ich nachher im Smoking wieder hier vorbeilaufe, einen Notfall vortäuschen? Gerne eine Ohnmacht oder so was, ich bin da nicht wählerisch.«
Sie lachte, eher ein Kichern, bevor ihr wohl einfiel, wer ihre Chefin war und dass sie ganz sicher gefeuert wurde, wenn sie mit mir flirtete. Abrupt wurde ihr Gesicht wieder zu der Maske aus unverbindlicher Freundlichkeit, und ich bedauerte es nur kurz, während ich mich zu den Aufzügen wandte.