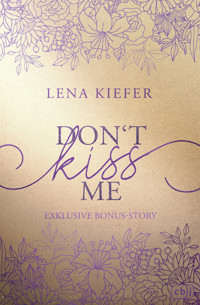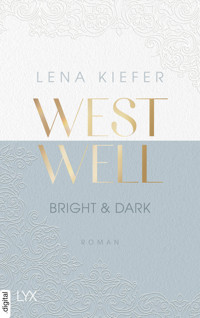9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coldhart
- Sprache: Deutsch
SOLLTE ICH NUN DERJENIGE SEIN, DER IHR DAS WIEDER WEGNAHM?
SOLLTE ICH IMMER DERJENIGE SEIN, DER SIE UNGLÜCKLICH MACHTE?
Vier Monate ist es her, dass Elijah die Frau von sich gestoßen hat, die ihm alles bedeutet. Und auch wenn sich jeder Gedanke an Felicity anfühlt wie ein Stich mitten ins Herz, bereut er nicht, es getan zu haben, denn es war der einzige Weg, sie zu beschützen. Jetzt verfolgt Elijah nur noch ein Ziel: denjenigen zu finden, der ihn vor dreizehn Jahren entführt hat und ihm das Leben seitdem zur Hölle macht. Doch er kann Felicity nicht vergessen, vor allem nicht, als er ihren Vater als seinen Entführer entlarvt. Mit einem Mal steht er vor der Entscheidung, Felicity weiterhin in dem Glauben zu lassen, er hätte nie etwas für sie empfunden - oder ihr die Wahrheit zu sagen und damit alles zu riskieren ...
"COLDHART enthält für mich absolut alles, was ich an Lenas Büchern liebe. Die Geschichte hat sich so echt, nah und tief angefühlt. Es ist die Sorte Buch, die das eigene Herz beim Lesen ein bisschen verändert - auf bestmögliche Art und Weise." CHARLIE_BOOKS
Band 2 der COLDHART-Reihe von Platz-1-Spiegel-Bestseller-Autorin Lena Kiefer
Die COLDHART-Reihe:
1. Coldhart - Strong & Weak
2. Coldhart - Deep & Shallow
3. Coldhart - Right & Wrong (24.09.2024)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 607
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Motto
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lena Kiefer bei LYX
Leseprobe
Impressum
LENA KIEFER
COLDHART
DEEP & SHALLOW
Roman
Zu diesem Buch
Elijah Coldwell verfolgt nur noch ein einziges Ziel: den Mann zu finden, der ihn vor mehr als dreizehn Jahren entführt hat und seither jeden bedroht, der ihm wichtig ist – zuletzt die Frau, die alles für Elijah hätte sein können. Noch nie zuvor in seinem Leben hat er sich bei einer Person so sicher gefühlt wie bei Felicity, noch nie zuvor hat er sich jemandem auf eine solche Weise geöffnet, wie er es bei ihr konnte. Aber um sie zu schützen, musste er sie von sich stoßen, und das auf die grausamste Weise. Auch jetzt, vier Monate später, fühlt sich jeder Gedanke an sie wie ein Stich ins Herz an, aber Elijah weiß, dass er die einzig richtige Entscheidung getroffen hat. Jetzt konzentriert er sich auf seine Ermittlungen, die ihn erst nach England und dann wieder zurück nach New York führen. Doch Felicity zu vergessen, ist unmöglich. Nicht nur weil sich ihre Wege immer wieder kreuzen und es beiden zunehmend schwerer fällt, die Anziehung zwischen ihnen zu ignorieren. Sondern auch weil Elijahs Suche ihn zu niemand anders als Felicitys Vater führt …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die triggern können.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Lena und euer LYX-Verlag
Für Charleen.
Ich wünschte, alle Menschen
würden Bücher so verstehen
wie du.
Playlist
Coldhart Theme – technokrates
hurts like hell – Wrabel, Valentina Ploy
All For You (with Ella Henderson) – Cian Ducrot, Ella Henderson
Angels Like You – Josh Rabenold
High Five – Sigrid
Rewind Your Love – JB Stark, Kestra
Worth It – Colbie Caillat
Million Eyes – Loïc Nottet
HONEY (ARE YOU COMING?) – Måneskin
Fix You – Fearless Soul
Overthinking – Zoe Wees
Lighthouse – Kelly Clarkson
False Dawn – Single Edit – Holding Absence
Someone To You – Piano Version – Roses & Revolutions
Am I Enough – Loi
No Right To Love You – Acoustic – Rhys Lewis
THE LONELIEST – Måneskin
Broken – Thomas Meilstrup
Everything everywhere always – Elijah Woods
Go To War – Nothing More
»To die, to sleep –
To sleep, perchance to dream – ay, there’s the rub,
For in this sleep of death what dreams may come …«
William Shakespeare, »Hamlet«
Prolog
Harrison Grant war kein Mann umständlicher Worte. Er bevorzugte ein offenes und direktes Gespräch, keinen überflüssigen Small Talk oder Leute, die ihm Honig um den Mund schmierten. Wahrscheinlich war deswegen Rex Farragano seit zehn Jahren sein Mann fürs Grobe. Der verlor nicht allzu viele Worte, sondern erledigte die Aufträge, die man ihm zuteilte.
Als Rex jetzt sein Wohnhaus auf der Upper West Side betrat, wusste Grant, dass der Termin nicht übermäßig lang dauern würde. Was gut war, denn Alyssa würde bald zu Hause sein und sie begegnete Rex besser nicht.
»Kommen Sie rein.« Er hielt dem Detektiv die Tür zum Büro auf. »Whiskey?«
»Nein danke, ich muss noch fahren. Und wenn die mich ein weiteres Mal erwischen, endet das böse.« Rex nahm ohne Aufforderung in einem der Sessel vor dem massiven Schreibtisch Platz. »Wie geht es mit Ihrer Tochter voran, Sir?«
Grant musste nicht nachfragen, um zu wissen, wen sein Gegenüber meinte.
»Wir machen Fortschritte. Sie hatte eine Weile damit zu kämpfen, dass der Coldwell-Junge sie abserviert hat, aber langsam überwindet sie es. Zum Glück habe ich sie in der Wohnung im Auge. Meine Leute überwachen genau, wer bei ihr ein- und ausgeht.«
Rex lächelte leicht. »Es war ein kluger Schachzug, ihre Wohngemeinschaft in Brooklyn aus dem Verkehr zu ziehen, indem man sie zu einem ach-so-gefährlichen Ort macht.«
»Ja, nur hätten Sie bei dem Einbruch nicht unbedingt jemanden töten müssen.« Grant verzog unzufrieden den Mund.
»Beinahe«, korrigierte Rex. »Ich habe ihn nur beinahe getötet. Der Typ ist durchgekommen.«
»Was nicht Ihr Verdienst war, sondern der fähiger Ärzte. Das hätte viel zu viel Aufsehen erregt. Wenn Sie beim nächsten Mal nicht besser aufpassen, muss ich mir überlegen, ob ich auf Ihre Dienste in Zukunft verzichte.«
»Verstanden.« Rex nickte knapp.
»Dann hätte ich jetzt gerne das Update.«
»Es gibt nicht viel Neues.« Der Detektiv warf einen Stapel Fotos auf den Tisch. Grant war alte Schule, er wollte den Kram grundsätzlich auf Papier. Eine Verschwendung von Ressourcen, aber der Boss bestimmte, wo es langging. »Sie trifft sich immer noch mit Alexis Wentworth, dem besten Freund von Coldwell. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass mehr zwischen ihnen ist, aber genau das zeigt vielleicht, dass Ihre Tochter noch nicht damit abgeschlossen hat.«
Die Bilder zeigten Felicity und den gefallenen Bankier-Erben in einem Café in der Nähe des Central Parks, sie aßen Kuchen und schienen sich zu amüsieren. Rex hatte recht, die Körpersprache deutete nicht darauf hin, dass romantische Gefühle im Spiel waren, genau wie die Tatsache, dass Wentworth sie nie in ihrer Wohnung besucht hatte. Das war jedoch keine Beruhigung. Wenn sie sich wegen Coldwell trafen, bedeutete das, Felicity war definitiv nicht darüber hinweg.
»Behalten Sie das im Auge. Wenn sich die beiden näherkommen, wäre das nur gut für uns.« Denn das würde Coldwell seinem Freund nie verzeihen, womit sich diese Gefahr ganz von selbst erledigte.
»Natürlich, Sir.« Rex nickte. »Felicitys Job bei Helena Weston beunruhigt Sie weiterhin nicht? Die Nähe zu den Coldwells würde mir Sorgen machen.«
»Die Arbeit macht ihr Spaß, ich möchte ihr das nicht wegnehmen. Außerdem weilt Elijah Coldwell ja aktuell im Ausland, also besteht keine Gefahr, dass sie sich begegnen. Wenn sich daran etwas ändert, werden wir neu entscheiden.«
»Gut, in Ordnung. Dann sind da Informationen zu Alyssas neuem Freund. Offenbar gab es noch einige andere Delikte mit Betäubungsmitteln, die von den Eltern jedoch wirksam unter den Teppich gekehrt wurden. Gibt es Planungen, die beiden zu trennen?«
Grant runzelte die Stirn. »Noch nicht, wir warten ab. Sie ist glücklich mit ihm und bisher stellt er kein Problem dar. Dass er aktuell Drogen nimmt, dafür gibt es keine Beweise, oder?«
»Nein. Er ist seit zwei Jahren sauber, was das betrifft.«
»Gut.« Grant nickte. »Dann wollen wir Alyssa diese Beziehung gönnen, solange er sich nichts zuschulden kommen lässt.«
Rex gab sein Einverständnis mit einem kurzen Heben seiner Schultern. »Wie Sie wünschen. Vielleicht ändern Sie Ihre Meinung, wenn Sie ihm begegnen. Er ist ein unerträglicher Idiot.«
Grant lachte. »Nun, wir beide wissen, dass Alyssas Urteilsvermögen in dieser Hinsicht ein wenig eingeschränkt ist. Deswegen sind wir ja da, um sie zu beschützen.« Damit war das Thema für ihn beendet.
»In Ordnung, dann bleibt nur noch Rosalie.«
»Trifft sie sich etwa auch mit jemandem?« Das hätte Grant gewundert. Seine älteste Tochter war der effizienteste und rationalste Mensch, den er kannte. Sie lebte für ihren Job und eine Beziehung wäre für sie nur ein Zeitfresser, den man sich auch sparen konnte.
»Nein, momentan nicht. Allerdings war sie in den letzten zwei Wochen öfter aus als früher. Keine Dates, sondern Treffen mit Freundinnen, aber sie hat dabei Alkohol getrunken und wir wissen, dass das für sie sehr ungewöhnlich ist. Vielleicht wollen Sie der Sache bei Gelegenheit auf den Grund gehen, das ist nicht wirklich mein Bereich. Ich wollte es dennoch erwähnen.«
Grant verzog besorgt das Gesicht. Rosalie verhielt sich schon seit ihrer Rückkehr aus London anders, sie widersprach häufiger und vertrat ihre Meinung vehementer als zuvor. Er war davon ausgegangen, dass sie sich durch den Aufenthalt im Ausland mehr emanzipierte, aber exzessiv zu feiern passte nicht zu ihr. Vielleicht musste sie einfach etwas Dampf ablassen, es war jedoch besser, wenn er sie im Auge behielt.
»Ich kümmere mich darum. Ist das dann alles?«
»Ja, im Grunde schon. Ich melde mich in zwei Wochen wieder.« Rex erhob sich und ging zur Tür. »Sir, darf ich mir noch eine Anmerkung zu Felicity erlauben?«
»Sicher.« Es gab keine Garantie, dass Offenheit nicht zu Konsequenzen führte, aber Rex arbeitete lange genug für Grant, um das zu wissen.
»Sie muss Elijah Coldwell eine Menge bedeuten, wenn nur ein simples Foto ihn dazu bringen kann, sie zu verlassen. Haben Sie keine Sorge, dass die Romanze zwischen den beiden wieder aufflammen könnte, wenn er nach New York zurückkehrt?«
»Nein, habe ich nicht.« Aktuell trieb sich Coldwell mit seiner Prinzessin in England herum und auch wenn nicht klar war, ob diese Zurschaustellung der Beziehung immer noch dazu diente, Felicity zu schützen, lag die Vermutung nahe, dass er darüber hinweg war. Wie konnte er auch nicht? Felicity war wirklich ein nettes Mädchen, aber jemand seines Kalibers würde wohl kaum lange Interesse an ihr haben. Es war Grants Hoffnung, dass sich diese Sache für immer erledigt hatte. Und falls nicht …
Dann würde er Mittel und Wege finden, um dafür zu sorgen.
1
Elijah
Das Old English Arms in Blackwood sah genauso aus, wie man sich ein Pub am Ende der Welt vorstellte: rußschwarze Fassade, schmutzige Fenster und ein windschiefer Schornstein auf einem Dach, das seine besten Zeiten vermutlich vor dem Zweiten Weltkrieg gesehen hatte. Das Schild mit dem Namen quietschte an seinen rostigen Ketten, als würde es eher heute als morgen herunterfallen. Und natürlich regnete es. In England regnete es schließlich immer.
Ich hatte den Kragen meines Mantels zum Schutz vor dem kalten Wind aufgestellt, leider half das nicht gegen die Wassermassen, die vom dunklen Himmel fielen und mich längst durchnässt hatten. Es war mir egal. Mir war so vieles egal, seit ich vor vier Monaten New York verlassen hatte und zu meiner Mission aufgebrochen war. Im Grunde alles, was nicht dazu führte, dass ich den Mann fand, der mich vor mehr als dreizehn Jahren entführt hatte. Den Mann, der jeden bedroht hatte, der mir etwas bedeutete – zuletzt das Mädchen, das alles für mich hätte sein können.
Der Gedanke an Felicity durchdrang für einen Moment meine Mauer aus Gefühllosigkeit und bescherte mir ein scharfes Ziehen im Magen. Ich drängte es brutal weg, drängte alles weg, was mich an sie erinnerte. Sie war Vergangenheit geworden, noch bevor ich sie zu meiner Gegenwart hatte machen können. Und in ihrer Zukunft würde ich keine Rolle mehr spielen, dafür hatte ich gesorgt. Ich hatte ihr wehgetan, mit voller Absicht, und hätte ich nicht meine Gefühle abgeschaltet, als wäre ich ein verdammter Vampir in dieser Serie mit den zwei Brüdern, wäre ich vermutlich unter der Last meiner Schuld zusammengebrochen. Aber ich hatte keine Wahl gehabt. Matilda zu bitten, die Farce um unsere angebliche Beziehung auf die Spitze zu treiben, war meine einzige Chance gewesen, Felicity aus der Schusslinie zu nehmen. Ich bereute es nicht, das getan zu haben. Ich bereute jedoch, dass es nötig gewesen war.
Die Tür zum Pub war ebenso unansehnlich wie die ausgebleichten Speisekarten, die in dem Kasten daneben hingen. Dennoch ging ich hinein. Ich war nicht hier, um etwas zu essen. Ich war hier, um Informationen zu bekommen.
Mich empfing der Geruch nach Frittierfett, Ale und feuchtem Holz – das war ebenfalls eine Mischung, die man in England sehr oft antraf. Ich hatte mich in den letzten Wochen allerdings auch selten in guten Gegenden aufgehalten. Schließlich war ich auf der Suche nach einem Typen, der zum Abschaum der Menschheit gehörte. Dem Typen, der mir mit seinem beschissenen Sturmfeuerzeug meine Narben zugefügt hatte. Und der mir als Einziger verraten konnte, wer ihn beauftragt hatte.
Im Pub war nicht viel los, zwei ältere Männer saßen am Tresen, drei weitere an einem Tisch in der Ecke. Ich strich mir das Wasser aus den Haaren und ging auf den Barkeeper zu, der gerade ein Bier zapfte.
»Haben Sie sich verlaufen?«, fragte er in stärkstem westbritischen Dialekt, eine Augenbraue hochgezogen. Ich konnte ihm die Skepsis nicht verübeln, schließlich war ich eindeutig nicht von hier. Hätte ich es gewollt, wäre ich sicherlich in der Lage gewesen, mein Äußeres genauso an diese Gegend anzupassen wie meinen Akzent, aber wozu? Ich wollte keine Freundschaften schließen.
Eher das Gegenteil.
»Nein«, antwortete ich kühl. »Ich suche jemanden.«
»Und wen könnten Sie wohl bei uns suchen?«
»Tom Baker. Mir wurde gesagt, dass er öfter hier ist.«
Die beiden Männer am Tresen begannen zu tuscheln, aber der Barkeeper verzog keine Miene. »Tom Baker? Nie von ihm gehört.« Sein abweisender Ton wurde noch davon unterstrichen, dass er mir anschließend den Rücken zudrehte, um ein paar Gläser ins Regal zu räumen. Deutlicher hätte er kaum machen können, dass dieses Gespräch für ihn beendet war.
»Wirklich nicht?«, setzte ich in leichterem Ton nach. »Dabei ist er doch der Ex-Mann Ihrer Tochter Sally und hatte mal ein Haus ein paar Straßen weiter.« Der Ort hatte kaum mehr als fünfhundert Einwohner, selbst wenn die beiden nicht familiär verbunden gewesen wären, hätte er ihn gekannt.
Es hatte mich Wochen an Recherche gekostet, Baker hier aufzuspüren, von der Geldsumme ganz zu schweigen. Thomas Baker war ein so verbreiteter Name, dass ich, nachdem ich ihn herausgefunden hatte, sprichwörtlich die Nadel im Heuhaufen hatte suchen müssen, bis die Parameter endlich passten. Das hier war nach einigen erfolglosen Versuchen der vielversprechendste Treffer.
»Was wollen Sie von Tom?« Der Wirt hatte seine ahnungslose Haltung aufgegeben und sich wieder zu mir umgedreht. »Hat er Schwierigkeiten?«
Interessant, dass er sich jetzt doch mit mir unterhalten wollte.
»Kommt darauf an.« Ich hob die Schultern.
»Worauf?«
»Ob mir gefällt, was er auf meine Fragen antwortet.«
Der Barkeeper musterte mich jetzt intensiver, als versuchte er, aus meinem Gesicht schlau zu werden. Viel Spaß dabei, dachte ich. Mein Pokerface war ungeschlagen, seit dem Beginn meiner Reise galt das noch mehr als vorher. Alles, was er sah, war eine undurchdringliche Miene.
»Sind Sie von irgendeiner Behörde?«
Vielleicht dachte er aufgrund meiner Kleidung und des US-Akzents, dass ich von der CIA war. So war es zumindest bei meinem Besuch im letzten Ort gewesen, in dem ich Tom Baker vermutet hatte – wo man mir gesagt hatte, dass seine Ex-Frau hier in Blackwood lebte. Noch lieber hätte ich mit ihr gesprochen, aber sie war zurzeit verreist.
Ich überlegte kurz und entschied mich für die Wahrheit. »Nein. Ich habe nur eine offene Rechnung mit Tom.« Mit dem Typen, der mich als Kind entführt und misshandelt hatte. Er sollte der Schlüssel zur Identität meines Entführers sein, mein Beweis für dessen Taten. Deswegen war ich hier, im britischen Spätwinter – bereit, endlich zu erfahren, ob unter meinen fünf Verdächtigen tatsächlich Cyrus Vanderbilt derjenige war, den ich zu Fall bringen musste. Oder ob es einer der anderen war. Bis auf Grant, den ich bei zwei Gelegenheiten verpasst hatte, war ich ihnen allen begegnet. Und niemand hatte sich so merkwürdig verhalten wie Vanderbilt. Es war logisch gewesen, ihn zum Ziel zu machen.
Meine Ermittlungen hatten in Chicago begonnen, wo Vanderbilt mittlerweile seinen Hauptgeschäftssitz hatte. Ich hatte sein Umfeld unauffällig durchforstet, seine Aktivitäten gecheckt, war sogar zu einigen Spendenveranstaltungen gegangen, um ihn aus der Reserve zu locken. Allerdings hatte er sich abgesehen von dem Treffen im Büro meiner Mutter keine weiteren Entgleisungen erlaubt und auch sonst hatte ich keine eindeutigen Beweise gefunden, dass er für den Tod der jungen Frau verantwortlich war, den ich mit angesehen hatte – oder für die Ermordung von Miranda. Und nachdem ich fast vier Wochen damit zugebracht hatte, ihm etwas nachweisen zu wollen, hatte ich eingesehen, dass es vielleicht die bessere Strategie war, jemanden zu finden, der ihn oder einen der anderen Verdächtigen zweifelsfrei als meinen Entführer identifizieren konnte. Früher hatte ich zu viel Angst gehabt, um in diese Richtung nachzuforschen, aber nun hatten sich die Dinge geändert.
Die drei Handlanger, die mich damals festgehalten hatten, waren zwar entkommen, bevor man sie vor Gericht stellen konnte, obwohl mir Miranda bei der Befreiung was anderes erzählt hatte, um mich zu beruhigen. Aber der Typ, der für meine Narben verantwortlich war, hatte mir nicht nur sein Gesicht gezeigt, sondern auch einen britischen Akzent und ein auffälliges Schlangentattoo auf dem Unterarm besessen. Also war ich nach vielen Nächten mit einem illegal beschafften Zugang zu den Datenbanken der US-Polizeibehörden und Scotland Yard schließlich fündig geworden und hatte ihn auf einem der Bilder erkannt und identifiziert. Mein Privatermittler Archie, den ich während der Zeit in Chicago eingeweiht hatte, war daraufhin aktiv geworden und hatte mir alles an Informationen geliefert, was es gab. Und nun war ich hier. Tom Baker würde mir sicher nicht freiwillig helfen, aber ich würde schon einen Weg finden, ihn dazu zu bringen, mir den Namen seines Auftraggebers zu verraten.
»Tom war ewig nicht mehr hier«, sagte nun der ältere Mann neben mir am Tresen. »Er kommt nur vorbei, wenn er Sally wieder einmal Geld abknöpfen will. Eine echte Plage, der Typ.«
Der Barkeeper schüttelte den Kopf. »Komm schon, Angus. Der Junge ist Familie.«
»Nicht meine«, wehrte sich der Alte. »Und deine auch schon lange nicht mehr, aber du bist immer noch auf seiner Seite. Du solltest dich was schämen, deine Tochter nicht vor ihm zu beschützen.«
Das Wortgefecht war ja ganz unterhaltsam, aber es brachte mich nicht weiter. »Haben Sie eine Ahnung, wo er sein könnte?« Ich richtete meine Frage an den alten Mann, weil ich den Eindruck hatte, er wäre eher bereit, mir Auskunft zu geben.
»Vielleicht?« Der Ausdruck in seinen Augen bekam etwas Berechnendes. Ich ahnte, was er wollte.
»Wie viel?«, fragte ich, meine Hand bereits in der Innentasche meines Mantels, um meine Geldbörse hervorzuholen. Wenn etwas überall auf der Welt funktionierte, war es Bestechung. Manchmal sogar besser als Drohungen, wie ich aus eigener Erfahrung wusste. Die letzten Monate hatte ich ausgiebige Studien zu beidem machen können.
»Was haben Sie denn dabei?«, fragte der Alte zurück und entlockte mir damit einen gehobenen Mundwinkel.
»Genug.« Ich nahm mehrere Fünfzigpfundnoten heraus und legte sie auf den Tresen. Der Barkeeper warf begehrliche Blicke darauf und ich sah ihn herausfordernd an. Wer mir sagte, wo ich Baker finden konnte, bekam das Geld. Ganz einfach. »Also?«
Der alte Mann wollte nach den Scheinen greifen, aber ich schob sie aus seiner Reichweite. Bevor ich keine Informationen hatte, würde er nichts davon sehen.
»Mein Sohn kommt ein bisschen rum, er arbeitet für einen Spediteur. Er meinte neulich, er hätte Tom in Windsbury gesehen. Das ist ein Ort etwa hundert Meilen von hier, mein Enkel studiert dort.«
»Okay.« Ich hielt die Hand weiterhin auf dem Geld. »Und wo genau in Windsbury muss ich suchen?« Ich hatte keine Ahnung, wie groß der Ort war, aber wenn es eine Universität gab, dann sicherlich größer als das Nest hier. Mich durchzufragen würde zu lange dauern.
»In der Altstadt gibt es eine Pension, irgendwas mit Horse oder Fox heißt die. Da soll er rausgekommen sein.«
Ich nahm die Hand von den Pfundnoten, dann warf ich einen Blick zum Barkeeper, dem diese ganze Szene mehr als unangenehm zu sein schien. »Wenn Sie ihn warnen, komme ich wieder und es wird Ihnen leidtun«, sagte ich in dem kühlen Tonfall, den ich zuvor bereits angeschlagen hatte.
Er hob abwehrend die Hände. »Keine Sorge. So weit geht meine Loyalität nicht.«
»Gut. Denn er hat recht.« Ich zeigte auf den Alten. »Sie sollten wirklich besser auf Ihre Tochter aufpassen.« Ich zückte noch ein paar Scheine und warf sie auf den Tresen, um den Barkeeper für etwas zu bezahlen, das ich überhaupt nicht bestellt hatte. Vielleicht würde ihn das auch später davon abhalten, seinen ehemaligen Schwiegersohn anzurufen.
Ohne mich zu verabschieden oder zu bedanken, ging ich zur Tür und machte mich durch den Regen auf den Rückweg zu meinem Mietwagen. Heute war es zu spät, um noch nach Windsbury zu fahren. Aber es würde das Erste sein, was ich morgen früh tat.
Das Bed and Breakfast, in dem ich übernachtete, lag zwei Orte weiter, und ich lenkte den Jeep über holprige Straßen, bis ich dort ankam. Eine Nachricht ging auf meinem Handy ein, als ich meinen nassen Mantel an die Tür hängte und mich anschließend auf das knarzende Bett fallen ließ. Blumentapete bedeckte sämtliche Wände, der Stoff der Tagesdecke war altrosa und der Sessel am Fenster hatte ein so hässliches Rankenmuster, dass der Designer nur auf einem schlechten Trip gewesen sein konnte. Müde schloss ich die Augen, um all das nicht mehr sehen zu müssen, auch wenn das gegen den penetranten Geruch nach Lavendelseife nicht half. Ich hätte alles darum gegeben, nur eine Nacht in meiner eigenen Wohnung zu verbringen, nur eine einzige. Aber ich konnte nicht nach New York zurück, bevor ich Gewissheit hatte.
Mir fiel die Nachricht wieder ein und ich zog das Handy hervor.
Helena hatte mir ein Foto geschickt: Buddy auf dem Teppich in ihrer Wohnung, mit einem riesigen Kauknochen im Maul. Wir vermissen dich, stand darunter.
Beim Anblick meines Hundes schnürte sich meine Kehle zu. Natürlich kam er ohne mich zurecht, vermutlich besser als umgekehrt, aber ich bildete mir ein, in seinen dunklen Augen Traurigkeit zu sehen, vielleicht sogar einen Vorwurf. Ich hatte ihn nie länger allein gelassen, seit er bei mir war – höchstens mal zwei Wochen für eine Reise, bei der ich ihm das Klima oder den Flug nicht zumuten wollte. Jetzt waren es schon vier Monate und ich wusste nicht, wie lange ich es noch ohne ihn aushalten konnte. Nicht, weil ich ihn brauchte, um aufkommende Panik zu vertreiben, da bestand gerade keine Gefahr. Nach der Attacke wegen der Bedrohung von Felicity hatte mein harter Break meine Kontrolle wieder auf Kurs gebracht. Nein, mir fehlte es einfach, dass mein Hund bei mir war. Dass ich meine Nase in sein Fell stecken konnte, um zu wissen, dass ich mich nicht allein auf der Welt befand. Nur war das momentan nicht möglich. Und zum Glück war er bei Helena und Jess in den besten Händen.
»Ich vermisse euch auch«, sagte ich leise, bevor ich das Foto mit einem Herz kommentierte und den Chat verließ.
Helena war die einzige Person in New York, mit der ich Kontakt hatte, und das auch nur, damit sich meine Familie keine Sorgen machte. Ich wusste, dass meine Mutter spätestens nach zwei Tagen eine ganze Heerschar an Ermittlern auf mich angesetzt hätte, wenn sie nicht wusste, wo ich war. Da war der Kontakt zu Helena ein guter Kompromiss, auch wenn ich ihr alle Details verschwieg. Sie wusste genau wie Mom, dass ich etwas erledigen musste, aber nicht genau, was. Und alle anderen sollten glauben, dass ich mich wegen meiner Beziehung mit Matilda in England aufhielt. Die Prinzessin war so nett, immer wieder auf Social Media Fotos und Videos von uns zu posten, die wir vorproduziert hatten, um den Schein zu wahren. Gesehen hatte ich auch sie schon seit Wochen nicht mehr.
Meine Liste unbeantworteter Nachrichten war lang. Direkt unter Helena stand Alecs Name und als ich daraufklickte, sah ich unseren Verlauf, der von meiner Seite aus im November ein Ende gefunden hatte – wie so viele andere ebenfalls.
Das Letzte, was ich ihm geschrieben hatte, war: Ich muss die Stadt für eine Weile verlassen. Kannst du ab und zu nach Felicity sehen? Aber sag ihr nicht, dass ich dich darum gebeten habe. Alec hatte darauf mit unzähligen Emojis, GIFs und Nachrichten in Großbuchstaben geantwortet, die sich teilweise um das Video von Matilda und mir drehten, teils um meine Bitte, teils um meine Abwesenheit. Zuletzt hatte er mir vor drei Tagen geschrieben und mich gefragt, wie es mir ging, mehr nicht. Als würde er sich einfach nur wünschen, ein Lebenszeichen von mir zu erhalten.
Ich hatte nicht geantwortet.
Wenn mich die Zusendung des Fotos mit dem Fadenkreuz darauf eins gelehrt hatte, dann dass jeder Mensch, der mir wichtig war, in Gefahr schwebte. Das galt nicht nur für Felicity, sondern auch für meine Freunde und meine Familie. Je weniger Kontakt ich zu ihnen hatte, desto weniger konnte man sie bedrohen – denn das war nur wirksam, wenn ich etwas davon mitbekam. Offiziell hatte ich daher alle Brücken hinter mir abgebrochen und war wegen Matilda nach Großbritannien übergesiedelt. Passend dazu hatte ich mein Studium vorübergehend pausiert, was mir sehr schwergefallen war, weil ich damit eventuell in Verzug kam, was den Abschluss anging. Aber bevor ich diesen Fall nicht aufgeklärt hatte, würde ich immer nur ein halbes Leben besitzen, und ich war es leid. Sobald ich meinen Entführer dingfest gemacht hatte, würde ich nicht nur nach New York zurückkehren, mein Studium beenden und das Museumsprojekt umsetzen können. Ich würde auch endlich, endlich frei sein.
Felicity hatte ich allerdings für immer verloren und es schnürte mir die Luft ab, daran zu denken, was ich ihr angetan hatte. Aber auch für sie war es besser so. Sie war einer Gefahr entgangen, der sie sich nie bewusst gewesen war. Und sie würde über mich hinwegkommen. Umgekehrt war ich mir da jedoch nicht so sicher. Sie war alles, was ich mir je gewünscht hatte, und genau deswegen hätte ich wissen müssen, dass die Sache zwischen uns zum Scheitern verurteilt war. Meine Wünsche erfüllten sich schließlich nie.
Meinen Entführer zu bestrafen war jedoch kein Wunsch, es war eine Notwendigkeit, und ich würde alles dafür tun, dass ich Erfolg hatte. Vielleicht hatte ich kein glückliches Händchen in puncto Wunscherfüllung, aber meine Ziele hatte ich bisher immer erreicht. Dazu musste ich nur Baker finden und ihm ein Geständnis abringen. Und genau das würde ich direkt morgen tun.
Mit dem Gedanken hievte ich mich auf die Füße, ging in das kleine Badezimmer, in dem es noch stärker nach Lavendelseife duftete, und machte mich fertig. Dann legte ich mich ins Bett, schloss die Augen und hoffte darauf, ein bisschen Schlaf zu finden. Morgen wartete Windsbury auf mich. Und ich würde es nicht wieder verlassen, bevor ich Baker gefunden hatte.
2
Felicity
»Wie ihr seht, gibt es hier nur wenige Mauern, die nicht farbig sind. Das Bushwick-Kollektiv ist eine der aktivsten Street-Art-Communitys des Landes.« Ich zeigte auf die Gebäude um uns herum. »New York verdankt es Joe Ficalora, der wollte, dass die hässlichen Wände des Viertels verschönert werden, und dafür einige Künstler zu einer Party einlud. Wenn andere eine Feier machen, gibt es hinterher vor allem Müll, der entsorgt werden muss, Joe dagegen bekam Street-Art vom Feinsten. Merkt euch das für eure nächste Party.«
Einige aus der achtköpfigen Gruppe lachten und ich trat beiseite, damit sie Fotos machen konnten. Wir standen vor einem Haus, an dessen Wand in grellen Pink- und Lilatönen ein Gebilde aus Linien gesprayt worden war, die ineinander übergingen und nirgendwo endeten. Es hieß »Eternal Return« und stammte von Chris Soria, dessen Stil kaum weiter von meinem eigenen hätte entfernt sein können, den ich aber dennoch – oder vielleicht genau deswegen – sehr bewunderte. Er war jedoch nicht der Einzige, der sich verewigt hatte. Bushwick war wie eine riesige Outdoor-Galerie, hier konnten Künstler legal Wände besprühen und ihren Visionen Ausdruck verleihen. Seit ich vor ein paar Wochen zum ersten Mal hier gewesen war, konnte ich mich bei jedem weiteren Besuch kaum sattsehen.
»Felicity, können wir ein Foto zusammen machen?« Zwei der Mädchen, die zu der Gruppe gehörten, winkten mich heran. Sie waren wie der Rest der Truppe aus San Francisco und wir hatten direkt einen Vibe zueinander gehabt.
»Klar.« Ich stellte mich zu ihnen und wir machten mehrere Posen vor der Mauer, um den perfekten Winkel einzufangen. Dann ging ich zu Keiko hinüber, die ihr Smartphone in der Hand hielt, das sie sinken ließ, sobald ich neben sie trat.
»Du machst das echt gut«, sagte sie. »Ich finde, du bist ein Naturtalent. Die Leute lieben dich.«
»Danke.« Ich lächelte. Keiko arbeitete hauptberuflich für Helenas Agentur Friends and the City und war für die Kunst- und Kultursparte zuständig. Sie hatte die Verantwortung für diese Gruppe und begleitete sie insgesamt drei Tage in Museen, Kunstgalerien und eben auch hierher.
Nach der Winterpause hatten sie und Helena mich gefragt, ob ich nicht ein paar Street-Art-Touren anbieten könnte, immer etwa zwei Stunden zu den interessantesten Pieces der Stadt. Ich hatte sofort zugesagt und wie erwartet machte es unglaublichen Spaß, den Leuten diese Kunst näher zu bringen, die so viel mehr war als Graffiti und das Beschmieren von Wänden. Zwar hatte ich mich erst einmal im Blitztempo mit den Hot Spots der Stadt vertraut machen müssen, weil ich vorher keine Zeit gehabt hatte, mich wirklich mit der Kunst hier zu beschäftigen. Aber jetzt hatte ich den Durchblick.
»Kommst du noch mit zum Essen?«, fragte mich Keiko. »Ich habe in der Nähe was reserviert.«
»Nein, ich kann leider nicht. Bin verabredet.« Wenn ich gewusst hätte, wie nett die Gruppe war, hätte ich das eventuell verschoben, aber so kurzfristig wollte ich nicht absagen.
»Oh, hast du ein Date?« Keikos Blick wurde neugierig und ich wand mich ein bisschen, weil mir diese Frage ständig gestellt wurde, wenn es um Treffen mit dieser bestimmten Person ging.
»Nein«, antwortete ich und zog meinen Schal fester um den Hals. Wir hatten Anfang März, aber es war immer noch kalt. »Ich treffe mich nur mit einem Freund.«
»Na, dann viel Spaß bei deinem Nicht-Date. Du kannst ja einfach beim nächsten Mal mitkommen.« Ihr Blick sagte mir, dass sie mir meine Gedanken ansehen konnte. Ich war eben immer noch ein offenes Buch und Helenas Team bestand aus sehr empathischen Menschen. Das machte Friends and the City so erfolgreich.
»Ja, beim nächsten Mal sehr gerne. Wir sehen uns morgen in der Agentur.«
Ich verabschiedete mich, tauschte mit den beiden Mädchen aus San Francisco noch die Nummern und machte mich dann auf den Weg zur nächsten Subway-Station. New York war mir häufig immer noch zu viel, zu laut, zu hart. Trotzdem fand ich mich allmählich zurecht. Vielleicht war ich an manchen Tagen sogar glücklich damit, hier zu leben. Zumindest, wenn ich nicht daran dachte, dass mir derjenige, mit dem ich diese Stadt mehr als mit jedem anderen verband, das Herz in tausend Stücke gerissen hatte.
Der Gedanke an Elijah sorgte für ein gewohntes Ziehen in meinem Magen, das nicht schwächer wurde, egal, wie viel Zeit verstrich. Dabei waren schon vier Monate vergangen, seit er mir sehr eindrucksvoll und in aller Öffentlichkeit klargemacht hatte, dass er nichts mehr von mir wissen wollte. Und dass ihm das, was zwischen uns gewesen war, nicht genug bedeutete, um ehrlich zu mir zu sein. Ich wusste bis heute nicht, was ihn dazu gebracht hatte, diese Show abzuziehen, aber ich hielt daran fest, dass es eine gewesen war. Er war nicht in Matilda verliebt und bestimmt war er jetzt nicht in England, um mit ihr zusammen zu sein. Es gab einen Grund für das, was er getan hatte. Nur kannte ich ihn nicht. Wahrscheinlich würde ich ihn nie erfahren.
Weihnachten war vorübergezogen und die Zeit in L. A. mit meinen Freunden hatte mir gutgetan. Sogar mit meiner Mutter war es wieder einigermaßen okay gewesen. Ich hatte mein erstes Trimester an der SVA beendet, auch wenn mich das nicht unbedingt mit Stolz erfüllte. Zwar hatte ich alle Prüfungen bestanden, aber mehrere davon nur knapp. Und ich konnte immer noch nicht behaupten, dass dieses Studium die Erfüllung meiner Träume war. Die meiste Zeit fühlte ich mich überfordert, meine Ideen fanden wenig Anklang bei Zeke und den anderen Dozenten und Anschluss hatte ich dort bisher auch nicht gefunden. Wenn mein Vater und die Arbeit für die Agentur nicht gewesen wären, hätte ich wohl längst hingeschmissen und wäre zurück an die Westküste gezogen. So kämpfte ich mich jedoch weiter durch und hoffte, dass sich das gewünschte Hochgefühl irgendwann doch noch einstellte – oder ich herausfand, was ich stattdessen studieren sollte.
Die Fahrt mit der Subway dauerte knapp zwanzig Minuten, dann stieg ich in Gramercy Park wieder aus und kehrte zurück an die Oberfläche. Mein Smartphone meldete zwei neue Nachrichten. Eine war von Rhoda, die sich seit Weihnachten quasi täglich erkundigte, wie es mir ging. Immerhin hatte sie damit aufgehört, ständig über Elijah zu schimpfen. Denn auch wenn sie recht hatte, dass er sich abscheulich verhalten hatte, war da die Stimme in mir, die eine Erklärung finden wollte. Die verstehen wollte, warum er das getan hatte, nicht einmal vierundzwanzig Stunden, nachdem er vor meiner Tür aufgetaucht war, um mir zu sagen, dass er bleiben würde. Es passte nicht zu ihm, nichts davon passte zu ihm – oder zusammen. Allerdings würde ich mit Sicherheit bald den Verstand verlieren, wenn ich nicht aufhörte, mir das Hirn deswegen zu zermartern.
Ich schickte Rhoda eine kurze Nachricht, dass ich eine Tour gehabt hatte und nun auf dem Weg zu meinem Treffen war. Dann verließ ich den Chat mit ihr. Die andere Nachricht stammte von meinem Vater, der mich daran erinnerte, dass wir uns morgen zum Abendessen bei ihm zu Hause trafen. Darauf hätte ich mich vielleicht gefreut, wäre da nicht der Umstand gewesen, dass meine Halbschwester Rosalie wieder zurück in New York war – und Begegnungen mit ihr jeden Spießrutenlauf wie einen Ausflug nach Disneyland aussehen ließen. Sie war immer noch biestig ohne Ende, glaubte daran, dass ich hier war, um ihr etwas wegzunehmen, und hatte grundsätzlich miese Laune. Immerhin brachte Alyssa ihren neuen Freund mit, das würde die Stimmung hoffentlich entschärfen.
Auch auf diese Nachricht antwortete ich und lächelte, als ich sah, dass mein Vater sie sofort las und mir den einzigen Emoji schickte, den er zu kennen schien – den hochgereckten Daumen. Was das Verhältnis zu ihm anging, konnte ich wenigstens einen Erfolg verbuchen. Am Anfang hatte es noch so ausgesehen, als würden wir nicht miteinander warm werden, aber nachdem er da gewesen war, als in meiner WG eingebrochen wurde, war es immer besser geworden. Nach wie vor gab es Momente, in denen er zu vergessen schien, dass ich erwachsen war und meine eigenen Entscheidungen traf, aber sie wurden seltener. Außerdem konnte ich mich über seine Fürsorge nicht beschweren, schließlich wohnte ich seit dem Einbruch in einer seiner Wohnungen. Und ich liebte dieses verdammte Apartment so sehr, dass ich bisher nur halbherzig nach einer neuen Bleibe gesucht hatte.
Das Gramercy Kitchen an der 3rd Avenue war gut besucht, als ich die Tür aufstieß und eintrat. Ich war nicht das erste Mal hier, aber jedes Mal nahm mich die gemütliche, etwas altmodische Atmosphäre mit dem dunklen Mobiliar und den vertäfelten Wänden aufs Neue für sich ein. Ich musste ein bisschen suchen, bis ich in dem vollen Restaurant die Person fand, mit der ich verabredet war. Er saß an einem Ecktisch, ein Buch vor sich, und bemerkte mich nicht, bis ich bei ihm war.
»Hey, Fremder.«
»Hey.« Alec sah auf und lächelte auf diese Weise, die sofort den Raum erhellte. Dann erhob er sich und begrüßte mich mit einer Umarmung. »Schön, dich zu sehen, Fel. Entschuldige, dass ich nicht Ausschau nach dir gehalten habe, das war unhöflich.«
»Nein, gar nicht, alles gut. Ich habe dich ja gefunden.« Ich erwiderte sein Lächeln, denn man konnte gar nicht anders, wenn man ihn ansah. Dann zog ich meinen Mantel aus und wickelte mir den Schal vom Hals, bevor ich mich setzte und ihn in meine Tasche stopfte. Es war ein ziemliches Ungetüm, das mir Alvaro gestrickt hatte, aber er hielt wunderbar warm.
Alecs Smartphone lag auf dem Tisch und meldete eine Nachricht, nachdem wir unsere Getränke bestellt hatten. Ich erkannte Hoffnung in seinen Augen, die direkt Frustration wich. Offenbar war es nicht das, was er erwartet hatte: eine Nachricht von Elijah. Das wusste ich, ohne mit ihm darüber reden zu müssen.
»Hast du etwas von ihm gehört?«, fragte ich, bevor ich mich daran hindern konnte.
Alec verzog das Gesicht. »Nein. Wenn man den sozialen Medien glauben darf, ist er noch in England, aber er antwortet auf keine meiner Nachrichten.« Man konnte ihm ansehen, wie sehr ihn das verletzte und gleichzeitig besorgte. Die beiden waren beste Freunde, und dass Elijah auf diese Art aus seinem Leben verschwunden war, musste wehtun. Erst recht Alec, der so sensibel war wie sonst kaum jemand, den ich kannte.
»Und du hast immer noch keine Ahnung, wieso …« Ich brach ab. Es war nicht das erste Mal, dass wir diese Unterhaltung führten, und sie hatte noch nie zu einem Ergebnis geführt.
»Wenn ich eine hätte, würde ich es dir sagen. Aber es ergibt einfach keinen Sinn, was er getan hat. Was er noch tut.« Alec machte eine Handbewegung in Richtung des Telefons und ich wusste, was er meinte: die Videos auf Matildas Account, in denen Elijah ab und zu auftauchte. In denen sie beide auf glücklich verliebtes Paar machten, das von den fünfzehn Millionen Followern der Prinzessin gefeiert wurde. Auch das ergab keinen Sinn. Elijah hasste Social Media, er besaß kein einziges Konto. Und nun ließ er sich regelmäßig mit Matilda filmen und stellte ihre Beziehung zur Schau?
Was ist passiert? Was, verdammt noch mal ist passiert?
Ich atmete ein und riss mich aus meinem Gedankenlabyrinth, in dem ich mich in den vergangenen Wochen viel zu oft verirrt hatte.
»Wie war deine Präsentation heute?«, wechselte ich das Thema. Alec musste für seine Masterarbeit in Industriedesign eine Produktstudie erstellen und hatte sie seinen Professoren vorab präsentieren dürfen, um eine letzte Rückmeldung zu erhalten, bevor es an das finale Design ging.
»Gut, glaube ich. Es gab positives Feedback und interessante Fragen.«
»Aber du bist nicht zufrieden.« Es war eine Feststellung. Alec und ich kannten uns mittlerweile gut genug, um zu wissen, wann er glücklich war und wann nicht. Was das betraf, war er für mich beinahe so leicht zu lesen wie umgekehrt.
Er lächelte. »Ist man jemals wirklich zufrieden? Ich glaube, Luft nach oben gibt es immer. Sie hatten ein paar Zweifel an der Ergonomie und ich fürchte, damit haben sie recht.« Sein Projekt drehte sich um die Entwicklung des Designs für einen elektrischen Rasierer und er hatte noch ein bisschen Zeit für die endgültige Abgabe, aber diese erste Runde war ein wichtiger Gradmesser für seine Note.
»Na, dann weißt du ja, was du ändern musst, oder?« Ich schenkte ihm ein zuversichtliches Lächeln.
»Ja, das stimmt.« Er hob die Schultern und nahm die Speisekarte in die Hand.
Ich spürte, dass da noch etwas anderes war.
»Alles okay mit deiner Familie?« Es war ein Schuss ins Blaue, aber oft traf er zu. Wenn sich Alec keine Gedanken um Elijah oder sein Studium machte, dann meist um seine Mum und seine Geschwister in England.
Sein Gesicht verfinsterte sich. »Ja, schon, irgendwie. Aber die Zwillinge kommen im Internat nicht klar und meine Mutter ist auf den Malediven und will davon nichts hören. Mit Dad herrscht immer noch Funkstille, aber sind wir mal ehrlich, ihn würde das noch weniger interessieren.« Alecs fünfzehnjährige Geschwister Aaron und Abigail waren von den Eltern für die letzten drei Schuljahre nach Cornwall geschickt worden, aber offenbar fühlten sie sich dort nicht wohl. Oder vielmehr kamen sie jetzt in die Pubertät und rebellierten gegen den Vater, angeblich nach Alecs Vorbild, der sowieso immer an allem Schuld zu sein schien.
»Gibt es denn keine Schule in London für sie?«, fragte ich.
»Natürlich gibt es die, aber die Tradition will, dass sie aufs Internat gehen. Und meine Mum hält nicht dagegen, das tut sie nie. Ich überlege, ob ich das Schweigen breche und mit Dad rede. Allerdings könnte ich dann auch den irren Typ im Bryant Park fragen, der allein an einem der Schachbretter sitzt und immer nur ›Betrug!‹ brüllt, das kommt ungefähr auf dasselbe raus.« Er seufzte, aber bevor ich etwas sagen konnte, schüttelte er den Kopf. Es galt nicht mir, eher sich selbst. »Genug davon, ich will lieber hören, wie deine Tour war.«
»Sicher?« Zweifelnd schaute ich ihn an.
»Ja, sicher. Alles, was nicht mit dem Namen Wentworth zu tun hat, ist ein gutes Thema. Und außerdem weiß ich doch, dass du immer ein bisschen aufgeregt bist, obwohl du das nicht mehr sein müsstest.« Er lächelte wieder.
»Die Tour war gut.« Ich unterbrach mich kurz, weil die Getränke gebracht wurden. »Die Leute waren super interessiert und entspannt. Sie kamen allerdings auch von der Westküste.«
Alec lachte und ein paar Mädchen in der Nähe drehten sich zu ihm um. Ich konnte es verstehen. Er sah einfach verboten gut aus und war dazu noch unglaublich nett und charmant auf eine zurückhaltende, angenehme Weise. Mit ihm Zeit zu verbringen machte nicht nur Spaß, es war auch Balsam für die Seele. Kein Wunder, dass sich das Interesse auf ihn richtete, sobald er irgendwo auftauchte.
Wie es dazu gekommen war, dass wir hier saßen, war schnell erklärt. Kaum eine Woche nach dem Video von Elijah und Matilda hatte Alec sich bei mir gemeldet. Keine Ahnung, woher er meine Nummer gehabt hatte, ich hatte ihn nie danach gefragt. Alec hatte sich erkundigt, wie es mir ging, und wir hatten eine Weile Nachrichten hin- und hergeschrieben. Nach ein paar Wochen war daraus ein Kaffeedate geworden und seitdem trafen wir uns regelmäßig. Die anderen Eastie Boys, Abraham Yates und Ezra Bishop, hatte ich seit Elijahs Verschwinden nicht mehr gesehen. Ich hielt mich fern von den Orten, an denen sie normalerweise zu finden waren.
Solange Alec und ich nicht über Elijah sprachen, waren unsere Treffen wirklich schön. Vielleicht wären wir längst richtig miteinander ausgegangen, wenn sein bester Freund nicht gewesen wäre. Wenn Elijah und ich uns nicht begegnet wären und ich mich niemals in ihn verliebt hätte. Denn sosehr ich es auch wollte, diese Gefühle waren nicht verschwunden. Erschüttert ja, getrübt, vielleicht verdrängt, aber nicht verschwunden. In meinem Herzen war kein Platz für jemand anderen und ich hatte den Verdacht, dass sich das auch so lange nicht ändern würde, bis ich endlich wusste, warum Elijah sich von mir getrennt hatte.
»Ich glaube, ich nehme den Gramercy Wrap, der ist einfach ungeschlagen.« Alec legte die Speisekarte weg und griff sich in die blonden Haare, eine einfache Geste, aber mein Blick heftete sich auf seine Hand, während ich die Bewegung verfolgte. Mein Magen zog sich zusammen, für einen Moment schmerzte alles in mir so sehr, dass mein Atem ins Stocken geriet. Er musste es mir ansehen, denn der Ausdruck in seinen Augen wurde besorgt.
»Was hast du, Liebes?«
»Gar nichts.« Ich winkte ab. Dabei war das gelogen, aber ich konnte ihm unmöglich erklären, dass die Art, wie er sich die Haare aus der Stirn strich, die gleiche war wie bei ihm.
Die beiden waren so gut befreundet gewesen, dass es manchmal Kleinigkeiten gab, die mich an Elijah erinnerten – eine Bewegung, ein bestimmtes Wort oder auch nur das Hochziehen einer Augenbraue. Alec und er waren optisch wie Licht und Schatten und auch ihr Wesen unterschied sich voneinander, aber sie hatten genug Zeit miteinander verbracht, um sich ähnlich zu werden, und es zog mir jedes Mal kurz den Boden unter den Füßen weg, wenn ich es bemerkte.
»Sicher?« Alec legte seine Hand auf meine, eine fürsorgliche Berührung, aber sofort schaute ich mich nervös um, checkte ab, ob es jemand gesehen hatte. Wir waren bereits zweimal in den sozialen Medien und auf ein paar Gossip-Seiten gelandet und obwohl bisher niemand hatte herausfinden können, wie mein Name lautete, war es mir unangenehm.
»Ja, klar.« Ich löste meine Hand sanft aus seiner. Im Grunde interessierten sich die Leute vor allem für Alec, ich wollte trotzdem nicht als »Die Neue von Alexis Wentworth« betitelt werden. Alec war nicht gerade jemand, der jedes Wochenende mit einer anderen ins Bett ging – dafür schien eher Ezra zuständig zu sein –, aber wenn man den Gerüchten glauben durfte, verliebte er sich häufig und heftig. Da lag die Schlussfolgerung nahe, ich wäre die nächste Frau auf einer langen Liste an schnell aufflammenden und dann wieder beendeten Beziehungen. Allerdings war sie falsch. Wir waren Freunde, sonst nichts.
Und Elijah würde immer zwischen uns stehen.
Wir verlegten uns auf andere Themen als die, die uns Bauchschmerzen bereiteten, und die Schwere verzog sich. Nachdem wir gegessen hatten, brachte mich Alec nach Hause. Er fuhr selbst, weil er sich keinen Fahrer mehr leisten konnte, seit sein Vater ihm den Geldhahn zugedreht hatte. Mir war das nur recht. So wurde ich schließlich nicht daran erinnert, was in einem anderen Wagen mit Chauffeur passiert war. An Elijahs Blick, an seine Lippen auf meinen, seine Berührungen und die Worte, die mir jeden Tag durch den Kopf geisterten.
Es ging nie um ein Nicht genug, Felicity. Es ging immer um ein Zu sehr.
Ich war froh, dass sich Alec auf den Verkehr konzentrieren musste und nicht mitbekam, wie ich wieder einmal in die Vergangenheit abtauchte. Wie ich wieder einmal frühere Begegnungen durchspielte, um herauszufinden, was passiert war. Aber wie immer fand ich keine Erklärung.
Eine Viertelstunde später hielten wir vor dem Haus, in dem ich lebte.
»Soll ich dich noch reinbringen?«, fragte Alec, ganz Gentleman, der er war.
Ich schüttelte den Kopf. »Das ist lieb von dir, aber ich gehe besser allein. Hinterher machen sie Bilder von uns und wenn sie wissen, dass ich hier wohne, finden sie auch raus, wer ich bin.«
»Okay.« Alec warf einen prüfenden Blick aus dem Fenster, als wollte er checken, ob draußen irgendeine Gefahr auf mich lauerte. Das hatte er schon öfter getan, ich hatte jedoch nie verstanden, warum. Die Gegend, in der die Wohnung meines Vaters lag, war nicht gerade für ihre hohe Kriminalitätsrate bekannt. Eher im Gegenteil.
»Glaubst du, dass mich ein Axtmörder auf den zehn Metern zwischen deinem Wagen und meiner Tür erwischt?« Ich grinste. »Wenn ja, nehme ich das auf meine Kappe, ich verspreche es.«
»Sag so etwas nicht«, entgegnete Alec streng. »Er bringt mich um, wenn …« Er brach ab, sah ertappt aus. Offenbar hatte er gerade etwas ausgeplaudert, das er mir nie hatte verraten wollen.
»Was meinst du damit?« Ich sah ihn irritiert an. »Wer bringt dich um?«
»Niemand. Das ist nur so ein Spruch, du weißt schon.«
»Sag es mir, Alec«, hakte ich nach, mein Ton fordernder als er – oder ich selbst – es von mir gewohnt war. Aber ich ahnte, dass es hier um etwas ging, das mir bisher verborgen geblieben war. Und davon hatte es in den letzten Monaten viel zu viel gegeben. Außerdem wollte mein verräterisches Herz glauben, dass er in diesem Fall Elijah war.
»Ich darf es dir nicht sagen. Das habe ich versprochen.«
»Es geht um Elijah, richtig?« Ich schnappte lautlos nach Luft, als mir klar wurde, was das bedeuten konnte. »Weißt du etwa, warum er das alles getan hat, und lügst mich seit Monaten an, dass du keinen Schimmer hast?«
»Nein!« Alec schüttelte heftig den Kopf. »Ich habe keine Ahnung, wieso er mit Matilda … wieso er dir wehgetan hat. Das quält mich genauso wie dich, glaub mir.« Dann atmete er ein. »Aber er hat mich gebeten, ein Auge auf dich zu haben, kurz bevor er aus der Stadt verschwunden ist. Er meinte, ich soll ab und zu nach dir sehen, dir allerdings nichts davon verraten.«
Ich starrte ihn an. Was sollte das denn? Elijah verletzte mich, auf die übelste, schmerzhafteste Art, die mir allein bei der Erinnerung einen unangenehmen Druck im Magen bescherte, und dann bat er Alec, auf mich achtzugeben und diese Bitte auch noch für sich zu behalten? Das ergab keinen Sinn – meine Gefühle allerdings schon. Ich fühlte mich verraten, erneut. War in dieser verfluchten Stadt denn nicht ein ehrlicher Kerl zu finden?
»Verstehe.« Ich zog am Türgriff. »Einen schönen Abend, Alec.«
»Felicity, warte.« Mit einer sanften Berührung an meinem Arm bat er mich, ihm zuzuhören. Und bei diesem Blick konnte ich es ihm nicht abschlagen. »Ich versuche seit Wochen, ihn zu erreichen, um Antworten zu bekommen. Aber er hat dichtgemacht und gibt mir keine Chance dazu. Wenn ich dir gesagt hätte, worum er mich gebeten hat, wäre keinem von uns geholfen gewesen.«
Ich atmete tief ein. »Das heißt, unsere Treffen waren einfach nur ein Gefallen für einen Freund?« Es tat weh, mir das vorzustellen.
»Natürlich nicht«, antwortete er sanft. »Ich mag dich, ich verbringe gern Zeit mit dir. Wenn er nicht wäre, dann hätte ich dich wahrscheinlich längst um ein richtiges Date gebeten.«
Ich wich seinem Blick aus, weil ich keine Ahnung hatte, was ich dazu sagen sollte. Es war ja nicht so, dass ich ihm nicht glaubte, aber gerade war einfach zu viel Chaos in meinem Kopf.
»Ich … geh jetzt besser rein. Wir telefonieren, okay?«
Er nickte. »Es tut mir leid. Ich wollte dir nicht das Gefühl geben, dass man dich hintergeht. Dass ich dich hintergehe, denn das tue ich nicht.«
»Ist schon in Ordnung.« Diese Gefühle bezogen sich schließlich nicht in erster Linie auf ihn. Sondern auf Elijah.
Wir verabschiedeten uns und Alec fuhr erst an, als ich bereits im Haus war.
Ich grüßte den Portier und wollte zum Aufzug gehen, da hielt er mich auf.
»Miss Everhart, Ihr Vater hat etwas für Sie abgegeben.« Er trat vor den Tresen, in den Händen ein flaches Paket, das sicherlich eineinhalb Meter breit und einen Meter lang war. »Soll ich es nach oben bringen?«
Ich starrte einen Moment auf das Paket, dann schüttelte ich den Kopf. »Nein, das mache ich schon selbst. Danke, Emilio.«
Er trug es mir dennoch zum Fahrstuhl und ich fuhr allein hinauf. Noch während der Fahrt bog ich eine Ecke des Kartons zur Seite, um einen Blick auf das erhaschen zu können, was sich darin verbarg, aber ich ertastete nur Luftpolsterfolie. Also musste ich warten, bis ich in meiner Wohnung war und eine Schere geholt hatte, um die Plastikbänder zu lösen und die Pappe aufzuklappen.
Unter der Folie kam ein Bild zum Vorschein. Ein ganz bestimmtes Bild.
Mir stockte der Atem. Dann griff ich zum Telefon.
»Das ist nicht dein Ernst«, sagte ich ohne Begrüßung und hörte meinen Vater am anderen Ende leise lachen.
»Ich scherze nicht, wenn es um Kunst geht, Felicity.« Im Hintergrund war gedämpfte Musik zu hören, ebenso wie Stimmengewirr. Wenn ich mich richtig erinnerte, war er heute Abend bei der Eröffnungsveranstaltung für ein neues Bürogebäude in Brooklyn. Er hatte mir bei unserem letzten Essen davon erzählt.
»Du kannst mir dieses Bild nicht schenken.« Es kostete mindestens dreitausend Dollar, vielleicht sogar mehr. Ich hatte neulich erwähnt, dass ich ein Fan von Ryan Porter war, einem aufstrebenden Street-Art-Künstler, der eine kleine Kollektion an Leinwandbildern verkaufte, die sicher sehr bald vergriffen sein würde. Ich hatte meinen Vater dazu bringen wollen, eines der Werke für sich selbst zu kaufen. Nicht für mich.
»Aber genau das habe ich getan«, gab er ungerührt zurück. »Sieh es als Einstieg in die Welt der Kunstsammler an.«
»Dad, das –« Ich wollte mit mehr Nachdruck protestieren, aber da sprach ihn jemand an und er hielt kurz die Hand über das Mikro, bevor er wieder zu hören war.
»Ich muss auflegen, Kleines, hier wollen ein paar Leute mit mir sprechen. Ich hoffe, du freust dich über das Bild.«
»Das tue ich«, versicherte ich ihm und nahm mir vor, beim nächsten Treffen mit ihm darüber zu reden. Vielleicht konnten wir vereinbaren, dass das Bild ihm gehörte, aber ich es bei mir aufbewahrte. Damit wäre mir wohler gewesen. Er hatte mir zwar schon öfter etwas geschenkt und akzeptierte auch keine Miete für die Wohnung, obwohl ich ihm das hundertmal angeboten hatte. Aber ein solch wertvolles Bild, das ging einfach nicht.
»Sehr schön. Wir sehen uns morgen. Alyssa will kochen und mir ihren … wie heißt er noch?«
»Wade. Er heißt Wade.« Was mein Vater wusste, aber er wollte es sich wohl einfach nicht merken.
»Richtig, Wade. Den will sie mir vorstellen. Wenn du da bist, wird es bestimmt weniger verkrampft. Die Freunde meiner Töchter haben grundsätzlich Angst vor mir. Ich habe keine Ahnung, wieso.«
Ich schon, schließlich konnte er ziemlich einschüchternd sein – nicht nur für potenzielle Partner von Alyssa, Rosalie oder mir. Mir schoss die Frage durch den Kopf, wie es wohl gewesen wäre, Elijah meinem Vater vorzustellen. Er hätte sich von Dad nicht einschüchtern lassen, das war einfach nicht seine Art. Stattdessen hätte er ihn vermutlich mit seinem Scharfsinn und seiner Fähigkeit, Menschen binnen Sekunden zu durchschauen, beeindruckt.
Wieder zog dieser Schmerz durch meinen Körper. Sinnlos, darüber nachzudenken, Felicity. Das wird nie passieren.
»Ich werde da sein«, sagte ich und hoffte, die Pause war nicht zu lang gewesen.
»Wunderbar. Ich freue mich darauf.«
Ich legte auf und sah wieder auf das Bild, dachte an meinen Vater und wie er es trotz seiner etwas ruppigen Art schaffte, mir ein Gefühl von Geborgenheit zu geben. Ich seufzte. Wenigstens ein Mann in New York, der ehrlich zu mir war.
3
Elijah
Windsbury war selbst für britische Maßstäbe ein sehr idyllischer Ort und das sicher nicht nur, weil es gerade für ein paar Stunden aufgehört hatte, zu regnen. Auf dem Weg in die Stadt war ich an einem alten Herrenhaus vorbeigekommen, das in jedem Jane-Austen-Film hätte mitspielen können, und in der Innenstadt reihte sich ein Backsteingebäude an das nächste. Wäre der Grund, aus dem ich hier war, nicht so ernst gewesen – und wichtig –, hätte ich vielleicht ein paar Tage verlängert. Aber so musste ich die Atmosphäre im Vorbeigehen in mich aufnehmen, während in meinem Bauch die Erwartung brodelte, endlich Baker zu finden. Meine Waffe trug ich unter dem Mantel und Pullover in einem Gürtelholster versteckt, sodass sie niemand sehen konnte. Ich wollte ihn nicht erschießen, aber Angst machen auf jeden Fall. Ob das bei ihm helfen würde, wusste ich nicht. Schließlich war er Gewalt gewohnt, das hatte er bei meiner Entführung sehr deutlich bewiesen.
The Fox Den, eines der vielen Bed & Breakfasts der Stadt, lag in einer Gasse, die vor allem von kleinen Geschäften gesäumt war. Es klemmte zwischen einem Teeladen und einem Blumengeschäft, hatte dunkelgrüne Fensterläden und eine ebenso gestrichene Bank vor der Tür. Mein Herz klopfte etwas zu schnell, vor Anspannung und grimmiger Hoffnung. Würde ich hier endlich fündig werden? Würde ich gleich dem Mann gegenüberstehen, der mir verraten konnte, wer für meine Entführung verantwortlich war?
Ich wollte die Tür aufschieben, aber sie war verschlossen. Verwundert sah ich auf die Öffnungszeiten. Check-in: 16–18 Uhr. War das deren Ernst? Ich war mal einen Sommer mit Jess durch Europa gereist, da hatten wir jedoch in hochpreisigen Hotels übernachtet, die genau wie in New York eine rund um die Uhr geöffnete Rezeption hatten. In England war das anders, aber selbst für hiesige Gefilde war es eine sehr knappe Zeitspanne. Wie sollte ich Baker nun finden? Wenn er ein Zimmer hier hatte, besaß er sicherlich einen Schlüssel für die Tür, solange ich allerdings nicht reinkam, half mir das nicht weiter. Ich würde wohl warten müssen, bis jemand auftauchte, um mir Auskunft zu geben. Am besten in der Nähe, damit ich mitbekam, falls Baker das Haus verließ oder betrat.
Wenn er überhaupt noch hier ist, sagte die zweifelnde Stimme in meinem Kopf. Ich antwortete ihr nicht. Schließlich hatte ich keine andere Spur.
Aufmerksam schaute ich mich um, ob es einen Ort gab, wo ich warten konnte, und wurde schnell fündig. Auf der gegenüberliegenden Seite der Gasse befand sich ein Laden namens Immernachtstraum – ein Antiquariat mit Café, dem Schild nach zu urteilen. Ich zögerte nur kurz, dann ging ich hinüber und zog die Tür auf. Eine leise, melodische Klingel ertönte und es war, als hätte ich eine Parallelwelt betreten. Regale aus dunklem Holz bedeckten sämtliche Wände, darin Unmengen an mit Leder eingebundenen Büchern. In einem zweiten Raum befand sich eine Theke mit Kuchen und im Laden verteilt standen kleine Tische mit Sesseln. Es war ziemlich gemütlich.
Ein paar Kunden stöberten bei den Büchern, aber viel war nicht los. An einem Tischchen neben dem Regal für Krimis saß, vor sich einen Becher Kaffee und ein Stück Kuchen, eine junge Frau, die tief in eine Ausgabe von Tana Frenchs »The Likeness« versunken war. Als ich an ihr vorbeiging, schaute sie kurz auf und lächelte, widmete sich dann aber wieder ihrer Lektüre.
Ich bahnte mir meinen Weg weiter in den Laden hinein, um jemanden zu finden, der hier arbeitete. Hinter dem Tresen stand entgegen meiner Erwartung kein alter Mann in Strickjacke und mit weißen Haaren, sondern ein junger Typ, vielleicht Ende zwanzig. Optisch hätte er eher ein Bruder von mir sein können als Jess – er war groß, hatte dunkle Haare und trug ein schwarzes Shirt. Vor sich hatte er etwas liegen, das ihn die Stirn runzeln ließ, wahrscheinlich eine Rechnung oder ein Lieferschein, der ihm Rätsel aufgab. Als ich näher kam, hob er jedoch den Kopf.
»Hi. Kann ich dir helfen?« Er zeigte ein Lächeln von der Sorte, die man kaum erkennen konnte, wenn man nicht selbst mit dem zweifelhaften Talent ausgestattet war, seine Emotionen niemals vor sich herzutragen.
»Ja, vielleicht.« Ich deutete hinter mich. »Eigentlich wollte ich jemanden besuchen, der drüben im Fox Den ein Zimmer hat. Aber die Tür ist verschlossen. Du weißt nicht zufällig, wie man die Betreiber außerhalb der Check-in-Zeiten erreichen kann?«
»Ich habe die Nummer, aber das wird dir nicht viel bringen. Mrs Montgomery pflegt ihre kranke Mutter und kann da nicht weg, deswegen wirst du vor vier kein Glück haben.«
»Okay.« Ich nickte, um ihm für die Information zu danken. »Dann würde ich hier warten, bis sie kommt. Ihr verkauft auch Kaffee, oder?«
Er nickte ebenfalls. »Ja, setz dich einfach hin, wo du willst. Um die Uhrzeit ist nicht viel los, wie du siehst. Falls du was essen möchtest, wir haben Sandwiches und Kuchen.«
»Ich glaube, Kaffee reicht erst mal.« Zwar war ich ohne Frühstück aufgebrochen, meine Anspannung schnürte mir jedoch den Magen zu. Dazu dann noch Kaffee zu trinken, war sicher nicht die beste Idee, aber so blieb ich nach dieser beschissenen Nacht wenigstens wach.
Ich wählte einen Tisch am Fenster, von wo aus ich direkt auf die Eingangstür des B&B schauen konnte, und zog meinen Mantel aus, um ihn über die Stuhllehne zu hängen, damit man die Waffe nicht sah. Als ich mich gesetzt hatte, fiel mein Blick auf einen Flyer, der auf der abgewetzten Holzplatte lag. Vorne drauf war ein Briefumschlag abgedruckt und die Worte Buchclub und international.
»Ein Online-Buchclub?«, fragte ich den Typen vom Tresen, der in diesem Moment einen Becher mit Kaffee vor mir abstellte. Die Verwunderung war meiner Stimme deutlich anzuhören. Nicht, weil ich nichts vom Internet hielt. Es passte für mich nur nicht zu dem Laden, der mehr wirkte, als würde er sich in Zeiten zurückwünschen, in denen es noch keine Computer und Smartphones gegeben hatte.
»Nein, nicht online.« Er zeigte auf das Bild. »Per Post. Wir schreiben uns Briefe.«
»Briefe«, wiederholte ich. Vielleicht war ich wegen Baker gerade schwer von Begriff, schließlich nahm die Suche nach ihm den Großteil meiner Gedanken ein. Aber Briefe? Ernsthaft?
»Ja, genau. Wir lesen ein Buch – meist zu zweit oder zu dritt – und tauschen uns per Brief dazu aus. Es ist quasi der Gegenentwurf zu den sozialen Medien oder E-Mails.« Er lächelte schief. »Ich weiß, es klingt wie aus der Zeit gefallen. Aber wir sind mittlerweile über vierzig Leute und es macht Spaß.«
So verrückt das wirkte, war ich überzeugt, dass er recht hatte. Früher, wenn ich im Sommer bei meinen Großeltern auf Martha’s Vineyard gewesen war, hatte ich Jess und Adam manchmal Briefe geschrieben und sie hatten sogar geantwortet. Es hatte etwas Entschleunigendes gehabt, auf diese Art zu kommunizieren.
»Und welches Buch besprecht ihr momentan?« Keine Ahnung, wieso ich das fragte. Als hätte ich gerade den Kopf für so etwas.
»Oh, das entscheiden die jeweiligen Partner selbst. Ich wollte mich eigentlich mal mit ›The Heart is a lonely Hunter‹ befassen, aber keiner aus der Gruppe hat Lust drauf.« Er hob bedauernd die Schultern.
»Echt nicht? Mein Grandpa hat mir vor Ewigkeiten eine Erstausgabe geschenkt und ich will es seitdem lesen, aber bisher hatte ich nie Zeit dafür.« In den letzten Wochen erst recht nicht. Ich hatte bewusst nicht darüber nachgedacht, was passieren würde, nachdem ich meine Mission beendet hatte. Am Anfang war das mein Motor gewesen, dieses Danach, das ein Leben in Freiheit versprach. Aber dann war es immer mehr hinter dem großen Berg an Recherchen, Wut und Rückschlägen verschwunden und ich hatte nicht mehr nachgesehen, ob es überhaupt noch da war.
»Na, falls du wieder Zeit haben solltest, melde dich. Ich bin übrigens Eden.« Er nickte mir zu.
»Elijah. Und danke, das mache ich.« Diesmal war ich es, der dieses kaum erkennbare Lächeln zeigte. Wir schüttelten einander nicht die Hand, denn Eden wirkte nicht wie jemand, der so etwas gern machte. Stattdessen schob ich den Flyer in die Manteltasche und Eden ließ mich allein.