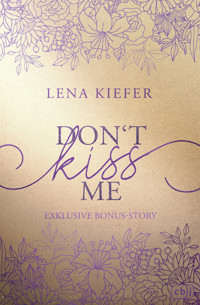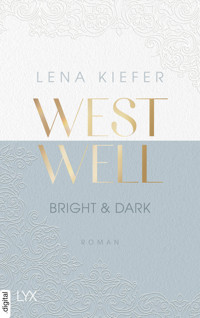9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Coldhart
- Sprache: Deutsch
NACH DER PLATZ-1-SPIEGEL-BESTSELLER-REIHEWESTWELL...
... DIE NEUE GROSSE TRILOGIE VON ERFOLGSAUTORIN LENA KIEFER
Elijah Coldwell hat sein Leben unter Kontrolle: Studium, Firma, Sport, alles ist strengstens durchorganisiert. Die Ängste, die ihn seit einer Entführung in der Kindheit quälen, hat er auf diese Weise im Griff. Nur sich zu verlieben, kommt für ihn nicht infrage, zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch dann trifft er auf Felicity Everhart, die ihn mehr fasziniert als irgendjemand zuvor. Eigentlich hat Felicity gerade andere Sorgen, bemüht sie sich doch vergebens darum, endlich ihrem Vater näherzukommen, von dem sie kaum etwas weiß. Aber das, was zwischen ihnen ist, können weder Elijah noch Felicity lange ignorieren - nicht ahnend, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, hat er keine Ahnung, dass einer der Namen auf seiner Liste ausgerechnet der von Felicitys Vater ist ...
»Bewegend, besonders und unglaublich bedeutsam: Elijahs und Felicitys Geschichte balanciert zwischen dem Wunsch, zu schützen, und dem, einfach lieben zu dürfen. Wirklich niemand verwebt Spannung und Sehnsucht so intensiv wie Lena.« MERIT NIEMEITZ
DieCOLDHART-Reihe:
1. Coldhart - Strong & Weak
2. Coldhart - Deep & Shallow (28.05.2024)
3. Coldhart - Right & Wrong (24.09.2024)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Motto
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lena Kiefer bei LYX
Impressum
LENA KIEFER
COLDHART
STRONG & WEAK
Roman
Zu diesem Buch
Dreizehn Jahre ist es her, dass Elijah Coldwell entführt, tagelang in einem dunklen Keller festgehalten und misshandelt wurde. Nach wie vor verfolgt ihn die traumatische Zeit in seinen Albträumen, aber immerhin hat er die Panikattacken, die ihn in seiner Jugend quälten, im Griff. Das verdankt er nicht zuletzt einer eisernen Regel: Behalte immer die Kontrolle. Sich zu verlieben, kommt daher für ihn nicht infrage, zu groß ist das Risiko, noch einmal so verwundbar zu sein wie damals. Doch als er auf Felicity Everhart trifft, bringt diese seine Prinzipien augenblicklich ins Wanken. Felicity ist gerade erst von L. A. nach New York gezogen und hat eigentlich ganz eigene Sorgen: Nicht nur fällt ihr der Start in der neuen Stadt schwerer als gedacht, sie versucht auch ihren Vater näher kennenzulernen, der zwar ihr Traumstudium an der Kunsthochschule finanziert, von dem sie sonst jedoch kaum etwas weiß. Doch das, was zwischen ihnen ist, können weder Elijah noch Felicity lange ignorieren – nicht ahnend, dass ihre Liebe unter denkbar schlechten Vorzeichen steht. Denn als Elijah neue Hinweise zu seinen Kidnappern erhält, hat er keine Ahnung, dass einer der Namen auf seiner Liste ausgerechnet der von Felicitys Vater ist …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die triggern können.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Wir wünschen uns für euch alle
das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Lena und euer LYX-Verlag
Für Merit,
E-Team forever.
Playlist
Coldhart Theme – technokrates
Welcome to New York (Taylor’s Version) – Taylor Swift
Control – Zoe Wees
West Coast – OneRepublic
Watch Me Rise – Mikky Ekko
Panic Room – Acoustic – Au/Ra
Fight For Your Right – Beastie Boys
Someone to Love – Joel Adams
World Gone Mad – The Phantoms
Here – Tom Grennan
Let it Be Me – Nina Nesbitt, Justin Jesso
Ruin – Moncrieff
Here With Me – Elina
Nur kurz glücklich – Max Giesinger, Madeline Juno
Moments to Memories – Adeline Hill
Wilder – Ryan McMullan
Woke Up in Love – Kygo, Gryffin, Calum Scott
Gold – Acoustic Version – Loi
Homeward – Dermot Kennedy
If Not For You – Måneskin
»Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be a liar;
But never doubt I love.«
William Shakespeare, »Hamlet«
Prolog
Harrison Grant sah sich zu allen Seiten um, bevor er die schmutzige Metalltür aufschob und hindurchtrat. Als sie sich hinter ihm schloss, sperrte sie das natürliche Licht komplett aus. Nur eine schwache Glühbirne an der Decke beleuchtete den Weg Richtung Kellertreppe. Es roch nach Schimmel, die Feuchtigkeit kroch ihm förmlich in den teuren Stoff des Mantels und den Maßanzug darunter, aber er verzog nicht einmal das Gesicht. Das hier war kein Hotel. Es war ein Gefängnis. Und da am Eingang ein Hinweis hing, dass dieses Gebäude einsturzgefährdet war, wagte sich niemand hinein.
Die Treppenstufen knarrten wenig vertrauenerweckend, als Grant in das Kellergeschoss hinabstieg. Der modrige Geruch verstärkte sich und wurde durch den von fettigem Essen ergänzt. An einem dreckigen Plastiktisch saßen auf Klappstühlen drei Typen, vor sich die Schachteln eines Take-aways. Sie schauten hoch, als er herantrat.
»Wie sieht es aus?«, fragte er ohne Begrüßung.
»Keine Veränderung.« Der Dickste, dessen Hintern kaum auf seinen Stuhl passte, hob die Schultern und stocherte mit den Stäbchen in der Packung. »Er redet nicht.«
Grant holte aus und schlug ihm das Essen aus der Hand. Es flog durch den Raum und verteilte sich auf dem Boden. »Dann bringt ihn zum Reden, verdammt«, verlangte er gefährlich leise. »Ich bezahle euch nicht dafür, dass ihr hier rumsitzt und ungesunden Scheiß in euch reinstopft. Wir müssen wissen, was er gesehen und wem er davon erzählt hat.« Sein Blick zuckte zu dem dunklen Gang, der zu einer Tür führte, die von hier aus nicht zu sehen war. Aber er wusste, was sich dahinter befand – oder eher, wer. Ein Zeuge, der alles ruinieren konnte. Doch das würde er auf keinen Fall zulassen.
»Wir haben wirklich alles versucht, Boss«, sagte der Dünne mit dem beunruhigenden Funkeln in den Augen. Seine Finger glitten zu einem Sturmfeuerzeug auf dem Tisch und strichen darüber, als wäre es seine Geliebte. »Er ist verflucht zäh, der kleine Bursche. Ich habe ihm wehgetan, mehr als einmal, aber er bleibt dabei, dass er nichts gesehen und niemandem was erzählt hat.«
Der glatzköpfige Dritte sah auf. »Was, wenn das stimmt?«
»Das wäre unser Glück.« Grant nickte grimmig. Denn dann bestand keine Gefahr. Wenn der Kleine den Mord an dieser lästigen Frau nicht beobachtet hatte – oder zwar beobachtet, aber niemandem was darüber gesagt hatte –, konnte man ihn diskret verschwinden lassen und keiner würde je davon erfahren.
Nur konnte er nicht sicher sein, dass es so war, nur weil die drei es vermuteten.
»Ich will ihn sehen«, sagte er in herrischem Ton.
Der Dünne sah auf. »Das ist keine gute Idee. Wenn er Sie erkennt …«
»Er hat doch die Augen verbunden, oder?«
»Natürlich. Wir nehmen ihm die Kapuze eigentlich nur ab, wenn er etwas zu essen bekommt.«
»Gut. Taschenlampe.« Grant streckte fordernd die Hand aus. Dann ging er den stockdunklen Flur entlang bis zu der massiven Tür am Ende. Sie führte zum ehemaligen Kohlenkeller des Hauses, ein Loch mit Gefälle unterhalb des Ganges, mit festgetretenem Lehmboden. Es war hier noch kälter und feuchter als im restlichen Gebäude.
In der Tür steckte ein Schlüssel, den Grant drehte, bevor er sie aufzog.
Der Lichtstrahl der Taschenlampe fiel auf eine kleine, zusammengekauerte Gestalt in der hintersten Ecke des Raumes. Der Junge hatte einen dunklen Sack über dem Kopf, daher konnte man sein Gesicht nicht erkennen, aber Grant wusste genau, wer sich darunter befand: Elijah Coldwell, der jüngste Sohn von Trish Coldwell, einer echten Größe in der Immobilienwelt von New York City. Pech für sie, dass ihr Kleiner offenbar keinen Respekt vor fremdem Eigentum hatte.
»Wer ist da?«, fragte der Junge mit leiser, bebender Stimme, die jedem mitfühlenden Menschen das Herz gebrochen hätte. Er hatte die Arme um seine Knie geschlungen und rückte in diesem Moment noch weiter an die schimmlige Wand, als könnte er dem entkommen, was er befürchtete. Sein Hemd hing in Fetzen an ihm herunter, die Brandwunden an seinem Oberkörper glänzten matt und er zitterte am ganzen Leib. Nachdem er keine Antwort bekam und vermutlich auf Rettung gehofft hatte, hörte man ein leises Wimmern, offenbar weinte er, vor Angst oder Schmerzen. Grant verdrängte den Gedanken an seine eigenen Töchter, die in einem ähnlichem Alter waren. Er hatte keine Wahl. Manchmal musste man unbequeme Entscheidungen treffen und das hier war eine solche.
Für einige Augenblicke betrachtete er den Jungen und überlegte, ob er wirklich so widerstandsfähig war, dass er log – oder ob er die Wahrheit sagte, wenn er behauptete, den Mord nicht gesehen zu haben. Aber er war verletzt und gebrochen, physisch und psychisch vollkommen am Ende. Es gab keinen Zweifel, dass er längst geredet hätte, wenn er etwas wusste.
Grant warf ihm einen letzten Blick zu, dann schloss er die Tür wieder so leise wie möglich und ging zurück zu seinen Handlangern im vorderen Teil des Kellers.
»Und?«, fragte der Dicke nur mäßig interessiert.
»Ihr habt recht, er muss die Wahrheit sagen. Er ist längst ein Wrack, kein Kind würde das so lange durchhalten.«
»Sag ich doch.« Der Dünne spielte wieder mit seinem Feuerzeug. Die Wunden des Jungen waren sicherlich sein Werk.
»Dann bleibt nur noch eins zu tun: Beseitigt ihn.« Grant schaute die drei an. »Aber unauffällig, irgendwo außerhalb der Stadt.«
»Sicher, Boss?« Der mit der Glatze wirkte beunruhigt. »Das ist der Kleine von Trish Coldwell. Sie sucht seit Tagen über alle Kanäle nach ihm, jeder Sender hat den Aufruf gebracht. Sie wird sicher nicht aufgeben, bis sie ihn gefunden hat, tot oder lebendig.«
»Umso besser, dann konzentriert sie sich weniger auf ihre Geschäfte. Sorgt einfach dafür, dass es eine endlose Suche wird.« Grant nahm ein blütenweißes Stofftaschentuch aus seiner Manteltasche und wischte sich die Hände ab. »Ist das ein Problem?« Eigentlich war es gnädig dem Jungen gegenüber, sein Leben zu beenden. Nach dem, was er hier erlebt hatte, würde er sowieso nicht mehr klarkommen.
Der Glatzköpfige und der Dicke wirkten, als würde es ihnen nicht behagen, ein Kind zu töten. Aber der Dünne nickte. »Nein, kein Problem. Sehen Sie es als erledigt an.«
»Sehr gut. Ich kontaktiere euch dann wegen der Bezahlung.«
Ohne ein weiteres Wort verließ Grant das verschimmelte Haus. Er spürte Erleichterung, als er auf die Straße hinaustrat und um die Ecke bog, um zu seinem Wagen zu gehen. Dieses Problem würde spätestens morgen gelöst sein, und dann stand seinem Einzug in die Oberliga von New York nichts mehr im Weg. Schon sehr bald würde endlich jeder in der Stadt seinen Namen kennen. Schon sehr bald würden die Reichen und Mächtigen ihn ernst nehmen, obwohl er keiner von denen war, die bereits mit einem goldenen Löffel im Mund geboren worden waren.
Und Elijah Coldwell würde ihn sicher nicht daran hindern.
1
Felicity
Manch einer gilt als mutig, nur weil er Angst hatte, davonzulaufen.
An diese Worte musste ich denken, als ich die Treppe der Subway-Station 7th Avenue hinaufstieg und auf das riesige Gebäude vor mir zuging. Ich wusste nicht mehr genau, von wem das Zitat war – vermutlich Emerson, schließlich war mein Englischlehrer besessen von ihm gewesen –, aber es passte. Ich fühlte mich nämlich kein bisschen mutig, weil ich hier war. Allerdings hatte ich zu viel Angst vor dem, was passieren würde, wenn ich jetzt wieder umdrehte.
Die Schiebetüren öffneten sich und gaben den Blick auf das Innere des Gebäudes frei. Die Eingangshalle war riesig, noch größer als erwartet, obwohl ich vor meinem Besuch hier alles über die Firma gelesen hatte. Ich atmete tief ein, packte den Gurt meiner Tasche fester und schritt auf den Tresen zu, an dem ein junger Mann saß, der gerade telefonierte. Er gab mir ein Zeichen, dass ich kurz warten sollte.
»Nein, Mr Grant ist zurzeit in einem Meeting. Ja, ich sage es ihm.«
Mr Grant. Ich spürte, wie mein Puls sich noch mal beschleunigte, als ich den Namen des Mannes hörte, wegen dem ich hier war. Irgendwie hatte ich nicht daran geglaubt, dass ich ihm eines Tages begegnen würde, aber da stand ich nun. Und es gab kein Zurück.
»Willkommen bei Grant Industries. Was kann ich für Sie tun?« Der Mann sah mich an. Er hatte eine wahnsinnig gepflegte Frisur, fiel mir auf. Kein Haar stand ab, nicht ein einziges. Überhaupt wirkten die Menschen in New York alle, als wäre ihr Äußeres eine echt ernste Angelegenheit, aber ganz anders als in Los Angeles. In meiner Heimatstadt legte man wenig Wert auf teure Kleidung oder Haarschnitte, dafür machte man eher einen Kult um das, was unter den Klamotten steckte. Hier in New York schien es extrem wichtig zu sein, wie teuer der Anzug war oder von welchem Label die Schuhe stammten. Ich war froh, dass ich für diesen Anlass Bluse und Blazer angezogen hatte. Das waren keine Sachen, die ich im Alltag trug, aber sie halfen dabei, mich seriös zu fühlen. Wie jemand, den man ernst nehmen konnte.
»Ich möchte gern zu Mr Grant«, sagte ich so selbstbewusst ich konnte, während mein Herz mir schmerzhaft gegen die Rippen schlug. Ich spürte Wut, begleitet von einer gewissen Traurigkeit. Die Mischung war vertraut – schließlich war ich als Kind traurig und als Teenager vor allem wütend gewesen, weil er nichts von mir wissen wollte.
Der Typ tippte etwas auf seinem Computer ein. »Wie ist Ihr Name, Miss?«
»Everhart. Felicity Everhart.« Es klang ein bisschen wie bei James Bond, aber der Witz darüber blieb mir im Hals stecken.
»Haben Sie einen Termin, Miss Everhart?« Nun schaute er auf eine Weise, die mir verriet, dass er die Antwort auf seine Frage bereits kannte. Schließlich gab es in seinem Kalender keinen Eintrag mit meinem Namen. Ich war unangemeldet hergekommen. Alles andere hätte nicht funktioniert.
»Nein«, antwortete ich ehrlich. »Aber ich hoffe, dass Mr Grant dennoch kurz Zeit für mich hat. Fünf Minuten reichen völlig. Oder vielleicht drei?«
»So, das hoffen Sie also. Und was bringt Sie zu dieser Annahme?«
Allmählich drängte sich mir das Gefühl auf, den größten Fehler aller Zeiten gemacht zu haben. Wieso war ich hergekommen? Warum genau hatte ich das für eine gute Idee gehalten? Ach ja, richtig. Weil ich an diesem einen Abend auf meiner Europareise am Strand von Praia dos Três Irmãos entschieden hatte, meine Heimatstadt zu verlassen und in New York studieren zu wollen. Und deswegen einen Flug gebucht hatte, um drei Wochen nach der Zusage in diesem Gebäude zu stehen.
»Also, ich …« Ich hatte jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder drehte ich mich um und verschwand, so schnell ich konnte, flog zurück nach L. A. und würde nie wieder ein Wort darüber verlieren. Oder ich zog es durch und spielte die Karte aus, die ich in der Hand hielt, seit ich in den Flieger gestiegen war. Die ich eigentlich schon mein ganzes Leben in der Hand hielt, wo sie mir in die Haut schnitt und mich daran erinnerte, dass mein Vater diese Bezeichnung nicht verdiente.
Der Assistent musterte mich, als hätte ich den Verstand verloren und wäre ein Fall für den Sicherheitsdienst. Viel Zeit hatte ich nicht mehr. Drei, zwei, eins, zählte ich runter.
»Ich bin seine Tochter.« Ohne Wackler, geradeheraus, als würde ich ein Pflaster mit einem Ruck abziehen. Ich hatte es noch nie laut gesagt und es fühlte sich komisch an. Aber auch befreiend.
»Seine Tochter«, echote der Mann.
»Ja, richtig.«
Als Antwort auf diese Eröffnung rechnete ich mit geweiteten Augen, einem schockierten Gesichtsausdruck, dem hektischen Griff nach dem Telefon, so was in der Art. Aber der Blick des Assistenten veränderte sich kaum, vielleicht wurde er nur noch einen Hauch arroganter.
»Mr Grant hat zwei Töchter und Sie sind keine davon, Miss Everhart.«
Nur mit Verzögerung wurde mir klar, dass er mir nicht glaubte. Er glaubt mir nicht? Das hatte auf der langen Liste der möglichen Szenarien, die ich mir ausgemalt hatte, relativ weit unten gestanden.
Der Typ lächelte schmal. »Aber ich muss Ihnen lassen, es ist eine originelle Idee.«
»Das ist keine Idee«, brachte ich heraus und spürte, wie ich rot wurde. »Es ist die Wahrheit. Harrison Grant ist mein Vater.« Wahrscheinlich wäre das der Moment gewesen, in dem ich den Beweis für meine Behauptung rausholte, zum Beispiel eine Kopie der Geburtsurkunde, in der Grants Name stand. Nur leider gab es so etwas nicht. Er hatte sich nie zu mir bekannt.
»Wenn dem so ist, dann verfügen Sie sicherlich über eine Möglichkeit, ihn auf anderem Wege zu kontaktieren.« Der Assistent wies zur Tür, durch die ich gekommen war. »Ich muss Sie nun bitten, zu gehen, Miss Everhart. Sofern das Ihr richtiger Name ist.«
»N…natürlich ist das mein Name!« Ich wollte mich weigern, aber es war lächerlich. Hier gab es garantiert Security und die würde mich innerhalb einer Minute rausschaffen, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich hatte keine Wahl, ich musste gehen. Mein Plan war gescheitert. Vielleicht war er von Anfang an dazu verurteilt gewesen. Ich hätte wissen müssen, dass mutige Kamikaze-Aktionen nicht mein Ding waren.
Als ich mich bereits umdrehte, öffnete sich jedoch einer der Aufzüge und drei Männer traten heraus – zwei jüngere und einer, bei dessen Anblick ich erstarrte.
Das ist er. Das ist mein Vater.
Ich war ihm noch nie begegnet, aber ich hatte natürlich die Bilder im Internet gesehen, im Grunde alle Bilder von ihm. Wenn man als Kind ständig die Frage »Wo ist denn dein Daddy?« zu hören bekam, dann entwickelte man eine gewisse Obsession. Deswegen erkannte ich ihn sofort: die graumelierten Haare, die markanten Gesichtszüge, den gepflegten Bart. Er war größer als erwartet, warum auch immer man eine bestimmte Vorstellung davon hatte, wie groß Menschen waren, die man nie persönlich getroffen hatte. Aber er war es. Eindeutig.
Er durchquerte die Lobby mit selbstbewussten, langen Schritten, die einem der erfolgreichsten Bauunternehmer New Yorks wohl zustanden. Dann schien ihm jedoch etwas einzufallen und er steuerte auf genau den Tresen zu, an dem ich immer noch wie eingefroren stand.
»Harold, können Sie meinen Termin mit den Leuten von Kazumo auf nächste Woche verschieben?«, sprach er den Assistenten an. »Meine Tochter braucht mich heute Abend.«
Als er den letzten Satz sagte, war es, als würde man mich mit eiskaltem Wasser übergießen. Meine Tochter braucht mich heute Abend. Damit war eindeutig nicht ich gemeint und plötzlich kamen mir all die Gelegenheiten in den Sinn, wo ich ihn gebraucht hätte. Die unzähligen Momente, vom ersten Fahrradfahren über Schulaufführungen bis zu Surfwettbewerben und Fernsehabenden. Meine Mom war toll und sie hatte alles getan, um seine Abwesenheit auszugleichen, ein Vater hatte mir dennoch gefehlt. Und warum? Weil er schon eine Familie gehabt hatte und ich nur das Resultat eines One-Night-Stands war. Er interessiert sich nicht für uns, Felicity. Aber wir kommen allein sowieso besser zurecht.
»Natürlich, Mr Grant. Ich werde das erledigen.« Der Assistent schien bereits eine Nummer zu wählen und forderte mich daher zum Glück nicht noch einmal zum Gehen auf.
»Danke.« Mein Vater wandte sich um und nickte mir dabei höflich zu, wie einer Fremden, die zufällig am Empfang seiner Firma stand. Weil ich im Grunde genau das war, aber irgendwie auch nicht. Ich war jedenfalls nicht in der Lage, etwas zu sagen, und rechnete damit, dass er durch die Tür verschwinden und ich ihn nie wiedersehen würde. Doch da hielt er inne, musterte mich plötzlich aufmerksamer. »Kennen wir uns?«, fragte er, mehr skeptisch als freundlich.
Mein Herz setzte einen Schlag aus, allerdings nicht auf die gute Art. Mehr auf eine, bei der ich sicher war, gleich tot umzufallen. Ich war nie ein Mensch gewesen, den man leicht einschüchterte, schließlich war ich in Venice Beach aufgewachsen und hatte gelernt, mich zu behaupten. Mein Vater schaffte es dennoch innerhalb von Sekunden.
»Nein«, brachte ich kaum hörbar heraus. Dann schwieg ich, im Gegensatz zu der Stimme in meinem Kopf. Bist du bescheuert? Wenn du jetzt nichts sagst, ist er weg! Ich gab mir einen Ruck. »Aber … vielleicht meine Mutter. Ihr Name ist Lucy Everhart.«
Sein Blick wurde eindringlicher, fast schon unangenehm sezierend, so als wäre er der Terminator und würde ein Programm ablaufen lassen, um Ähnlichkeiten zu der Frau zu finden, die er einmal gekannt hatte. Ich war zwar nicht das Ebenbild meiner Mutter, die vor meiner Geburt als Model gearbeitet hatte und auch jetzt noch eine dieser Frauen war, die alle Blicke auf sich zogen, wenn sie einen Raum betraten. Aber wir hatten die blonden Haare und grauen Augen gemeinsam und sahen uns für Grant bestimmt ähnlich – vor allem, wenn man bedachte, dass ich mit meinen knapp zwanzig Jahren im gleichen Alter war wie meine Mom, als er ihr begegnet war.
»Du bist Lucys Tochter?« Grant wurde bleich, als ihm aufzugehen schien, wessen Tochter ich damit noch war. Es dauerte nur eine Sekunde, dann hatte er sich wieder im Griff, aber mir war klar, dass er es wusste. Natürlich wusste er von mir. Schließlich hatte er meiner Mom Geld angeboten, damals, nach meiner Geburt, sie hatte jedoch abgelehnt und danach war der Kontakt von seiner Seite aus abgebrochen. Ob er wütend war, weil ich hier auftauchte? Schwer zu sagen – sein Gesicht war eine starre Maske. Und er wartete auf eine Antwort.
Ich nickte nur, da meine Kiefer zu fest aufeinandergepresst waren, um etwas zu sagen.
»Sir?«, mischte sich Harold ein, der von seinem Platz aufgestanden war. »Ich habe der jungen Dame bereits gesagt, dass sie hier nicht erwünscht ist. Bitte gehen Sie jetzt, Miss. Oder ich sehe mich gezwungen, das Sicherheitspersonal zu informieren.«
»Nicht nötig.« Mit einer einzigen knappen Handbewegung brachte Grant ihn dazu, sich zurückzuziehen. »Dann bist du … Felicity?«
Wieder nickte ich, verwundert darüber, dass er sich an meinen Namen erinnerte. Mom hatte ihn damals sicher erwähnt, aber sie hatten seit fast zwanzig Jahren nicht miteinander geredet. Vermutlich verfügte er über dieses spezielle Gedächtnis, das Geschäftsmänner haben mussten, um jederzeit zu wissen, mit wem sie es zu tun hatten.
»Großer Gott.« Er schüttelte den Kopf, fassungslos, sofern ein Mann wie er überhaupt die Fassung verlieren konnte. »Ich hätte nicht erwartet, dich jemals kennenzulernen.«
Das klang nicht so, als wäre er sauer, weil ich unangekündigt aufgetaucht war. Aber erfreut auch nicht unbedingt. Ich gab mir Mühe, die aufkommende Enttäuschung zurückzudrängen. Mein Ziel war nicht gewesen, seine Zuneigung zu gewinnen. Ich wollte nur einen Deal mit ihm machen.
»Was tust du denn hier?«, fragte er mich. »Ich dachte, du und deine Mutter leben in L. A.«
»Das stimmt. Aber ich bin hier, weil … Um ehrlich zu sein, wollte ich dich treffen.« Ich bemühte mich, meine Schultern zu lockern, um nicht so verkrampft zu wirken, wie ich war.
»Mich treffen?« Grant klang, als wäre das absurd. Langsam kam es mir auch so vor.
»Ja.« Hier im Foyer des Gebäudes mit meiner Forderung herauszurücken erschien mir falsch, irgendwie unwürdig, aber ich würde wohl keine andere Gelegenheit bekommen. »Man hat mir einen Studienplatz angeboten und –«
»Einen Studienplatz in New York?«, unterbrach er mich und ich hätte das unhöflich finden können, wenn ich nicht dankbar gewesen wäre. Schließlich war ich momentan nicht sonderlich eloquent. »Dann ziehst du hierher?«
»Nein, also, ja, vielleicht.« Richtige Sätze waren offenbar gerade nicht drin. »Es gibt da noch ein paar Hürden zu überwinden.«
»Welche Hürden sind das?« Er sah mich an, wurde jedoch abgelenkt, als einer der zwei Männer, die mit ihm aus dem Aufzug gestiegen waren, zu uns kamen und ihn an einen Termin erinnerten. Er gab kurze, knappe Anweisungen, die aus fremd klingenden Namen und irgendwelchen Abkürzungen bestanden. Der Typ nickte und entfernte sich Richtung Ausgang.
Grant schaute auf sein Smartphone, der Kalender war geöffnet. »Wie lange bist du in der Stadt? Wir könnten heute Abend zusammen essen.«
Essen? Ich antwortete erst nicht, weil ich überfordert war. Ich hatte vorher geübt, wie ich ihn sehr sachlich, aber mit Nachdruck darauf hinweisen wollte, dass er mir ein zinsloses Darlehen für meine Studiengebühren geben sollte. Schließlich hatte ich geglaubt, er wäre ein arroganter Snob, der mich als geheimen Makel in seiner Vita betrachtete – und sein bisheriges Verhalten hatte mich nicht vom Gegenteil überzeugt. Die Essenseinladung kam deswegen ziemlich überraschend. Allerdings hatte ich keine Möglichkeit, sie anzunehmen, selbst wenn ich gewollt hätte.
»Nein, tut mir leid«, brachte ich endlich heraus, »mein Rückflug geht schon um sieben.« Es war die billigste Variante gewesen, nur für etwa sechs Stunden in New York zu bleiben. Ich hatte gedacht, es würde reichen.
Grant runzelte die Stirn. »Okay. Ich habe jetzt einen wichtigen Termin in Brooklyn, den ich nicht verschieben kann. Würdest du mitfahren? Dann können wir unterwegs reden.«
Nur kurz durchzuckte mich der Gedanke, dass das vielleicht seine Art war, mich diskret loszuwerden, ohne dass seine Mitarbeiter etwas davon mitbekamen, aber ich hatte keine große Wahl. Ich war hergekommen, um mit ihm zu reden. Die Gelegenheit nun abzulehnen wäre dumm gewesen.
»Ja, klingt gut.« Ich nickte und zupfte an meinem Dreißig-Dollar-Blazer, weil ich mich neben meinem Vater in seinem Maßanzug fühlte, als hätte ich mir einen Kartoffelsack übergezogen.
»Schön. Dann komm, mein Wagen wartet bereits.«
Ich folgte ihm nach draußen, wo vor dem imposanten Eingang eine schwarze Limousine mit getönten Scheiben stand. Ein Mann in dunkler Uniform hielt die hintere Tür auf und Grant ließ mir den Vortritt. Ich drückte meine Tasche an mich und stieg ein, nahm auf der bequemen Rückbank Platz, die mit weichem Leder bezogen war. Meine Güte, in diesem Auto roch es sogar teuer.
Grant setzte sich mir gegenüber und öffnete den oberen Knopf seines Sakkos. Wir sahen uns einen Moment an, schweigend, während der Wagen anrollte. Ich versuchte, in seinem Gesicht etwas von mir zu erkennen, aber ich war viel zu befangen und nervös.
»Das ist für uns beide wohl eine spezielle Situation«, sagte mein Vater und zeigte das erste Lächeln, seit wir uns begegnet waren. Es war dezent, kaum sichtbar, aber es ließ mich aufatmen.
»Ja«, stieß ich aus. »Es tut mir leid, dass ich dich nicht vorgewarnt habe. Wahrscheinlich hätte ich anrufen sollen, aber ich hatte Sorge, dass du mich abwimmeln würdest.«
Verwundert schaute er mich an. »Abwimmeln? Das klingt, als gäbe es für diese Annahme einen Grund.« Eine kurze Pause, ein wachsamer Blick. »Du möchtest etwas von mir, richtig?«
Meine Hände schlossen sich fester um meine Tasche. Woher wusste er, dass ich hier war, um wegen des Darlehens mit ihm zu sprechen?
»Felicity, ich bin bereits mein halbes Leben Geschäftsmann. Ich erkenne, wenn jemand etwas will. Also raus damit.« Es klang bestimmt.
Ich atmete tief ein und beschloss, es noch einmal mit der Pflastertaktik zu versuchen. »Ich habe einen Studienplatz an der SVA hier in der Stadt angeboten bekommen, aber es gibt ein Problem mit den Gebühren.«
»SVA? Die School of Visual Arts? Dann möchtest du Kunst studieren?«
»Ja. Eigentlich wollte ich an ein staatliches College gehen, aber es gibt in New York einen neuen Studiengang für Urban Art, der von einem meiner großen Vorbilder geleitet wird und …« Ich brach ab. Für Grant spielte es sicher keine Rolle, warum ich mir mehr als alles andere wünschte, hier studieren zu können. Und ich wusste auch nicht, wie lange die Fahrt nach Brooklyn dauerte, deswegen war es besser, ich konzentrierte mich auf das Wesentliche. »Ich hatte mich für ein Stipendium beworben und wurde abgelehnt. Einen Studienkredit mit hohen Zinsen kann ich mir nicht leisten. Und –«
»Und nun bist du hier, um mich um dieses Geld zu bitten.« Grant sagte es neutral, ohne jede Emotion. Ich konnte auch an seinem Gesicht nicht ablesen, ob er mein Vorhaben unverschämt fand oder nicht. Mir war nicht wohl dabei, ihn danach zu fragen, denn ich hasste es, von anderen abhängig zu sein. Aber in diesem Fall war es die einzige Möglichkeit, meinen Traum nicht platzen zu sehen.
»Es wäre nur ein Darlehen, ich würde es zurückzahlen«, versuchte ich mich zu erklären. Diesen Plan hatte ich mit meinen Freunden entwickelt, ohne die ich nie mutig genug gewesen wäre, herzukommen. »Mir ist bewusst, dass du nie Kontakt zu mir haben wolltest. Und es geht mir auch nicht darum, an diesem Status quo etwas zu ändern, aber –«
»Moment«, unterbrach mich mein Vater. »Ich wollte keinen Kontakt zu dir? Hat deine Mutter das behauptet?«
Kurz war ich aus dem Tritt gebracht. »Ja«, sagte ich dann. »Sie meinte, du hättest deine Familie hier in New York und dass du kein Interesse an einem Baby hast, das aus einem Fehler entstanden ist.«
Grant atmete geräuschvoll aus und die neutrale Maske fiel von ihm ab. Ich erkannte Wut, Schock und noch mindestens drei weitere Emotionen, bevor er schließlich den Kopf schüttelte.
»Ich habe keine Ahnung, warum Lucy dir so etwas erzählt hat. Es stimmt, dass die Nacht mit ihr ein Fehler war, denn es war der Anfang vom Ende für meine Ehe. Aber das hat doch nichts mit dir zu tun.« Er beugte sich vor, nur ganz leicht. »Ich wollte Kontakt zu dir, Felicity. Deine Mutter war es, die das verhindert hat.«
»Das stimmt nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Du hast ihr doch sogar Geld angeboten, damit sie dich nie wieder belästigt.«
»Ich habe nicht …« Er unterbrach sich selbst, starrte mich an. »Ich habe ihr nie Geld geboten, damit sie mich nicht mehr kontaktiert. Ich habe ihr Geld geben wollen, damit sie Kleidung für dich kaufen kann, eine Erstausstattung fürs Kinderzimmer, solche Dinge. Und ich wollte sie monatlich unterstützen, weil ich wusste, dass sie keine Rücklagen hatte, so jung, wie sie war. Aber sie hat die Schecks einfach ungeöffnet zurückgehen lassen und irgendwann habe ich aufgegeben.«
Als er das sagte, passierte in mir so viel gleichzeitig, dass ich es gar nicht verarbeiten konnte. Der Teil von mir, der sich immer einen Vater gewünscht hatte, wollte losheulen. Der Teil, der mein Leben lang wütend auf Grant gewesen war, wollte nun sauer auf meine Mutter sein. Aber im Grunde war ich einfach nur geschockt. Hatte Mom mich tatsächlich mein ganzes Leben lang angelogen? Oder war ich gerade bereit, diesem Mann zu glauben, weil ich wollte, dass er die Wahrheit sagte?
»Ich …«, begann ich und schluckte. »Warum hätte sie das tun sollen?« Seit ich denken konnte, war Geld bei uns knapp gewesen. Mom stammte aus New York und war nach L. A. umgezogen, als sie mit mir schwanger gewesen war – und arbeitete, seit ich in den Kindergarten gekommen war, als Sozialarbeiterin. Damit verdiente man nicht die Welt und wir hatten immer rechnen müssen. So vieles wäre für uns einfacher gewesen, wenn wir ein bisschen Unterstützung bekommen hätten. Und sie hatte das abgelehnt?
»Das kann ich mir auch nicht erklären. Vielleicht war sie zu stolz. Vielleicht verbindet sie mit mir zu viele schmerzhafte Erinnerungen. Vielleicht wollte sie auch nicht, dass du mit meiner Familie konfrontiert wirst. Sie hat mir jeden Kontakt zu dir verboten, während ich mir immer gewünscht habe, dich ab und zu sehen zu dürfen.« Grant schaute mich an. »Aber nun bist du erwachsen und kannst selbst entscheiden. Und ich bin wirklich froh, dass du hergekommen bist.«
Ich wollte etwas antworten, aber ich brachte keinen Ton heraus. Mein gesamtes Weltbild war mit einem Mal auf den Kopf gestellt worden. Ich hatte keine Ahnung, was ich noch glauben sollte. Oder sagen.
Grant öffnete seine Aktentasche und zog eine Visitenkarte hervor. Darauf stand ein mir unbekannter Name unter dem Logo einer Bank. »Das ist der Ansprechpartner für meine privaten Finanzen. Ich werde ihm Bescheid geben, damit er sich um die Zahlung deiner Studiengebühren kümmert. Du kannst entscheiden, ob er das Geld direkt dorthin überweist oder erst einmal an dich. Außerdem werde ich dir einen monatlichen Betrag zur Verfügung stellen. Die Lebenshaltungskosten in New York sind hoch und es soll dir an nichts fehlen.«
Wow, okay, das geht jetzt wirklich sehr schnell.
»Halt, Moment, stopp«, bat ich ihn. Er hielt inne und sah mich an. »Es geht mir nur um die Studiengebühren. Du musst mein Leben hier nicht finanzieren, das schaffe ich schon. Und ich will das Geld nicht einfach so. Ich möchte es zurückzahlen.« Ich war mit dem Ziel hergekommen, ein zinsfreies Darlehen von meinem Vater zu erhalten, keine Geschenke. Und so krass alles war, was ich von ihm gehört hatte, wollte ich von dieser Entscheidung nicht abweichen.
»Das kommt überhaupt nicht infrage«, wehrte Grant ab. »Dieses Geld steht dir seit Jahren zu. Es ist das Mindeste, dass ich für deine Ausbildung bezahle, wenn ich dich schon bei nichts anderem unterstützen durfte.«
»Vielleicht, aber es fühlt sich falsch an, wenn ich es einfach annehme. So bin ich nicht aufgewachsen.«
Er überlegte und nickte schließlich leicht. »Gut, dann möchte ich dafür eine Gegenleistung: Ein Essen pro Woche, damit wir uns kennenlernen können. Du erzählst mir, wie dein Leben in den letzten zwanzig Jahren verlaufen ist, und ich verrate dir im Gegenzug alles über mich, was du wissen möchtest.«
»Okay.« Ich fühlte mich nicht hundertprozentig wohl mit der Abmachung, dazu war das alles zu erschütternd. Aber ich wollte dieses Studium antreten und es kam mir verrückt vor, die Chance abzulehnen, meinen Vater kennenzulernen. »Das klingt gut.«
»Schön. Dann haben wir einen Deal.« Er streckte die Hand aus und ich ergriff sie, selbstbewusster als ich mich fühlte.
Wahrscheinlich hätte ich überglücklich sein sollen. Ich konnte in New York studieren, ich konnte meinen Traum von einem Abschluss an der SVA verwirklichen, den Traum davon, irgendwann mit meiner Kunst meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Aber während ich meinem Vater in die Augen sah, beschlich mich das Gefühl, dass dieser Deal kein Geschenk war. Auch keine Chance.
Sondern ein Geschäft, dessen Preis ich noch nicht kannte.
2
Elijah
Ich liebte die Stille am frühen Morgen.
Nichts schenkte mir mehr Frieden als diese besondere Ruhe, bevor die Stadt, die niemals wirklich schlief, wieder richtig zum Leben erwachte. Es war keine völlige Stille, schließlich hörte ich meinen stoßweisen Atem, genau wie den Klang von Metall auf Metall, wenn ich die Gewichte zurück in die Halterung gleiten ließ. Aber das waren Geräusche, die ich kontrollierte. Ansonsten hörte ich nichts, keinen Lärm, keine anderen Leute, nicht einmal meine eigenen Gedanken. Diese eine Stunde Training am Morgen gehörte mir allein und für sechzig Minuten fühlte es sich an, als wäre ich der einzige Mensch auf der Welt. Und ich mochte das Gefühl nicht nur, ich brauchte es auch. Ich brauchte es zum Überleben.
Ich atmete tief ein und drückte die Stange mit den Gewichten von mir weg, bevor ich sie sinken ließ. Wieder und wieder, bis meine Arme brannten und nach einer Pause schrien. Ich ignorierte es, biss die Zähne aufeinander, machte noch einen Durchgang, dann noch einen. Erst als die große Uhr, die über der Tür hing, lautlos auf 6:00 sprang, erlaubte ich mir, aufzuhören. Ich ließ die Gewichte einrasten und schüttelte meine Arme aus, bevor ich aufstand. Es war eine gute Einheit gewesen, vor allem, wenn man bedachte, dass ich nicht allzu viel geschlafen hatte. Keine von den besseren Runden, aber durchaus akzeptabel.
Das Handtuch auf der Bank gegenüber war bereits ziemlich feucht, ich wischte mir dennoch damit über Gesicht und Nacken. Dann hängte ich es mir um die Schultern, verließ meinen Kraftraum und lief in Richtung Küche. Im Durchgang dazu lag ein dick gepolstertes Kissen und darauf ein schwarzer Labrador, der müde aufschaute, als ich neben ihm in die Hocke ging.
»Hey, mein Junge.« Ich strich Buddy, der bereits seit sechs Jahren an meiner Seite war, liebevoll über den Kopf. Er ließ prompt ein zufriedenes Schnaufen hören und drehte sich auf den Rücken, damit ich ihm den Bauch streicheln konnte. Ich lächelte und erfüllte ihm den Wunsch – auch wenn das bedeutete, dass ich mich später beeilen musste. Aber es lohnte sich, denn während ich Buddy kraulte und ihm erzählte, dass er der beste Hund der Welt war, konnte ich förmlich spüren, wie ich mich entspannte. Dann sah ich hoch zur Uhr in der Küche. Sie zeigte Viertel nach sechs.
»Ich muss dringend unter die Dusche«, beendete ich die Streicheleinheit und erhob mich. »Lass mich das schnell erledigen, dann gehen wir raus.« Buddy gähnte zur Antwort und legte den Kopf wieder auf das Kissen. Der Morgen war nie seine liebste Zeit gewesen, aber als er noch jung gewesen war, hatte er mich meistens auf meiner frühen Joggingtour begleitet. Jetzt war er jedoch schon acht Jahre alt und wir drehten eher eine gemütliche Runde am Morgen, bevor ich in die Uni oder Firma musste – dafür ging ich am Abend ohne ihn laufen. Sport vor dem Schlafen war eine gute Methode, um die Dämonen in Schach zu halten. Je mehr ich mich auspowerte, desto geringer war die Chance, nachts von meiner Vergangenheit geweckt zu werden.
Buddy hatte seine Augen längst wieder geschlossen, als ich die Treppe ins obere Stockwerk hinaufging. Auf dem Weg kam ich an einer Zeitschrift vorbei, die ich achtlos auf eine der Stufen gelegt hatte. Es war die letzte Ausgabe des Forbes Magazine zum Thema »30 under 30«. Die Headline unter dem Foto war mir bekannt, mein Blick blieb trotzdem daran hängen.
Elijah Coldwell – Die Zukunft von New York City?
Das Fragezeichen hatte meine Mutter schwer aufgeregt, mich weniger. Schließlich war man sich alles andere als einig, was meine Person betraf. Die einen nannten mich Hoffnungsträger, Wunderkind oder Ausnahmetalent. Die Gegenseite hielt mich für arrogant, selbstgerecht und überschätzt. Natürlich bestand letztere Gruppe zum Großteil aus alten Männern, die keine Lust hatten, sich von einem Zweiundzwanzigjährigen wie mir vorführen zu lassen. Trotzdem glaubte ich, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte lag. Deswegen war das Fragezeichen schon okay.
Ich schaltete das Licht im Badezimmer ein und sah durch die breite Fensterfront, wie der Central Park aus der Dunkelheit auftauchte. Kurz hielt ich inne und schaute auf die Stadt, wappnete mich für den bevorstehenden Tag. Denn ich wusste, sobald ich nach meinem Smartphone griff, das ich am Abend immer weglegte, war ich nicht mehr allein auf der Welt. Im Gegenteil, dann befand ich mich mitten in einem Strudel aus Erwartungen, Anforderungen und Entscheidungen. Vor ein paar Jahren hätte mich das gelähmt, heute nicht mehr. Es war zwar an vielen Tagen immer noch ein verfluchter Kampf. Aber mittlerweile hatte ich gelernt, wie man ihn gewann.
Ein letzter Atemzug, dann nahm ich das Telefon und aktivierte mit meinem Fingerabdruck das Display. Routiniert checkte ich erst meine Mails, dann meine Nachrichten. Die Assistentin meiner Mutter hatte mir die Tagesordnung für die heutige Vorstandssitzung gemailt. Ich überflog sie kurz, aber es war das, was ich erwartet hatte. Mein Vater schrieb mir, ob ich nächste Woche Zeit für ein Essen mit ihm hatte, wenn er aus Miami zu Besuch war. Ich musste leider verneinen, weil ich einen anderen Termin hatte. Außerdem war da eine weitere Nachricht, sie stammte von meinem Bruder.
Hey Kleiner, heute Abend Tough Rock?
Ich verzog das Gesicht. Nicht, weil Jess immer noch Kleiner zu mir sagte, obwohl ich längst erwachsen und mittlerweile genauso groß war wie er. Es lag auch nicht daran, dass ich keinen Bock auf Sparring mit ihm hatte, er war der beste Partner, den es dafür gab. Ich zögerte, weil ich ahnte, worauf dieses Treffen hinauslief, und nicht wusste, ob ich mir das geben wollte. Diese Woche würde auch ohne Zoff mit Jess anstrengend genug werden.
Statt zu antworten, legte ich das Telefon weg und schnappte mir ein frisches Handtuch. Wir hatten bereits halb sieben, ich musste mich beeilen, wenn ich noch mit Buddy rausgehen wollte. Aber ich war gerade auf dem Weg zur Dusche, da klingelte mein Handy. Kurz sah ich auf die Uhr, ob ich es mir erlauben konnte, den Anruf anzunehmen. Eigentlich nicht.
Ich tat es dennoch.
»Hi, Alec«, begrüßte ich die Person am anderen Ende.
»Morgen, Elijah. Es ist beschämend, dass du so früh wach bist.« Der britische Akzent meines Freundes ließ seine Worte noch ein bisschen missbilligender klingen. Er war gerade bei seiner Familie in London, wo es bereits nach elf war. Ansonsten hätten wir niemals um diese Uhrzeit telefoniert. »Du hast schon trainiert, oder? Bitte lass das. Gegen dich wirken wir anderen wie Couch-Potatoes.«
Ich grinste, da ich wusste, dass er nur deswegen mies gelaunt war, weil ihm seine Familie auf den Sack ging. Alec war normalerweise der Netteste von uns, geradezu unanständig höflich. England musste ihm echt zusetzen, wenn er so angepisst war.
»Du weißt, dass ich das nicht mache, um gut auszusehen«, antwortete ich milde belustigt.
»Ja, das behauptest du immer. Aber im Grunde stehst du drauf, wenn die Mädels Oh Gott, Elijah hauchen, sobald du dein Hemd ausziehst.«
Ich unterdrückte ein Lachen. »Klar, das mache ich ja auch ständig«, stimmte ich dann trocken zu. »Erst letzte Woche bei diesem Meeting mit der Finanzabteilung in der Firma. Die Resonanz war überwältigend.«
»Du weißt, was ich meine«, murrte mein Kumpel, mehr aus Prinzip.
»Nein, ich habe keine Ahnung. Ich mache Sport, weil es mir beim Denken hilft.« Und dabei, die Kontrolle zu behalten, fügte ich stumm hinzu. »Außerdem hindert dich niemand daran, gleichzuziehen, Alexis«, erinnerte ich ihn, stellte das Handy auf Lautsprecher und legte es auf die Ablage, um mein durchgeschwitztes Shirt auszuziehen. Höchstens noch zwei Minuten, dann musste ich Alec leider abwürgen.
»Kein normaler Mensch kann dein Pensum länger als eine Woche durchhalten, ohne zu sterben.« Alec schnaubte, aber ich hörte dem Laut an, dass er bereits bessere Laune hatte. »Wie viele Punkte stehen für heute auf deiner To-do-Liste?«
»Elf.« Meine Sportshorts wanderte ebenfalls in den Korb. »Und wenn ich die schaffen will, sollte ich jetzt dringend duschen.«
»Verstanden. Ich wollte dir sowieso nur sagen, dass ich nächsten Montag endlich zurück nach New York komme. Damit bleibt mir immerhin eine Woche, um vor dem Semesterstart London aus meinem Kopf zu kriegen. Ich hoffe sehr, du hilfst mir dabei.«
»Immer.« Ich verdrängte das Ziehen in meinem Magen, das sich bei dem Gedanken an einen vollen Club meldete. Wo wir hingingen, war es ungefährlich. Dafür würde ich sorgen. »Ich sage den Jungs Bescheid. Ezra hat eh genug von den Bahamas und Yates sollte morgen zurück sein.« Ich war der Einzige, der in diesem Sommer hiergeblieben war, und freute mich, die anderen wiederzusehen. Schon seit drei Jahren bildeten wir ein gut funktionierendes Quartett, obwohl wir wahnsinnig verschiedene Persönlichkeiten waren.
»Perfekt. Wir sehen uns, Mann. Mach bei nächster Gelegenheit ein paar Crunches für mich mit.«
»Sicher nicht. Bye, Alec.«
Ich legte auf und sah die Uhrzeit auf dem Display. 6:36. Eilig warf ich das Handtuch über die Glasabtrennung und zog die Tür auf. Spätestens um zehn vor sieben mussten Buddy und ich aus dem Haus. Das würde eng werden.
Ich ging meinen Tagesplan durch, während das heiße Wasser meinen Nacken und Rücken hinunterlief. Zuerst hatte ich die Vorstandssitzung, dann ein Abschlussseminar der Summer School an der Columbia, mittags Lunch mit einem der Investoren für das Museumsprojekt, am Nachmittag ein Treffen mit meinem Professor wegen der Abschlussarbeit und eine Besprechung für ein Gruppenprojekt, das im kommenden Semester anstand. Danach konnte ich kurz nach Hause, um mich umzuziehen, bevor mich meine Mutter bei einem Essen mit Geschäftspartnern im Eleven Madison Park erwartete. Das ging vermutlich bis neun, also hätte ich theoretisch Zeit gehabt, noch mit Jess ins Tough Rock zu gehen. Allerdings nicht die Nerven, um seine Blicke zu ertragen. Oder die unausgesprochene Frage darin: Geht es dir gut, Eli?
»Ja, verfluchte Scheiße, es geht mir gut«, knurrte ich düster. Aber trotz meiner Worte warf mich der Gedanke an Jess ein paar Jahre zurück, in eine Zeit, als mich alle noch Eli genannt hatten, nicht nur er – und mein Körper sprang darauf an. Es war ein altbekanntes Gefühl, als würde etwas meine Eingeweide zusammendrücken, während gleichzeitig meine Sinne unnatürlich scharf wurden, sich auf Kampf oder Flucht vorbereiteten. Ich reagierte sofort, griff nach dem Regler und drehte das Wasser auf eiskalt. Dann biss ich die Zähne zusammen, versuchte trotz der Kälte und der Enge in meiner Brust zu atmen, schaffte es – und das Gefühl verschwand. Weil ich es so wollte. Weil ich die Kontrolle hatte. Ich hatte mir vor drei Jahren geschworen, sie nie wieder zu verlieren. Und daran hielt ich mich eisern.
Denn ich wusste genau, wenn ich sie verlor, dann verlor ich alles.
Abtrocknen, anziehen und das Haus verlassen kostete mich kaum zehn Minuten, deswegen konnten wir die große Runde durch den Central Park drehen. Und auch danach blieb ich perfekt im Zeitplan: Nur eine halbe Stunde, nachdem wir in meine Wohnung zurückgekehrt waren und ich Buddy gefüttert hatte, stiegen wir beide aus dem Wagen.
Ich schloss wie automatisch den oberen Knopf meiner Anzugjacke und betrat CW Buildings durch den Haupteingang. Im Vorbeigehen grüßte ich das Empfangsteam, den Blick auf mein Smartphone gerichtet, in der anderen Hand die Leine. Ich brauchte Buddy tagsüber nicht mehr zu meiner Unterstützung und hätte ihn auch zu einer Betreuung bringen können, die sich um ihn kümmerte, wenn ich in der Firma oder Uni war. Aber ich hatte meinen Hund einfach gern bei mir, schließlich war er schon mein bester Freund gewesen, als ich keinen anderen gehabt hatte. Außerdem konnte ich Menschen noch besser durchschauen, wenn er da war. Es war beeindruckend, wie schnell Leute ihr wahres Ich zeigten, sobald sie einem Hund begegneten.
Zum Glück war der Aufzug, der auf mich wartete, leer. Ich hasste nichts mehr als leeren Small Talk am Morgen. Und da man mich auch in der Firma wahlweise für einen verwöhnten Bengel, eine ernsthafte Bedrohung oder den Messias der Immobilienbranche hielt, gab es nur selten interessante Gespräche zwischen Tür und Angel. Denn nichts davon traf zu. Okay, das mit der Bedrohung vielleicht. Aber nur, wenn man Angst vor Fortschritt hatte.
Da war immer noch die unbeantwortete Nachricht von Jess, und sie starrte mich vorwurfsvoll an. Ich holte Luft und tippte eine Antwort: Sorry, hab schon was vor. Vielleicht nächste Woche. Dann steckte ich das Telefon weg, im gleichen Moment hielt der Speedlift. Ich wurde bereits erwartet, als sich die Türen öffneten und ich gemeinsam mit Buddy heraustrat.
»Elijah, du bist pünktlich. Sehr gut.« Meine Mutter kam auf mich zu, wie immer in heller Kleidung, heute einem Etuikleid aus grauer Seide.
»War ich das je nicht?« Ich grinste und drückte ihr einen Kuss auf die Wange. »Morgen, Mom.«
»Morgen, mein Schatz.« Sie verzog den Mund zu einem raschen Lächeln und tätschelte dann meinem Hund flüchtig den Kopf. Ich musterte sie einen Moment aufmerksam, um herauszufinden, ob es ihr gut ging. Wache Augen, keine Sorgenfalte zwischen den Brauen, sie schien im Gegensatz zu mir gut geschlafen zu haben. »Bist du bereit für die Sitzung?«, fragte sie.
»Du meinst, ob ich bereit bin, Krieg mit dem Vorstand zu führen? Ich freue mich schon den ganzen Morgen darauf.« Mein Sarkasmus zog eine Spur hinter uns her, während wir den Flur entlanggingen. Buddy lief bei Fuß, seine Leine hatte ich längst ausgehakt. Er war nicht nur hervorragend ausgebildet, sondern auch sehr gut erzogen und er blieb ohnehin immer an meiner Seite, wenn ich ihm nichts anderes sagte.
»Nimm es nicht persönlich. Sie wissen, dass du jung und brillant bist, und das schüchtert sie ein.« Meine Mutter berührte mein Revers. »Allerdings könntest du mal einen Anzug in einer anderen Farbe als schwarz tragen. Das macht dich so düster.«
»Ich bin nicht brillant«, widersprach ich, ohne auf die Bemerkung zu meinem Outfit einzugehen. »Ich bin nur nicht so verbohrt wie sie. Oder so gierig.« Im Grunde wusste ich nicht, warum wir diesen Bürokraten überhaupt Rechenschaft schuldig waren, schließlich konnten wir als Gesellschafter auch allein entscheiden. Da Jess vor Jahren auf seine Anteile verzichtet hatte, hielt ich seit meinem achtzehnten Geburtstag siebenunddreißig Prozent der Firma, fünf gehörten meinem Vater, der Rest Mom. Aber da das Unternehmen schon lange zu groß war, um alles selbst im Blick zu behalten, gab es den Vorstand. Und die Mitglieder waren nicht unbedingt Fans von mir.
»Heute geht es nur um die Finanzierung.« Sie winkte ab. »Das ist pro forma. Wir wissen beide, dass die nicht in der Hand des Vorstands liegt.«
Das stimmte, aber für das, was wir planten, brauchten wir externe Investoren und die sahen es nicht gerne, wenn Unmut in den eigenen Reihen herrschte. Deswegen hoffte ich, dass es weniger Gegenwind gab als gedacht. Dieses Projekt war mir wichtig, mit dem Museum wollte ich meine Marke in der Stadt setzen, noch bevor ich fünfundzwanzig wurde. Das würde ich mir nicht vom Vorstand versauen lassen.
»Wann hast du eigentlich deinen Bruder zuletzt gesehen?« Mom sah auf ihr Tablet, aber mir entging der Tonfall nicht. Sie wusste, dass es zwischen Jess und mir gerade nicht gut lief, ohne dass einer von uns es ihr verraten hatte. Die Leute hielten meine Mutter für die böse Eiskönigin, sie war jedoch sehr viel empathischer, als man ihr zutraute.
»Keine Ahnung, ist schon ein bisschen her«, sagte ich beiläufig. »Aber ich gehe vielleicht am Sonntag ins Adam & eVe.« Dort fanden sich immer einige Freunde und Familienmitglieder zusammen und daher war die Gefahr gering, dass Jess und ich Gelegenheit hatten, in Ruhe miteinander zu reden. Fuck, so weit war es also schon gekommen. Mit einem Mal vermisste ich meinen verstorbenen Bruder Adam so heftig, dass es wehtat. Er hätte es wahrscheinlich geschafft, zwischen uns zu vermitteln.
»Schön, dann werde ich mich vermutlich anschließen. Ich habe die beiden seit zwei Wochen nicht gesehen.« Meine Mutter lächelte erneut und ich erinnerte mich an die Zeiten, als sie blanke Panik bei dem Gedanken befallen hatte, Jess und Helena könnten zusammen sein. Umso mehr freute es mich, dass sie so glücklich miteinander waren und ihre Beziehung von allen akzeptiert wurde. Ich würde das nie haben, aber ich wollte es auch gar nicht. Menschen an sich heranzulassen bedeutete immer, sich angreifbar zu machen. Und kaum etwas hasste ich mehr.
Ich sah auf meine Uhr. »Es ist Zeit. Wir sollten sie nicht warten lassen.«
Mom nickte und ich folgte ihr gemeinsam mit Buddy zum Konferenzraum, dessen Glasfront auf Coldwell House ausgerichtet war und in dem sich bereits alle Vorstandsmitglieder befanden. Beim Betreten des Raums straffte ich die Schultern, richtete mich zu voller Größe auf, hob das Kinn. Die Anwesenden musterten mich und ich begegnete ihren Blicken ebenso selbstsicher wie unbeeindruckt. Jahrelange Übung machte es möglich.
»Meine Damen, meine Herren, wir sind vollzählig.« Mom setzte sich und ich gab Buddy einen Wink, damit er auf die Decke ging, die für ihn in der Ecke des Raums bereitlag. Die Anwesenheit meines Hundes sorgte schon lange nicht mehr für Stirnrunzeln oder gerümpfte Nasen, schließlich begleitete er mich bereits, seit ich Gesellschafter geworden war. Ich war mir sogar sicher, dass die meisten Buddy sehr viel lieber mochten als mich.
Ich nahm neben meiner Mutter Platz, löste den Knopf meines Sakkos, legte kurz die Hand an den Knoten meiner Krawatte, der perfekt saß. Dabei rutschte die Manschette meines Hemdes ein Stück hoch und der Blick von Greg Talbot, der mir gegenüber an dem großen Konferenztisch saß, fiel auf die Ausläufer meines Tattoos, die unter dem Rand des Stoffs zum Vorschein kamen. Missbilligend verzog sich sein Mund, aber ich schob den Ärmel nicht wieder herunter, um die schwarze Tinte zu verbergen. Stattdessen ließ ich ihn noch ein Stück zurückrutschen, sodass man mehr von dem grafischen Muster sehen konnte.
Talbot schnaubte leise und ich grinste leicht. Wahrscheinlich wäre er in Ohnmacht gefallen, wenn ich ihm gesagt hätte, dass nicht nur meine Arme, sondern auch der größte Teil meines Oberkörpers tätowiert war. Oder wenn ich ihm verraten hätte, warum.
»Es geht heute um die Finanzierung des Museumsprojekts auf unserem kürzlich erworbenen Grundstück am Bryant Park.« Meine Mutter gab ihrer Assistentin einen Wink, damit diese die Präsentation startete. Die offiziellen Pläne der Baubehörde von New York wurden an die Wand geworfen, in denen das geplante Gebäude bereits eingezeichnet war. Mom schaute zu mir. »Die Details haben wir ja schon besprochen. Ich gehe kurz auf den aktuellen Stand ein, und Elijah wird dann die benötigten Mittel skizzieren.«
Ich nickte, spürte wieder für einen Moment diesen Druck, bevor ich das Gefühl ohne Probleme erneut verbannte. Eine Situation wie diese konnte mich nicht mehr aus der Fassung bringen. Denn auch wenn ich sehr häufig das Echo meiner früheren Angst wahrnahm, ließ ich sie niemals an die Oberfläche.
1134 Tage. So lange hatte ich schon keine Panikattacke mehr gehabt. Seitdem waren vor allem Disziplin und Beherrschung meine Begleiter, nicht Furcht und Hilflosigkeit. Daher war ich nicht nur in der Lage, so etwas wie ein normales Leben zu führen, sondern saß auch in einem Raum mit einflussreichen Menschen, die mich längst mit Respekt statt Mitleid betrachteten. Und es machte mich auf grimmige Art stolz. Einige von ihnen hatten sicher noch im Kopf, was mir mit neun Jahren passiert war – obwohl ich alles dafür getan hatte, es sie vergessen zu lassen. Als ich jetzt meinen Blick über den Vorstand schweifen ließ, wirkte es, als hätte das funktioniert: Keiner schaute mich an, als würde er oder sie mich mit der Entführung in Verbindung bringen. Doch ich erinnerte mich noch sehr gut an die mitleidigen Blicke und das Getuschel hinter vorgehaltener Hand, das mich damals auf Schritt und Tritt verfolgt hatte. Er ist traumatisiert, der arme Junge, wie sollte er auch klarkommen? Niemand könnte das einfach so wegstecken.
Dieses leere Mitgefühl war so ermüdend und kein bisschen hilfreich. Schließlich hatten sie keine Ahnung. Sie stellten sich vielleicht vor, wie es sein musste, zehn Tage in einem stockdunklen, kalten und feuchten Kellerloch in Harlem zu sitzen, ohne zu wissen, ob man da lebend wieder rauskommt. Wie fürchterlich es sein musste, körperlich und psychisch misshandelt zu werden, ohne zu wissen, ob jemand kam, um einen zu retten. Vielleicht stellten sie sich auch vor, wie es sein musste, wenn es ihr Sohn, ihre Tochter gewesen wäre, denen das angetan worden war. Wie hilflos, wie nutzlos sie sich gefühlt hätten. Aber niemand wusste wirklich, wie sich diese Art von Todesangst, diese Art von Schmerz anfühlte. Und niemand wusste, was tatsächlich in den zehn Tagen passiert war. Oder danach. Nicht die Öffentlichkeit, nicht meine Eltern oder mein Bruder. Auch nicht die Polizei oder meine Therapeuten, zu denen ich jahrelang jede Woche gegangen war. Ich hatte es ihnen nie erzählt. Aus gutem Grund.
Und wenn es nach mir ging, würde es auch nie jemand erfahren.
3
Felicity
»Felicity, das kann nicht dein Ernst sein.« Meine Mutter stand in der Tür meines Zimmers, die Arme verschränkt. Trotz ihrer abweisenden Haltung sah ich vor allem Sorge in ihrem Gesicht. Klar. Musste ja auch scheiße sein, wenn man feststellte, dass die jahrelangen Lügen gegenüber der eigenen Tochter aufgeflogen waren.
»Wenn es dein Ernst war, mir kein Wort darüber zu verraten, dass mein Vater sehr wohl Kontakt zu mir haben wollte«, ich sah sie wütend an, »dann ist es auch mein Ernst, nach New York zu ziehen.«
Mom warf die Arme in die Luft. »Herrgott noch mal, ich habe das nur getan, um dich vor einer Enttäuschung zu bewahren! Die Familie von Harrison Grant ist etwas, von dem man sich so weit wie möglich fernhalten sollte, glaub mir. Das sind Snobs wie aus dem Bilderbuch und keiner von denen wäre nett zu dir gewesen.«
Ich pfefferte einen Sweater in meinen Koffer. »Dir glauben? Vergiss es, Mom! Ich glaube dir nie wieder irgendetwas!« Mir war bewusst, dass ich gerade dramatisch reagierte, aber ich hatte jedes Recht dazu. Nachdem ich vor zwei Wochen aus New York zurückgekehrt war, hatte ich Mom mit dem konfrontiert, was ich erfahren hatte – und sie hatte ihre Lügen zugegeben. Zu meinem Besten, wie sie seitdem unermüdlich betonte, was immer das bedeuten sollte. Wie konnte es das Beste für ein kleines Mädchen sein, ohne ihren Vater aufzuwachsen? Oder jeden einzelnen Cent umdrehen zu müssen, weil das Geld vorne und hinten nicht reichte?
»Hör mir zu, Fay –«
»Nein«, unterbrach ich sie harsch und drehte mich zu ihr um. Der Spitzname aus meiner Kindheit machte mich nur noch wütender. Du bist mein kleines Feenkind, hatte sie immer zu mir gesagt, weil ich so zart und blond gewesen war. Ein Feenkind ohne Vater. Den sie von mir ferngehalten hatte. »Es gibt keinen vernünftigen Grund, warum du mich angelogen hast, also tu mir einen Gefallen und verschon mich, okay? Ich fliege, ganz egal, was du sagst.«
Wir stritten uns täglich, seit ich zurück war, und kamen keinen Schritt weiter. Es war gut, wenn ich morgen endlich etwas Abstand zwischen uns brachte. In New York würde ich davon abgelenkt sein, dass mich ausgerechnet der Mensch, dem ich bedingungslos vertraute, verraten hatte. Auf die übelste Art und Weise. Sie hatte meinen Kummer mitbekommen, als ich ein Kind gewesen war und nicht verstanden hatte, wieso mein Dad am Vatertag keine selbst gebastelte Karte wollte. Sie hatte meinen Zorn erlebt, als ich in die Pubertät gekommen war und auf ihn geschimpft hatte, weil er kein Interesse an mir hatte. Und sie hatte nichts gesagt. Ich wusste nicht, ob ich ihr das jemals verzeihen konnte.
»Dann willst du jetzt den Rest deines Lebens wütend auf mich sein?« Meine Mutter sah mich an und ich erkannte, dass sie verletzt war. Das war jedoch nichts gegen meine Verletztheit, und deswegen blieb ich hart.
»Erwartest du, dass ich einfach hinnehme, was du getan hast?« Ich schnaubte. »Du hast nicht nur verschwiegen, dass mein Vater Kontakt zu mir wollte, du hast das Gegenteil behauptet! Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich wäre nicht gut genug für ihn!« Ein Gefühl, das mich seit meiner Kindheit begleitet hatte, wann immer ich mit Menschen in Kontakt gekommen war, die Einfluss oder Geld hatten. Es war wie ein Reflex, mich ihnen gegenüber klein und minderwertig zu fühlen.
»Du hast ihn damals nicht gekannt. Harrison Grant wäre niemals der Vater gewesen, den du dir gewünscht hast. Er war völlig besessen von Erfolg und Macht.«
»Na, offenbar hat dich das nicht davon abgehalten, mit ihm zu schlafen, oder?« Ich schloss meinen Koffer und zog den Reißverschluss zu. »Du hast einen Fehler gemacht, Mom, nicht ich. Aber ich bin diejenige, die dafür bezahlt hat.«
Meine Mutter schwieg und ich sah Tränen in ihren Augen. »Ich habe das für dich getan. Und ich hoffe, dass du das eines Tages verstehst und mir verzeihst, nicht die Wahrheit gesagt zu haben.«
Darauf wollte ich nichts antworten, also schaute ich auf die Uhr und nahm dann meine Tasche. »Ich muss los, ich treffe mich mit den anderen. Wir wollen Abschied feiern.«
»Sehen wir uns noch, bevor du fliegst? Ich habe morgen Frühschicht.«
Widerwillig nickte ich. »Sicher.«
Meine Mutter ging und ich blieb allein in meinem Zimmer zurück, schaute mich um. Vieles hatte sich mit der Zeit verändert, die Möbel, die Wandfarbe, der Stil meiner Zeichnungen, die überall an den Wänden hingen. Obwohl ich so oder so ausgezogen wäre, war es immer mein Zuhause gewesen, und es tat weh, wegzugehen. Im Grunde tat gerade alles mehr oder weniger weh, aber vielleicht gehörte das dazu, wenn man seinen eigenen Weg finden wollte.
Ich ging zur Tür und verließ die Wohnung, lief die Treppe hinunter und trat auf die Straße. Wir hatten Anfang September, draußen war es wunderbar warm, und zum ersten Mal nahm ich dieses Wetter nicht für selbstverständlich. In New York stand mir ein kalter Winter bevor, so viel wusste ich, und auch wenn ich neugierig darauf war, graute es mir doch ein bisschen davor, in dicker Jacke und mit Mütze auf dem Kopf das Haus zu verlassen. Meine Freundin Rhoda hatte mich mal den Inbegriff des kalifornischen Mädchens genannt und vielleicht stimmte das. Ich liebte Wärme und Helligkeit, sommerliche Klamotten und Sonnenuntergänge am Strand. Wenn ich davon umgeben war, fühlte ich mich wohl und geborgen.
Morgen um zehn Uhr am Vormittag würde ich jedoch mit meinen zwei Koffern in ein Flugzeug steigen, das mich nach New York brachte, in ein vollkommen neues, unbekanntes Leben. Ich würde ohne meine Freunde zurechtkommen müssen – die vier Menschen, die bereits seit der Junior High immer an meiner Seite gewesen waren. Und ich würde L. A. verlassen, meine Heimat, die ein Teil von mir war. Ich kannte in Venice jede Ecke, jedes Haus und die meisten Leute. Es würde eigenartig sein, bei null anzufangen. Aber gleichzeitig ein Abenteuer, auf das ich mich freute.
Auf dem Weg zum Skatepark kam ich an dem Bikeverleih vorbei, in dem ich bis zu unserem Europatrip gearbeitet hatte. Vor dem Laden hockte mein ehemaliger Chef neben einem der Fahrräder und ölte die Kette.
»Hi Jay«, sprach ich ihn an und er sah hoch.
»Felicity, du hier? Solltest du nicht schon auf dem Weg in das kalte, ungemütliche Land namens New York sein?«
Ich grinste. »Erst morgen. Heute feiere ich meinen Abschied mit den anderen.«
Jay richtete sich auf und schob die Sonnenbrille hoch. Wie viele Männer in Venice war er tätowiert und ziemlich muskulös, das war Teil seines Lifestyles. Ich ging jede Wette ein, dass er den Leg Day im Public Gym am Strand nie ausließ. Aber im Inneren war er so weich wie ein Marshmallow.
»Ich trauere dir immer noch nach, das weißt du, oder?« Er lächelte. »Du hast mir einen echten Kundenrekord beschert, als du hier gearbeitet hast. Die Leute haben dich sogar mehr geliebt als Samaire, aber verrate es ihr nicht.«
»Das ist ganz sicher gelogen«, lachte ich. Seine Frau war ein wahres Verkaufstalent. Seit das zweite Kind da war, blieb sie jedoch meist zu Hause und kümmerte sich um die Familie. »Aber es hat auch wirklich Spaß gemacht, für dich zu arbeiten.« Jay war immer großzügig bei der Bezahlung gewesen und so entspannt, wie man eben hier bei uns war. Und mir fiel es leicht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, um ihnen eine gute Tagestour zu empfehlen, deswegen war der Job ein perfect match gewesen.
»Na gut, ihr wart gleichauf. Aber mehr fünf Sterne bei Google hast trotzdem du mir eingebracht. Und die beste Rezension aller Zeiten: Großartiger Bikeverleih mit den besten Mitarbeitern. P. S: Felicity, bitte heirate mich.«
Erneut musste ich lachen. »Ich war fast enttäuscht, dass nie etwas daraus geworden ist. Er war echt heiß, aber er ist nie wiedergekommen.«