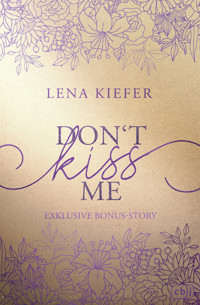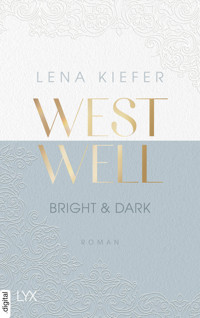9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Westwell
- Sprache: Deutsch
"Ich liebe dich, Helena. Wahrscheinlich sollte ich das nicht sagen, weil es alles nur schlimmer macht, aber ich kann nicht anders."
Helena kann es nicht fassen: In dem Moment, als ihr Glück mit Jess endlich zum Greifen nah ist, wird es ihr schon wieder entrissen. Gerade haben die beiden beschlossen, sich all denen zu widersetzen, die ihre Liebe verhindern wollen, da greifen Unbekannte Jess an und verletzen ihn lebensgefährlich. Doch wer hat es auf ihn abgesehen? Und warum? Helena muss sich erneut auf die Suche nach Antworten begeben, die gefährlich eng mit dem Tod von Valerie und Adam verwoben sind. Und je näher sie der Wahrheit kommt, desto mehr fragt sie sich, ob sie und Jess jemals eine gemeinsame Zukunft haben können - oder ob ihre Liebe nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt war ...
"Vorsicht, macht süchtig! High Society, forbidden love und Thrillervibes - Lena Kiefer hat hier eine Geschichte geschrieben, die spannender nicht sein könnte. Eine absolute Highlight-Reihe, die ich jedem in die Hand drücken möchte." BOOKSLOVE128
Der Abschlussband der WESTWELL-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Lena Kiefer
Band 1: Westwell - Heavy & Light
Band 2: Westwell - Bright & Dark
Band 3: Westwell - Hot & Cold
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 611
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Widmung
Playlist
Motto
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Epilog
Leseprobe
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Lena Kiefer bei LYX
Impressum
LENA KIEFER
WESTWELL
HOT & COLD
Roman
Zu diesem Buch
Endlich mit Jess zusammen zu sein und ein Leben zu leben, das nicht von anderen, sondern nur von ihr selbst bestimmt wird – das ist alles, was Helena sich wünscht. Doch gerade als sie ihren Eltern den Rücken kehrt und ihr Traum damit in greifbare Nähe rückt, geschieht das Unfassbare: Jess wird von Unbekannten angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Aber wer hat es auf ihn abgesehen? Und warum? Helena ist außer sich vor Sorge, zumal Jess‘ Mutter der festen Überzeugung ist, dass es die Beziehung zur einer Weston-Tochter ist, die ihrem Sohn – wie auch schon dessen Bruder – zum Verhängnis wurde. Während sie mit aller Macht versucht, Helena von Jess fernzuhalten, muss sich Helena fragen, ob ihre Liebe überhaupt jemals eine Chance hatte oder ob sie nicht von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Aber ihre Gefühle für Jess sind zu stark, ihre Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft ist zu groß, als dass sie jetzt aufgeben könnte. Erneut begibt sie sich auf die Suche nach Antworten – nicht ahnend, dass die Wahrheit sowohl für sie als auch für Jess gefährlicher ist, als sie jemals geglaubt hätten …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält Elemente, die triggern können. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
Für Simone,
du bist meine Heldin.
Playlist
Westwell Theme – technokrates
I Don’t Pray – AVEC
Breathe Easy – Blue
I Guess I’m in Love – Clinton Kane
You Are The Reason – Duet Version – Calum Scott, Leona Lewis
Out Of The Woods – Taylor Swift
Lost Without You – Freya Ridings
Shape of My Heart – Backstreet Boys
Warm – Moncrieff
Cry On Me – Ella Henderson, Mikky Ekko
Half a Heart – One Direction
Walk With Me – Måns Zelmerlöw, Dotter
Crazy What Love Can Do (Acoustic) – David Guetta, Becky Hill, Ella Henderson
Little By Little – Oasis
Lay Me Down – Sam Smith
Closer – Kings of Leon
Brave – Ella Henderson
11:11 – Ben Barnes
Wonderland – Taylor Swift
Where It All Begins – Summer Kennedy
»These violent delights have violent ends
And in their triumph die, like fire and powder,
Which, as they kiss, consume.«
William Shakespeare, »Romeo & Juliet«
1
Helena
»Notrufzentrale, hallo?« Die Stimme klang ruhig, fast schon gelassen. Also das komplette Gegenteil von mir.
»Hallo, hier … hier ist Helena Weston«, brachte ich heraus. Meine Hände zitterten so sehr, dass ich mein Handy kaum festhalten konnte. »Ich brauche sofort einen Krankenwagen zum Emilio’s im West Village.«
»Ganz ruhig, Miss. Was ist passiert?«
»Mein Freund, er … er braucht dringend Hilfe.« Da war ich mir sicher, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was genau geschehen war. Seine Stimme, dieser Tonfall, ich hatte Jess noch nie so gehört.
»Miss, Sie müssen mir sagen, was vorgefallen ist, sonst kann ich nicht helfen.«
»Ich weiß nicht, was passiert ist, verfluchte Scheiße!«, entfuhr es mir heftig. Mir war klar, dass ich mich nicht fair verhielt, aber die Angst verhinderte jeden vernünftigen Gedanken.
Die Person am anderen Ende holte tief Luft. »Was sehen Sie? Ist er bei Bewusstsein, atmet er, gibt es sichtbare Verletzungen?«
»Ich bin nicht bei ihm, er war am Telefon, er hat meinen Namen gesagt, aber ganz schwach, so … so als würde er sterben. Können Sie jemanden dort hinschicken? Bitte!« Tränen liefen mir über die Wangen, verzweifelt sah ich die Straße hinunter. Ich stand vor Jess’ Haus – wie weit war es von hier bis zu dem Restaurant, das er mir genannt hatte?
»Okay, ich schicke einen Rettungswagen«, kam endlich die Erlösung, aber sie hielt nur zwei Sekunden vor, bis die Panik in meinem Inneren wieder ansprang. Was war mit Jess passiert? Und würde der Notarzt schnell genug da sein, um ihn zu retten?
Ich nannte noch einmal den Namen des Restaurants und meinen eigenen, bevor ich auflegte, und war bereits dabei, mich nach einem Taxi umzusehen. Aber da war keins, weit und breit nicht. Wie konnte es sein, dass in dieser verdammten Stadt, die mehr Cabs als Einwohner hatte, ausgerechnet jetzt kein einziges in der Nähe war?!
Meine Reisetasche stand noch neben mir, und ich warf sie kurzerhand hinter ein paar Büsche an der Eingangstür. Mir war es gerade vollkommen egal, ob jemand sie klaute. Dann lief ich eilig los, in Richtung der 7th, hoffte dort auf ein Taxi. Aber auch da herrschte gähnende Leere. Wir hatten Heiligabend, wahrscheinlich lag es daran.
Hastig rief ich auf dem Handy die Karten-App auf, tippte zweimal daneben, weil meine Finger so fahrig waren, fluchte leise. Dann gab ich das Emilio’s ein und startete die Fußgängerroute. Es waren eineinhalb Meilen, angeblich brauchte man dafür fünfundzwanzig Minuten.
Ich muss es schneller schaffen.
Ich rannte los und während ich die Straße überquerte, zuckten die schrecklichsten Szenarien durch meinen Kopf: Jess, den man angefahren und liegen gelassen hatte. Jess, der von jemandem verprügelt worden war. Jess, den man mit einem Messer angegriffen hatte. Ich hatte von ihm nicht mehr gehört als meinen Spitznamen, ausgesprochen in diesem fürchterlich dünnen Tonfall, als würde ihn alle Kraft verlassen. Und als ich nachgefragt, ihn darum gebeten, ihn angeschrien hatte, mir zu sagen, was passiert war, hatte ich keine Antwort bekommen. Obwohl ich noch nie mit einem Sterbenden gesprochen hatte, war ich mir sicher, dass es so klang. Und dann war das Gespräch einfach weg gewesen. Ein simpler melodischer Laut, der mich von ihm getrennt hatte. Ende.
Ich hastete an einem Bistro vorbei, vor dem ein paar Raucher standen, rempelte zwei davon an, entschuldigte mich murmelnd. In meinem Kopf war nur Jess. Die wenigen Erinnerungen an uns zusammen, der Abend im Bella Ciao, die Nacht in seiner Wohnung, der Schneesturm im Randy East. Die ganze Zeit hatte ich Angst gehabt, dass ich ihn nicht wiedersehen würde, nicht wiedersehen durfte. Aber nie auf eine so schreckliche Art wie jetzt.
Im Laufen warf ich einen Blick auf das Smartphone, ich hatte etwa die Hälfte der Strecke geschafft. Längst hatte ich Seitenstechen, aber ich merkte es kaum. Würde ich rechtzeitig da sein? Würde der Rettungswagen rechtzeitig da sein? Scheißescheißescheiße. Ich hatte doch schon einmal einen Menschen verloren, der mir die Welt bedeutete. Das durfte kein zweites Mal geschehen.
Eine Gruppe von Leuten kam auf mich zu, ein bisschen schlingernd, die meisten von ihnen schienen betrunken zu sein. Ich bremste meinen Lauf ab und wollte ausweichen, aber sie ließen mich nicht. Wütend stieß ich einen der Männer beiseite, heftiger als beabsichtigt, dann rannte ich wieder los.
Der Typ fluchte mir noch hinterher, da war ich schon an der nächsten Straßenecke. Für einige Hundert Meter war mein eigener Atem alles, was ich hörte, neben den Geräuschen der wenigen Autos, die hier unterwegs waren. Ich wagte es nicht, eines davon anzuhalten. Als New Yorkerin wusste ich, dass niemand für mich stoppen würde. Eher würden sie die Polizei rufen, wenn ich es versuchte, und das konnte ich nicht riskieren. Also rannte ich, rannte, so schnell ich konnte. Weil ich hoffte, dass ich Jess rechtzeitig erreichen würde.
Die Meter schmolzen nur langsam und mein Körper meldete, dass er am Limit war. Trotzdem wurde ich nicht langsamer. Und wenn ich danach zusammenbrach, ich würde es bis zu Jess schaffen. Ich musste einfach.
Ich war vollkommen durchgeschwitzt in meinem Mantel, als ich endlich den Schriftzug des Emilio’s am Ende der Straße entdeckte. Mein Blick wurde aber bald abgelenkt, denn an der Ecke zu einer Gasse sah ich blinkende Lichter und eine Menschentraube. Abrupt blieb ich stehen, mir wurde eiskalt, während ich diese Szenerie anstarrte, die ich sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Was, wenn es genauso war wie in den Krimiserien? Was, wenn er tot war?
Ein Teil von mir wollte hinlaufen, ein anderer hielt mich an Ort und Stelle. Erinnerungen an den Morgen nach Valeries Tod schossen mir durch den Kopf, jede einzelne davon ein schmerzhafter Schlag, der mich lähmte.
Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht.
»Bitte nicht.« Meine Stimme klang fremd in meinen Ohren, atemlos und flehend. Dann löste ich mich endlich aus meiner Starre und setzte mich in Bewegung.
Ich wollte die Straße überqueren, da ertönte ein ohrenbetäubendes Heulen und ein Krankenwagen fuhr an mir vorbei, beschleunigte und raste Richtung Norden davon. Ich sah ihm nach und wusste es. Keine Ahnung, wieso, aber ich wusste, dass Jess dort drin war. Sie hatten ihn bereits mitgenommen. Ich war zu langsam gewesen.
Mir entfuhr ein Laut, halb Schrei, halb Schluchzen, und meine Knie wollten nachgeben, aber ich zwang sie, weiter zu funktionieren. Ich durfte jetzt nicht zusammenbrechen. Jess brauchte mich. Ich musste mich am Riemen reißen und nachfragen, was geschehen war. Auch wenn ich nie mehr Angst vor etwas gehabt hatte als vor der Antwort.
»Was ist hier passiert?«, sprach ich wahllos ein paar Leute an, die hinter dem Absperrband standen.
»Da wurde jemand angeschossen«, antwortete eine Frau mittleren Alters, die ihre Strickjacke vor der Brust zusammenhielt. »Wirklich üble Sache. Das hier ist eigentlich ein friedliches Viertel.«
»An… Angeschossen?« Ich wiederholte es tonlos, fassungslos, aber vor allem hilflos. Jess war angeschossen worden. Angeschossen. Das Wort drehte sich in meinem Kopf, ohne einen Sinn zu ergeben.
»Schätzchen, geht es Ihnen gut?« Die Frau schaute mich besorgt an.
Eine Antwort brachte ich nicht heraus, denn in diesem Moment traten einige der Leute zur Seite und gaben den Blick auf die Gasse frei. Ein paar Meter hinter der Absperrung schaltete ein NYPD-Officer gerade einen Strahler ein, der auf den Boden leuchtete. Mir drehte sich der Magen um, als ich den großen dunklen Fleck sah. Das war Blut. Eine Menge Blut. Wie viel hatte ein Mensch davon? Konnte er überleben, wenn er so viel verlor? Das NEIN in meinem Kopf war sehr laut. Aber der Rettungswagen war mit hohem Tempo davongefahren, also gab es Hoffnung, oder?
Wenn ich je gedacht hatte, meine Gedanken wären gerast – jetzt wusste ich, dass sie es bis zum heutigen Tag nie getan hatten. Ich konnte kaum eine Frage in meinem Kopf fassen, bevor die nächste kam. Mein Körper war taub, alles in mir sperrte sich gegen die Realität. Vielleicht war es nur ein Traum. Vielleicht wachte ich gleich auf und Jess war bei mir, unversehrt und lebendig.
Aber es war kein Traum. Und ich wachte nicht auf.
Ein Polizist lief an mir vorbei und ich gab mir einen Ruck, hielt ihn auf, versuchte, bei Verstand zu bleiben. »Sir, wissen Sie, wo man den Verletzten hingebracht hat?«
Er musterte mich. »Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, Miss.«
»Bitte, sagen Sie es mir!«, rief ich verzweifelt. »Er ist mein Freund, ich …« Der Rest des Satzes wurde von dem Kloß in meinem Hals erstickt. Das war erst das zweite Mal, dass ich Jess als meinen Freund bezeichnete. Mir schnürte es alle Luft ab, dass ich es vielleicht nie wieder in der Gegenwartsform sagen konnte.
Der Cop schien Mitleid zu haben, denn sein Blick wurde weicher. »Sie wollten ins Mount Sinai am Stuyvesant Square, das liegt am nächsten.« Ich wandte mich schon ab, da sprach er mich noch einmal an. »Miss? Wir haben keinen Ausweis bei dem Opfer gefunden, können Sie uns sagen, wer er ist? Dann kontaktieren wir die Angehörigen.«
Am liebsten hätte ich es ihm verschwiegen, weil ich wusste, wen sie anrufen würden. Aber Trish hatte ein Recht darauf, es zu erfahren. Also nickte ich.
»Er heißt Jessiah Coldwell. Sie wissen bestimmt, wer seine Mutter ist.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, ging ich schnellen Schrittes in die Richtung, in die der Krankenwagen weggefahren war. Und als würde mich das Universum verspotten, war da plötzlich nicht nur ein Taxi, das mir entgegenkam, sondern gleich mehrere. Mit einer energischen Geste, bei der ich keine Ahnung hatte, wo ich die Kraft dafür hernahm, hielt ich eins an, riss die Tür auf und ließ mich auf den Sitz fallen.
»Wohin geht’s?« Der Fahrer drehte sich zu mir um und ich hielt mich gerade noch davon ab, ihn anzuschreien, wo er vor zwanzig Minuten gewesen war. Stattdessen konzentrierte ich mich auf das Wesentliche: Jess.
»Zum Mount Sinai an der First. So schnell Sie können.«
2
Helena
Der Taxifahrer nahm mich beim Wort und fuhr zügig in Richtung der First Avenue los. Die ganze Fahrt über krallte ich die Finger in die Wolle meines Mantels und stellte mir vor, es wäre Jess, so als könnte ich ihn auf diese Art am Leben halten. Kurz dachte ich daran, jemanden anzurufen – Malia oder Lincoln –, aber ich wollte nicht aussprechen müssen, was passiert war. Einen Moment lang sehnte ich mich auch nach meinen Eltern, ein kindlicher Reflex, bis mir einfiel, dass ich ihnen erst vor einer Stunde gesagt hatte, dass ich ausziehen und mit Jess zusammen sein würde. Es kam mir vor, als wäre das Tage her.
Das Mount Sinai kam in Sicht und nur mit Mühe löste ich meine verkrampften Finger, um mein Portemonnaie hervorzuziehen. Die Panik in meinem Inneren übertönte zwar alles andere, aber dass ich die Fahrt bezahlen musste, drang dennoch zu mir durch.
»Wir sind da.« Der Taxifahrer fuhr vor den Haupteingang des Krankenhauses und ich zahlte hastig viel zu viel, bevor ich aus dem Wagen stieg und zum Eingang rannte. Die Schiebetüren glitten auf und mich empfing grelles Licht, das mir nach der Dunkelheit draußen in den Augen stach. Ich ignorierte den Schmerz und sah mich um, konnte Jess aber nirgends entdecken. Natürlich nicht. Sie hatten ihn bestimmt längst in den OP gebracht.
»Hi«, sagte ich zu der Frau hinter dem Info-Schalter und brachte ein dünnes Lächeln zustande. »Hier wurde gerade jemand eingeliefert, ein junger Mann, er … auf ihn wurde ge… er wurde verletzt. Können Sie mir sagen, wie es ihm geht?«
Sie sah mich an. »Sind Sie eine Verwandte?«
»Ja«, log ich, weil ich wusste, sie würde mir sonst nichts verraten. »Bin ich. Er ist mein … Wir sind verwandt.«
»Und welcher Art ist diese Verwandtschaft?« Skepsis mischte sich in ihren professionellen Blick und ich wusste, dass sie meine Lüge durchschaute. Normalerweise war ich besser darin, aber in dieser Verfassung schaffte ich es nicht, überzeugend zu sein. Also knickte ich ein.
»Gar keiner Art. Er ist mein Freund. Ich wollte gerade zu ihm, als er angerufen hat und klang, als würde er sterben. Ich habe 911 gewählt und bin hingerannt, aber es war zu weit und ich bin zu spät gekommen, er war schon weg.« Die Worte sprudelten aus mir heraus und ich merkte, wie ich heftig zu zittern begann, weil Schock und Angst langsam das Adrenalin ablösten. »Jetzt bin ich hier und weiß nicht, was los ist. Und ich glaube, dass ich demnächst den Verstand verliere, wenn ich nicht wenigstens erfahre, ob er noch lebt.«
Die Pflegekraft schien zu merken, in welch erbärmlichem Zustand ich mich befand. »Wie ist Ihr Name, Miss?«
»Helena … Helena Weston«, sagte ich und meine Zähne klapperten. Ich konnte das Zittern nicht unterdrücken.
»Miss Weston, ich verstehe, was Sie gerade durchmachen. So viel kann ich Ihnen sagen: Ihr Freund wird im Moment operiert. Weitere Auskunft über seinen Zustand darf ich Ihnen nicht geben, sonst komme ich in Teufels Küche. Vielleicht kennen Sie jemanden aus seiner Familie und können dort anrufen? Dann können Sie zusammen warten, bis es etwas Neues gibt.«
Beinahe hätte ich hysterisch gelacht. Ja, Trish Coldwell würde garantiert gerne mit mir warten und mich darüber informieren, wie es ihrem Sohn ging. Eher fror die Hölle zu. Aber ich wusste, mehr würde ich jetzt nicht bekommen. Also nickte ich.
»Danke«, sagte ich tonlos und lief zu den Stühlen im Wartebereich, setzte mich hin, weil ich keine Ahnung hatte, wie lange ich noch aufrecht stehen konnte.
Ich fühlte mich erschöpft und gleichzeitig so, als hätte ich zehn Tassen Kaffee getrunken – ruhelos und aufgewühlt. Das Einzige, was diesen Zustand beenden konnte, war jedoch die Nachricht, dass Jess es schaffen würde.
Wer tat so etwas? War das nur ein missglückter Raubüberfall gewesen und er zur falschen Zeit am falschen Ort? Oder hatte man ihn ganz gezielt angegriffen? Ich dachte an Valerie und Adam, an die Möglichkeit, dass man die beiden getötet hatte. Aber warum sollte derjenige nun auch Jess umbringen wollen? Das ergab doch keinen Sinn.
Die Zeiger auf der Uhr im Wartebereich bewegten sich in Zeitlupe, zumindest kam es mir so vor. Ich zuckte jedes Mal zusammen, wenn jemand aus dem Bereich hinter den Milchglastüren trat, aber es waren nur Ärzte und Pfleger, die ihre Arbeit machten. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal so grauenhaft fühlen könnte, so ausgeliefert und schwach. Das letzte halbe Jahr ohne Jess war schrecklich gewesen, aber da hatte ich immerhin gewusst, dass er am Leben war. Jetzt wusste, nein, spürte ich, dass er darum kämpfte. Vielleicht bildete ich es mir auch nur ein. Ich dachte dennoch an ihn, ganz fest, und hoffte, hoffte einfach nur, dass sie ihn retten würden.
Meine Finger umklammerten mein Telefon und ich wünschte mir so sehr wie nie, dass Valerie noch am Leben wäre. Dass sie hier wäre, um mir zu sagen, dass alles in Ordnung kommen würde – selbst wenn sie keine Ahnung hätte, ob es so war. Dann wäre ich nicht so allein gewesen und hätte mich bestimmt weniger hilflos gefühlt. Aber Valerie war nicht mehr da. Nur ihre Stimme in meinem Kopf, die sich ab und zu meldete, um mir einen Rat zu geben.
Ruf Lincoln an.
So wie jetzt.
Vorhin hatte ich den Impuls noch verworfen, aber wenn ich ehrlich war, brauchte ich dringend jemanden, der mich davon abhielt, durchzudrehen. Und mein großer Bruder war einer der beruhigendsten Menschen, die ich kannte.
Durfte man in Krankenhäusern mittlerweile Handys benutzen oder war es immer noch verboten? Ich hatte keine Ahnung, aber da ich kein Warnschild sah und meinen Beinen nicht traute, wagte ich es und wählte die Nummer. Nach dem zweiten Klingeln ging er dran.
»Len, alles in Ordnung?«
»Linc, ich … ich brauche deine Hilfe.« Es klang mehr als kläglich, aber ich schaffte es gerade einfach nicht, stark zu sein.
»Was ist passiert?« Er wirkte alarmiert. »Geht es dir gut? Bitte sag was!«
»Mir geht es gut, aber Jess … Er …« Wieder musste ich abbrechen, weil sich ein heftiges Schluchzen meine Kehle hinaufkämpfte. Es auszusprechen machte es noch ein bisschen mehr zur Realität. »Jemand hat auf ihn geschossen.«
»Geschossen?«, wiederholte mein Bruder fassungslos. »Was ist mit ihm, wird er versorgt?«
»Ja, ich habe 911 angerufen und sie haben ihn mitgenommen.«
»Dann warst du dabei? Bist du unverletzt?« Panik mischte sich in seine Stimme.
»Nein, ich war nur am Telefon«, stieß ich hastig hervor. »Und jetzt bin ich hier im Krankenhaus, aber die wollen mir nichts sagen, weil ich nicht zur Familie gehöre und …« Ich konnte das Schluchzen nicht länger unterdrücken. Mit einer Hand auf dem Mund erstickte ich mein Weinen.
»Ich komme zu dir. Welches Krankenhaus?« Man hörte das Geräusch eines Schlüssels, das Rascheln eines Mantels. Ich wusste nicht, ob er noch bei unseren Eltern war oder bereits zu Hause. Es war mir auch egal.
»Das Mount Sinai an der First«, presste ich zwischen meinen Fingern hervor.
»Okay, das ist nur ein paar Blocks von uns. Bin gleich da, Len, halte durch.« Dann legte er auf.
Ich war merkwürdig erleichtert, als ich das Handy vom Ohr nahm, weil nun auch jemand anderes Bescheid wusste. Es änderte nichts an Jess’ Zustand, wenn Lincoln hier war, aber es würde vielleicht etwas leichter sein, auf Neuigkeiten zu warten. Mit ihm zu reden, worüber auch immer.
Mein Bruder war noch nicht da, als die Glastüren aufgingen und jemand hereinstürmte, eine große blonde Frau in einem langen beigefarbenen Mantel, der hinter ihr herwehte. Es war Trish Coldwell. Sie schaute nicht nach links und rechts, sondern steuerte auf direktem Wege den Empfangstresen an. Ich blieb stocksteif sitzen, hatte keine Ahnung, was ich tun sollte.
»Mein Sohn ist hier eingeliefert worden«, herrschte sie die Pflegekraft an. »Jessiah Coldwell. Ich will sofort wissen, wie es ihm geht.«
Die Antwort verstand ich nicht, weil ich zu weit weg war, aber die Frau sprach länger mit ihr als mit mir, also gab man ihr bestimmt mehr Informationen. Dann erhob sie sich und ging durch die Milchglastüren, vielleicht um einen Arzt zu holen. Trish blieb am Empfang und wartete.
Sie stand mit dem Rücken zu mir und hatte mich eindeutig noch nicht gesehen. Und wahrscheinlich hätte ich es dabei belassen sollen, schon allein weil ich die Konsequenzen für meine Familie nicht absehen konnte. Ich wollte nichts weniger, als mit ihr zu sprechen, aber sie war gerade die Einzige, die mir sagen konnte, wie es Jess ging. Vielleicht konnten wir unsere gegenseitige Abneigung ja nur heute beiseitelassen, für ihn.
Ich nahm meinen Mut zusammen und erhob mich, ging auf sie zu.
»Mrs Coldwell?«, fragte ich vorsichtig. »Können Sie mir vielleicht sagen –«
Sie fuhr zu mir herum. »Du?!« Es klang so zornig, dass ich zurückwich. »Warst du etwa mit ihm zusammen, als es passiert ist?«
»Nein.« Ich schüttelte den Kopf. »Aber wir haben telefoniert und –«
»Was habe ich dir über den Umgang mit meinem Sohn gesagt?!«, schnauzte sie mich an und ich sah die gleiche Angst in ihren Augen, die ich selbst empfand. »Ich habe dir gesagt, dass du dich verdammt noch mal von ihm fernhalten sollst!«
»Ich habe es versucht!«, rief ich und es war mir egal, dass die Krankenhausmitarbeiter Zeugen unseres Streits wurden.
»Das ist alles, du hast es versucht?« Sie schnaubte und es klang verzweifelt. »Ich hatte mich doch wohl klar ausgedrückt, was passiert, wenn du dich nicht an unsere Vereinbarung hältst, oder? Welchen Grund hattest du also, dagegen zu verstoßen?«
»Ich liebe Jess!« Es war grauenhaft, dass ich das zum ersten Mal in dieser Situation aussprach, während ich um sein Leben bangte und mit seiner Mutter stritt. Aber es war die Wahrheit.
Sie kam näher, drohend und wütend. Einen Moment war ich sicher, sie würde mir eine Ohrfeige geben. Dann wurde ihre Stimme jedoch leise und messerscharf.
»Ja, das ist immer die Erklärung für alles, nicht wahr? Reicht es nicht, dass deine missratene Schwester Adam in den Tod gerissen hat? Musstest du nun auch noch Jess umbringen?«
Es fühlte sich an, als hätte sie mir tatsächlich ins Gesicht geschlagen. »Ich … Ich habe nicht … Ich würde niemals …« Ich stammelte nur, fassungslos von so viel Ungerechtigkeit und Vorwurf.
Trishs Augen sprühten vor Hass. Vor Hass auf mich.
»Du bist schuld daran, dass mein Sohn vielleicht stirbt, Helena. Du ganz allein. Und ich schwöre dir bei allem, was mir heilig ist, wenn er das nicht übersteht, dann werde ich nicht nur deine Familie zu einer Fußnote in der Gesellschaft von New York machen. Nein, wenn er stirbt, dann wirst du dir wünschen, man hätte auf dich geschossen. Und –«
»Trish, hören Sie sofort damit auf!« Plötzlich war Lincoln da, legte einen Arm um mich und schirmte mich von ihr ab. »Ich verstehe, dass Sie außer sich sind, aber was immer mit Jess passiert ist, war ganz sicher nicht Helenas Schuld.«
Sie lachte auf, laut und bitter. »Oh doch, es ist ihre Schuld. Ihr Westons seid ein verdammter Fluch! Wenn Valerie nicht gewesen wäre, würde Adam noch leben. Wenn Helena nicht wäre, läge Jess jetzt nicht auf einem OP-Tisch! Ihr könnt nichts anderes, als meine Familie zu zerstören!«
Ein Arzt kam durch die Türen und war offenbar irritiert, als er uns alle sah, die Gesichter verzerrt vor Abneigung und Fassungslosigkeit.
»Mrs Coldwell?«, fragte er.
»Ja, das bin ich.« Sie stürmte auf ihn zu. »Was ist mit meinem Sohn? Wie geht es ihm?«
Ich sperrte meine Ohren so weit auf, wie ich konnte. Näher zu ihnen zu gehen, wagte ich nicht.
»Wir können aktuell nichts Genaues sagen, die Operation läuft noch«, sagte der Arzt in beruhigendem Ton. »Es wird sicherlich noch ein paar Stunden dauern, bis wir eine Prognose abgeben können.«
»Aber er wird es doch überstehen, oder?« Jetzt klang Trishs Stimme nicht mehr herrisch und hasserfüllt, sondern nur flehend.
»Das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Meine Kollegen tun alles, was sie können, um ihn zu retten. Sie müssen Geduld haben.«
Ich presste die Hand auf den Mund, weil ich ahnte, dass seine Worte ein Code waren für Es könnte sein, dass er es nicht schafft. Lincoln zog mich in seine Arme und hielt mich fest. Alles, woran ich denken konnte, war jedoch der Wunsch, dass es Jess wäre, der mich umarmte. Wir hatten viel zu wenig Zeit miteinander gehabt. Er durfte nicht sterben. Das durfte nicht passieren.
»Gehören Sie auch zur Familie?«, sprach uns in diesem Moment der Arzt an und ich ließ meinen Bruder los.
»Nein, ganz und gar nicht«, sagte Trish scharf. »Es ist das komplette Gegenteil. Dieses Mädchen hat den Angriff auf meinen Sohn zu verantworten. Sie könnte nicht weniger zur Familie gehören.«
Der Blick des Arztes veränderte sich, als er mich musterte, und ich schüttelte heftig den Kopf.
»Das ist nicht wahr! Ich habe nichts getan, ich war nur am Telefon –«
Lincoln griff sanft nach meinem Arm, zog mich ein gutes Stück von Trish und dem Arzt weg, der sich von ihr verabschiedete und dann verschwand.
»Helena, ich glaube, wir sollten gehen.«
»Was? Nein!« Ich machte mich los. »Ich kann nicht weg, solange ich nicht weiß, ob er es übersteht!«
Mein Bruder warf einen Blick zu Jess’ Mutter, die nun jemandem am Telefon Befehle zubellte. Er wirkte ernsthaft beunruhigt. »Du kannst nicht hierbleiben. Sie denkt offenbar tatsächlich, dass du verantwortlich bist. Und du weißt, wie viel Einfluss sie hat. Was sie mit Valerie gemacht hat. Ich will nicht, dass sie irgendetwas tut, vor dem ich dich nicht beschützen kann.«
»Aber ich hatte damit doch nichts zu tun«, wehrte ich mich verzweifelt. »Ich habe auf ihn gewartet, vor seiner Wohnung, er war bei einer Restaurant-Eröffnung und wollte direkt nach Hause kommen. Wir haben telefoniert, das ist alles.« Meine Tränen liefen schon wieder.
»Das weiß ich doch. Trotzdem ist es besser, wenn du sie nicht provozierst. Wir gehen zu mir nach Hause, das ist nicht weit, du bist innerhalb von zehn Minuten wieder hier, wenn du möchtest. Und ich rufe Ben an, ob er uns auf dem Laufenden halten kann.«
An Ben Hatfield hatte ich noch gar nicht gedacht. Er war Lincolns bester Freund und Assistenzarzt hier im Krankenhaus. Und auch wenn er die Regeln eigentlich nicht umgehen durfte, würde er es für meinen Bruder vielleicht tun.
Trotzdem sperrte sich alles in mir dagegen. Ich konnte nicht einfach weg, wenn Jess da drinnen um sein Leben kämpfte. Das fühlte sich vollkommen falsch an. So als würde ich ihn im Stich lassen.
Ich rührte mich noch immer nicht, als mehrere Männer die Lobby betraten. Sie trugen die Uniformen des NYPD und gingen direkt auf Trish zu. Als sie einem von ihnen die Hand gab und mit ihm sprach, ließ sie uns zwar links liegen, aber ich hatte dennoch Angst. Wenn die mich wegbrachten oder zur Befragung mitnahmen, weil Trish behauptete, dass ich was damit zu tun hätte, dann würde ich gar nichts mehr über Jess’ Zustand erfahren. Also blieb mir keine Wahl.
»Okay«, gab ich auf und sah meinen Bruder an. »Gehen wir.«
Mit einem letzten Blick auf Trish verließ ich das Krankenhaus und folgte Lincoln nach draußen, panische Angst in meinem Bauch – nicht um mich, sondern um Jess. Nur um Jess. Ich wollte mir nicht vorstellen, dass er sterben könnte, aber der Gedanke kreiste unablässig in meinem Kopf, so penetrant, dass nichts anderes darin Platz hatte. Ich bemerkte kaum, wie ich in Lincolns Auto stieg und er sich ans Steuer setzte. Aber ich bemerkte, wie ich mich mit jedem Meter weiter von Jess entfernte, und es tat so unendlich weh, als würde man mir das Herz rausreißen.
Was sollte ich tun, wenn ich ihn verlor?
Was sollte ich tun, um es zu verhindern?
3
Helena
Paige empfing uns, als wir in die Wohnung kamen. Ich rechnete es ihr hoch an, dass sie keine Fragen stellte, sondern mich einfach nur umarmte und dann in die Küche ging, um Tee zu machen. Lincoln nahm unsere Mäntel und ich tigerte ruhelos im Wohnzimmer auf und ab, bis er zurückkam und mich mit sanftem Druck dazu zwang, mich auf das Sofa zu setzen. Während er sein Handy nahm und seinen Freund Ben anrief, trug Paige ein Tablett herein und stellte es auf dem niedrigen Couchtisch ab. Als sie mir einen Becher in die Hände drückte, sah ich sie dankbar an, war aber zu keinem Wort fähig.
»Ja, verstehe. Ich danke dir. Bis gleich.« Lincoln legte auf und setzte sich neben mich. »Ben hat heute keinen Dienst, deswegen ruft er in der Klinik an und fragt nach. Er meldet sich bald wieder.«
Ich nickte nur und nippte an meinem Tee. Jetzt, wo ich nicht mehr in Jess’ Nähe war, hatte die Panik einer Art Schockstarre Platz gemacht. Meine Finger krampften sich um den Becher, meine Beine spürte ich kaum noch. Es fühlte sich an, als wäre jede Faser meines Körpers zum Zerreißen gespannt. Deswegen sagte ich auch weiterhin nichts, bis Lincolns Handy klingelte. Mein Bruder ging dran und ich hielt es nur schwer aus, ihm dabei zuzusehen, wie er mit Ben sprach. Kaum hatte er das Telefonat beendet, öffnete ich jedoch den Mund.
»Und?« Meine Stimme war hoch und schrill, als würde sie nicht zu mir gehören.
»Es ist ernst«, stieß Lincoln aus. Mein Herz schien eine ganze Stufe tiefer zu sacken, fast ließ ich den Tee fallen. Ich wusste nicht, womit ich gerechnet hatte. Aber damit nicht. »Ben sagt, Jess wurde in den Rücken geschossen. Die Projektile haben die großen Gefäße dort zum Glück verfehlt, allerdings wurde eine Niere getroffen und die Milz hat auch etwas abbekommen. Ich bin kein Arzt, aber soweit ich es verstanden habe, versuchen sie jetzt, die inneren Blutungen zu stoppen und die Organe zu retten.«
Ich drückte eine Faust auf den Mund, es half jedoch nichts, die Tränen liefen mir dennoch über die Wangen. In den Rücken geschossen, Niere, Milz, innere Blutungen? Was waren das für Worte, was für eine Bedeutung hatten sie noch außer Er könnte sterben? Das war alles ein verdammter Albtraum, einer von jenen, in denen man eine Tür suchte, um zu entkommen, aber immer wieder im gleichen Raum landete. Diese Nacht hätte so anders verlaufen müssen. Es hätte die erste Nacht vom Rest unseres gemeinsamen Lebens sein sollen. Glück, Nähe, Liebe, das hätten die vorherrschenden Gefühle sein sollen. Nicht Hass, Angst und Hilflosigkeit.
»Ben fährt jetzt hin, damit er uns vor Ort auf dem Laufenden halten kann«, sagte Lincoln und berührte meinen Arm.
Ich stellte den Becher ab, weil meine Hand zu sehr zitterte, um ihn länger festzuhalten. Mein Bruder bemerkte es und schloss mich wieder in die Arme. Ich nahm es dankbar an, auch wenn ich wusste, dass er damit vielleicht mich, jedoch nicht Jess beschützen konnte.
»Ich habe solche Angst, Linc«, flüsterte ich erstickt in seinen Pullover.
»Ich weiß, aber Jess schafft das«, murmelte Lincoln beruhigend, während er über meinen Rücken strich. »Er ist stark, er wird kämpfen und gewinnen, ganz bestimmt.«
Es klang so, als wäre es eine unumstößliche Wahrheit, aber ich wusste, es war nur Hoffnung. Trotzdem klammerte ich mich daran, weil ich nichts anderes hatte, an dem ich mich festhalten konnte.
»Er hat sich so grauenhaft schwach angehört.« Ich löste mich von Lincoln und wischte mir mit dem Ärmel über das Gesicht. »Völlig fremd für mich. Es war furchtbar.« Jess war der lebendigste Mensch, den ich kannte – seine Augen, sein ganzes Wesen strahlte diese spezielle Wildheit aus, die nur einer der Gründe war, warum ich mich in ihn verliebt hatte. Ihn so zu hören hatte mich erschüttert, alles in mir. Wenn ich daran dachte, dass es das letzte Mal gewesen sein könnte, dass ich mit ihm gesprochen hatte. Dass meine panischen Rufe das Letzte gewesen sein könnten, was er in seinem Leben gehört hatte … Ich atmete tief ein. Hoffnung. Das war es, worauf ich mich konzentrieren musste. Hoffnung. Nicht auf das Schlimmste, was passieren konnte, sondern auf das Beste: dass er es schaffte und wieder gesund wurde. Ich hätte alles dafür getan, auch versprochen, mich den Rest meines Lebens von ihm fernzuhalten, wenn er nur wieder die Augen öffnete.
»Willst du uns erzählen, was passiert ist, nachdem du aus der Wohnung verschwunden bist?«, fragte Lincoln vorsichtig.
Ich schüttelte den Kopf, das konnte ich jetzt nicht.
»Mom und Dad waren außer sich, oder?« Eigentlich wollte ich auch darüber nicht reden, aber es lenkte mich immerhin von den schrecklichen Vorstellungen in meinem Kopf ab. »Dass ich ausgerechnet zu Jess wollte, muss sie unglaublich wütend gemacht haben.«
Paige und Lincoln wechselten einen Blick.
»Nein«, antwortete Paige dann. »Ich hatte eher den Eindruck, dass sie traurig sind.«
Ich schnaubte. Traurig, klar. In dem Gespräch, das wir geführt hatten, waren sie mir nicht traurig vorgekommen, sondern enttäuscht und zornig, weil ich nicht so funktionierte, wie sie es sich vorstellten. Selbst jetzt, da ich mich im absoluten Ausnahmezustand befand und keine Ahnung hatte, wie es weitergehen würde, war für mich ganz klar: Zurückgehen würde ich nicht.
»Soll ich … sie vielleicht anrufen?« Lincoln sah mich an.
»Nein, auf keinen Fall.« Ich schaute auf meine Hände. »Aber du solltest ihnen spätestens morgen Bescheid geben, dass sie wachsam sein müssen. Trish Coldwell weiß, dass ich mich nicht an unsere Vereinbarung gehalten habe. Sobald sie die Gelegenheit dazu hat, wird sie alles daransetzen, die Weston Group zu vernichten.«
Mein Bruder nickte. »Darum werden wir uns schon kümmern.« Er klang dennoch beunruhigt und vielleicht wäre ich das auch gewesen, wenn nicht jeder Quadratzentimeter meiner Gedanken und Gefühle mit Jess besetzt gewesen wäre. Meine Eltern hatten ihre geschäftlichen Kämpfe jahrelang ohne meine Beteiligung geführt. Und sie hatten deutlich gemacht, dass sie keinen Wert auf meine Mithilfe legten.
»Möchtest du etwas essen?« Paige warf mir einen fragenden Blick zu. »Ich kann dir ein Sandwich machen, wenn du willst. Wir haben auch noch Suppe von gestern da.«
Ich rang mir ein Lächeln ab. »Danke, aber ich bekomme eh nichts runter.« Schon die zwei Schlucke Tee rumorten unangenehm in meinem Magen, so als hätten sie noch nicht entschieden, ob sie den Rückweg antreten wollten. Es war besser, wenn ich nichts weiter zu mir nahm. »Tut mir leid, dass ich euch vom Schlafen abhalte. Ihr habt euch Weihnachten sicher anders vorgestellt.«
Lincoln griff nach meiner Hand und drückte sie. »Hör auf, dich dafür zu entschuldigen. Du bist meine Schwester und wir sind füreinander da. Immer.«
»Du kannst so lange hierbleiben, wie du willst«, sagte auch Paige. »Bis Jess sich erholt hat und du weißt, wie es weitergehen soll.«
Ich hätte mich gewundert, dass sie mich in dieser Sache unterstützte, wenn ich nicht geahnt hätte, dass Paige vielleicht auch manchmal daran dachte, sich von ihrer Familie zu lösen. Von außen wirkte es immer so, als hätten Leute wie wir ausschließlich Privilegien: Geld, Einfluss, Macht. Was viele nicht sahen, waren die Verpflichtungen, die dieses Leben mit sich brachte und die oft genug jeden Funken Freiheit erstickten.
Ich bedankte mich erneut, aber mehr gab es nicht zu sagen, also schwiegen wir und ich wiederholte im Kopf immer wieder das Mantra an Jess, durchzuhalten. Vielleicht betete ich sogar, obwohl ich eigentlich nicht religiös war, während ich auf die Uhr schaute und mich fragte, wie lange so eine Operation dauerte.
Wäre seine Mutter nicht gewesen, hätte ich immerhin im Krankenhaus bleiben können, um da zu sein, wenn es irgendetwas Neues gab. Was war wohl mit Eli? Wusste er es bereits oder hatte Trish ihn schlafen lassen und würde ihm erst morgen erzählen, was passiert war? Mein Herz zog sich zusammen, als ich an Jess’ kleinen Bruder dachte. Er hatte schon Adam verloren. Und er brauchte Jess mehr als jeder andere, sogar mehr als ich.
Wir blieben wach, alle drei, die halbe Nacht. Lincoln sagte Paige irgendwann, dass sie ins Bett gehen sollte, aber sie weigerte sich und saß weiterhin bei uns. Ich war dankbar dafür, auch wenn wir nicht sprachen oder viel tun konnten, während wir auf einen Anruf warteten, der Entwarnung gab. Ben meldete sich noch einmal gegen zwei und sagte uns, dass es keine Veränderungen gab, danach blieb das Telefon lange still.
Irgendwann musste ich dann doch eingeschlafen sein, denn ich hatte wirre Träume und als ich aufwachte, lag ich unter einer Wolldecke auf dem Sofa und mein Bruder hockte davor, eine Hand an meinem Arm. Ich schreckte auf, setzte mich hin, ignorierte den Schwindel.
»Gibt es was Neues?«, fragte ich ängstlich. Lincolns Gesichtsausdruck war weder erfreut noch komplett niedergeschlagen, also konnte ich es daran nicht ablesen.
»Ja, Ben hat gerade angerufen. Jess ist raus aus dem OP, sie konnten ihn stabilisieren und die Blutungen stoppen. Er ist aber noch nicht über den Berg, sein Zustand ist weiterhin kritisch. Die nächsten Stunden werden entscheiden, ob er es schafft. Spätestens morgen früh wissen wir es.«
Schon wieder waren da Tränen, ich wischte sie weg. Erleichterung darüber, dass er noch lebte, vermischte sich mit Angst, ob der nächste Anruf eine andere, schlimmere Nachricht bringen würde.
»Kann ich … Kann ich zu ihm?« Ich musste ihn sehen, um zu glauben, dass er noch da war. Um ihm vielleicht Kraft geben zu können, wie auch immer ich das anstellen sollte.
Lincoln schüttelte den Kopf. »Solange er auf der Intensivstation ist, dürfen nur Angehörige zu ihm, und die auch nur kurz. Außerdem hat Trish Coldwell offenbar Sicherheitspersonal engagiert, das den Bereich, wo Jess liegt, komplett abschirmt. Ben sagt, es wäre wie in einem Hochsicherheitsgefängnis.«
Für einen Moment starrte ich ihn nur an.
»Tut sie das etwa meinetwegen?«, fragte ich dann leise. Wie sollten Jess und ich jemals glücklich werden, wenn seine Mutter es mit solcher Gewalt zu verhindern versuchte? Er hatte gesagt, dass er keine Angst vor ihr hatte, aber er war vermutlich der einzige Mensch, auf den das zutraf. Ich hatte Angst vor ihr. Und wie.
Mein Bruder schüttelte den Kopf. »Nein, Len, bestimmt nicht. Sie hat dem Personal gesagt, sie hätte die Befürchtung, dass derjenige, der auf Jess geschossen hat, noch einmal zurückkommt. Du weißt schon, um zu beenden, was er angefangen hat. Offenbar hat Trish ernsthafte Sorgen, dass es ein gezielter Angriff war, nicht ein missglückter Raubüberfall mit Jess als zufälligem Opfer. Paranoid, wenn du mich fragst. Aber sie wird bestimmt bald wieder einen klaren Kopf bekommen und diese Maßnahmen beenden.«
»Vielleicht auch nicht.« Ich begriff nur verzögert, was das bedeutete, und es erzeugte Panik in meinem Inneren. »Das heißt, ich werde ihn gar nicht sehen dürfen, oder?« Selbst wenn Trish die Sicherheitsleute nicht meinetwegen engagiert hatte, würde sie ihnen sicher die Anweisung geben, mich von Jess fernzuhalten. Warum auch immer, sie hielt mich für verantwortlich.
Lincoln setzte sich neben mich, einen ernsten Ausdruck in den Augen. »Doch, bestimmt. Sie hasst uns, aber sie ist im Grunde ein sehr rationaler Mensch. Sobald es Entwarnung gibt, wird sie einsehen, dass du mit der Sache nichts zu tun hast. Wie solltest du auch, das ist ein absurder Vorwurf.«
In ihrem Kopf vermutlich nicht, wenn sie glaubte, dass der Tod ihres ältesten Sohnes und der Anschlag auf Jess zusammenhingen. Ich dachte an die manipulierten Überwachungsaufnahmen und das, was wir über unsere Geschwister herausgefunden hatten. Nur dass Lincoln davon bisher nichts wusste.
»Linc, ich muss dir was sagen.« Ich wappnete mich innerlich, bevor ich es wagte, ihn anzusehen. Und dann sprach ich es einfach aus. »Es könnte sein, dass Valerie und Adam … dass sie ermordet wurden.«
Mein Bruder war gerade dabei gewesen, aufzustehen, und erstarrte nun in der Bewegung. Über sein Gesicht flackerten Angst, Fassungslosigkeit und Bestürzung. »Was?« Ich las das Wort von seinen Lippen ab, hören konnte ich es nicht. Er ließ sich auf das Sofa sinken.
»Jess und ich haben in den letzten Monaten zusammen ermittelt und es gibt Hinweise darauf, dass jemand in ihrer Suite war, als sie gestorben sind. Jemand, der nicht gesehen werden wollte.« Ich redete weiter, bevor er etwas erwidern konnte. »Jess hat daraufhin eine Spezialistin angeheuert, die den Fall noch mal komplett durchleuchtet. Aber wir haben bisher keine Ergebnisse.«
»Wow.« Lincoln schüttelte den Kopf, erst leicht, dann heftiger, dann wieder leicht. Schließlich stand er doch auf. »Wer … Ich meine, wieso …?«
»Wissen wir nicht. Wir wissen ja nicht einmal, ob es wirklich so ist.« Und ich schwankte seither zwischen dem Wunsch, dass es stimmte, weil Valerie dann entlastet war, und der Hoffnung, dass die beiden nicht auf diese Weise gestorben waren. »Aber wenn Trish etwas davon ahnt, liegt ihre Angst nahe, dass Jess das Gleiche passieren könnte.« Obwohl es keinen Sinn ergab, dass sie dann nicht versucht hatte, die Mörder zu finden – sondern stattdessen diese Schmutzkampagne gegen Valerie gestartet hatte. Aber vielleicht hatte sie erst später Wind davon bekommen.
Lincoln nickte langsam. »Wurde ihr Jüngster nicht auch vor einigen Jahren entführt?«
»Eli, ja. Das ist sechs Jahre her.«
»Dann sollte sie wohl eher sich selbst die Schuld geben als dir. Offenbar lebt man als Coldwell gefährlich.« Er stieß die Luft aus. »Glaubst du, dass es wirklich so ist? Dass jemand die beiden getötet hat?«
Ich verschränkte meine Finger miteinander und sah auf den Teppichboden zu meinen Füßen. »Keine Ahnung. Aber wenn es so ist, werden wir denjenigen finden, der dafür verantwortlich ist.«
»Ihr? Bist du verrückt?« Seine Augen wurden groß. »Ich weiß ja, dass du das aufklären wolltest, aber Mord … so etwas ist Sache der Polizei.«
»Die Polizei steckt vielleicht mit drin, Lincoln. Wir können denen nicht vertrauen, was diesen Fall angeht.«
Mein Bruder schwieg, ziemlich lange. Dann hob er den Kopf und sah sehr entschlossen aus. »Wenn das so ist, brauchst du Schutz. Ich werde mich darum kümmern.«
Ich wusste seine Fürsorge zu schätzen, aber gerade konnte ich mich damit nicht befassen. »Können wir das besprechen, wenn alles vorbei ist? Ich wollte einfach nur, dass du Bescheid weißt.«
»Natürlich.« Er lächelte schief. »Ich mache uns mal Kaffee.«
Er ging raus und ich schaute zur Uhr an der Wand. Seit Lincoln mich geweckt hatte, waren gerade mal fünfzehn Minuten vergangen, wir hatten kurz nach sieben am Morgen. Fuck. Das würde der längste Tag meines Lebens werden.
Mein Handy, das ich nach der Ankunft in der Wohnung auf den Couchtisch gelegt hatte, begann, leise zu vibrieren. Als ich den Namen auf dem Display sah, griff ich hastig danach.
»Malia?«
»Len, ich habe es gerade gehört, geht’s dir gut?« Sie klang mehr als nur besorgt. »Warst du dabei, als es passiert ist?«
Mit kurzen, völlig unzureichenden Worten schilderte ich ihr, wie ich den Angriff auf Jess miterlebt hatte. Weit weg, ohne eingreifen zu können. Ob es mich auch erwischt hätte, wenn ich bei ihm gewesen wäre? Ob der Täter ihn in der Wohnung aufgesucht hätte, wenn er ihm nicht dort auf der Straße begegnet wäre? Die Gedanken ließen meine Hände wieder zittern, aber ich zwang mich zur Beherrschung.
»Weiß das NYPD schon irgendetwas?«, fragte ich. Meine ganze Aufmerksamkeit war zwar auf Jess gerichtet, aber deswegen war es ja dennoch wichtig, denjenigen zu finden, der ihm das angetan hatte.
»Sie werten noch alle Zeugenaussagen aus und ein Team ist wohl gerade dabei, die Leute in der Nachbarschaft zu befragen. Der Verdacht lautet erst mal Raubüberfall. Das sechste Revier ist zuständig, ich fahre gleich mal hin, ich habe keinen Dienst. Hast du schon eine Aussage gemacht?«
»Ich … Nein. Ich war ja auch gar nicht dabei und am Telefon konnte ich nichts hören, das hilfreich wäre.« Da waren keine anderen Stimmen gewesen oder irgendetwas, das zur Ergreifung der Täter führen könnte.
»Okay, falls dir doch etwas einfällt, ruf mich an. Ich melde mich, wenn ich was Neues weiß.« Sie legte auf und ich nahm das Handy herunter. Konnte es wirklich ein Raubüberfall gewesen sein? War Jess nur zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen? Ich kannte ihn gut genug, um zu wissen, dass er nicht an materiellen Dingen hing und zu klug war, um ein solches Risiko einzugehen. Er hätte mit Sicherheit Geld, Handy oder Autoschlüssel hergegeben, wenn er mit einer Waffe bedroht worden wäre.
»Wer war das?«, fragte Paige, als Lincoln und sie mit einem Teller Bagels und einer Kanne Kaffee zurückkamen.
»Malia. Das NYPD ermittelt in Greenwich, sie befragen gerade die möglichen Zeugen. Sie ruft mich an, wenn sie neue Infos hat.« In dem Moment, als ich es ausgesprochen hatte, wanderte meine Aufmerksamkeit schon wieder weg von den Ermittlungen und Malia. Natürlich war es wichtig, dass der Täter gefasst wurde. Aber erst einmal war es am wichtigsten, dass Jess überlebte.
Ich nahm einen Kaffee von Paige entgegen und lehnte den Bagel ab.
Dann begann ich, wieder zu hoffen.
4
Helena
Der Tag verging so langsam, wie ich es erwartet hatte. Nachdem es draußen irgendwann hell geworden war, rief Lincoln unsere Eltern an und berichtete ihnen in knappen Worten, was passiert war und dass Trish Coldwell vermutlich in der nächsten Zeit zu sehr harten Bandagen greifen würde. Was sie darauf antworteten, bekam ich nicht mit und es interessierte mich auch nicht. Ich konnte gerade nicht darüber nachdenken, was mein gestriger Bruch mit ihnen bedeutete. Oder wie unser Verhältnis in Zukunft aussehen würde. Ich wusste nur, dass ich mich jederzeit wieder so entschieden hätte. Gegen ein Leben, das mir nicht gehörte. Und für Jess.
Lincoln blieb zu Hause, aber ich fragte nicht, was meine Eltern dazu sagten. Stattdessen zwang ich zwei Bissen eines Bagels herunter und spülte mit so viel Kaffee nach, dass mein Herzschlag von diesem kräftigen, angsterfüllten Pochen zu einem hektischen Stakkato wechselte. Gegen elf überlegte ich, ob ich eine Runde laufen gehen sollte, um wenigstens ein bisschen von meiner Anspannung loszuwerden, da klingelte mein Handy. Ich kannte die Nummer nicht und für eine Sekunde hoffte ich, dass es Jess war, aber das war natürlich unmöglich. Sollte ich es einfach klingeln lassen? Es gab außer ihm und vielleicht noch Ben niemanden, mit dem ich gerade reden wollte. Trotzdem konnte es wichtig sein.
»Hallo?«, fragte ich rau. Das Weinen in der Nacht hatte seine Spuren hinterlassen.
»Helena?« Die Stimme kam mir bekannt vor, aber ich konnte sie nicht direkt zuordnen.
»Ja, ich bin es. Wer ist da?«
»Hier ist Eli. Eli Coldwell.« Jess’ jüngerer Bruder wirkte gefasst, aber eher auf die Art, bei der man mit aller Macht versuchte, nicht den Verstand zu verlieren. Ich konnte es ihm nachfühlen. »Ich hoffe, es ist okay, dass ich … mir deine Nummer besorgt habe.«
»Natürlich ist es das«, beteuerte ich, während mein Herzschlag alle Rekorde brach. Rief Eli an, weil er etwas wusste? Gab es schlechte Nachrichten zu Jess’ Zustand?
»Ich wollte nur … Ich dachte, vielleicht weißt du was Neues über Jess? Meine Mom ist im Krankenhaus, aber ich kann sie schon seit einer Weile nicht mehr erreichen und ich habe Angst, dass das was Schlimmes bedeutet …« Elis Stimme brach und mein Herz gleich mit. Offenbar wusste er noch weniger als ich.
»Jess ist aus dem OP raus, sie konnten ihn stabilisieren.« Dem erleichterten Einatmen am anderen Ende entnahm ich, dass Trish ihm nicht einmal das gesagt hatte. »Aber wir müssen noch abwarten.«
»Okay, das ist gut, oder?« Es klang mehr als hilflos. »Dann … danke, Helena. Wenn du wieder etwas hörst, könntest du mich vielleicht anrufen? Das wäre nett von dir.« Wie höflich er war, obwohl er höllische Angst haben musste, auch noch seinen anderen Bruder zu verlieren. Gerade er mit seiner Vorgeschichte. Auf einmal kam mir ein fürchterlicher Verdacht.
»Eli, bist du etwa allein zu Hause?«, fragte ich.
»Ja«, kam die leise Antwort und seine Stimme zitterte, weil er sich so sehr beherrschte. »Dad ist nicht in der Stadt. Und meine Großeltern sind auch nicht erreichbar.«
Ich schnappte nach Luft. Klar, Eli war fast sechzehn und damit beinahe erwachsen, natürlich brauchte er keine Nanny mehr, aber ihn in einer solchen Situation sich selbst und seinen Gedanken zu überlassen war grausam. Allerdings passte es zu Trish. Wenn ich mich daran erinnerte, wie sie Jess von Adams Tod unterrichtet hatte, war es sogar genau das, was man von ihr erwarten konnte.
Daher traf ich, ohne zu zögern, eine Entscheidung. Ich war gerade eigentlich selbst auf emotionale Unterstützung angewiesen, aber Eli war es noch mehr.
»Ich bin in zwanzig Minuten bei dir«, sagte ich zu ihm und stand bereits auf.
»Das ist nicht nötig, wirklich nicht. Ich komme klar.«
Es klang nicht so, als wäre es die Wahrheit. Trotzdem wollte ich ihn nicht bevormunden, indem ich behauptete, er käme nicht zurecht. Also wählte ich einen anderen Weg.
»Da bin ich sicher, aber es würde vielleicht uns beiden helfen.«
»Okay«, willigte Eli erleichtert ein. »Danke, Helena.«
»Bis gleich.« Ich legte auf und ging zum Garderobenschrank, um meinen Mantel herauszuholen.
Lincoln schien mich gehört zu haben, denn er kam in den Flur gelaufen. »Was ist los, wo willst du hin?«
»Jess’ jüngerer Bruder ist allein zu Hause und dreht wahrscheinlich bald durch, weil ihm niemand sagt, was los ist. Ich muss zu ihm.«
Er nickte. »Dann fahre ich dich. Ich habe kein gutes Gefühl, dich da allein reingehen zu lassen.«
Ich wusste, was er meinte – Coldwell House war Trishs Revier und keiner von uns hatte eine Ahnung, was sie tun würde, wenn sie nach Hause kam und mich in ihrer Wohnung vorfand.
»Gut.« Ich fühlte mich nicht stabil genug, um das Angebot abzulehnen. Mein Bruder war mir in den letzten Stunden eine solche Stütze gewesen, dass es mir Angst machte, sie zu verlieren.
Paige kam dazu, als wir dabei waren, unsere Mäntel anzuziehen. »Gibt es etwas Neues?«
Mein Bruder erklärte ihr, warum wir wegmussten, und sie nickte. »Wenn ihr schon dort seid, dann tut mir einen Gefallen: Taucht ihre Zahnbürste ins Klo.«
Ich lachte, obwohl mir permanent zum Heulen zumute war, aber Paige, die einen Witz machte, war einfach zu komisch. Die beiden lachten mit und es tat gut, für ein paar Sekunden zu vergessen, dass es einer der schlimmsten Tage meines Lebens war. Aber dann kehrten die Schatten zurück, die Angst, die Sorge. Und als Lincoln und ich das Haus verließen, war ich nicht sicher, ob nicht doch ein Fluch auf unseren Familien lag.
Zwanzig Minuten später hielten wir vor dem unendlich hohen Gebäude und der Valet-Service kümmerte sich um Lincolns Auto. Obwohl wir wussten, dass Eli auf Unterstützung wartete, blieben wir beide vor dem Haupteingang stehen und sahen an der weißlichen Glasfassade hoch. Ich war ein kleines bisschen eingeschüchtert, musste ich zugeben. Zwar hasste ich dieses Bauwerk wie die Pest. Aber beeindruckend war es dennoch.
»Zwei Westons in Coldwell House?« Ich schaute meinen Bruder an. »Es gibt Leute, die dachten, dafür müsste Weihnachten auf Ostern fallen.«
»Dann hoffe ich mal, dass wir heute noch etwas zu feiern haben.« Er legte leicht die Hand auf meinen Rücken und gemeinsam traten wir durch das gläserne Eingangsportal. Dahinter sah es aus wie in einer schwarzen Antarktis – schwarzer Boden, schwarze Möbel, schwarzer Empfangstresen, der vermutlich längste seiner Art in New York. Wir traten auf eine junge Frau in dunkler Uniform zu, die dahinter stand und uns zu erwarten schien.
»Miss Weston?« Die Concierge nickte mir höflich zu und schaute dann zu meinem Bruder. »Und Mr Weston, wie ich sehe. Sie werden erwartet. Ich schalte Ihnen Fahrstuhl vier für das Penthouse frei.«
Ich hob leicht die Augenbrauen in Lincolns Richtung, aber dankte ihr und wir gingen zu den Aufzügen. Offenbar hatte Eli die Weitsicht gehabt, über meinen Besuch Bescheid zu geben, weil er wusste, dass ich sonst vielleicht daran gehindert worden wäre, zu ihm gelassen zu werden. Mir war klar gewesen, dass Jess’ Bruder klug war. Aber dass er in einer solchen Situation noch auf diese Art mitdenken konnte, damit hatte ich nicht gerechnet.
Wir betraten den Aufzug und fuhren nach oben, wobei mir aufgrund der Geschwindigkeit des Speedlifts leicht flau im Magen wurde.
»Alles okay?«, fragte Lincoln.
»Ja, geht schon. Niemand sollte sich mit mehreren Metern pro Sekunde nach oben bewegen, wenn du mich fragst.«
Bevor er antworten konnte, waren wir jedoch bereits da, die Türen glitten auf und gaben den Blick in eine gewaltige Eingangshalle frei. Eli stand im Durchgang zum Wohnbereich, die Hände fest um seine Unterarme geklammert. Als er mich sah, kam er auf mich zu, und obwohl wir uns bisher nur wenige Male unterhalten hatten und sicher nicht nahestanden, schloss ich ihn fest in meine Arme – vielleicht war es auch umgekehrt – und wir hielten uns gegenseitig aufrecht. Sobald ich ihn losließ, lächelte ich beruhigend, obwohl ich kein bisschen beruhigt war. Eli brauchte das jetzt.
»Tut mir leid, dass ich dich angerufen habe.« Er strich sich fahrig über das Gesicht. »Aber ich wusste nicht, wen ich sonst fragen sollte, um herauszufinden, was mit Jess ist. Mom geht nicht an ihr Handy.«
Ich unterdrückte den Impuls, ein paar passende Takte über Trishs Verhalten zu verlieren, und berührte ihn stattdessen am Arm. »Es gibt keinen Grund, dich zu entschuldigen. Niemand, dem Jess etwas bedeutet, sollte gerade allein sein.« Ich drehte mich um. »Du kennst meinen Bruder Lincoln?« Eli musste seine Mutter nur selten zu Veranstaltungen begleiten, aber ich war mir dennoch sicher, dass die beiden sich schon mal irgendwo begegnet waren. »Sein Freund Ben arbeitet in dem Krankenhaus, in dem Jess liegt, und er hält uns über seinen Zustand auf dem Laufenden.« Ansonsten hätte ich vollkommen im Dunkeln getappt. Ben hatte wirklich etwas gut bei mir.
»Was, im Ernst?« Eli sah Lincoln groß an, als hätte er nicht erwartet, dass auch noch ein anderer Weston in der Lage war, über seinen Nachnamen hinwegzusehen. »Danke, echt.«
»Kein Problem.« Lincoln lächelte leicht und mir kam in den Sinn, dass unsere Eltern einander vielleicht hassten, aber dass das nicht für unsere Generation gelten musste. Valeries und Adams Liebe, die zwischen Jess und mir oder die Tatsache, dass mein Bruder und ich in dieser Wohnung waren, all das schienen Argumente dafür zu sein, dass Hass sich nicht vererbte.
Elis Blick huschte umher, als wüsste er nicht, was er fokussieren sollte, um nicht die Fassung zu verlieren. Ich fasste ihn vorsichtig an den Schultern.
»Er schafft das«, wiederholte ich Lincolns Worte. »Dein Bruder ist der stärkste Mensch, den ich kenne. Er kommt zu uns zurück, okay?«
Eli nickte tapfer.
Lincoln nahm mir meinen Mantel ab und legte ihn zusammen mit seinem einfach über die Lehne der großen weißen Ledercouch, die in dem riesigen Raum stand. »Ich schau mal, ob ich Tee finde.«
Er ging zur Küche, die wie alles in diesem Penthouse monströs war. Aber es war auch sehr unpersönlich, wie mir auffiel, fast schon steril. Ein kompletter Kontrast zu Jess’ Wohnung, die mit dem dunklen Holz und der riesigen Samtcouch warm und gemütlich wirkte. Hier war alles weiß, der Boden, die Möbel, die Küche. Und mittendrin in einem ausgeleierten Sweatshirt und zerschlissener Jeans Eli, der in dieses Penthouse so wenig zu passen schien, dass es wehtat. Er atmete ein und sah zur Fensterfront. Aber er schien den Wahnsinnsausblick auf den Central Park nicht zu registrieren.
»Wer tut so etwas?«, fragte er leise. »Ich meine, es passieren jeden Tag schlimme Dinge in dieser Stadt, aber warum sollte irgendjemand ausgerechnet Jess angreifen? Er hat doch niemandem etwas getan.«
Manchmal brauchte es keine Provokation für eine solche Tat, das sagte ich jedoch nicht, weil Eli es wusste. »Das NYPD ermittelt gerade in alle Richtungen. Sie denken, es war ein Raubüberfall.«
Eli sah zu Boden und ich ahnte, dass er daran dachte, wie er selbst Opfer von Gewalt geworden war, als man ihn entführt hatte. Um zu verhindern, dass er sich tiefer in seine Erinnerungen begab, suchte ich nach einem anderen Thema und fand eins: Auf der Couch lag ein Tablet und daneben ein Skizzenbuch.
»Du zeichnest?«, fragte ich.
»Ja, schon.« Er hob die Schultern. »Nichts Besonderes, nur Sachen, die mir in den Sinn kommen oder die ich irgendwo gesehen habe. Meine Mom hält es für Zeitverschwendung, aber ich mag es.«
Und wieder ein Grund, Paiges Vorschlag mit der Zahnbürste doch noch in die Tat umzusetzen. Ich verstand immer mehr, warum Jess trotz seiner Abneigung gegen New York in der Stadt blieb. Weil sein Bruder sonst überhaupt niemanden hatte, der auf seiner Seite war.
Die Angst, Jess zu verlieren, wurde mit einem Mal wieder schmerzhaft heftig, aber ich atmete sie aus. Positiv denken. Wir mussten positiv denken, alles andere half ihm nicht.
»Darf ich mir die Zeichnungen ansehen?« Ich wusste, dass Künstler manchmal eigen mit ihren Entwürfen waren, und ich wollte Elis Grenzen nicht überschreiten.
»Klar.« Er griff nach dem Block, aber dann schienen ihm seine Manieren wieder einzufallen und er deutete auf die Couch als Angebot, mich zu setzen.
Ich nahm es an, während mein Bruder in der Küche Wasser in einen Designerkessel füllte und ihn auf den Herd stellte. Hoffentlich funktionierten die Geräte hier überhaupt. Ich hielt Trish für keine Person, die regelmäßig kochte.
Ich schlug den Block auf und merkte in der ersten Sekunde, dass ich vieles erwartet hatte, aber nicht das. Vor mir sah ich nicht die unbeholfene Zeichnung eines Teenagers, der zum Zeitvertreib ein bisschen herumkritzelte. Sondern eine Szene an einem Pier, die so lebendig war, dass ich glaubte, reale Menschen vor mir zu sehen. »Wow. Das ist echt gut.«
Eli sah ein bisschen verlegen aus. »Ist nur Gekritzel.«
»Das ist kein Gekritzel«, widersprach ich und fühlte mich wie eine stolze große Schwester, mit dem Unterschied, dass das hier wirklich gut war und ich nicht so tun musste.
Es folgten einige sehr detaillierte Zeichnungen von Gebäuden, aber mir fiel auf, dass Eli jedes Mal Menschen hineinzeichnete, die vor dem Haus entlangspazierten oder irgendwo saßen. Als würde er sich darüber an die Anwesenheit von Personen gewöhnen wollen, was vielleicht gar keine schlechte Idee war, um seine Ängste zu therapieren. Denn die Menschen in seinen Bildern konnte er kontrollieren, etwas, das ihm da draußen nicht gelang. Es war aber nicht das Einzige, das mir auffiel. Es waren nämlich auch noch andere Lebewesen auf den meisten der Zeichnungen zu sehen.
Ich schaute von dem Block auf. »Du magst Hunde, oder?« Es waren alle Sorten Vierbeiner dabei, kleine Dackel ebenso wie große Doggen, mit einer Detailliebe gezeichnet, dass die Antwort auf meine Frage klar war.
»Ich liebe sie.« Für einen kurzen Moment sah ich in Elis Gesicht etwas aufleuchten, dann verschwand es wieder unter der blassen Maske von Furcht. »Ich hätte gern einen, aber Mom erlaubt es nicht. Sie meint, ich könnte mich mit meinen Attacken nicht richtig darum kümmern.« Er hob hilflos die Schultern.
Als er das sagte, spürte ich Mitgefühl. Und mir fiel etwas ein – ein Artikel, den ich neulich gelesen hatte, über Assistenzhunde. Blindenhunde kannte jeder, aber mittlerweile wurden auch welche für andere Zwecke ausgebildet – wie Diabetes, Epilepsie oder posttraumische Belastungsstörungen, wie Eli eine hatte. Diese Hunde waren unglaublich, sie erkannten nicht nur eine drohende Panikattacke bereits lange vor dem Menschen, sondern konnten sie auch unterbrechen, indem sie Körperkontakt suchten oder im Fall von Albträumen das Licht einschalteten. Ich würde schauen, ob ich den Artikel wiederfand. Sicher würde Jess … Jess. Der Stich in meinem Herzen war so stark, dass ich einen Schmerzenslaut unterdrücken musste, als ich an ihn dachte. Für einen Moment hatte ich vergessen, dass er gerade um sein Leben kämpfte, nur eine Sekunde, aber es reichte aus. Es war wie bei Valerie. In der ersten Zeit hatte ich häufig an sie gedacht, als wäre sie noch da, hatte sie ganz selbstverständlich in meine Planungen einbezogen, obwohl ich in England auf dem Internat gewesen war. Nur kurze Momente des Vergessens, und jedes Mal war der Fall auf den Boden der Wahrheit knallhart gewesen. So auch jetzt.
Aber Jess ist nicht tot, sagte ich mir immer und immer wieder. Er lebte. Er würde überleben. Alles andere durfte in meinem Kopf keinen Platz haben. Und trotzdem bahnte sich die Angst erneut einen Weg durch mein Inneres wie eine Schlange, die nur darauf wartete, zuzubeißen.
Eli legte eine Hand an meinen Arm und ich sah auf. Er hatte offenbar bemerkt, dass ich mich in meinen düsteren Gedanken verloren hatte, und holte mich mit dieser flüchtigen Berührung zurück ins Jetzt. Ich rang mir ein Lächeln ab, weil ich wusste, dass es nötig war, auch wenn es sich unecht anfühlte.