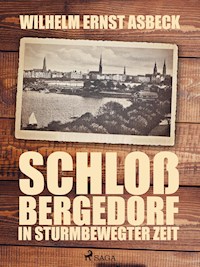Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Asbecks Roman beginnt und endet mit einem Todesfall: Es ist – beide Male – der Tod von Anton Beha, genannt Dorer, Spitzname zuletzt "der alte Jim", geboren am 10. August 1795 als uneheliches Kind der Rosa Beha im Bregtal unweit Vohrenbach im Schwarzwald, Deutschland. Dorer stirbt am 20. Februar 1850 in New York und wird am 24. Februar auf dem Friedhof der Namenlosen in Pottersfield als Nummer 20 356 ins Grab gesenkt. "Zur gleichen Stunde, als dieses geschah, kauft ein Egidi Dorer aus dem Nachlaß seines verunglückten Vetters Sepp den verfallenen Berghof, der – so weit Menschen im Bregtal zurückdenken können – im Besitz der Familie Dorer gewesen ist. Mit jenen beiden Begebenheiten findet eine lange Geschichte ihren Abschluß. Sie berichtet von den Schicksalswegen der Berghofdorer; von Glück und Leid, Schuld und Sühne, Niedergang und Wiederaufbau!" Ebendiese Geschichte erzählt auf den folgenden etwa 250 Seiten Wilhelm Ernst Asbecks spannender Heimatroman.Wilhelm Ernst Asbeck (1881–1947; Pseudonym: Ernst Helm) war ein deutscher Schriftsteller. Wilhelm Ernst Asbeck lebte in Hamburg; während des Zweiten Weltkriegs übersiedelte er nach Burg (Dithmarschen). Sein literarisches Werk besteht vornehmlich aus Romanen, Erzählungen, Märchen, Theaterstücken und Hörspielen, die sich häufig historischen Stoffen annehmen und überwiegend in Asbecks norddeutscher Heimat, etwa im Raum Hamburg und an der Nordseeküste, aber auch etwa in Skandinavien angesiedelt sind.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 319
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wilhelm Ernst Asbeck
Wetterleuchten über dem Schwarzwald
Die Schicksalswege der Berghofdorer
Erzählt
Saga
Wetterleuchten über dem Schwarzwald
© 1939 Wilhelm Ernst Asbeck
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711517857
1. Ebook-Auflage, 2016
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Erster Teil.
1.
Vor einem hohen, finsteren Haus der 29. Strasse in New York hält ein Wagen. Zwei Männer entsteigen ihm und heben eine Bahre heraus. Zerlumpte Kinder eilen herbei. Vorübergehende bleiben stehen und bilden eine Gasse zwischen dem Hauseingang und dem Wagenschlag. Aus einem dunklen Loch der Mietskaserne wird ein Elender hervorgeholt. Seine Augen liegen tief in den Höhlen, das Antlitz ist von Falten zerfurcht. Er gleicht kaum noch einem menschlichen Wesen, eher schon einem Skelett.
Neugierig, ohne Mitempfinden, gaffen die Umstehenden. Mancher von ihnen wird einst genau so enden. Aber was macht es aus, wenn ein kleines Menschenlicht unter Millionen verlöscht? Täglich werden neue Menschen geboren, täglich speien die Schiffe der alten Welt frische lebende Fracht an die Küsten Amerikas. Pah, jeder muss seine Ellbogen rücksichtslos gebrauchen, um nicht im Strudel des Existenzkampfes zu versinken.
„Old Jim kommt auch nicht wieder!“ sagt eine Frau laut, so dass es der Kranke hören muss; ihre harten Gesichtszüge verzerren sich zu einem abstossenden Lachen.
Der alte Jim hat nicht weit zu fahren. Am Ende der Gasse steht ein langgestrecktes, düsteres Gebäude. Es sieht eher einem Gefängnis als einem Krankenhaus ähnlich. Wie zum Hohn glänzen über dem Tor die Worte „Bellevue-Hospital!“.
Wenige Tage später wird Jim wieder auf eine Bahre gelegt. Er spricht nicht mehr, er klagt nicht mehr. Er ist erlöst. Einige Männer stehen um ihn herum. Der eine nimmt, wie es die Anstaltsvorschrift erfordert, die Fingerabdrücke vor. Ein anderer hat ein dickleibiges Buch aufgeschlagen. Auf den Kopf des Blattes klebt er das Lichtbild des Toten und lässt einen Raum für die Fingerabdrücke frei.
Er schreibt:
„Gestorben: 20. Februar 1850.
Todesursache: Hungertyphus und übermässiger Genuss von Rauschgift.
Grösse: 1,64 Meter.
Haar: weiss, stark ergrauter Vollbart.
Hautfarbe: gelb.
Augen: schwarz.
Besondere Merkmale: keine.
Verheiratet: nein.
Angehörige: keine.
Name: Anton Beha, genannt Dorer.
Geboren: am 10. August 1795 als uneheliches Kind der Rosa Beha im Bregtal unweit Vöhrenbach im Schwarzwald, Deutschland.“
Der Name wird rot unterstrichen, denn es ist selten der Fall, dass die ins Bellevue-Hospital Eingelieferten Papiere bei sich tragen. In grossen Schriftzügen wird noch die laufende Nummer 20 456 vermerkt.
Das ist also das Ende des alten Jim, wie ihn die Leute im Elendsviertel riefen. Auf Nahrung hatte er in den letzten Jahren manchen Tag verzichtet, aber sein geliebtes Rauschgist konnte er nicht missen. Immer neue Mittel und Wege fand er, um es sich zu beschaffen. Er wusste, es würde ihn vorzeitig zu einem hinfälligen Greis machen und früh ins Grab bringen. Er wollte es so!
Liebe, Treue und Rechtschaffenheit waren ihm Begriffe gewesen, über die er sich lachend hinwegsetzte. Doch je älter er wurde, desto hartnäckiger packte ihn das Heimweh. Er hatte ehemals nur einen Freund, Karl Deubner, der mit ihm herübergekommen war. Ihm vertraute er sich eines Tages an; er schämte sich zugleich seiner Schwäche und fürchtete, verspottet zu werden. Aber Karl erging es wie ihm. Beide hatten gleichviel auf dem Kerbholz, der eine war nicht besser als der andere. Bei ihrer Rückkehr nach Deutschland gaben sie sich der Hoffnung hin, unerkannt zu bleiben. Ein verhängnisvoller Irrtum! Die von ihnen früher um Hab und Gut betrogenen Uhrmacher bereiteten ihnen einen heissen Empfang. Den Karl fand man erschlagen beim Galgen im Stöcklewald, den Anton retteten nur seine schnellen Füsse. Anton ging wieder dahin, woher er gekommen war. Fortan war ihm die Heimkehr verwehrt. Die wilde Sehnsucht nach den Bergen und Wäldern ergriff ihn aber nur noch stärker und machte ihn krank. Die von ihm einst missachtete Heimat rächte sich!
Als es ans Sterben ging, hatten diese Bilder noch einmal Gestalt angenommen. —
In den Kellergewölben des Bellevue-Hospitals reiht sich in den Wandverliessen Sarg an Sarg; solche, nicht grösser als ein Schuhkarton, und auch solche, die die Körper von Riesen Bergen. Alle sind hier gleich, ob sie im Leben Grafen, Landstreicher, Bettler oder Verbrecher waren. Alle ruhen in Särgen, die aus ungehobelten Brettern bestehen, auf denen ihre Nummer und das Datum des Todestages gemalt sind. Auch Nummer 20 456 vom 20. Februar 1850 ist hier aufgestellt.
Das Leben der aufgebahrten Toten glich wohl einem Roman. Viele hatten Tage des Glanzes und Reichtums gesehen, bevor sie im Sumpf New Yorks untergingen; andere kannten nur Hunger, Not und Elend. Jetzt ruhen sie Seite an Seite; die am Hunger Gestorbenen, die durch ekelhafte Krankheiten Verendeten, die Selbstmörder und die Verunglückten. Das Armenhospital hatte Menschen jeden Alters und jeder Nation geborgen, aber bis zu Anton Beha, genannt Dorer, sind es ihrer erst armselige 20 456 gewesen. Noch Hunderttausende werden im Laufe der Jahre Blatt um Blatt, Buch um Buch füllen.
Die Torflügel werden aufgerissen. Zwei Lastwagen poltern über das Pflaster. Sie sind mit siebzehn Holzsärgen beladen. An den Fassaden vornehmer Häuser, den prunkvollen Schaufenstern der Geschäfte und Kaufhäuser, an lachenden Menschen und spielenden Kindern geht die Fahrt vorüber. Niemand kümmert sich um die unheimlichen Fuhrwerke. Kaum, dass hin und wieder jemand einen Blick voll Abscheu und Grauen hinüberwirft. Die da einhergehen, stehen ja noch mitten im Leben!
Das Gewühl der verkehrsreichen Strassen der Innenstadt liegt nun hinter den Fahrern. Einsamer werden die Gassen, schneller greifen die Pferde aus. Die letzten Häuser der Vororte entschwinden. Die Gespanne rollen über die Landstrasse. Nur Felder und Wiesen breiten sich an ihr aus. Endlich ist die Küste erreicht. Ein Stück geht’s am Strand entlang. Dann wird Halt gemacht. An der Brücke wartet schon die Fähre. Drüben erhebt sich aus dem Wasser Potters-Field, das Ziel. Es gibt kaum eine traurigere Stätte auf Erden. Sie ist der Friedhof der Namenlosen. Kein Grabkreuz, keine Blume, kein Strauch unterbrechen die trostlose Eintönigkeit der Zementplatten, die sich in unabsehbarer Folge aneinanderreihen. Sie tragen keine Inschrift, keinen Namen. Nur Nummern.
Jetzt wird Nummer 20 456 mit sechzehn Leidensgefährten ins Grab gesenkt. Kein Priester, kein Angehöriger steht an der Gruft. Keiner weint den Verstorbenen eine Träne nach. Sie sind vergessen und verschollen.
Sträflinge verrichten die Arbeit der Totengräber. Ein Beamter des Hospitals vergleicht die Zahlen auf den Särgen mit einem Buch. Die Erdschollen klatschen in die Tiefe.
Hier auf Potters-Field, der Insel der Unbekannten, ruht der Uhrenträger Anton Beha, genannt Dorer. Seine Spur ist ausgelöscht. Niemand auf der weiten Welt wird nach seinem verfehlten Leben fragen. Ja, alter Jim, das Schicksal ist hart, aber es ist gerecht: so wie du dich bettest, so schläfst du!
*
Zur gleichen Stunde, als dieses geschah, kauft ein Egidi Dorer aus dem Nachlass seines verunglückten Vetters Sepp den verfallenen Berghof, der — so weit Menschen im Bregtal zurückdenken können — im Besitz der Familie Dorer gewesen ist.
Mit jenen beiden Begebenheiten findet eine lange Geschichte ihren Abschluss. Sie berichtet von den Schicksalswegen der Berghofdorer; von Glück und Leid, Schuld und Sühne, Niedergang und Wiederaufbau!
*
2.
Dicht bei Furtwangen, etwa auf halber Höhe zwischen Gipfel und Talsohle, liegt der Berghof. Über ihm erhebt sich der Wald mit uralten, gen Himmel ragenden Baumriesen. Hell und freundlich ist heute das Grün der Tannen, prangen sie doch im frischen Frühlingskleid. Unter der Holzbrücke jagt die breite Breg dahin. Kristallklar ist ihr Wasser. Hier und dort steht eine Forelle in der Sonne, bis sie wie der Blitz davonschiesst. Der Fluss hat sich in blumenbunte Wiesen eingebettet. Linker Hand zieht sich in vielen Krümmungen die Landstrasse hinauf. Hin und wieder fährt ein Ochsengespann vorüber, auch mal ein von Pferden gezogener Bauernwagen. Vereinzelt ist dort, wo sich die Hügel erheben, ein Haus erbaut. Ringsumher reiht sich Anhöhe an Anhöhe, Berg an Berg. Teils reicht der Forst noch hart bis an das Ufer der Breg heran, aber meistens hat die Axt die Baumbestände schon arg gelichtet, und wo sich einst dichter Wald befand, haben Menschenhände Matten und Kornfelder geschaffen. Von den Weiden klingt das Läuten der Kuhglocken. Der Fremde glaubt, einen einzigen Ton zu hören, aber der Hirtenbub weiss, dass jede Glocke einen anderen Klang hat, und hieran erkennt er ihre Trägerin, ohne sie zu sehen.
Bei der Brücke zweigt sich ein Weg von der Landstrasse ab, steigt allmählich bergan und mündet vor dem wuchtigen Haus des Berghofes. Ein Dutzend kleiner Fenster mit weissen Rahmen, sauberen Gardinen und Blumen blicken vom ersten Stockwerk hernieder. Darüber hängt eine Galerie. Sie wird von dem weit vorspringenden, schindelgedeckten Dach überragt, das an der Rückseite des Gebäudes, wo sich auch Ställe und Scheune befinden, den Erdboden berührt. Im Vorderbau, der infolge des abfallenden Geländes einen vollen Stock Raumgewinn aufweist, tritt es zurück, damit auch in die Gesindestuben Licht und Sonne dringen. Hinter dem Berghof stehen einige Fruchtbäume, Kirschen, Äpfel und Birnen. Ein wenig oberhalb des Hauptgebäudes sind das Milchhaus und die kleine Kapelle mit dem Zwiebeltürmchen errichtet. Sie bilden gleichzeitig einen Schutzwall gegen Sturm und Unwetter.
Sonntag ist heut! Aber nicht nur das, Festtag ist obendrein! Der Xaver Dorer und seine Monika feiern Kindtauf’! Ein Nachzügler ist eingetroffen, der Adam. Der Kirchgang liegt nun hinter ihnen. In allen Stuben sitzen die Gäste. Auf der grossen Diele sind Tische und Bänke aufgeschlagen. Es wird gespeist, gezecht, gesungen und gelacht. Der Schustertoni hat seine Trompete mitgebracht, der Schnefflerfranz seine Klarinette und der Bürstenkarl seine Fiedel. Da bleibt es nicht beim Gesang, die Jugend will tanzen, und die Alten wollen zeigen, dass sie sich noch nicht alt fühlen. Aber jetzt hat erst einmal der Maurerwendel das Wort. Stolz ist er darauf, des Xavers Bruder zu sein und auch vom Berghof abzustammen. Er ist voll des Lobes, wie vorbildlich Xaver und seine Moni wirtschaften und das Erbe der Väter verwalten. Reden kann er wie ein Buch! Von den Eltern, Grosseltern und Urgrosseltern weiss er manche wackre Tat und manch schnurriges Stücklein zu berichten. Man hört ihn gern, aber wer ein Ohr dafür hat, merkt aus seinen Worten etwas Neid und verhaltenen Grimm heraus. Doch der Wendel ist viel zu klug, um es zu einem Bruch mit seinem reichen Bruder kommen zu lassen. Bei seinem grossen Durst, dem schlechten Geschäftsgang und lockeren Leben ist er immer in Geldverlegenheit. Da muss denn der Berghofbauer oft aushelfen. Angenehm ist solche Sache nicht, manche grob vorgebrachte Wahrheit muss der Wendel einstecken, ehe der Bauer in den Beutel langt, aber schliesslich tut er es ja doch. So eine wohltätige Quelle wird kein gescheiter Mann verstopfen, und der Maurerwendel zählt sich zu den Gescheiten.
Nun hat er seine Taufrede beendet. Den Adam liess schon die Tante Regina, der Moni Schwester, hoch leben. Nun ist es an ihm, auf das Wohl der Eltern des Neuangekommenen anstossen zu lassen, aber grosszügig, wie er nun einmal ist, schliesst er auch dessen Brüder, den Uhrmacherleo und den Andres, gleich mit ein. O, er ist ein guter Schauspieler. Mit welcher Unschuldsmiene er Erstaunen heucheln kann! Er stellt sich, als bemerke er erst jetzt, dass der Platz des Jüngeren leer ist.
Die Gäste werfen sich vielsagende Blicke zu.
Die Moni flüstert dem Xaver ins Ohr: „Ein boshafter Lump ist und bleibt der Wendel! Keinen roten Heller solltest du dem Tagedieb mehr geben; erntest doch nur Undank!“
Der Bauer beisst sich auf die Lippen und wirft dem Bruder einen finstren Blick zu. Der aber hält sein Glas in der Hand, leert es in einem Zug, und alle Anwesenden tun es ihm nach. Lachen, Lärmen und Musik setzen ein. Der kleine Zwischenfall ist vergessen — so scheint es wenigstens.
Bis zum Berggipfel hinauf tönt das Singen, Spielen und Jauchzen. Im Steinbruch, der sich tief wie eine gewaltige Höhle in den Wald hineingefressen hat, liegt hinter Felsstücken und Geröll versteckt ein junger Mensch von siebzehn Jahren. Er hält sich die Ohren zu, er will nichts von der Freude und Ausgelassenheit da unten hören. Zorn und Bitternis erfüllen seine Seele. Wie er den Neugeborenen hasst! Einen Dieb und Erbschleicher schilt er ihn in seiner blinden Wut. Eine Welt voll Hoffnungen und glänzenden Zukunftsträumen ist mit der Ankunft des kleinen Adam für ihn in Trümmer geschlagen worden.
Wie sicher sich der Andres seiner Sache fühlte! Wie er schon den „jungen Herrn“ herauskehrte! Ihm, dem Jüngsten, musste nach dem Gesetz der Schwarzwaldbauern ja in absehbarer Zeit der Hof zu eigen werden, sobald sich der Vater auf sein Altenteil zurückzog.
In seiner Einfalt war ihm nicht einmal bewusst geworden, warum ihn das Gesinde in den letzten Monaten mit spöttischen Augen ansah. Jetzt ist ihm die Binde von den Augen gerissen. Nun weiss er sich auch die Worte zu deuten, die die Kuhmagd dem alten Knecht Jockele zuflüsterte: „Der Andres wird sich noch schön wundern!“
O, alle hatten längst gewusst, was gespielt wurde!
Eine seltsame Müdigkeit übermannt ihn. Die Augen fallen ihm zu. Er mag nicht mehr grübeln, er will nichts mehr hören und sehen. Die Umwelt versinkt. Ein wohliges Gefühl beschleicht ihn. Es ist ein Zustand zwischen Wachen und Träumen.
Ringsum tauchen Gestalten auf, Menschen einer längst vergangenen Zeit. Vom Tal steigen sie herauf. Dicht an Andres schreiten sie vorüber, aber keiner scheint ihn zu bemerken. Dort, wo sonst Steinblöcke und Geröll lagen, ist jetzt ein Eingang in den Berg zu sehen. Ein langer, niedriger Gang führt tief in das Innere. Zu beiden Seiten zweigen sich andere Gänge ab. Sie sind dürftig von Fackeln beleuchtet. Weit hinten glänzt und glitzert es. Erz und Silber! Die Spitzhacke frisst sich in das Gestein, grosse Blöcke fallen zu Boden, werden auf Karren verladen und ins Freie befördert.
Viele Leute umgeben jetzt Andres, aber niemand nimmt von ihm Notiz. Altmodische, vornehme Röcke und Hüte tragen die Herren. Es wird gefeilscht und gehandelt. Viel Geld heimst der Bergwerksbesitzer ein.
Doch was ist das? Vom Tal herauf hallen Trompetengeschmetter und Trommelklang! Feuerschein färbt den Himmel blutigrot!
Wie Schatten zerrinnen die Gestalten.
In Asche und Staub sinken Städte, Dörfer, Kirchen und einsame Gehöfte. Es ist Krieg!
Die Gegend entvölkert sich. Wohin man sieht, liegen ermordete und am Wege verendete Menschen. Die Überlebenden flüchten in die Wälder, die ihnen Schutz und Unterkunft gewähren. Doch da schreitet die Pest über Höhen und Täler und ereilt die Flüchtenden.
Weithin ist fast alles Leben versiegt. Nur der Berghof blieb erhalten. Gottes schützende Hand war über ihm ausgebreitet. Die Mauer der Tannen verbarg ihn vor den gierigen Blicken der mordenden, plündernden und sengenden Landsknechtshaufen. Sein Pfad ist verwildert und mit Dornensträuchern, Buschwerk und jungen Bäumen bestanden. Der Eingang zum Bergwerk liegt längst verschüttet. Schwere Felsblöcke versperren ihn, Unterholz und Rankengewächs hängen wie eine Matte vor dem Gang, in dem Reichtümer aufgestapelt liegen, die nur darauf warten, von Menschenhand gehoben zu werden.
Alles das sieht und erlebt der Andres.
Und dann beginnt es zu poltern und zu rumoren, als trieben tausend böse Geister im Innern des Berges ihr Spiel. Er weiss, was er davon zu halten hat. Der Berggeist meldet sich! Er wittert Gefahr für seine Schätze. Er will die Menschen, dieses wühlende Erdgewürm, erschrecken. Wer aber furchtlos ans Werk geht, dem kann er nur selten etwas anhaben.
„Tobe nur, Alter, in deinem finsteren Loch, ich komme doch eines Tages dich besuchen. Meinst du, ich hätte Angst vor dir? Haha, der Berghofbauersohn und Angst!“ —
„Heda! Du! Siebenschläfer! Was schwatzt du denn für sonderbares Zeugs daher?“
Eine derbe Hand rüttelt den Schlafenden munter.
„Vetter Wendel, Ihr?“a]
„Freilich, Bub. Was verkriechst du dich hier oben in der Wildnis? Hör’ nur, da unten geht’s lustig her!“
Der Andres springt hoch. Versunken sind alle Traumgebilde. Hart und kalt steht ihm die Wirklichkeit vor Augen. Tränen rollen ihm über die Wangen.
„Zähne zusammenbeissen, nicht heulen!“
„Pah, ich wein’ ja aus Wut! Ausräuchern — —“
„Pscht! So etwas denkt und sagt man nicht, Andres!“ Der Maurerwendel hat die Worte recht salbungsvoll gesprochen. Er wirft sich ordentlich in die Brust wie einer, der eine grosse Tat vollbracht hat. Er drückt den Neffen auf einen Stein nieder, setzt sich zu ihm, schlägt ihm vertraulich auf die Schulter und fährt im Ton eines Biedermannes fort:
„Wenn keiner dich und dein Leid versteht, ich verstehe es. Hab’s ja am eignen Leib erfahren, wie’s tut. War gerade so alt wie du, als dein Vater geboren wurde und ich mit langer Nase abziehen musste. So was verwindet man im ganzen Leben nicht. Aber sei klug, tu wie ich: zeige eine gute Miene zum bösen Spiel und suche für dich herauszuholen, was herauszuholen ist!“
„Vetter Wendel, kann euch gar nicht sagen, wie ich das schreiende, blärrende Etwas hasse, das mit blöden Augen in die Welt starrt und mich um Haus und Hof bringt!“
„Glaub’s schon, aber du und ich und alle anderen haben auch einmal so blöde ausgesehen wie der kleine Adam.“
„Soll ich mich vielleicht später bei ihm als Knecht verdingen?“
„Habe ich das getan? Maurer beim Mäntelemichel bin ich geworden! Braucht’ es nicht zu bereuen, er starb früh, und sein Geschäft fiel mir als reife Frucht in den Schoss.“
„Ist auch gerade etwas Gescheites gewesen!“ antwortet Andres und wirft hochmütig die Lippen auf.
„Dein Grosstun lass jetzt nur beiseite, es passt schlecht für den Zweitgeborenen! Ich bin gekommen, dir zu helfen. Werde alt und stümprig, da könnte ich einen jungen Burschen, wie du es bist, brauchen. Lernen sollst du schon was bei mir. O ja, der Maurerwendel versteht sein Fach!“
Nun ist Wendel ganz aufgeblähter Stolz, aber sein Neffe ist von den hochtrabenden Worten nicht sonderlich beeindruckt. Er hat genug über ihn vom Vater, der Mutter und fremden Leuten gehört, um sich ein Bild von der Tüchtigkeit seines Onkels machen zu können.
„Nun ja, wenn du nicht willst, lässt du es bleiben. Ich finde zehn für einen“, fährt der Wendel fort, „doch geh jetzt mit mir. Sei kein Narr! Soll man dir auf hundert Schritt Entfernung von der Nase ablesen, wie’s um dich bestellt ist? Lach’, als seiest du der Vergnügtesten einer! Dann haben die Leute Achtung vor dir!“
Andres gibt nicht gleich eine Antwort, er fühlt, es ist richtig, was der Wendel gesagt hat. Es kommt ihm sauer an, die Mundwinkel zu einem Lachen zu verziehen und freundliche Worte daherzureden, aber er bezwingt sich und geht mit.
Es ist ein ungleiches Paar, das da den Weg zum Berghof hinabschreitet. Der Maurerwendel ist von gedrungener Gestalt, mit einem aufgeschwemmten Gesicht, kleinen Augen und grauem schütteren Haar, während der Andres hochgewachsen und stämmig ist. Trotzig hält der Bursch den Kopf in den Nacken geworfen; der Haarschopf über der breiten Stirn ist tiefbraun wie die Augen, die Nase und das Kinn verraten Willensstärke.
Als beide in die Tür treten, stellt sich der Berghofbauer, als sähe er sie nicht. Er tut auch, als habe er das Fehlen Andres’ nicht bemerkt, aber eine Falte steht ihm kerzengerade auf der Stirn. Die Leute wissen, dann ist mit ihm nicht gut auszukommen. Die Moni beugt sich zu ihm: „Schau, Xaver, der Bub musste erst mal mit sich zurecht kommen. Nun hat er sich durchgebissen. Ist ja auch nicht einfach für ihn.“
„Gesetz ist Gesetz, dem hat sich jeder zu fügen!“
„Freilich, er fügt sich nun.“
„Möcht’ ich ihm auch geraten haben!“
„Verdirb ihm nicht die Freud’! Sieh nur!“
Der Xaver blickt zum Andres. Der hat schon einen Kreis von jungen Burschen und Maidlis um sich versammelt und gibt so viel Spassiges an den Tag, dass die Umstehenden sich vor Lachen die Hüften festhalten. Da schmunzelt der alte Bauer. So will er es haben! Feiert er ein Fest, dann soll auch noch nach Jahr und Tag davon geredet werden, was an Speis und Trank aufgetischt wurde, und wie lustig alle gewesen sind! Kein Schatten darf die Freude trüben.
Mit einem Kreuzdonnerwetter wird er dazwischen fahren, wenn ihm jemand in die Quere kommt!
*
3.
Mehr als drei Jahre sind seit jenem 30. Mai 1777 vergangen. Ein frischer, fröhlicher Bub ist der Adam geworden, den jeder gern hat. Auch der Andres tut allzeit schön mit ihm, aber da ist einer, der traut dem Frieden nicht: der Berghofbauer. Spiegelt sich ihm doch in seinem Jüngsten sein eigenes Leben wieder. Der Wendel spielte auch immer den besorgten Bruder, wenn andere Leute zugegen waren, heimlich aber bekam der Xaver manchen Stoss und wurde geärgert und gehänselt. Wie war er froh, als der Grosse zum Mäntelemaurer ging und aus dem Hause kam! Er hat es ihm nicht nachgetragen, verstand er doch später den Beweggrund seines Handelns — aber er ist voller Argwohn gegen den Andres! Eine schlimme Tat traut er ihm allerdings nicht zu, doch auch kleiner Schabernack kann das Dasein vergällen. Seinen Adam möchte er davor schützen. Mehr als einmal fragte er den Älteren, ob er nicht ein Handwerk erlernen wolle. Der scheint sich vom Hof nicht trennen zu können. Xaver versteht auch das, ist er doch selbst Bauer und auf der Scholle aufgewachsen. Ganz heimlich fühlt er sich in der Schuld des Jungen, hat Mitleid mit ihm. Aber es weiss niemand darum, und es geht auch keinen etwas an.
Der Bauer stapft mit wuchtigen Schritten über den Hof. Seine grosse Gestalt, die kraftvolle Stimme und seine herrische Art verschaffen ihm überall Respekt. Rotgebrannt von der Sonne ist sein bärbeissiges Gesicht, in dem kluge, helle Augen stehen. Nase und Mund haben eine ausgeprägte Form. Volles braunes Haar schliesst die ziemlich breite Stirn ab. Die derben Hände stecken in den Taschen der Joppe.
Er ruft nach dem Andres. Zum Leo soll er gehen. Ist Wochenend’, da schickt der Berghofbauer ihm allerlei schöne Dinge aus Feld und Garten; Fleisch zu einem Braten, und die Mutter packt ein selbstgebackenes Brot bei und feines Sonntagsgebäck obendrein. Der Leo soll wissen: morgen ist Feiertag und die Eltern denken an dich!
Klein Adam gibt keine Ruh. Er will mit laufen! Beim Bruder Leo bekommt er alleweil viele seltsame Dinge zu sehen. Er ist immer lieb zu ihm, kann schöne Geschichten erzählen, spielt mit ihm, und oft hat er ein kleines Geschenk für ihn. Der alte Meister Grieshaber und Vrenili, sein zartes Frauchen, tun ebenfalls alles, um ihn zu erfreuen.
Nun gegen der Andres und der Adam fort. Es ist ein weiter Weg. Aber schön ist er, denn sie wählen nicht die staubige Talstrasse, sondern wandern den schmalen Saumpfad entlang, der über bewaldete Höhenzüge führt. Bald schon sind sie im nahen Forst verschwunden. Der Grosse trägt in jeder Hand einen schweren Korb. Er ist fast 21 Jahre alt geworden, kerngesund und kräftig; der Kleine ist schmächtig und von blasser Hautfarbe. Sein freundliches Lächeln, das der Grosse zur Schau trägt, ist wie weggewischt, sobald er den Blicken der Alten entschwindet. Dann tritt auf seine Stirn die steile Falte, die das Gesinde bei seinem Vater fürchtet. Vor ihm her springt der Bub. Was für eine Zierpuppe er ist! Siegt so ein Bauer aus? Nein! Er, der Andres, mit seinen Riesenkräften wäre der Rechte gewesen, den Hof zu bewirtschaften! Ja, wenn — ach, er will nicht daran denken. Aber hartnäckig kehren die Gedanken wieder und umlauern ihn wie Wölfe. Hatte er nicht heimlich gehofft, der Adam würde daraufgehen, als er vor Jahresfrist schwer an Lungenentzündung darniederlag? Er selbst sollte zum alten Stegerer nach Vöhrenbach laufen. O, er hat sich kein Bein ausgerissen und — war es nicht ein Hohn? — er betete, der Doktor möge nicht zu Hause sein. Aber er war zu Hause und kam noch eben zur rechten Zeit.
Wie ein fressendes Gift nistet sich der Hass in seinem Herzen ein und raubt ihm Ruhe und Frieden. Warum ist er nicht längst gegangen? Er kann sich nicht losreissen. Immer noch wartet er auf die Fügung des Schicksals, die ihm zu seinem vermeintlichen Recht verhilft. Zeit und Stunde hat er über die Grübeleien vergessen. Er schlägt die Augen auf. Hart am Bergrand führt jetzt der Pfad entlang. Steil fällt die Felswand in die Tiefe. Unten liegen Steinblöcke und Geröll. Auch das Becken der Breg ist damit angefüllt, so dass der Fluss an dieser Stelle wie ein Wildbach dahinbraust. Wer da hinunterstürzt, wird sich nie wieder erheben. Sträucher mit grossen roten Himbeeren bedecken die Bergkuppe, ihre Zweige schweben zwischen Himmel und Erde.
Wo ist Adam? Vor Schreck stockt dem Träumer der Herzschlag. Einem inneren Befehl gehorchend, stellt er die Last zu Boden. Dicht am Rande steht der Kleine und pflückt arglos die süssen Früchte. Er achtet nicht der drohenden Gefahr. Ein einziger Schritt genügt, und es ist um ihn geschehen. Schon will Andres hinstürzen und den Ahnungslosen zurückreissen. Da kommt ihm ein teuflischer Gedanke: das ist der Wink des Schicksals! Weit und breit ist niemand zu sehen. Ein Unglücksfall! Kein Mensch ist Zeuge. Reichtum und Besitz sind dein!
Langsam, Schritt um Schritt, nähert er sich dem Bruder. Jetzt steht er hinter ihm. Fast unbewusst streckt er den Arm aus. In der nächsten Sekunde wäre es geschehen. Da gellt ihm ein Schrei in die Ohren: „Andres! Greif zu!“ Und er packt den Kleinen, als ihm der abschüssige Boden unter den Füssen wegsackt und Erde und Gestein zu Tal stürzen. Er hält ihn, der schon in den Abgrund zu versinken droht, und reisst ihn zurück.
„Bist ein braver Bub! Das hast du gut gemacht! Werde es deinen Eltern erzählen!“
Adam sieht sich erstaunt um. Er versteht nicht, was geschehen ist. Er fühlt nur, einer grossen Gefahr entronnen zu sein.
„Bist ja kreideweiss, Andres. Komm, setz dich! Die Beine versagen dir schier den Dienst.“
Liebkosend streicht der Mann durch das volle Haar des Jünglings. Andres zittert am ganzen Körper. Er wagt nicht, die Augen aufzuschlagen. Vor ihm steht eine lange, hagere Gestalt mit einem gutherzigen Gesicht. Auf dem Rücken trägt sie eine hohe Kiepe. Es ist der Bürstenkarle, der seine Ware von Ort zu Ort, von Hof zu Hof feilbietet. Auf der Taufe des Adam hat er die Fiedel gespielt.
Andres schämt sich bis in den Herzensgrund hinein. Um ein Haar wäre er zum Brudermörder geworden, und jetzt wird er von dem Arglosen für seine Schlechtigkeit obendrein belobt. „Schweig darüber, Karle, Vater und Mutter geht die Sache nichts an!“
„Doch! Hören sollen sie, wie du dein Leben dran gesetzt hast, das Brüderchen zu retten!“
„Ich will’s nicht, dass du’s sagst! Warum sie in Angst und Schrecken versetzen! Ist ja alles gut —, ja, nun ist alles gut.“
Der Bürstenkarle denkt: wie sonderbar der Junge spricht, wie unruhig seine Augen flackern. Es wird der ausgestandene Schrecken sein. Dann sagt er: „Ich muss nun fort. Gib gut acht auf den Kleinen!“, und er geht bedächtig davon.
„Sei unbesorgt, ich werd’ gut acht geben!“ ruft ihm der Andres nach, und die Stimme klingt, als werde sie aus tiefster Angst und Reue hervorgestossen. Ganz still sitzt der Bursch. Die Hände hält er ineinander verkrampft, Tränen rollen ihm über die Wangen.
„Andres, was hast du?“ fragt Adam mit heller Kinderstimme und streicht ihm übers Gesicht. Andres stösst den Bruder entsetzt zurück, reisst ihn aber im nächsten Augenblick an sich und liebkost ihn, wie er es nie getan hat. Dabei stösst er unverständliche, abgebrochene Worte hervor. „Ein Lump bin ich!“ Das hat der Kleine verstanden. Mit seinen drei Jahren weiss er nicht, was ein Lump ist. Doch dass es etwas Hässliches sein muss, begreift er. Sein kleines Herz ist voll von Mitleid. Aber irgendwo in seinem Gedächtnis setzen sich die Worte fest: „Ein Lump ist der Andres“ und bleiben haften fürs ganze Leben.
*
Wohl eine Viertelstunde Wegs von Vöhrenbach, an einen kahlen Hügel gelehnt, steht das altehrwürdige Haus des Uhrmachers Nepomuk Grieshaber. Es schaut anders als die Gebäude im Schwarzwald aus. Die langen, gekuppelten Fensterreihen sind nachträglich eingebaut. Die vielen Scheiben sind dem Lichte zugewandt.
Leo tritt aus dem Haus. Er ist ein schmalgebauter junger Mann mit einem verträumten Gesicht und freundlichen Augen. Er hat dunkles, lockiges Haar und lange Hände. Sein Anzug ist von peinlicher Sauberkeit.
Freudig eilt Leo dem vom Walde heraufkommenden Andres entgegen, um ihn von der Last zu befreien. Das ist aber nicht leicht, denn der Adam hat sich an seinen Hals gehangen, herzt und küsst ihn und will ihn gar nicht wieder loslassen.
An Holzstössen vorbei führt der Pfad. Hektor, der Haushund, springt freudig bellend an den Brüdern hoch. Nun steigen die drei ein paar ausgetretene Steinstufen empor und gehen durch einen engen, dunklen Gang. Der weisshaarige Meister Nepomuk und das zarte Vrenili begrüssen die Gäste. Adam läuft zur Werkstatt, wo es die vielen seltsamen Dinge zu sehen gibt. Strahlend hell ist es hier. Die Lichtflut strömt über die unmittelbar an der Fensterreihe sich hinziehende Werkbank. Ein wirres Kunterbunt zahlloser Uhrteile und Geräte liegt darüber zerstreut. Links ist der Drehstuhl befestigt. Grieshabers Vater und Grossvater haben schon an ihm hantiert. Tiefe Buchten wetzte er im Laufe der Jahrzehnte in das Holz. Von der Decke herab ist ein drehbares Gestell, die Werkzeugdrille, angebracht, all das tragend, was schnell zur Hand sein muss. An den Fensterpfosten hängen Drähte, Ketten, Räder und mancherlei andere Gegenstände, und inmitten dieses Durcheinanders stehen einige Topfpflanzen, deren Blumenpracht etwas Sonntägliches über die nüchternen Dinge des Alltags breitet.
Doch für all das hat der kleine Adam kein Auge. Seine Aufmerksamkeit fesseln die an den Wänden klebenden Uhren, von denen lange Ketten und Bleigewichte herunterhängen. Der Leo zeigt ihm die Wunderwerke und zaubert mit wenigen Griffen ihre verborgenen Geheimnisse zutage. Schau nur, dort auf dem Werkkasten der Wanduhr steht eine Mönchsfigur. Jetzt läutet sie auf einer kleinen Messingglocke die Betstunden. Und nun beginnen die dahinter liegenden sechs Glasglöckchen sich zu bewegen, und es tönt eine zarte Weise durch den Raum. Der Bub kommt aus dem Staunen nicht heraus. Die Nachbaruhr mit dem hübschen, geschnitzten Gehäuse spielt gar ein richtiges Musikstück!
„Was ist denn das?“
„Eine Schnappuhr.“
Auf den lackierten Schild ist ein grimmiger Türkenkopf gemalt, einer jener schlimmen Heiden, die noch vor wenigen Jahren Wien bedrohten und von denen ungeheuerliche Greuelgeschichten erzählt werden. Bei jedem Pendelschlag rollt er die Augen, öffnet den grossen Mund und schnappt zu. Adam drängt sich unwillkürlich schutzsuchend dichter an seinen grossen Bruder heran.
Da gefällt ihm die nächste Uhr schon besser. Ein Knabe sitzt auf einer Schaukel. Hei, wie lustig er auf und nieder schwingt und nie müde dabei wird!
So sind noch mancherlei schnurrige Dinge zu bewundern. Endlich ist der Rundgang beendet. Alle gehen ins Zimmer, wo die Grieshaberin schon den Tisch gedeckt hat. Kuchen und Ziegenmilch sind zu Ehren der Gäste aufgetragen, doch Andres gibt keine Ruh’, er muss nach Vöhrenbach hinein, hat dort etwas Eiliges zu besorgen.
Leo packt die schönen Sachen aus, die ihm die Eltern bringen lassen. Der Meister und die Meisterin stehen mit blanken Augen dabei. All das kommt ihnen ja mit zugute. Der Berghofbauer schickt es nur deshalb an den Sohn, um den beiden Alten das Danken zu ersparen. Daher geben sie dem Andres stets ein „Vergelt’s Gott!“ mit auf den Weg.
*
Vor dem verwahrlosten Haus des Maurermeisters Wendelin Dorer steht der Andres und betrachtet die ungeputzten Fenster und die schmutzige Hauswand. Endlich zieht er am Strang. Schrill läutet die Glocke. Eine geraume Weile rührt sich nichts, bis eine missmutige Weibsstimme ruft:
„Wer ist denn da? Wo brennt’s denn? He?“
„Der Andres ist hier, Annili, öffne schnell, ich muss den Vetter sprechen!“
„Glaubst du denn, dass der am Samstagabend daheim bleibt? Kennst ihn schlecht! Geh zum „Engel“, da wirst du ihn finden, wenn er nicht schon beim Ketterer im „Leuen“ ist!“
Nicht einmal die Tür öffnet die Annili.
Währenddessen sitzt der Wendel im Gasthof „Zum Engel“ und führt das grosse Wort. Der Schustertoni und der Schnefflerfranz sind seine Zechgenossen.
„Was heisst da vorbildlich den Hof bewirtschaften? — Jeder Kuhbub kann das, wenn die Truhen daheim bis zum Rand voll blanker Guldenstücke liegen und ihm die Holländertannen aus seinen Wäldern Jahr um Jahr ein Vermögen einbringen!“
Der Toni tut gemächlich einen tiefen Schluck, dann sieht er den Maurer herausfordernd an: „Die grosse Klappe allein macht’s nicht, und trotz Holländertannen und gefüllten Geldtruhen muss der Xaver schon was können, denn bei ihm geht’s bergauf und nicht bergab mit der Wirtschaft wie bei manchem anderen grossen Hof!“
Der Schnitzer fügt hinzu: „An dem könnt sich mancher ein Beispiel nehmen. Er ist morgens der Erste und abends der Letzte. Und wie der Xaver, so die Moni; und wie der Bauer, so Knecht und Magd!“
„Versteh’ schon, worauf Ihr hinaus wollt, aber die Annili lasst mir aus dem Spiel!“ ruft wütend der Wendel. „Mit euch sollt sich unsereins überhaupt nicht an einen Tisch setzen!“
„Ja, wer bist denn du? Freilich, der Bruder vom Berghofbauern, aber der Bauer ist ein feiner Kerl, vor dem jeder den Hut zieht!“
„Jawohl, jeder, der glaubt, auf seiner Tasche liegen zu können!“ schreit der Wendel ausser sich. Die Leute in der Gaststube wenden sich nach ihm unwillig um, und Ganter, der Wirt, verbittet sich den lauten Ton. Der Schnefflerfranz aber guckt den Maurer aus seinen verschmitzten Augen recht listig an und sagt: „Ja, wer haben will und nichts zu geben hat, muss in manchen sauren Apfel beissen. Gelt, Toni, da sind wir besser dran! Wir spielen auf, dass jeder seine Freude daran hat und brauchen vor niemandem zu duckmäusern.“
„Hast ein wahres Wort gesprochen, doch das muss dem Xaver zu seiner Ehr’ nachgesagt werden, wie ein Fürst hat er uns auf des Adams Kindtauf’ bezahlt!“
„Pah, ein ganz schlauer Fuchs ist der Xaver! Dass er den Adam in die Welt gesetzt hat, hat mit der Lieb zur Moni ein’ Dreck zu tun! Nichts als Berechnung war’s. Fünfundzwanzig Jahre länger wirtschaftet er jetzt auf dem Hof, ehe er auf’s Altenteil zu gehen braucht! Fünfundzwanzig Jahre! Da kann er schon ein protzig’ Fest feiern, es geht ja auf Andres’ Kosten — ich weiss Bescheid. Hätt’ mein Alter an mir nicht ebenso gehandelt, der Zwölfkreuzerschoppen würd’ grad gut genug für mich sein. — Heda, noch eine Runde!“
Der Ganter kommt gemächlich hinter der Theke hervor, aber mit leeren Händen. „Hast du denn auch Geld bei dir?“
„Dein Geld kriegst’ schon noch. Schreib an!“
„Musst erst mal von der alten Schuld runterkommen, bis dahin wird nicht mehr gepumpt.“
„Vetter Wendel! Vetter Wendel!“
Alle schauen sich um.
Andres hat die Worte gerufen. Jetzt sieht er den Gesuchten.
„Kommt, Vetter, ich muss mit euch sprechen!“
„Setz dich, Bub!“
„Nein, was ich euch zu sagen habe, geht nur uns an.“
„Hast recht. Wir wollen die Tür von draussen zumachen, hab’ längst das Wirtshausleben satt!“ Der Wendel ist wieder ganz Würde. Er streicht sich über den ergrauten Spitzbart: „Kommt nichts dabei heraus. Auf Wiedersehen! Wünsche gute Unterhaltung allerseits!“
Nur wenige erwidern seinen Gruss, spöttische Bemerkungen und höhnisches Gelächter folgen ihm.
Auf der Strasse wirft er einen Blick auf den Neffen. Wie bleich der aussieht! „Ist was Schlimmes geschehen?“
„Ich will zu euch, will Maurer werden, Vetter Wendel!“
„Nanu? Mehr als drei Jahre habe ich auf dich gewartet. Jetzt hast du’s mit einem Mal so eilig? Was ist denn los?“
„Fragt nicht. Wollt Ihr mich haben oder nicht?“
„Oho, mein Bürschchen, in solchem Ton spricht man nicht mit mir!“
„Hat’s dumm geklungen? Nehmt’s nicht falsch. Will nur wissen, woran ich bei euch bin. Sagt ja oder nein!“
„Und wenn ich nein sag?“
„So geh ich auf und davon!“
„Was willst du denn, und wohin willst du?“
„Ich weiss es nicht. Aber vom Berghof muss ich herunter!“
„Hast du dich mit deinem Vater überworfen?“
„Nein! Das ist nicht der Grund.“
„Hm. Kann es mir schon denken. Erträgst es nicht, Tag für Tag den Adam vor Augen zu haben. Stimmt’s?“
„Fragt doch nicht!“
„Wann willst du denn zu mir kommen?“
„Auf der Stelle!“
„Wie? Sofort?“
„Ja!“
„Potz Blitz, hast du es eilig! Und was sagen die Eltern dazu?“
„Sie wissen es nicht.“
„Nanu? Ist dir der Entschluss plötzlich unterwegs gekommen?“
„Ja!“
„Das ist merkwürdig. Da muss doch ein Grund vorliegen?“ Misstrauisch mustert der Alte den Jungen.
„Lebt wohl!“ Andres wendet sich und geht davon.
Einen Augenblick steht der Wendel, als sei er am Erdboden festgenagelt. Das ist ihm denn doch noch nicht vorgekommen. Sicher hat der Neffe keinen Kreuzer in der Tasche, nichts trägt er bei sich, nicht mal ein Stück Brot! Nun marschiert er geradenwegs auf Hammereisenbach zu. Da gibt’s ja gar keinen Zweifel, er geht auf und davon! Alles spricht dafür, dass er an ein Heimkehren nicht denkt. Nein, dahin darf es nicht kommen.
Bald ist der Ausreisser eingeholt.
„He, du, mach keine Dummheiten! Komm! Kannst bei mir bleiben!“
Der Wendel nimmt Andres gleich danach in sein Haus mit. Mürrisch befolgt Annili, eine schlacksige und wohlbeleibte Person, seine Anweisungen, dem Neffen Speise und Trank vorzusetzen.
Dann erhält der Andres sein Zimmer gezeigt. Es ist ein unfreundlicher Raum mit einer verblichenen Tapete, einem Bett, einem Tisch und einem Schrank. Das Holz der Möbel ist wurmstichig, die Gardinen sind grau vom Staub, und die Farbe des Fussbodens ist auch nicht mehr zu erkennen.
Spät am Abend macht sich der Wendel noch auf den Weg, um den Adam zum Berghof zurückzugeleiten. Auch will er mit dem Xaver über die neue Lehre vom Andres reden und alles ins rechte Lot bringen.
*
„Das glaub ich, wenn alle wären wie der Xaver und seine Moni, wär’s ein herrlich’ Dasein auf Erden!“ So ruft der Bürstenkarle und spricht die Worte aus tiefster Überzeugung. Er hat auch alle Ursache, die Berghofleute zu loben. Seine „Krätze“ ist erheblich leichter geworden, und beim Kauf wird nicht gemäkelt und gefeilscht, wie es so mancher andrer Bauern Art ist. Ein Schoppen Wein steht vor ihm, und der Tisch ist reich mit guten Speisen gedeckt.
Die Stube ist mit alten Möbeln aus Urväterbesitz ausgefüllt, unter denen besonders der Schrank mit seinen prächtigen buntgemalten Blumen auffällt. Aus dem Herrgottswinkel leuchten grüne Blattpflanzen und Ranken.
An der Wand hängt als Prunkstück die neue Uhr. Gar nicht satt sehen kann man sich daran. Das herrliche Gehäuse hat der berühmte Matthias Faller in St. Märgen geschnitzt, und das Bild ist von Kajetan Kreuzer in Furtwangen gemalt. Ja, der ist ein Meister seiner Kunst! Das Uhrwerk ist das Gesellenstück des Leo. Der alte Grieshaber sagt, der Xaver könne stolz auf seinen Sohn sein, der verstehe sein Fach wie kein zweiter und werde es noch mal weit bringen.
Die Moni blickt immer und immer wieder auf die Uhr, aber sie sieht heute nicht, wie sonst, voller Freude darauf. Unruhe und Angst plagen sie.
„Ist schon bald neun, und die Kinder sind noch nicht zurück.“
„Was willst du? Der weite Weg! Und dann lässt sie der Leo nicht so bald gehen.“