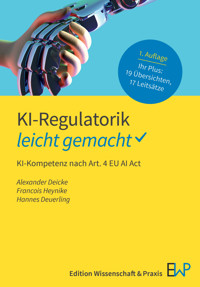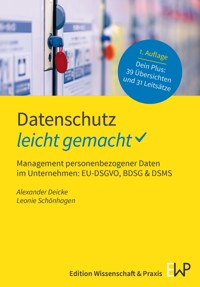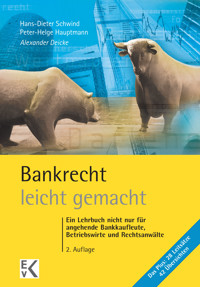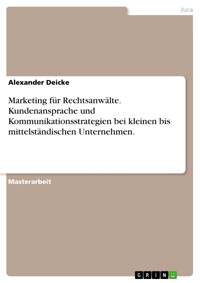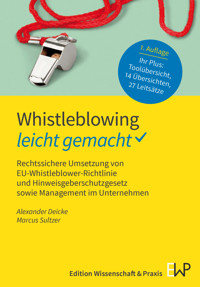
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edition Wissenschaft & Praxis
- Sprache: Deutsch
Im Mai 2023 wurde in Deutschland die Whistleblower-Richtlinie in das Hinweisgeberschutzgesetz übertragen. Seitdem ist für alle Unternehmen mit mehr als 50 Mitarbeitenden die Einführung eines Hinweisgebersystems verpflichtend. Aber was bedeutet das konkret für die regulatorische Umsetzung? Was muss wie genau gemacht werden? Umfassend, übersichtlich und leicht verständlich erfahren Sie in diesem Buch von zwei Experten alles, was Sie zum Thema Whistleblowing in Ihrem Unternehmen wissen müssen:
– Relevanz von Whistleblowing und Begriffsbestimmungen
– Rechtslage in Deutschland und internationale Gesetze
– Managementsysteme zur praktischen Umsetzung
Ombudsperson oder doch besser die Abbildung über ein IT-Tool? Nicht jede Lösung ist für jedes Unternehmen geeignet. Die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungsstrategien werden aufgezeigt und weisen den Weg durch den Wust regulatorischer Umsetzungsvorgaben. Eine Einordnung in Nachhaltigkeitsthemen (ESG) sowie Bezüge zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz und zu KI runden die Einführung ab.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
IPR – leicht gemacht
GELBE SERIE - leicht gemacht
Herausgegeben von Helwig Hassenpflug
Die leicht gemacht-Lehrbücher führen Studierende erfolgreich in die Fächer Recht (GELBE SERIE) und Steuern / Rechnungswesen (BLAUE SERIE) ein, indem sie besonderes Augenmerk auf didaktische Erfordernisse legen und die wichtigsten Grundlagen vermitteln. Die Bände richten sich insbesondere an Anfängerinnen und Anfänger ohne Vorkenntnisse und sind daher ideal für den Einstieg und zur Prüfungsvorbereitung.
Weitere spannende Bände unter:
www.leicht-gemacht.de
[3]
IPRleicht gemacht
Das InternationalePrivat- und Verfahrensrecht
2., überarbeitete Auflage
von Sascha Gruschwitz
Edition Wissenschaft & Praxis
[4]
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation inder Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Datensind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.
Umschlagbild: © Peter Schaefer – iStock
Alle Rechte vorbehalten©2024 Edition Wissenschaft & Praxisbei Duncker & Humblot GmbH, BerlinSatz: Michael HaasDruck: Prime Rate Kft., Budapest, UngarnGedruckt auf FSC-zertifiziertem Papier
leicht gemacht® ist ein eingetragenes Warenzeichen
ISBN 978-3-87440-397-9 (Print)
ISBN 978-3-87440-797-7 (E-Book)
www.duncker-humblot.de
[5]
Vorwort
Der vorliegende Band erschien erstmals im Jahr 2013 und wurde erfreulich gut aufgenommen. In den zurückliegenden Jahren hat sich das Internationale Privatrecht rege weiterentwickelt, womit eine Neuauflage dringend angezeigt erschien. Das Werk wurde daher in allen seinen Teilen gründlich überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht, auch kleine Kinderkrankheiten, die eine Erstauflage mit sich bringt, wurden beseitigt. Dennoch konnte die kompakte Darstellungsweise beibehalten werden. Der Autor hofft, damit auch weiterhin eine gut lesbare, in allen Teilen übersichtliche Bearbeitung anbieten zu können. Lob und Kritik sind jederzeit willkommen.
Leipzig, im April 2024 Sascha Gruschwitz
[6]
[7]
Inhalt
I.Grundlagen des Internationalen Privatrechts
Lektion 1: Überblick
Lektion 2: Einführung
Lektion 3: Rechtsquellen
II.Allgemeiner Teil des IPR
Lektion 4: Kollisionsnormen
Lektion 5: Tatbestandsseite
Lektion 6: Rechtsfolgenseite
Lektion 7: Anwendung und Korrektur des gefundenen Rechts
III.Besonderer Teil des IPR
Lektion 8: Recht der natürlichen Personen
Lektion 9: Gesellschaftsrecht
Lektion 10: Vertragliches Schuldrecht
Lektion 11: Gesetzliches Schuldrecht
Lektion 12: Sachenrecht
Lektion 13: Familienrecht
Lektion 14: Erbrecht
IV.Internationales und Europäisches Zivilverfahrensrecht
Lektion 15: Gegenstand und Rechtsquellen
Lektion 16: Internationale Zuständigkeit
Lektion 17: Anerkennung und Vollstreckung
Sachregister
[8]
Leitsätze * Übersichten
Übersicht 1 Aufbau des Internationalen Privatrechts
Leitsatz 1 Warum ein Internationales Privatrecht?
Leitsatz 2 Sachrecht
Übersicht 2 Ziele des Internationalen Privatrechts
Leitsatz 3 Kollisionsrecht
Leitsatz 4 Ausländisches Recht vor deutschen Gerichten
Leitsatz 5 International vereinheitlichtes Sachrecht
Übersicht 3 Abgrenzungen
Leitsatz 6 Fundstellennachweis B
Leitsatz 7 Europäisches IPR
Übersicht 4 Aufbau des IPR im EGBGB
Übersicht 5 Normenhierarchie im internationalen Recht
Leitsatz 8 Arten von Rechtsnormen
Leitsatz 9 Aufbau von Kollisionsnormen
Leitsatz 10 Arten von Kollisionsnormen
Leitsatz 11 Anknüpfungsmomente
Leitsatz 12 Qualifikation
Leitsatz 13 Tatbestand der Kollisionsnorm
Leitsatz 14 Vorfragen
Übersicht 6 Vorfragenproblematik
Leitsatz 15 Gesamtverweisung - Sachnormverweisung
Übersicht 7 Rückverweisung und Weiterverweisung
Übersicht 8 Voraussetzungen eines ordre public-Verstoßes
Leitsatz 16 ordre public
Leitsatz 17 Art. 7 II S. 3 EGBGB
Leitsatz 18 Gesellschaftsstatut
Übersicht 9 Sitztheorie - Gründungstheorie
Leitsatz 19 MoMiG
Übersicht 10 EuGH-Rechtsprechung zum internationalen Gesellschaftsrecht
Übersicht 11 Anwendungsvoraussetzungen des UN-Kaufrechts
Leitsatz 20 Internationale Sachrechtsvereinheitlichung
Leitsatz 21 Anwendungsbereich Rom I-VO
Leitsatz 22 Sonderanknüpfungen nach der Rom I-VO
Übersicht 12 Prüfungsreihenfolge im internationalen Schuldvertragsrecht
[9]
Übersicht 13 Rechtsquellen des internationalen gesetzlichen Schuldrechts
Leitsatz 23 Ungerechtfertigte Bereicherung
Leitsatz 24 Vorteile der lex rei sitae
Übersicht 14 Offene Tatbestände - Geschlossene Tatbestände
Leitsatz 25 Ausweichklausel
Leitsatz 26 Transposition
Leitsatz 27 Eheschließung
Übersicht 15 Das Anknüpfungssystem im internationalen Familienrecht
Übersicht 16 Prinzipien des internationalen Erbrechts
Übersicht 17 IZVR im Kontext
Leitsatz 28 Lex fori
Übersicht 18 Zusammenspiel internationale Zuständigkeit und IPR
Leitsatz 29 Internationale Zuständigkeit
Leitsatz 30 Anwendbarkeit der Brüssel Ia-VO
Leitsatz 31 Besonderer Gerichtsstand des Erfüllungsortes
Übersicht 19 Prüfungsreihenfolge der internationalen Zuständigkeit nach der Brüssel Ia-VO
Übersicht 20 Zuständigkeiten nach dem autonomen IZVR
Übersicht 21 Anerkennungshindernisse
Übersicht 22 Ablauf der Anerkennung und Vollstreckung nach Brüssel Ia-VO
Übersicht 23 Ablauf der Anerkennung und Vollstreckung nach autonomem IZVR (ZPO)
[10]
[11]
I. Grundlagen des Internationalen Privatrechts
Lektion 1: Überblick
Erste Gedanken zum Internationalen Privatrecht
Das Internationale Privatrecht, kurz IPR, gehört ohne Zweifel zu den interessantesten und zugleich ungewöhnlichsten Rechtsgebieten, die eine Rechtsordnung zur Verfügung stellen kann. Normalerweise interessiert sich eine Rechtsordnung nicht für grenzüberschreitende Fälle, ihre Gesetze sind für gewöhnlich streng auf nationale Sachverhalte beschränkt. Nicht so im IPR. Seine Bedeutung liegt gerade darin, internationale Sachverhalte zu regeln. Auf diese Weise bietet sich dem Juristen die seltene Gelegenheit, über den juristischen Tellerrand seines ihm bekannten nationalen Rechts hinaus zu blicken. Dies wird allgemein als willkommene und lehrreiche Abwechslung gesehen.
Dennoch gilt: Dem IPR haftet nicht ohne Grund der Ruf eines äußerst anspruchsvollen Rechtsgebietes an. Durch sein „Schweben über dem materiellen Sachrecht“ ist es in seiner Ausdrucksweise und Formulierung besonders abstrakt angelegt. Statt aus Paragraphen bestehen die gesetzlichen Vorschriften aus Artikeln. IPR gebraucht sonderbare Rechtsbegriffe, mit denen Juristen, die sich noch nicht näher mit diesem Rechtsgebiet befasst haben, wenig vertraut sind. Oder haben Sie schon von Anknüpfung, Qualifikation, Vorfragen, Verweisung usw. im Zusammenhang mit der allgemeinen juristischen Arbeitsweise gehört?
Stellen wir einen Vergleich zu anderen internationalen Rechtsgebieten an: Europarecht und Völkerrecht. Beide Rechtsbereiche stehen bei Studierenden „hoch im Kurs“, während IPR lange Zeit als juristischer Sonderling galt, der nur in den Randbereichen der Ausbildung zum Tragen kam. Dieses Verständnis hat sich nicht zuletzt auch durch die voranschreitende Europäisierung des Rechts gewandelt. Man muss sich nur eines verdeutlichen: Nahezu im gesamten IPR wird seit Jahren praktisch umgesetzt, was in der Vorlesung zum Europarecht mit Art. 3 II EUV nur als blanke Theorie vermittelt wird: Die Verwirklichung des Raumes der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts ohne Binnengrenzen - dazu trägt europaweit vereinheitlichtes IPR wesentlich bei.
[12]
Um gleich zu Anfang mit einem Vorurteil aufzuräumen: Die Befassung mit IPR hat nicht zur Voraussetzung, zuvor eine fremde Rechtsordnung oder Sprache erlernen zu müssen. Vom Grundsatz ausgehend ist es Teil einer nationalen Rechtsordnung. Erst dann, wenn nationales IPR auf ausländisches Recht verweist, wird der Rechtsanwender mit fremden Rechtsordnungen in Berührung kommen. Dann beginnt die Auslegung und Anwendung ausländischen Rechts.
Auch in der juristischen Ausbildung können Prüfungsarbeiten ausländisches Recht zum Gegenstand haben. Sicherlich werden Sie sich jetzt wundern und fragen, wie Sie die benötigten Kenntnisse zum ausländi-sehen Recht erlangen (Bsp.: codice civile - italienisches Zivilgesetzbuch). Hierbei besteht kein Grund zur Sorge. Im Rahmen der Ausbildung werden Studierende mit den Grundzügen des IPR vertraut gemacht. Dann kann es neben der Anwendung des eigenen IPR zwar auch vorkommen, ausländisches Recht (IPR und Sachrecht) in der Sache selbst prüfen zu müssen.
Wenn eine Prüfungsarbeit tatsächlich ausländisches Recht zum Gegenstand haben sollte, werden die einschlägigen Gesetze und deren Übersetzung dem Prüfungssachverhalt angeschlossen sein oder zur anderweitigen Kenntnis der Prüfungsteilnehmer/innen gelangen. Andernfalls werden die Aufgaben so gestellt sein, dass neben nationalem auch ausländisches Kollisionsrecht zu prüfen ist, nach dessen Anwendung Sie dann wieder ins deutsche Recht gelangen, Stichwort Rückverweisung, dazu später mehr (Lektion 6).
Zur Arbeit mit diesem Buch
Wie sonst in der Rechtswissenschaft gilt auch hier: Die Arbeit mit dem Gesetz begleitend zu dieser Darstellung sollten Sie für sich zur Pflicht statuieren. Gerade weil der Normenbestand des IPR im Vergleich zu anderen Rechtsgebieten besonders abstrakt ist, sollte auf die Gesetzeslektüre höchste Sorgfalt gelegt werden. Aufgrund seiner verstreuten gesetzlichen Regelung existiert leider kein in sich geschlossenes Gesetz, sondern viele Einzelgesetze. Die bekannten Gesetzessammlungen „Habersack“ und „Sartorius“ helfen hier nur bedingt weiter. Die wichtigen Gesetze zum IPR lassen sich aber über das Internet abrufen (z.B. http://dejure.org/) oder in besonderen Gesetzessammlungen nachschlagen (z.B. Beck’sche Textausgabe „Internationales Privat- und Verfahrensrecht“).
[13]
Wer Interesse daran hat zu erfahren, wie Gerichte in der Rechtspraxis IPR anwenden, dem sei die gelegentliche Lektüre solcher Gerichtsentscheidungen empfohlen - einen einfacheren Weg, die Fallpraxis nachzuvollziehen, gibt es kaum. Gerichtliche Entscheidungen und Abhandlungen zum IPR und ausländischen Recht finden sich in der eigens dafür publizierten Fachzeitschrift IPRax, der NJW sowie in der Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (BGHZ).
IPR lässt sich in einen Allgemeinen Teil (AT) und Besonderen Teil (BT) gliedern. Dieses Verklammerungsprinzip wird Ihnen bereits aus dem BGB bekannt sein. Der AT beinhaltet die kollisionsrechtlichen Systembegriffe und Arbeitsmethoden, der BT betrifft die Spezialmaterien. Ebenso wichtig und regelmäßig im Zusammenhang mit dem IPR zu erlernen ist das Internationale Zivilverfahrensrecht (IZVR), welches sich mit der verfahrensrechtlichen Durchsetzung von Rechten im internationalen Rechtsverkehr befasst.
An dieser Vorgehensweise orientiert sich auch der inhaltliche Aufbau der Darstellung: Während unter I. die Grundlagen des IPR vermittelt werden, widmen sich II. und III. dem AT und BT. Unter IV. wird das IZVR dargestellt.
[14]
Lektion 2: Einführung
Wozu ein Internationales Privatrecht?
Der Zugang zu einem unbekannten Rechtsgebiet erschließt sich am ehesten über eine Begriffsdefinition. Im Falle des IPR hilft sogar das Gesetz weiter - Art. 3 EGBGB lautet vereinfacht formuliert:
Es ist das Recht, welches bei Sachverhalten mit einer Verbindung zu einem ausländischen Recht das
anzuwendende Recht
bestimmt.
Menschen reisen und wohnen in fremden Ländern, bestellen ausländische Waren über das Internet, kehren ihrem Heimatland aus privaten oder beruflichen Gründen den Rücken zu und wandern aus, wieder Andere heiraten eine/n ausländische/n Partner/in. Im Wirtschaftsleben agieren Unternehmen welt- und europaweit, indem sie neue Absatzmärkte erschließen und Zweigstellen sowie Niederlassungen auf die ganze Welt verteilt gründen. Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie sich unser tägliches Leben mehr und mehr gewandelt hat. Wie selbstverständlich ist für uns der kulturelle Austausch geworden. Die Globalisierung hat zu einer engen Vernetzung der einzelnen Völker und Kulturkreise geführt. Was früher als kaum überwindbare Entfernung galt, ist heute meist nur einen „Mausklick“ oder wenige Flugstunden entfernt. So groß der Nutzen und die Bereicherung dieser grenzüberschreitenden Kontakte auch ist, so umfangreiche rechtliche Probleme können sie nach sich ziehen.
Fall 1
Der Deutsche D befindet sich im Sommerurlaub in Italien. Vor Ort mietet er sich für drei Tage einen Kleinwagen bei dem nach französischem Recht gegründeten Mietwagenunternehmen M. Während einer Fahrt durch das Gebirge gerät D in einen Autounfall, indem er mit dem Pkw des unvorsichtigen Österreichers Ö zusammenprallt. D wird verletzt. Er fragt sich, nach welchem Recht sich seine Ausgleichsansprüche richten.
Fall 1 verdeutlicht Ihnen gleich zu Beginn, wie schnell sich aus einer alltäglichen Situation Berührungen mit einer fremden Rechtsordnung ergeben können. Eine Internationalisierung des gesellschaftlichen Lebens führt auch immer zu einer Internationalisierung im Rechtsleben. Das [15] Beispiel hat einen Autounfall am Urlaubsort zum Gegenstand, betrifft also keinesfalls ein lebensfernes Szenario. Potentielle rechtliche Schnittpunkte sind hier gleich zu vier Rechtsordnungen gegeben: Es bestehen Bezüge zu Deutschland (D als Geschädigter ist Staatsangehöriger), Italien (Ort des Unfalls), Frankreich (französisches Recht ist Gründungsrecht von M) und Österreich (Ö als Schädiger ist Staatsbürger Österreichs). Bei jeder der genannten Rechtsordnungen könnte man zumindest möglicherweise an ihre Anwendung auf den Sachverhalt zur rechtlichen Entscheidung denken. Welcher einen (!) Rechtsordnung ist dann aber der Vorrang einzuräumen und aus welchen Gründen erfolgt dies? Hier setzt das IPR mit seiner rechtlichen Konfliktbewältigung an.
Leitsatz 1
Warum ein Internationales Privatrecht?
Anders gesagt: Ein IPR wäre nicht erforderlich,
-wenn es keine Rechtsunterschiede zwischen den Staaten gäbe, sondern alle Staaten dieser Erde ein und dasselbe Recht anwenden würden,
-wenn jeder Staat immer nur sein eigenes materielles Recht berücksichtigen würde oder
-wenn jeder Staat schließlich allen grenzüberschreitenden Sachverhalten den Rechtsschutz verweigerte.
► Da nichts davon zutrifft, muss es einen rechtlichen Kompromiss geben. IPR hat den Ordnungsauftrag, das auf den jeweiligen Fall anwendbare Recht aufzufinden.
Nun interessieren Sie sich doch sicherlich für die Lösung von Fall 1 und wollen wissen, wie der Fall zu entscheiden ist? Bei einem Autounfall handelt es sich um ein schädigendes Ereignis. Die rechtliche Einordnung hat als unerlaubte Handlung in das Deliktsrecht zu erfolgen. Da der Fall nicht in Deutschland, sondern Italien spielt, liegt ein grenzüberschreitender Sachverhalt mit einer Berührung zu mehreren ausländischen Rechtsordnungen vor. Weil die verschiedenen nationalen Rechtsordnungen möglicherweise zu unterschiedlicher rechtlicher Beurteilung des Sachverhaltes kommen könnten, kann zur Lösung nicht einfach willkürlich ein nationales Recht gewählt werden. Sie müssen zunächst in einer Art Vorprüfung herausfinden, welches Recht das anwendbare [16] ist. Hierzu muss das IPR herangezogen werden. Man gelangt in Fall 1 zu Art. 4 I Rom II-VO (gesprochen: Rom-2-Verordnung). Dieser wendet auf eine unerlaubte Handlung das Recht des Staates an, in dem der Schaden eingetreten ist. Dieses „Tatortprinzip“ führt zu der Anwendbarkeit italienischen Rechts. D’s Ausgleichsansprüche richten sich nach dem italienischen Schadensrecht, obwohl weder er noch Ö sonst nähere Bezüge zu Italien haben.
Nachdem Sie nun das Ergebnis der Falllösung kennen: Hätten Sie sich auch für das italienische Recht entschieden?
Fall 1 bricht durch die bestehende Auslandsberührung des Sachverhalts mit den vertrauten rechtlichen Fallschilderungen, in denen der deutsche Rechtsraum nicht verlassen wird. Bei letzteren wird z.B. nach der Wirksamkeit eines Kaufvertrages zwischen einem deutschen Käufer und deutschem Verkäufer gefragt. Die Anwendbarkeit des deutschen bürgerlichen Rechts auf solche Fälle erscheint wie selbstverständlich und steht außer Frage. Warum auch sollte daran gezweifelt werden? Sobald sich aber mehrere Rechtsordnungen in einen Fall „einmischen“, wird das gewohnte Muster durchbrochen.
Die Arbeitsweise im IPR
Wer den Einstieg in das IPR sucht, wird regelmäßig schon über erste Vorkenntnisse zum deutschen Zivilrecht verfügen. Umso überraschter ist der Leser dann, wenn er merkt, wie unterschiedlich die rechtliche Herangehensweise des IPR im Vergleich zum materiellen deutschen Zivilrecht ist. Im IPR geht es zwar wie sonst auch in der Rechtswissenschaft um die Rechtsanwendung, also Definition und Subsumtion von Rechtsnormen und Lebenssachverhalten. Das Ergebnis, welches am Ende steht, ist aber gänzlich anders. Im materiellen Recht dreht sich die Rechtsprüfung um Ansprüche, im IPR steht am Ende als Ergebnis, welche Rechtsordnung auf einen Sachverhalt anwendbar ist - das sogenannte Statut. Es geht vorrangig nicht um das Auffinden einer Anspruchsnorm des materiellen Sachrechts, sondern um die Ermittlung der „zuständigen“ Rechtsordnung an sich. Aus diesem Grund kann man ohne weiteres im IPR ein dem materiellen Sachrecht vorgelagertes Recht sehen.
[17]
Wenn die Rede von Sachrecht ist, ist damit nicht etwa Sachenrecht, das Recht der beweglichen und unbeweglichen Sachen, gemeint. Sachrecht lässt sich am einfachsten negativ umschreiben: Jedes Recht der Rechtsordnung eines Staates mit Ausnahme des IPR. Während nationales Sachrecht, beispielsweise BGB-Kaufrecht darüber entscheidet, ob eine Kaufsache mangelfrei ist oder nicht (also in der Sache selbst eine Entscheidung trifft), beantwortet IPR „lediglich“ die Frage, nach welcher nationalen Rechtsordnung die Mangelhaftigkeit der Kaufsache zu beurteilen ist. Das IPR trifft keine Aussage in der Sache selbst, diese bleibt vielmehr dem zur Anwendung berufenen Recht überlassen. Letztgenannte Frage kann und will IPR nicht beantworten. Es trifft nur ein rechtliches Zwischenergebnis.
Leitsatz 2
Sachrecht
Sachrecht (nicht Sachenrecht!) ist materielles Recht einer Rechtsordnung, welches eine bestimmte Rechtsmaterie in der Sache regelt. Im Gegensatz dazu bestimmt Kollisionsrecht (IPR) nur, welches Recht (damit auch Sachrecht) Anwendung findet. Das vom IPR berufene Recht wird auch als Statut bezeichnet (Bsp.: Erbstatut, Scheidungsstatut).
Welche Ziele verfolgt IPR?
Warum bemühen sich Staaten darum, in aufwendiger Weise gesetzlich zu regeln, welches Recht für bestimmte Sachverhalte anwendbar sein soll? Wäre es nicht einfacher, übersichtlicher und wirtschaftlicher, wenn jeder Staat ohne Rücksicht auf fremde Rechte bedingungslos seinem eigenen Recht den Vorzug einräumt? Auf den ersten Blick mag vieles für diese Annahme sprechen. Es würde jedoch in erheblichem Maße völkerrechtlichen Grundsätzen (Bsp.: Anerkennung fremder Staaten und Respekt vor deren eigenen Rechtsordnungen) widersprechen.