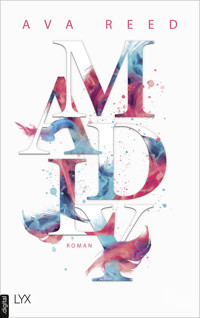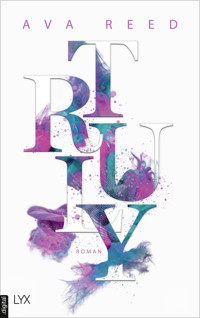9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Whitestone Hospital
- Sprache: Deutsch
MANCHE LEBEN KANN MAN NUR RETTEN, INDEM MAN ANDERE LOSLÄSST
Der Job als Assistenzärztin am Whitestone Hospital gibt Jane Miller mehr Kraft, als sie jemals für möglich gehalten hätte - bis sie in die Gynäkologie versetzt wird und dort mit der Oberärztin Dr. Abby Clark zusammenarbeiten muss. Abby berührt sie. Aber am schlimmsten ist, dass sie hinter Janes Fassade zu blicken und ihre dunkelsten Momente zu erkennen scheint. Kann Jane das zulassen und ihr Herz noch einmal für einen anderen Menschen öffnen?
»Saved Dreams ist eine Geschichte, die sicher kein Auge trocken lässt. Hochemotionale Patientinnengeschichten und eine herzzerreißend ehrliche Slow-Burn-Liebe, die sehnsüchtig auf jeden Kuss warten lässt!« ANNE LÜCK
Band 4 der Serie rund um die jungen Ärzt:innen des WHITESTONE HOSPITALS von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Ava Reed
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Liebe Leser:innen
Contenthinweis
Soundtrack
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Nachwort & Danksagung
Glossar
Die Autorin
Die Bücher von Ava Reed bei LYX
Impressum
Ava Reed
Saved Dreams
WHITESTONE HOSPITAL
Roman
Zu diesem Buch
Trotz aller Widrigkeiten hat Jane Miller ihr Medizinstudium abgeschlossen und arbeitet jetzt als Assistenzärztin am Whitestone Hospital in Phoenix. Die Arbeit im Krankenhaus gibt ihr Halt, sie liebt ihren Job und ganz besonders die Chirurgie. Die Station, die sie hingegen um jeden Preis meidet, ist die Gynäkologie. Bis ihr keine Wahl mehr bleibt und sie ausgerechnet dort bei einem Vorfall so schwer verletzt wird, dass sie in den nächsten Wochen keine Operationen durchführen kann. Jane muss daher weiter auf der Gyn arbeiten – unter Aufsicht der Oberärztin Dr. Abby Clark. Abby ist leidenschaftlich, sie brennt für ihren Job und ihre Patientinnen und versteht nicht, wieso ihre neue Assistenzärztin am liebsten von ihrer Station verschwinden würde, da Jane ein gutes Gespür für die Arbeit dort mitbringt. Doch sie merkt auch, dass Jane leidet und ihren Schmerz vor der Welt verbirgt. Und obwohl Jane versucht, Abby aus dem Weg zu gehen, berührt diese sie. Aber am schlimmsten ist, dass sie hinter Janes Fassade zu blicken und ihre dunkelsten Momente zu erkennen scheint. Kann Jane das zulassen und ihr Herz noch einmal für einen anderen Menschen öffnen?
Für jeden Menschen, der einen Teil von sich verloren hat und nicht weiß, wie es weitergehen soll – weil der Schmerz zu groß ist, zu stark, und sich jeder Tag anfühlt, als würde man atmen, ohne Luft zu bekommen.
Ich sehe euch.
Liebe Leser:innen,
dies ist der vierte Band der Whitestone-Hospital-Reihe. Bitte denkt dran, dass sich die Storyline kontinuierlich durch alle Bände zieht und die Geschichten daher nicht in falscher Reihenfolge oder unabhängig voneinander lesbar sind.
Saved Dreams knüpft direkt an das Ende von Tough Choices, dem dritten Band der Reihe, an.
Wie bereits in den Bänden zuvor findet ihr hinten ein Glossar mit den wichtigsten medizinischen Begriffen.
Die medizinischen Aspekte innerhalb der Reihe wurden meinerseits nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und auch von erfahrenem Fachpersonal geprüft. Falls dennoch Fehler durchgerutscht sein sollten, könnt ihr sie gerne direkt dem Verlag mitteilen, damit sie korrigiert werden können. Danke!
Dies ist mein erstes queeres Buch, und ich bin so happy, dass ich die Geschichte von Jane und Abby schreiben durfte. Ich hoffe, die beiden können euch berühren, begeistern und mitnehmen.
Eine kleine Bitte: Lest das Nachwort und die Danksagung wirklich erst, wenn ihr mit diesem Band fertig seid.
Willkommen zurück im Whitestone Hospital!
Eure Ava
Contenthinweis
In der gesamten Whitestone-Hospital-Reihe werden – auch aufgrund des Settings – verschiedenste Themen ihren Platz finden, die triggern können.
In Saved Dreams sind es unter anderem Leistungsdruck, körperliche Verletzungen jeglicher Art, diverse Körperflüssigkeiten, explizite Erwähnung und Beschreibung von Krankheiten, Operationen, Geburten sowie teils erfolglosen Reanimationen, Traumata, Waffengebrauch, Bedrohung, Verlust, Trauer, Schwangerschaft, Tod- und/oder Fehlgeburt, Kindstod, Organspende, Suizidgedanken, Stalking, Missbrauch / Vergewaltigung.
Diese Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte achtet auf euch und eure Gefühle.
Soundtrack
SOMETHING IN THE ORANGE (PIANO VERSION) – SUMMER RIOS
BIGGER THAN THE WHOLE SKY – TAYLOR SWIFT
IRIS (COVER) – GRACE DAVIES
BEAUTIFUL THINGS – BENSON BOONE
HIGH, HIGH, HIGH – CAMYLIO
WANT YOU MORE – MONCRIEFF
LEAVE A LIGHT ON (ACOUSTIC) – TOM WALKER
GHOST (ACOUSTIC COVER) – BETH
DANCING IN THE SKY – LIV HARLAND
LAY ME DOWN – SAM SMITH
MISSING PIECES – BELLA LAMBERT
MORE TO THIS – MARC SCIBILIA
CONFIDANT – BLAKEY
BRUISES – LEWIS CAPALDI
DARKEST HOUR – CHARLOTTE OC
WHO WE LOVE – SAM SMITH FEAT. ED SHEERAN
THANK YOU (ACOUSTIC) – GESTÖRT ABER GEIL, ANNA GREY
WE’LL BE FINE (ACOUSTIC) – LUZ
RUN TO YOU – LEA MICHELE
WHAT ABOUT US (COVER) – DAVINA MICHELLE
1. Kapitel
Jane
Ich kann nicht sterben, denn ich bin längst tot.
Das ist das Erste, was mir durch den Kopf geht, als ich herumgerissen werde und die kühle Klinge des Messers an meiner Kehle spüre; das Messer, die verschwitzte Hand an meinem Arm und das wilde Klopfen meines Herzens.
Der Geruch von Alkohol und Schweiß dringt in meine Nase, und ich höre Dutzende Geräusche, die in meinem Kopf zu einer chaotischen Arie werden. Nach und nach kommen immer mehr Menschen auf mich zu, drängen sich in den Gang oder bleiben an der Ecke stehen, von der aus man zielsicher zu jedem Bereich der gynäkologischen Station findet. Ich erkenne, wie sich ihre Münder zu einem stummen O formen, sich ihre Augen erschrocken weiten und sich auf ihren Gesichtern Schock, Wut oder Unglauben abzeichnet. Sie halten an, scharen sich um die Szenerie wie Geier um ein dahinscheidendes Tier.
Und dieses Tier bin ich.
Weil sie nichts tun können.
Nicht hingucken.
Nicht wegsehen.
Nicht helfen.
Nein, sie können nichts tun – außer warten.
Warten, bis es vorbei ist …
»Ich will zu meiner Frau!«, brüllt der Mann, der mich bedroht und an sich drückt, in mein Ohr, und ich zucke unwillkürlich zusammen – trotz der scharfen Waffe an meinem Hals. Ich warte auf die Panik, die mich ergreifen, und auf die Angst, die mir bis in die Knochen kriechen sollte. Doch sie kommen nicht, sie sind nicht da. Auch wenn ich schneller atme, mein Herz zu heftig klopft und ich zu schwitzen beginne, ist die Welt um mich herum klar und die in meinem Kopf ruhig.
»Ich will zu meinem Kind!« Die Stimme meines Angreifers bricht am Ende des Satzes, während ihm ein verzweifelter Laut entweicht und er so sehr an mir festhält, dass er kurz das Gleichgewicht verliert.
Ich torkle mit ihm nach hinten. Es ist wie ein Tanz auf Glas. Ein, zwei Schritte, bis er sich wieder fängt. Trotzdem keuche ich leise, denn er ruckt weiterhin von einer Seite zur nächsten, und obwohl ich ihn nicht sehen kann, spüre ich jede seiner Bewegungen.
Spüre seine Furcht und seinen Ärger. Seine Verzweiflung. Den unbändigen Drang, die Realität nicht anzuerkennen.
Ich kenne das.
Dieses Gefühl ist wie ein Gift, das ich überlebt habe, aber nie wieder losgeworden bin. Ein Gift, das mich ausfüllt, durchdringt und in die Knie zwingt. Eines, das mich den Abgrund sehen lässt, ohne es zu Ende zu bringen. Es macht mich zu einem Menschen, den ich nicht mehr kenne und der ich nie sein wollte. Tag um Tag.
»Wo ist meine Familie, verfluchte Scheiße! Wo?« Mit seinem Gebrüll reißt er mich aus meinen Gedanken. Ich erschrecke mich, bekomme eine Gänsehaut und spüre, wie meine Hände mitsamt dem Schweißfilm kalt werden.
»Wer … wer sind Sie?«, bringe ich schließlich hervor und ziehe damit seine Aufmerksamkeit auf mich. »Wer ist Ihre Frau?«
»Lili«, antwortet er. »Ich muss zu ihr.«
Der Name sagt mir etwas. Er klingt wie …
»Liliana Scott«, murmle ich nachdenklich und bemerke, wie er erleichtert durchatmet, weil ich sie zu kennen scheine.
»Ja. Liliana. Sie ist hier irgendwo. Mit unserem Kind. Ich muss wissen, wo genau. Ich muss wissen, dass es den beiden gut geht.«
Der da hinter mir mit der Alkoholfahne und der Waffe kann niemand anderes als Andrew Scott sein. Anfang zwanzig und Lilianas Mann, der gerade gegen seine Auflagen verstößt. Ich bin sicher, die Familie, von der Maisie mir berichtet hat – die junge Frau, der süchtige Mann –, das waren sie. Außerdem hat mich Dr. Abby Clark zu Beginn der Schicht eingeweiht und mir die Akte vorgelegt, weil Liliana auf Station lag und Wehen verzeichnet wurden. Sie kam bereits wenige Minuten später in den Kreißsaal, und ein Alarm ging los. Liliana musste in den OP, weil das Baby nicht gut auf den Wehenstress reagierte und die Herztöne zu langsam waren. Zudem hat der Kopf sich bei jeder Presswehe gegen das Becken gedrückt. Die Stirn des Babys ist am Ende so stark angeschwollen, dass es kaum mehr eine Chance hatte, durch den Geburtskanal zu kommen. Daher der Kaiserschnitt. Abby hat ihn durchgeführt, ich habe derweil eine andere Patientin betreut, die ambulant reinkam und einen Termin hatte. Sie wollte sich über die Vor- und Nachteile einer Spirale informieren und hat einen Termin für das Einsetzen ausgemacht. Gerade als diese ging und Liliana kurz darauf aus dem OP kam, wurden die Stimmen im Flur lauter. Ich ging hin, sah nach – und das hier ist das Ergebnis davon.
Die wichtigste Frage ist jedoch, woher ihr Mann, der sie nicht nur misshandelt hat, sondern dem zudem ein Kontaktverbot auferlegt wurde, Bescheid weiß.
»Woher wissen Sie von der Geburt?«, hake ich nach, und sein Griff verstärkt sich, sodass ich meinen Kopf aus Reflex noch ein Stückchen mehr in den Nacken lege. Für einen Augenblick habe ich die Klinge vergessen und irgendwie auch meine beschissene Situation, doch der Druck an meinem gestreckten Hals erinnert mich wieder sehr deutlich daran.
»Was?« Seine Stimme wirkt panisch, seine Bewegungen fahrig. Ich kann sie und seine Rastlosigkeit an meinem Rücken spüren. Und so ruhig meine Gedanken sind, so wenig Angst ich habe, mein Körper reagiert anders und absorbiert diese Hektik. Es ist schwer, still zu stehen, doch ich zwinge mich dazu.
Da Andrew meine Frage anscheinend nicht verstanden hat, versuche ich es noch einmal.
»Sind Sie rein zufällig hergekommen?«
»Nein … nein … man hat mich angerufen. Man hat mich informiert, dass meine Frau in den Wehen liegt.«
Scheiße. In Gedanken fluchend schließe ich einen Moment die Augen. Jemand hat nicht aufgepasst. Nicht nachgedacht. Hat den Vermerk in der Akte ignoriert oder übersehen. Ein Fehler. Einer der passieren kann, aber nicht passieren darf.
Was soll ich tun? Besser meinen Mund halten? Einfach warten?
Müsste ich, verflucht noch mal, nicht weinen und zittern und ängstlich sein?
»Sie sollten gehen«, höre ich mich stattdessen sagen. Mit ruhiger, klarer Stimme, während jedes Paar Augen in unmittelbarer Nähe auf mich gerichtet ist. Ich spüre sie, als wären sie große und viel zu helle Scheinwerfer. »Sie sollten das Messer einstecken, gehen und Ihre Frau in Ruhe lassen.«
»Ich soll was?« Ich höre sein Keuchen. »Und mein Kind etwa auch? Mein Kind auch?«
»Ja«, bringe ich hervor.
»Willst du mich verarschen?«, zischt er, und der Druck an meinem Hals nimmt zu.
Ich kann nicht sterben, denn ich bin längst tot.
Mein Blickfeld ist jetzt eingeschränkt, so, wie ich meinen Kopf halten muss, aber ich erkenne plötzlich bekannte Gesichter in der Menge. Maisie. Grant. Sie stehen in ein paar Metern Entfernung, aber sie sind da und müssen sich das hier ansehen, ohne etwas tun zu können. Maisie will vortreten, aber Grant hält sie zurück. Zum Glück. Wehe, sie bringt sich in Gefahr.
»So, wie ich das sehe«, beginne ich und atme schwer dabei, »haben Sie nicht viele Alternativen.«
»Red keine Scheiße, was weißt du schon? Das ist meine Frau. Das ist mein Kind. Und die will ich jetzt sehen.«
»Nein.«
»Halts Maul, Schlampe!« Seine Stimme überschlägt sich und dröhnt in meinen Ohren.
Ein kollektives Luftanhalten durchdringt den Raum. Keuchen. Leise und laute Töne des Schocks. Und auf einmal ist da dieses Ziehen an meiner Kehle. Dieser feine Schmerz, den man verspürt, nachdem man sich an einem Stück Papier geschnitten hat.
Zweier Dinge bin ich mir sicher: Die Klinge ist scharf – und Blut rinnt an meinem Hals hinab. Sickert vermutlich gleich in den Kragen meines Kasacks. Nicht viel. Ich glaube nicht, dass die Wunde allzu tief oder groß ist. Noch nicht. Aber seine Drohung ist unmissverständlich. Und doch kann ich nicht anders. Wenn es schon egal ist, was mit mir passiert, kann ich zumindest alles tun, um Liliana und dem Baby zu helfen.
»Sie haben Ihre Frau bereits verloren. Ihr Kind auch. Und zwar, als Sie angefangen haben, sie zu schlagen – sie und das Ungeborene in ihrem Bauch. Sie haben sie verloren, als sie süchtig wurden und Ihnen die Kontrolle über sich abhanden gekommen ist. Das Beste, was Sie jetzt tun können, ist, zu verschwinden.« Meine Worte sind laut. Selbstbewusst. Sicher. Alles, was ich gerne wäre.
Ich höre sein Schluchzen. Spüre die tiefe Verzweiflung in jedem seiner Atemzüge beinah körperlich.
»Ich sagte, halt dein Maul!« Er klingt, als würde er mich am liebsten schütteln.
Keine zwei Atemzüge später dreht er sich ruckartig mit mir nach links, als eine fremde Stimme zu ihm spricht und nicht länger ich.
»Sie hat recht, Andrew. Die Polizei ist bereits auf dem Weg. Sie werden Lili nicht sehen und das Kind auch nicht.« Abby steht keine sechs Schritte von mir entfernt, mit ernstem Gesichtsausdruck. Gefasst und aufmerksam.
»Ich werde sie umbringen!«, blafft Andrew, und mir ist klar, dass er mich meint.
Mich.
Mich.
Mich.
Bin ich dafür bereit? Will ich das? Darf ich das wollen? Darf es mir egal sein und gleichzeitig nicht? Was sollte und müsste ich jetzt fühlen und denken und sagen und tun?
Was nur?
Abby lässt ihren Blick von ihm zu mir wandern, trifft meinen, verhakt sich mit ihm, und ich schaue nicht weg. Ich halte stand.
Wir sind keine Freundinnen. Wir sind Kolleginnen. Genau genommen ist sie mein Boss. Aber in Gedanken schreie ich ihr ins Gesicht: Wehe, du gibst nach. Wehe, du lässt ihn zu ihr! Das bin ich nicht wert.
Und aus irgendeinem Grund glaube ich, dass sie jedes meiner Worte in ihrem Kopf hört. Vielleicht ist es die Art, wie sie ihn neigt oder wie sie die schmalen Lippen zusammenpresst.
»Andrew. Sie werden hier nicht durchkommen.« Abbys Blick liegt weiterhin auf mir. »Ich werde Sie unter keinen Umständen vorbeilassen. Liliana und das Kind unterstehen mir und meinem Schutz. Es spielt keine Rolle, was Sie tun oder versuchen: Die Polizei wird gleich eintreffen und Sie festnehmen. Sie verlassen dieses Haus in Handschellen. Ob als Mörder oder nicht, obliegt Ihnen.«
Eine Gänsehaut bildet sich auf meinen Unterarmen. Es ist, als würde das Whitestone für einen Wimpernschlag lang die Luft anhalten, während Abbys Worte verklingen.
Andrews Schrei fährt mir durch Mark und Bein. Mein Mund ist trocken, mein Nacken beginnt zu schmerzen. Ab jetzt kann alles passieren, und ich habe keine Ahnung, ob ich bereit dafür bin, aber es macht mir nichts aus. Nichts …
»Hast du mich nicht verstanden? Ich bringe sie um! Ich schneide ihr die verdammte Kehle durch. Und danach dir. Ich steche jeden ab, bis ich bei meinem Kind bin.« Meine Beine beginnen zu zittern. Dabei habe ich keine Angst. Da ist keine Angst in mir …
»Warum keine Pistole?«, höre ich mich sagen. »Warum ein Messer?«
»Ist doch scheißegal!« Er schnaubt, der Griff um meinen Oberkörper verstärkt sich.
»Mit dem Messer können Sie mich verletzen oder umbringen, ohne Frage, aber danach sind Sie ein leichtes Ziel für die Polizei. Mit einer Pistole könnten Sie viel schneller mehr Schaden anrichten. Sich den Weg freischießen.« Ich schlucke, auch wenn es unangenehm ist. »Nein. Sie wollen niemanden umbringen. Nur zu ihrer Familie.« Meine Stimme wird mit jedem Wort, das mir über die Lippen kommt, schwächer. Wie in Trance hebe ich meine rechte Hand, schiebe sie unter Andrews Arm, zwischen mich und ihn, direkt unter sein Handgelenk, immer weiter. Wie durch einen Schleier erkenne ich, wie Abbys Augen sich weiten und ihre Lippen sich teilen, wie ihr Arm nach vorne ruckt, als würde sie ahnen, was ich vorhabe.
»Verfluchte Scheiße! Was machst du da?« Andrew bekommt Panik, während ich Druck ausübe – und er lässt es zu. Weil er nicht damit gerechnet hat. Weil es lebensmüde ist.
Meine Hand gleitet ans Messer. Ich schiebe es zurück, lehne mich so weit nach hinten, wie ich noch kann … Dann befindet sich meine Handfläche zwischen meinem Hals und der Waffe.
Ich dränge sie weg.
Doch nach dem kurzen Schockmoment hält er dagegen. Weniger stark als vorher, zögernd.
Blut quillt hervor und tropft auf meine Kleidung, läuft mir über das Gelenk und zwischen die Finger. Doch ich gebe nicht nach. Nicht ihm und nicht dem Schmerz, den ich dumpf wahrnehme. Meine Hand schließt sich fest um die Klinge.
»Lass los! Fuck. Du willst wirklich sterben, oder?«
Ich könnte Ja sagen. Ich könnte Nein sagen. Beides wäre eine Lüge. Beides wäre wahr.
»Ich kann nicht sterben, denn ich bin längst tot«, wispere ich und realisiere zu spät, dass ich die Worte dieses Mal nicht nur gedacht habe.
Andrews Griff um meinen Arm wird schwächer. Vielleicht, weil er mich gehört hat. Vielleicht auch nur, weil er mir entgegen seiner eigenen Aussage tatsächlich kein Haar krümmen will. Vielleicht, vielleicht, vielleicht …
Ich halte die Klinge, drehe mich zur Seite. So weit, wie ich kann. So weit, wie es nötig ist, um ihn direkt anzusehen. In seine aufgerissenen Augen mit den viel zu großen Pupillen.
Und als würde Andrew endlich begreifen, was gerade passiert, als würde er aufwachen und bemerken, dass ich kurz davor bin, die Oberhand zu gewinnen, packt er mich erneut. Noch unnachgiebiger als zuvor.
Mit einem Ruck entzieht er das Messer meinem Griff.
Zisch.
Ratsch.
So hört es sich in meinem Kopf an.
Keuchen.
Aufschreie.
So hört es sich in echt an.
Schnell.
Schmerzhaft.
Nachhallend.
So ist es, als die Klinge meine Haut teilt …
Er hat sie mir quer über die Innenfläche der rechten Hand gezogen, die sich mit Blut füllt, und ich kann mir ein Stöhnen und einen darauffolgenden hohen Schmerzenslaut nicht verkneifen. Ein Wimmern entfährt mir, weil es mehr wehtut, als erwartet.
Und nun? Nun stehe ich da. So anders als vorher und doch irgendwie gleich.
Meine Handinnenfläche brennt, und ich schaue Andrew in die Augen, während er mir die nun mit Sicherheit rötlich glänzende Spitze des Messers genau an die Halsschlagader drückt. Sein Gesicht ist zu einer widerlichen Fratze verzogen. Der Geruch nach Blut, Schweiß und Alkohol wird stärker. Einhüllender. Ich unterdrücke ein Würgen, versuche, nicht an meine Hand zu denken. Ich habe nichts zu verlieren und nichts zu gewinnen. Also wieso sollte ich jetzt aufhören und nachgeben?
»Ich weiß, wie das ist«, murmle ich so, dass nur er mich verstehen kann. »Ich weiß, wie das ist, wenn man nicht vor und nicht zurück kann.«
Hinter mir höre ich, wie Stimmen lauter werden und Schritte, die näher herankommen. Andrew schaut schnell von links nach rechts, scannt seine Umgebung. Hektisch, unsicher, wütend.
Die Polizei ist da.
»Ich weiß, wie es ist, wenn man etwas verliert, das man unbedingt behalten möchte.« Er schaut zurück zu mir, zieht seine Brauen zusammen, und ich kann erkennen, wie er schwer schluckt. Dabei bin ich in Gedanken nicht mehr hier. Ich bin weit weg. An einem anderen Ort. Zu einer anderen Zeit.
Tränen steigen mir in die Augen.
»Manchmal kann man nichts mehr tun, außer zusehen. Manchmal rinnt einem alles durch die Finger, alles, was man gerne festhalten möchte«, wispere ich nahezu erstickt und schließe für wenige Sekunden die Lider. Atme. Lasse die Tränen zu. »Es ist egal, ob man selbst schuld ist. Egal, ob man es hätte ändern können oder nicht. Es ist zu spät. Manchmal muss man einfach damit leben.«
Ich sehe ihm an, dass er am liebsten schreien und toben würde. Vermutlich würde er mir gerne wieder und wieder an den Kopf werfen, dass ich keine Ahnung habe, wovon ich rede. Doch meine Tränen sprechen eine andere Sprache, und das ist ihm klar. Meine Situation ist nicht wie seine – aber sie kommt auf das Gleiche hinaus.
Wir beide können nicht zurück.
Wir beide haben etwas verloren, das wir nicht verlieren wollten.
Wir beide müssen anfangen, das zu akzeptieren.
Und das tut weh.
Das.
Tut.
So.
Weh.
Ganz tief in einem drin.
Ich blinzle mehrmals, räuspere mich und mache ihm noch einmal klar, was unabänderlich ist.
»Sie werden Liliana und Ihr Kind nicht sehen. Sie werden nicht zu Ihnen können. Vielleicht niemals, aber definitiv nicht heute. Das Beste, was Sie tun können, ist, das zu respektieren. Seien Sie dankbar, und erfreuen Sie sich an dem Gedanken, dass beide glücklich werden. Bitte, lassen Sie die beiden glücklich sein.«
Mir ist bewusst: Er hat mein Mitleid nicht verdient. Und am wenigsten haben seine Frau und sein Kind verdient, was ihnen von ihm und durch ihn angetan wurde.
Trotzdem habe ich es. Mitleid.
Denn er ist das Opfer seiner eigenen geschaffenen Hölle.
2. Kapitel
Abby
Jedes Jahr hoffen wir darauf, dass die Feiertage und die letzten Momente des Jahres ruhig werden. Besinnlich.
Und jedes Mal geht es in die Hose.
Dabei war bis eben alles in Ordnung. Die Geburt der kleinen Anna-Rose war zwar kein Spaziergang für Liliana, aber beide sind wohlauf, und man kümmert sich um sie. Deshalb war ich mir, nachdem ich den OP verlassen habe, sicher, dass ich mit Dr. Jane Miller direkt die nächste Patientin betreuen kann. Wir lagen recht gut in der Zeit, doch das hat sich offensichtlich erledigt. Denn statt in meinem Untersuchungszimmer zu sein, stehe ich im Flur, vor dem Durchgang zur Geburtsstation – keine fünf Schritte von Andrew Scott entfernt. Lilianas unliebsamer Gatte richtet in dieser Sekunde ein verdammt großes Messer auf Jane. Die Assistenzärztin, die heute endlich ihren Dienst in der Gynäkologie angetreten hat. Ohne Ausreden. Ohne Schiebereien. Ohne Zwischenfälle.
Bis jetzt.
»Sir, treten Sie zurück, und legen Sie die Waffe auf den Boden. Schön langsam. Danach heben Sie Ihre Hände über den Kopf, sodass wir sie sehen können!« Die laute, jedoch ruhige Stimme eines Polizisten dröhnt durch den Gang und hallt von den Wänden wider. Sie übertönt das Rauschen des Blutes in meinen Ohren und meine wirren Gedanken.
Ich starre auf die Szenerie, als könnte ich dadurch etwas verändern. Als könnte ich Jane aus dieser gefährlichen Situation befreien und Andrew der Polizei übergeben. Doch das kann ich nicht. Ich bin keine Hilfe. Nicht für Jane.
Sie steht vor Andrew, als hätte sie nichts zu verlieren. Mit erhobenem Kinn. Blut, das an ihrer Hand und ihren Fingern hinabrinnt und auf ihrem weißen Kittel prangt wie neonfarbene Lichter. Auf dem Kittel, auf ihrer Haut und dem hellen Boden.
Jane ist standhaft wie ein Berg. Wie etwas, das nicht in die Knie gezwungen werden kann.
Ich habe nicht viel gehört von dem, was sie zu ihm gesagt hat. Was sie zu ihm gesagt haben muss, denn ihre Lippen bewegten sich, während sich seine Mimik änderte. Aber ich habe gehört, dass sie nicht nachgeben wird, und der Blick, den sie mir dabei zugeworfen hat, sagte mir, dass ich das gefälligst auch nicht tun sollte. Und das werde ich nicht.
Andrew wird nicht zu Liliana und dem Baby gelangen.
Verflucht, ich weiß nicht mal, was er hier zu suchen hat. Woher er von der Geburt wusste. Das wird eines der Dinge sein, die es später zu klären gilt.
»Los! Hände hoch! Dahin, wo ich sie sehen kann!« Einer der Polizisten wird nachdrücklicher. Seine Waffe und die seiner Kolleginnen und Kollegen sind auf Andrew gerichtet. Auf ihn und auf Jane, die er vor sich hält wie einen Schutzschild. Jane starrt in sein Gesicht und wirkt dabei, als wäre sie mit den Gedanken woanders. Weit weg. Sie steht da, mit dem Rücken zur Polizei, mit dem Profil zu mir, und ich kann verdammt noch mal nichts für sie tun, obwohl ich am liebsten nach vorne stürmen und sie mir schnappen würde. In meinem Kopf ist das ganz leicht: Ich sprinte zu ihr, ziehe sie weg und mit mir mit. Raus aus der Gefahrenzone. Im Hier und Jetzt ist das eine beschissene Idee, die mit Sicherheit in die Hose gehen würde. Egal wie, ich wäre nicht schnell genug und würde der Polizei in die Quere kommen. Abgesehen davon, dass der Mistkerl Jane immer noch ein großes scharfes Messer gegen die Halsschlagader drückt.
Andrews Blick wird zunehmend panischer, seine Hände beginnen zu zittern, und sein Adamsapfel hüpft, als er mehrmals schwerfällig schluckt. Er verringert den Druck des Messers für einen Wimpernschlag, hebt es an und dreht es ein Stück. Die Klinge liegt nicht länger nur mit der Spitze an Janes Hals, sondern in gesamter Länge an ihrer Kehle. Jane verzieht merklich das Gesicht, während ich fluchend die Hände zu Fäusten balle und sie an meine Oberschenkel drücke.
Grant steht schräg hinter einem Teil des Polizeiaufgebots, hält Maisies Hand und sie damit zurück. Wahrscheinlich hat sie schon mehr als ein Mal daran gedacht, nach vorne zu hechten, um ihrer Freundin zu helfen.
Die Polizei hat Andrew mittlerweile umzingelt, und anhand seiner Mimik und Gestik hat dieser das längst erkannt. Die Frage ist, wie reagiert er darauf? Wie zugedröhnt ist er? Wie klar kann er denken? Wie sehr will er zu seinem Kind? Wie egal sind ihm die Konsequenzen?
»Sie wollen niemanden verletzen, da bin ich sicher«, versucht es eine Polizistin. »Also nehmen Sie die Waffe runter, lassen Sie die Ärztin los, und wir finden gemeinsam eine Lösung.«
Andrew hält inne, sieht die Polizistin an – und lacht. Er lacht sie aus. Scheiße.
»Wir finden eine Lösung«, höre ich ihn sagen. Mehr zu sich selbst als zu anderen. Bis er das Gesicht verzieht, als würden sich Schmerz und purer Zorn zu einem Gift mischen, das alles zugrunde richtet. Ihn und seine ganze Welt. »Welche Lösung?«, brüllt er, und seine Finger krallen sich fester in Janes Kittel. »Darf ich mein Kind sehen? Meine Frau?«, spuckt er aus. »Darf ich zu ihnen?« Plötzlich bricht seine Stimme. Verzweiflung, Scham und Trauer übernehmen.
Er hat recht. Es wird keine Lösung geben. Andrew wird verhaftet werden, so oder so. Wie lange er ins Gefängnis muss, liegt an ihm.
»Sie haben nur noch eine Wahl«, beginnt Jane mit klarer Stimme und reckt das Kinn. »Sterben oder leben. Denn ich glaube nicht, dass jemand zögern wird, auf Sie zu schießen, sollten Sie das Messer nicht fallen lassen, und stattdessen mich damit verletzen – oder Schlimmeres. Aber wenn Sie die Waffe weglegen, leben Sie. Das bedeutet, dass es eine Chance gibt, Ihre Tochter zu sehen. Irgendwann.« Jane bietet ihm keine Lösung. Nein, sie bietet ihm mehr: Hoffnung. Mehr, als er verdient, nachdem er seiner Frau und seinem ungeborenen Kind bisher nichts Gutes gebracht hat …
Und vielleicht wird ihm das in dieser Sekunde bewusst. Dringt durch den Schleier aus Alkohol, dem Wahn und Zorn.
Ganz vielleicht ist da etwas in ihm, das versteht, was Liebe wirklich bedeutet.
Andrews Schultern sinken herab, ein gequälter Laut entfährt ihm, und seine Unterlippe beginnt zu zittern, während die Pistolen der Polizei und die Blicke all jener, die nichts tun können, aber eben anwesend sind, weiterhin auf ihn gerichtet sind. Sein heftiger Atem weht wie Wind durch Janes kurzen Pony, wodurch ihre Strähnen zur Seite hüpfen – bis Andrew das Messer nicht länger an ihre Kehle drückt.
Ein Raunen erfüllt den Raum, danach ein Luftanhalten. Er lässt ruckartig von Jane ab und stößt sie von sich.
Andrew lässt das Messer fallen – genau wie sich selbst. In der Sekunde, in der Jane ein Keuchen entfährt und sich ihre Augen weiten, prallt Andrew schluchzend mit den Knien auf den Boden.
Die Polizei reagiert sofort.
»Hinlegen!«
»Auf den Boden!«
»Hände über den Kopf!«
»Gesichert!«
Gesichert. Die Polizei nimmt Andrew fest, erklärt ihm seine Rechte, während Jane weiter dasteht, als wäre sie unbezwingbar. Sie steht da und starrt an die Wand; mit einer Träne, die über ihre Wange rollt, als würde sie sich wünschen, es wäre anders.
Es ist nur ein Gefühl, vielleicht ist es nichts weiter als Einbildung, aber der Gedanke lässt mich nicht los.
Und in der Sekunde, als das laute Klicken von Handschellen erklingt, kann ich das kollektive Durchatmen der Menschen um mich herum nicht nur hören, sondern nahezu spüren. Ihres und meines.
Ich erwache aus meiner Starre, begreife, dass ich Jane nicht mehr in Gefahr bringe, wenn ich mich falsch bewege, und bin bereits einen Wimpernschlag später bei ihr. Ich hebe meine Hand und schiebe Strähnen ihres kurzen braunen Haares hinter ihr linkes Ohr, um ihren Hals besser betrachten zu können. Als meine Finger ihr Kinn berühren, zuckt sie kaum merklich zusammen. Es ist, als würde sie aufwachen. Ihr Blick aus blaugrünen Augen findet meinen und lässt mich schwer schlucken. Sie ist etwas kleiner als ich, etwas zierlicher, und sie war mir nie so nah wie in diesem Moment. Sie mir nicht, ich ihr nicht.
Eine zarte Gänsehaut bildet sich auf meinen Unterarmen, während ich ihrem Blick standhalte. Aus Augen, bei denen ich nicht sagen kann, ob ganze Welten in ihnen liegen – oder nichts als Leere.
Ich bin Jane öfter im Flur, manchmal in der Cafeteria oder in der Notaufnahme begegnet, habe ein, zwei Mal mit ihr zusammengearbeitet, nur kurz, und sie war stets sehr distanziert. Ruhig. Unauffällig. Freundlich, ja, aber auch reserviert. Und zum ersten Mal frage ich mich, ob da mehr ist als eine Person, die einfach nur in sich gekehrt ist. Ob diese Stille da ist, weil alles andere in der Welt zu laut ist.
Der Impuls, sie in eine Umarmung zu ziehen, ist plötzlich übermächtig und wird lediglich durch Maisie und Grant verhindert, die sich einen Weg durch das Chaos gebahnt haben, neben uns zum Stehen kommen und den Blickkontakt zwischen Jane und mir unterbrechen.
Ich räuspere mich leise, begutachte Janes Hals, gegen den bis eben eine Klinge gedrückt wurde, und stelle fest, dass es neben einem oberflächlichen Schnitt, der bereits aufgehört hat zu bluten und von allein in wenigen Tagen abheilen wird, nur ein, zwei rote Druckstellen gibt.
»Du meine Güte, Jane!«, sagt Maisie und kann den Drang, ihre Freundin zu berühren, nicht mehr unterdrücken. Sie legt ihre Arme schwungvoll um Janes Mitte und drückt sie so fest an sich, dass sie kurz zur Seite schwankt und einen überraschten Ton von sich gibt. Doch die Umarmung währt nicht lange, denn bereits wenige Sekunden später schreckt Maisie zurück, als hätte sie sich verbrannt. »Deine Hand. Du bist verletzt! Hab ich dir noch weiter wehgetan?« Sie deutet auf das Blut, das vereinzelt auf den Boden tropft, und als Jane verneint, stemmt die sonst so fröhliche Maisie ihre Fäuste in die Hüften und funkelt ihre Freundin wütend an. Und mir bleibt nichts anderes übrig als zuzusehen. »Bist du verrückt geworden? Du greifst einfach in ein Messer? Und ich muss dastehen und kann nichts tun? Weißt du, wie viele Sorgen ich mir eben machen musste? Willst du, dass ich einen Herzinfarkt bekomme?«
Nicht nur Grant lächelt bei dieser Standpauke, sondern auch Jane, und das überrascht mich. Ich kann mich nicht erinnern, sie je so sehr lächeln gesehen zu haben, oder auch nur zaghaft. Vermutlich ist es diese Art von Lächeln, welches Jane sich nur für diejenigen aufhebt, die ihr etwas bedeuten.
Während meine Gedanken unaufhaltsam umherspringen, greife ich nach Janes Hand und hebe sie vorsichtig an, um mir die Wunde in der Innenfläche anzusehen. Ein sauberer Schnitt. Aber ein verdammt langer. Wie tief er ist, kann ich nicht erkennen, dafür muss all das Blut erst mal verschwinden.
»Wir sollten die Wunde säubern und schauen, was gemacht werden muss. Wir kommen wohl nicht umhin, zu nähen«, sage ich trocken und verhindere damit einen weiteren kleinen Wutausbruch von Maisie. Ich und der Polizist, der im nächsten Moment auf uns zutritt und mich anspricht.
»Sind Sie die zuständige Ärztin?«
»Dr. Abby Clark, diensthabende Ärztin der Station. Ich nehme an, es geht um den Bericht?«
Er nickt, danach lässt er seinen Blick zu Jane huschen, die ihren sofort senkt.
Ich halte weiter ihre verletzte Hand.
»Ich werde alles in die Wege leiten. Der Chefarzt wird sich melden, wir lassen Ihnen alle Aussagen zeitnah zukommen. Oder ist es nötig, Sie aufs Revier zu begleiten?«
»Nein, das ist in Ordnung. Wir werden unsererseits einen vorläufigen Bericht anfertigen.« Er nickt erneut knapp, dann wendet er sich Jane zu. »Können Sie mir nur schnell erklären, wie es dazu kam?«
Mit fester Stimme gibt Jane ihm einen Einblick in die Geschehnisse.
»In Ordnung. Danke. Bitte lassen Sie sich medizinisch betreuen. Sie sind hier in den besten Händen, nehme ich an«, sagt er, lächelt sowohl Maisie und Grant als auch mir und Jane kurz zu, bevor er seinen Kolleginnen und Kollegen folgt, die Andrew soeben abgeführt haben.
»Maisie, Grant, ihr solltet zurück auf Station. Wenn möglich, schreibt heute oder morgen den Bericht, alles, was ihr wisst und gesehen habt. Ihr könnt ihn direkt Ian geben, ich informiere ihn gleich.«
Maisie zögert, und mir entgeht nicht, dass Grant ihre Hand nimmt. Das bringt mich zum Schmunzeln. Anscheinend haben sich die beiden gefunden.
»Es tut mir leid, das ist meine Schuld«, bricht es plötzlich aus Maisie heraus, und sie wirkt, als würde sie jeden Augenblick in Tränen ausbrechen. Grant seufzt und legt einen Arm um sie, um sie zu trösten, während Jane so verwirrt aussieht, wie ich mich fühle. Ich runzle die Stirn und warte.
»Das war nicht deine Schuld, Mase«, sagt Grant, doch sie sieht nicht überzeugt aus.
»Wieso sollte es das auch sein?«, hake ich nach.
»Ich hab Grant eine ruhige Schicht gewünscht«, nuschelt sie ernst. »Ich wusste nicht, dass man so etwas nicht sagt. Dass dann erst recht schlimme Dinge passieren. Ich hab es gesagt, und der Alarm ging los.«
Ich muss mir ein Lachen verkneifen. Das ist süß. Auch wenn manche Menschen, was das angeht, etwas abergläubisch sind, hat das hier nichts mit ihr oder ihren Worten zu tun. Schlimme Dinge im Krankenhaus passieren nicht, nur weil man sich eine ruhige oder perfekte Schicht wünscht. »Das ist nicht deine Schuld. Aber vielleicht verkneifen wir uns diese Art von Satz alle in nächster Zeit.« Neckend zwinkere ich ihr zu.
»Das ist nicht hilfreich, Abby«, grummelt Grant, und ich erkenne Maisies zaghaftes Lächeln. Sie sollte sich keine Vorwürfe machen. Alles wird wieder gut.
»Die beiden haben recht. Du bist dafür nicht verantwortlich. Okay?«, bestärkt Jane sie.
»Okay.« Maisie nickt. »Wir sehen uns zu Hause. Kommst du zurecht?«
»Ja. Das wird schon.«
Ich sehe Maisie an, wie sie mit sich ringt. Die Sorge um ihre Freundin ist zu groß. Das verstehe ich. Der Schreck sitzt uns allen in den Knochen. Jane bestimmt auch, selbst wenn sie es nicht zeigt.
»Ich kümmere mich um sie«, sage ich, damit sie weiß, Jane ist nicht allein. »Sobald sie versorgt ist, schicke ich sie nach Hause, damit sie sich ausruhen kann.«
»Danke, Abby.« Maisie schenkt mir ein Lächeln, bevor sie sich verabschiedet, genau wie Grant. Sie verlassen die Gynäkologie, und ich widme meine Aufmerksamkeit erneut meiner Assistenzärztin und ihrer Verletzung.
Ich halte noch immer ihre Hand.
Keine Ahnung, ob es ihr bewusst ist. Ich weiß nur: Nach dem, was ich eben gesehen habe oder zu sehen geglaubt habe, bin ich mir nicht mehr sicher, erahnen zu können, wer genau Jane Miller ist – oder wer sie unbedingt versucht zu sein.
3. Kapitel
Jane
Es ist vorbei.
Ich atme noch.
Es ist alles, wie es war.
Abby steht direkt vor mir, sieht mich an, und für einen Augenblick kann ich kaum atmen, weil ich das Gefühl habe, sie würde sehen, was in mir vorgeht. Was ich denke und fühle. Deshalb schaue ich weg, befeuchte meine Lippen mit der Zunge und räuspere mich. Gebe alles, um die Risse in meiner Mauer zu flicken und meine Gedanken zu ordnen. Dabei spüre ich ihre Hand an meiner und würde sie gerne wegziehen, aber ich tue es nicht. Ich tue es nicht, weil …
»Komm mit«, sagt Abby sanft. »Lass uns die Wunde anschauen und versorgen.«
»Schon gut, ich gehe einfach runter in die Notaufnahme oder mache es selbst. Ich krieg das hin. Du musst dir keine Umstände machen, du hast genug zu tun.« Meine Stimme klingt fremd, hohl, ein wenig, als würde sie nicht mir gehören. Vielleicht stehe ich unter Schock. Es wäre seltsam wenn nicht, oder?
Als ich nach oben blicke, erkenne ich, wie Abby die Lippen kräuselt und eine Augenbraue hochzieht. Sie legt mir ohne Vorwarnung eine Hand auf den unteren Rücken und schiebt mich in Richtung ihres Behandlungszimmers. Ohne etwas zu sagen, hat sie meinen Protest im Keim erstickt.
Es gibt in meiner Welt viele Gründe, nicht in der Gynäkologie zu arbeiten. Dutzende. Keiner davon hatte damit zu tun, Angst vor einem bewaffneten Mann haben zu müssen, und doch ist genau das passiert. Der unwahrscheinlichste Fall ist eingetreten, hat mich heute eingeholt wie ein Albtraum. Wie ein Zeichen oder schlechtes Omen. Ich glaube nicht an solche Dinge, auch wenn ich es mir manchmal wünsche. Es wäre schön, darauf vertrauen zu können, dass am Ende alles gut wird. Dass es einen Plan gibt. Einen Gott. Es wäre leichter, mein Leben zu leben, wüsste ich, dass alles einen Sinn hat. Und ich bin mir sicher, all die schlechten Dinge, all das, was mich bei Tag und Nacht verfolgt, wäre nur halb so schlimm.
»Setz dich.« Abby deutet auf den Stuhl vor ihrem Schreibtisch, der in der linken Ecke ihres Behandlungszimmers steht.
Der Raum ist groß und lichtdurchflutet, es riecht nach Kamille statt nach Desinfektionsmittel, und an den Wänden findet man weder kitschige Tapete noch gerahmte Gemälde namhafter Künstlerinnen und Künstler – es sind Malereien von Kindern. Vermutlich von jenen, die Abby seit ihrer Geburt kennt oder deren Mütter sie behandelt. Passend dazu steht an einer Wand ein kleiner bunter Tisch mit zwei Stühlen, Papier, Stiften und einer Kiste voller Spielzeug. Und ich frage mich, wie das wohl ist, das eigene Kind beim Malen und Spielen zu beobachten …
»Jane?«
Mein Kopf ruckt zu Abby herum, die mich aus meinen Gedanken gerissen und sich bereits alles zurechtgelegt hat. Sie beobachtet mich aufmerksam. Mehr, als mir lieb ist. Abby sieht mich an, als könne sie das, was ich im Herzen trage, erkennen und damit all meine Geheimnisse. Am liebsten würde ich gehen. Wegrennen. Abby die Augen zuhalten, damit ich mich weniger nackt fühle. Weniger gesehen. Stattdessen atme ich tief durch.
»Ich … ich komme schon.«
Ohne dass einer von uns ein weiteres Wort verliert, lasse ich mich auf dem Stuhl vor ihr nieder. Abby hat sich die Hände gewaschen und einen neuen Zopf gebunden, damit ihr langes kastanienfarbenes Haar ihr nicht ins Gesicht fällt und ihr die Sicht versperrt. Sie zieht sich Handschuhe über und bringt sich in Position, nimmt meine Hand in ihre, und mir ist klar, dass sie ihren Job macht, dass ich gerade eine Patientin bin, niemand anderes, aber aus irgendeinem Grund kann ich nicht aufhören, ihre Finger anzustarren. Ihre und meine.
Doch als ich meinen Blick einen Moment später auf die Wunde fallen lasse, auf das Blut – frisch, verschmiert und getrocknet –, vergesse ich das und merke, dass die Verletzung mehr und mehr schmerzt, jetzt, da das Adrenalin nicht länger wie ein Sturm durch mich hindurchjagt.
Abby reinigt meine Hand, wischt all das Blut fort, aber es fließt noch immer neues nach. Sie denkt kurz über eine Blutsperre nach – vermutlich um mich zu ärgern – und bittet mich, ein Mal die Hand zu schließen und die Finger zu beugen.
»Du hast Glück gehabt, die Wunde ist lang, aber nicht so tief, dass die Chirurgie es nähen müsste. Keine motorischen Ausfälle.« Mit dem, was sie mir mitteilt, wird mir erst richtig bewusst, was ich getan habe. Wäre der Schnitt tiefer, könnte ich vielleicht nie wieder operieren. All meine Arbeit wäre umsonst, all die Jahre, all das Durchhalten.
Plötzlich schäme ich mich dafür, dass ich mir egal bin.
»Soll ich dir erklären, was jetzt kommt?«, murmelt Abby, während sie das lokale Anästhetikum verabreicht, mit ihrer Arbeit beginnt und sich ganz auf meine Hand konzentriert. Ihre Frage ist nichts weiter als eine Ablenkung, denn ihr ist bewusst, dass mir klar ist, was sie tun wird und wie man eine derartige Wunde behandelt. Womöglich ist es sogar ein Mechanismus, eine Berufskrankheit, die uns dazu zwingt, nach so etwas zu fragen. So oder so, ich verneine.
Schweigend sitze ich da, starre auf meine Beine, auf die Blutflecken, lausche meinem Atem, höre mein leises Räuspern, ein leichter Druck an meiner Haut, leises Klappern oder Ratschen hier und da, das mich daran erinnert, dass ich zusammengeflickt werde.
»Du musst Angst gehabt haben.« Abby sieht mir nicht in die Augen, während sie das sagt, sondern näht den Schnitt – und ich verziehe unwillkürlich das Gesicht.
Du musst Angst gehabt haben, hallt es in mir nach. Die hatte ich, aber wohl nicht genug. Bei Weitem nicht genug. Doch das erzähle ich Abby nicht. Genauso wenig, warum ich wirklich geweint habe. Dass es nicht Angst war oder Erleichterung, sondern dass ich mir für einen Moment gewünscht habe, Andrew hätte nicht losgelassen. Ich habe mir gewünscht, dass es endet – das mit mir. Meinem Schmerz. Dass ich meinen Frieden finden kann. Obwohl dieser Job die Taubheit, die Trauer und den Kummer in mir daran hindert, mich komplett aufzufressen, ist es ein steter Kampf. Ein andauerndes Hinfallen und Aufstehen, ein Aufgeben und Weiterkämpfen, ein ewiges Ziehen und Zerren, bis ich vergessen habe, wer ich mal war und wer ich sein wollte. Wie soll man erklären, dass man leben will, aber es nicht mehr kann?
»Oder bist du tatsächlich so … mutig?«, hakt Abby nach, und ich habe deutlich mitbekommen, wie sie über das passende Wort nachdenken musste. Ich kann nicht anders, ich schnaube. Es klingt beinahe wie ein knappes, ungläubiges Lachen, und das bringt Abby dazu aufzuschauen. Sie zieht eine Braue hoch, hält meinen Blick für ein paar Sekunden fest, bevor sie die letzten Stiche setzt und die Wunde ganz verschließt.
»Ich bin nicht mutig«, antworte ich leise, weil nicht zu antworten immer unhöflicher wird. Schließlich ist sie meine Vorgesetzte und verarztet mich gerade.
»Dann eher lebensmüde? Oder fällt dir eine bessere Beschreibung ein?« Abby wirkt plötzlich unterschwellig wütend. Das verstehe ich nicht, was sie mir wohl ansehen muss, denn sie erklärt sich sofort. »Du hast ihn nicht durchgelassen. Du hast mit keiner Wimper gezuckt. Bei keiner Bewegung, keiner Drohung.«
Mit gerunzelter Stirn schaue ich in ihr Gesicht. »Hättest du es getan?«
»Man kann nie sagen, wie man in solchen Situationen reagieren würde. Vielleicht hätte ich geweint, gezittert, hätte gefleht …«
»Hättest du ihn zu ihr gelassen?«, wiederhole ich nachdrücklich die einzige wichtige Frage und zwinge Abby dazu, innezuhalten.
»Nein. Aber ich bin mir nicht sicher, ob mich der Rest nicht aus der Bahn geworfen hätte. Ob ich meine Hand absichtlich um eine verdammt scharfe Klinge gelegt hätte, die ein Mann unter Kontrolle hatte, der mental nicht besonders stabil ist.« Ihre Nasenflügel beben, sie atmet tief durch. »Es ging auch um dein Leben, Jane.«
Und das trifft mich härter als gedacht. Nicht, dass ich das nicht wüsste, aber sie hat es ausgesprochen. Dinge, die man ausspricht, beginnen zu existieren.
Was soll ich darauf erwidern?
»Ich weiß«, murmle ich daher nur und lasse Abby meine Hand verbinden.
»Vielleicht hätte ich ihn irgendwann doch durchgelassen, um dich zu retten«, gesteht sie so leise, dass ich es beinahe überhört hätte. Abby fühlt sich anscheinend nicht nur für Liliana verantwortlich, sondern wohl auch für mich. Es tut mir leid, dass sie in so einer Situation war. Dass ich in das Messer gegriffen habe.
Abby schweigt, aber ich spüre immer wieder ihren Blick auf mir. Forschend, neugierig. Und immer wieder ignoriere ich es und schaue überallhin, nur nicht zu ihr. So lange, bis sie fertig ist und der Folienverband sitzt. Danach reinigt und desinfiziert sie die Wunde an meinem Hals, legt dabei für einen Moment ihre Finger an mein Kinn und die empfindliche Haut an der Schlagader, und ich zucke unmerklich zusammen, weil ich diese Art von Berührung nicht gewohnt bin. Nicht mehr. Abby ist mir so nah wie nie und sagt dabei kein Wort, und das macht es irgendwie intimer. Seltsamer.
Ich schlucke ein paar Mal hintereinander, spüre ihren Atem auf meiner Haut, und je mehr ich versuche, ihre Nähe und Berührung zu ignorieren, umso schwerer wird es. Zum Glück ist die Wunde nicht schlimm und Abby schnell fertig.
Sie steht auf, räumt alles zurück an seinen Platz, und ich bleibe sitzen, ohne zu wissen, was ich sagen sollte oder könnte. Mit dem Rücken zu mir räumt Abby die Dinge weg, doch als das erledigt ist, dreht sie sich nicht wie erwartet um, sondern bleibt so stehen und stemmt ihre Hände in die Hüften.
»Gibt es etwas, das dich belastet?«, höre ich sie in die Stille fragen, und es fühlt sich an, als würde sich die Mauer in mir noch fester und unnachgiebiger um mein Herz errichten.
Um meine Geheimnisse.
Mein Unbehagen wächst, ich knabbere an meiner Lippe und spiele mit dem Saum meines Kasacks. Abbys Frage macht mich tatsächlich nervöser als ein Messer an meiner Kehle …
»Hat das nicht jeder Mensch?« Meine Stimme, zu ruhig, kraftlos, und ich bin mir nicht sicher, ob meine Antwort oder die Art, wie ich sie ausgesprochen habe, letztendlich dafür sorgt, dass Abby sich ruckartig umdreht und schnaubt. Ihre Lippen teilen sich, sie holt Luft – aber sie schluckt ihre Erwiderung herunter, wie auch immer sie ausgesehen hätte. Ihre Miene wird undurchdringlich, ihre Haltung unberührt, professionell und distanziert. Genau wie ihr Ton. Doch trotz dieser Änderung spüre ich, dass sie unterschwellig vor Wut kocht – was mir die Röte, die ihren Hals hinaufsteigt, bestätigt –, und aus irgendeinem Grund fühle ich mich deswegen schlecht.
Sie geht zu ihrem Tisch, setzt sich auf den in die Tage gekommenen schwarzen Schreibtischstuhl und tippt etwas in ihren PC. Der Drucker springt an, und sie greift nach dem Zettel, reicht ihn mir, ohne mir in die Augen zu sehen.
»Gegen die Schmerzen, dreimal am Tag, am besten nach dem Essen. Hol dir die Tabletten unten ab. Die Fäden ziehen wir in ungefähr zehn Tagen, je nachdem, wie gut alles heilt. Übermorgen schauen wir das erste Mal nach der Wunde, bis dahin bist du freigestellt. Komm bitte am Mittwoch um zehn Uhr hier zu mir.«
»Und danach?«
Abby zieht lediglich eine Braue nach oben und sieht mich endlich wieder an. »Was meinst du?«
»Übermorgen kann ich wieder arbeiten, richtig?« Beinahe hätte meine Stimme meine aufkommende Panik verraten.
»Mit dieser Verletzung? Bis zum Fädenziehen solltest du dich erholen und die Hand schonen.«
»Ich will und brauche keinen Urlaub. Ich möchte arbeiten.«
Wir starren uns an, und ich wünschte, ich könnte Abby erklären, dass ich arbeiten muss, weil das hier mein Halt ist. Länger als eine Woche nicht arbeiten können – ich würde in ein tiefes Loch fallen. Ich würde fallen und nicht mehr aufstehen, weil es in diesem Loch keinen Boden gibt.
»Jetzt hast du erst einmal frei.«
»Aber …«
»Ich kläre das, und zwar mit Ian. Übermorgen können wir dann weitersehen«, schneidet Abby mir das Wort ab. »Du wurdest gerade genäht. Mit dieser klaffenden Schnittwunde direkt in der Handfläche kannst du nicht uneingeschränkt arbeiten.« Ihr Blick erzählt mir alles, was sie nicht mehr ausspricht: Nicht in unserem Job. Vor allem nicht im OP oder der Notaufnahme. Du warst leichtsinnig, Jane.
Ich nicke, obwohl es mir schwerfällt, und auch wenn mich der Verdacht beschleicht, das sei nicht alles, kommt nichts mehr, das mich zusätzlich aus der Bahn werfen könnte.
Ich muss warten. Mehr kann ich jetzt nicht tun.
»Geh heim, ruh dich aus. Schreib zeitnah einen Bericht für die Polizei. Und solltest du doch mit jemandem reden wollen, bin ich hier«, fügt Abby leise und versöhnlich an.
»Danke«, bringe ich heraus und stehe auf. Der Stuhl schabt über den Boden, und meine Beine fühlen sich wackelig an. Ganz so, als würde mein Körper nicht zu mir gehören und mir mitteilen wollen, dass ihn das von eben wirklich mitgenommen hat; unabhängig davon, dass ich mich gut fühle.
Ich kann es mir nicht verkneifen, noch einmal zu Abby zu schauen, doch sie blättert bereits konzentriert in einer Akte. Selbst wenn sie es mitbekommt, zeigt sie es nicht.
Die Lippen zusammengekniffen, öffne ich die Tür und verlasse das Zimmer, hole meine Tabletten und mache mich danach auf den Weg zu meinem Spind.
Meine Gedanken fliegen zurück zu dem Zeitpunkt, als ich vor Andrew stand, als ich nicht viel fühlte und noch weniger nachdachte. Als ich die Klinge mit meiner Hand umschloss …
Ich kneife die Augen eine Sekunde fest zusammen.
Keine Ahnung, warum mir Abbys Worte und Reaktion etwas ausmachen. Warum ich vorhin kurz den Drang verspürt habe, ihr irgendetwas erklären oder mich gar entschuldigen zu wollen.
Warum es mir nicht vollkommen egal ist, was sie denkt.
Wie in Trance hole ich meine Sachen, ziehe mich um und gehe heim.
Mein Kopf ist leer, während die Welt an mir vorbeizieht und ich beinahe mechanisch einen Fuß vor den anderen setze. Bis ich irgendwann die Tür zu unserer Wohnung öffne und in eine alles verzehrende Stille trete. Niemand ist da. Sierra ist in Mexiko, Maisie im Whitestone. Und ich? Ich dachte, ich hätte mich im Griff. Ich dachte, es hätte nichts mit mir gemacht. Doch als meine Beine unter mir nachgeben, meine Knie auf den Boden krachen, zusammen mit meiner Tasche und den Schlüsseln, die aus meiner Hand fallen, und Tränen über meine Wange fließen, immer schneller, immer heftiger, muss ich mir eingestehen, dass das nicht stimmt.
Selbst kaputte Dinge können weiter brechen.
Ich fürchte, bis ins Unendliche.
Bis sie Staub sind und Asche.
Und sich nicht mehr erinnern können, was sie einmal waren.
4. Kapitel
Abby
Scheiße. Ich höre auf zu lesen, stütze die Ellbogen auf den Tisch und lasse meinen Kopf mit einem lauten Seufzen in meine Hände fallen. In meinen Gedanken herrscht Chaos. Der Terminplan ist Chaos. Der ganze Tag ist Chaos!
Ich reibe mir über die Augen, bin froh, dass ich heute Morgen keine Lust auf Mascara hatte – notgedrungen, weil ich verschlafen habe –, und fühle mich, als hätte ich eine verdammt lange Schicht hinter und nicht vor mir.
Meine Finger beginnen zu zittern. Sie zittern nie. Also knete ich sie so lange, bis ich merke, wie es weniger wird.