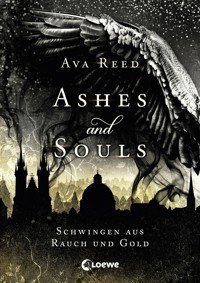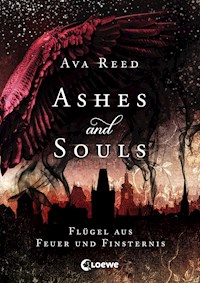Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Drachenmond Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Lynn bemerkt an ihrem Geburtstag, wie sich auf der Haut ihres Unterarms ein Sternenbild abzeichnet. Die einzelnen Punkte leuchten und Lynn versucht verzweifelt, sie zu verstecken. Als nicht nur die Sterne auf ihrem Arm, sondern auch sie selbst zu leuchten beginnt, ist nichts mehr, wie es war. Dunkle Schatten jagen sie - die Wächter des Mondes. Und sie begegnet Juri, der ihr erzählt, sie sei eine Prinzessin - kein Waisenkind. Trotz Lynns Unglauben folgt sie dem Mondkrieger und stellt sich ihren Verfolgern. Juri verliebt sich in Lynn, doch sie ist einem Prinzen bestimmt und nicht ihm...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Ava Reed
Mondprinzessin
Astrid Behrendt Rheinstraße 60, 51371 Leverkusenwww.drachenmond.de, [email protected]
LektoratJulia Adrian
KorrektoratMichaela Retetzki
Satz, LayoutMartin Behrendt
BildmaterialShutterstock
UmschlaggestaltungAlexander Kopainski
ISBN: 978-95991-317-1 ISBN der Druckausgabe: 978-3-95991-316-4
Alle Rechte vorbehalten
Inhalt
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Übersicht
Planeten und Gaben
Danksagung
Der Mond lunamånelua лунаmjesecměsíc lunomoon mánikuumaan
Ich widmedieses Buchallen Waschbärendieser Welt.
Seit Anbeginn der Zeit waren Erde und Mond Freunde. Bis der Mond sich nach mehr sehnte, bis er sich Kinder schuf und formte – aus seinem Staub, aus seinem Herzen und aus den Sternen. Die Erde tat es ihm gleich, aber sie erschuf nur einfache Wesen, keine Sternenkinder. Aus Eifersucht ließ sie die Erdenkinder in dem Glauben, es gäbe nur sie. Sie wandte sich vom Mond ab, aber er folgte ihr in stiller Trauer, umkreiste sie als bester Freund. Bis heute, Tag um Tag.
Kapitel 1
Hoffnung … und den Glauben, dass alles gut werden wird. Diese zwei Dinge sollten wir nie verlieren, denn sie tragen uns durch den Tag und durch die Nacht. Sie sind unser Schwert und unser Schild.
Juri
»Sie ist tot!«
»Wie kannst du es wagen?«, fährt König Artas Malik an.
»Wie ich es wagen kann?«, wiederholt Malik ungläubig und schreit dabei durch den ganzen Raum, sodass ich mich seufzend vom Konferenztisch erhebe und auf ihn zugehe, bevor die Situation vollkommen aus dem Ruder läuft.
Die anderen Hauptmänner sitzen weiterhin betreten da, während Malik mit geballten Fäusten vor dem König steht, der nun von seinem Stuhl aufspringt. Er hat eine stolze Statur, auch wenn der Verlust seiner Tochter ihn krank werden ließ, blass und ausgelaugt, so büßt er nichts von seiner Autorität ein. Seine Wangen röten sich vor Wut, seine blonden Haare liegen schon lange nicht mehr ordentlich und seine Blicke drohen Malik zu erdolchen. Dieser hält jedoch dagegen. Er ist so unendlich stur.
»Lunamea ist fort! Wahrscheinlich sogar tot. Jemand muss dir endlich klarmachen, dass das möglich ist. Vielleicht musst du loslassen, alter Freund.« Nach seinem vorherigen Gefühlsausbruch spricht Malik den letzten Satz beinahe sanft, während er seine Hand auf die Schulter des Königs legt und abwartet. Stille breitet sich aus und ich verharre in der Bewegung, beobachte die beiden.
Seit Jahren vollführt König Artas eine Gratwanderung zwischen seinem Amt und seiner Persönlichkeit als Vater. Nie war seine Zerrissenheit so spürbar wie heute.
»Vielleicht hat er recht, Vater«, sagt Faras neben ihm beinahe schüchtern, aber dieser zeigt darauf keine Reaktion, hält seinen Blick fest auf Malik gerichtet. Im Gegensatz zum König besitzt sein Adoptivsohn Faras pechschwarzes Haar und leicht gebräunte Haut. Er wirkt drahtig, manchmal unscheinbar, aber nie unaufmerksam. Er ist mir ein Rätsel.
»Mein Freund, solange die Krieger keinen brauchbaren Beweis erbringen, will ich dies nicht glauben. Noch ist Zeit. Noch suchen wir weiter!« Der König bleibt hartnäckig.
»Wie oft sollen wir noch suchen?«, schreit Malik.
»So oft, bis ich sage, es ist genug! So oft, bis ihr sie gefunden habt«, herrscht er ihn an.
Als Malik nichts mehr sagt, nur die Lippen zusammenkneift, wahrscheinlich darum bemüht, sich nicht die Haare zu raufen und den König nochmals anzuschreien, trete ich vor.
»Ich werde nach ihr suchen. Lass mich auf die Erde, Malik. Dort werde ich beginnen.«
»Harús Krieger haben die Erde schon Dutzende Male durchkämmt. Was nutzt es, dich alleine hinunterzuschicken?« Mit aufgerissenen Augen zeigt er auf Harú am Tisch und auf alle anderen Hauptmänner, die stumm dem Schauspiel folgen, das sich ihnen hier bietet. Sie sind müde und ausgelaugt, haben die Hoffnung verloren, sie suchen nur weiter, weil es befohlen wurde, nicht weil sie denken, dass es noch etwas bringt. Die Spuren der schlaflosen Nächte haben sich in ihre Gesichter gegraben, sie haben längst aufgegeben. Fast siebzehn Jahre sind sie schon auf der Suche. Vergeblich.
Der König richtet seine Aufmerksamkeit vollends auf mich. Sein weiß-blauer Umhang, der perfekt zu seiner Rüstung passt, raschelt leicht, als er an Malik vorbeischreitet und sich vor mir aufbaut.
»Ich dachte, ihr habt alle aufgegeben?«
Misstrauisch funkeln mich die hellgrauen Augen an, mustern mich, versuchen herauszufinden, ob ich nicht auch so denke wie Malik. Ob ich mich nur anbiedern will oder es wirklich ernst meine. »Wieso wollt Ihr weitermachen?«
»Ihr habt gesagt, wir suchen weiter. Genau das habe ich vor – nicht mehr und nicht weniger.«
»Ihr glaubt auch, sie sei tot, nicht wahr?« Seine Stimme bekommt einen warnenden Unterton, der mich unwillkürlich dazu bringt, das Kinn zu recken und mich noch größer zu machen. König Artas muss den Kopf leicht in den Nacken legen.
»Majestät, ich will Euch nicht anlügen. Ich denke, jeder hat schon einmal daran gedacht. Aber im Moment gehe ich davon aus, dass sie noch lebt und uns rennt die Zeit davon. Die Erde ist ein perfekter Ort, um sie zu verstecken. Wir haben dort keine Truppen und keine Verbündeten wie auf den anderen Planeten. Die Menschen sind unwissend und wir könnten etwas übersehen haben.« Ich werfe einen Seitenblick zu Harú, dem ich hier mehr oder weniger unterstelle, nicht gründlich genug gewesen zu sein.
»Das ist Juri.« Malik tritt vor, während er mir mit Blicken zu verstehen gibt, ich soll die Klappe halten, da ich das erste Mal dabei bin, wenn der König den Sitzungen beiwohnt. »Er wird bald meine Nachfolge antreten, deshalb ist er hier. Er ist definitiv einer der besten Krieger unserer Zeit, aber noch würde ich nicht …« Der König unterbricht ihn mit einer Handbewegung und fordert ihn auf, schneller zum Punkt zu kommen, was mich, trotz unserer Lage, grinsen lässt.
Malik holt tief Luft, fixiert mich. »Juri ist schwierig.«
»Sprich nicht in Rätseln!«
»Er ist …«
»Genauso ein Hitzkopf wie du?«, helfe ich Malik aus und sehe, dass ein Muskel in seiner Wange zu zucken beginnt.
»Mehr oder weniger.« Er muss die Worte beinahe mit Gewalt zwischen den Zähnen hervorwürgen.
»Wenn er so ist wie du, Malik, mache ich mir keine Sorgen. Was sind deine weiteren Bedenken?«
»Er reagiert immer noch viel zu intuitiv.« Malik seufzt. »Bisher ging es gut, aber …«
Er macht sich zu viele Sorgen, das war schon immer sein Problem.
»Ist er so gut, dass er deine Nachfolge verdient?«
»Ja. Er und sein Schutzgeist ebenso«, erwidert Malik ohne zu zögern. »Aber er ist auch wie ein kleiner Junge, der das Spielzeug, mit dem er gerade gespielt hat, nicht wegräumt, bevor er ein neues holt. Es endet im Chaos.«
Sein Jammern ist wirklich süß. »Und doch finde ich alles immer wieder.«
In Maliks Auge droht eine Ader zu bersten, weil er so einfach zu reizen ist.
»Vertraust du ihm, Malik?« Der König blickt ihn von der Seite aus fragend an und ignoriert unser Wortgefecht.
»Ja«, gibt er widerwillig zu. Er würde mich da am liebsten raushalten.
»Dann gibt es für mich keinen Grund, ihn nicht gewähren zu lassen. Ich werde ihm jeden Krieger zur Seite stellen, den er wünscht.«
»Ich reise allein.«
»Das habe ich befürchtet«, nuschelt Malik und stöhnt.
Faras kommt auf uns zu, versucht nochmals das Wort an den König zu richten. »Das macht keinen Sinn, Vater! Die Hauptmänner haben lange genug versucht, sie zu finden, die Erde wurde oft genug durchkämmt. Sie ist nicht da«, sagt er beinahe energisch.
König Artas lässt sich nichts anmerken, er reagiert nicht, wohingegen Faras grimmig dasteht, die Zähne zusammenbeißt.
»Vielleicht ist sie nicht da, aber ich werde trotzdem nach ihr suchen«, kontere ich Faras. »Allein werde ich kaum Aufmerksamkeit erregen und kann mit der Prinzessin schneller verschwinden.«
»Wenn sie nicht gefunden wird, dann …« Die Stimme des Königs versagt.
Ich nicke. Ich weiß, was er sagen will. Wenn wir sie nicht finden, ehe ihre Magie erwacht, ist sie jede Sekunde auf der Flucht. Wenn sie nicht jetzt schon tot ist, spätestens dann wird sie es sein. Die Zwietracht zwischen den Familien und Planeten wächst stetig, besonders nach der Entführung der Prinzessin.
»Ich werde sie finden.« Ich sage es, und ich glaube daran.
Nach weiteren Diskussionen über weitaus unwichtigere Dinge zieht Malik mich aus dem Zimmer, immer noch schäumend vor Wut.
»Was zum Teufel hast du dir nur dabei gedacht?«, zischt er, während wir den Tunnel durchqueren, der den Konferenzsaal mit dem Rest des Schlosses verbindet und den schnellsten Weg zum Hauptgebäude darstellt. Hier ist es stets, als würde man zwischen den Welten schweben. Mitten im All. Im Nichts. Die Sterne sind überall um uns herum. Der Tunnel verbindet einen Turm mit dem nächsten, wie ein gläserner Schlauch.
»Ich bin keine sechzehn mehr.«
»Nein, aber denkst du wirklich, die vier Jahre mehr machen dich zum Mann?«
»Wir wissen beide, dass es nicht die Jahre sind, die mich dazu gemacht haben.«
»Verzeih mir.« Malik fährt sich seufzend durch die Haare und verzieht das Gesicht. »Ich mache mir einfach Sorgen. Du solltest dich nicht so leichtfertig Gefahren aussetzen. Das sage ich dir nicht, weil ich denke, du seist weder Mann noch Krieger. Das sage ich dir, weil du Gefahren und Schwierigkeiten anziehst wie ein beschissener Magnet! Du solltest hierbleiben. Du wirst sie nicht finden.«
Ich bleibe ruckartig stehen, mitten im Gang, und blicke hinaus. Es ist Nacht. Mein Blick wandert über die Landschaft Menuas und all ihre Lichter, zur Erde, zu all den leuchtenden Farben, dem Blau der Meere, dem Grün und Braun der Kontinente und den wundervollen Mustern der Wolken. Ich sehe all das und irgendetwas sagt mir, dass die Prinzessin dort unten ist. Es ist nichts weiter als ein dumpfes Gefühl. Aber es ist da.
Malik ist wie ein Vater für mich und ich verstehe, dass er sich sorgt, aber ich muss das tun. Die Zeit wird knapp. Sie rinnt uns allen durch die Finger. Seit dem Verschwinden der Prinzessin hatte es unzählige Krisensitzungen gegeben, von denen eine erfolgloser war als die andere. Sie alle hatten zu nichts geführt, außer zu mehr Sorgen, Problemen und noch mehr Fragen anstatt Antworten.
Wir müssen sie finden. Vor allem, weil mit jedem Tag ihrer Abwesenheit des Königs Trauer wächst. Und seine Hoffnungslosigkeit, auch wenn er das nicht zugibt. Er ist krank. Seine Zeit verrinnt schneller als wir dachten und die Trauer hat sich um ihn geschlungen wie eine Schlange, sie greift seinen Körper an, vergiftet seinen Geist und bohrt ihre scharfen Zähne mitten in sein Herz. Seine Kräfte lassen nach.
Bis heute versuche ich zu verstehen, wie sehr man jemanden lieben muss, damit man daran zerbrechen kann.
Kapitel 2
Wenn wir nicht an uns selbst glauben, wer soll es dann tun? Mut im Herzen, Liebe in der Seele – wir müssen sie uns bewahren und uns stets daran erinnern, dass es egal ist, ob wir scheitern. Es kommt darauf an, ob wir es überhaupt versuchen.
Lynn
»Scheiße, Lynn! Du sollst doch die Arme hochnehmen, verflucht noch mal!«
Jim muss wirklich lernen, weniger zu fluchen. Allerdings komme ich gerade selbst kaum drum herum, als ich mir die Nase halte und sehe, wie das Blut aus ihr heraus über meine Hand auf den Mattenboden fließt.
»Zeig mal her.« Jim hebt meinen Kopf an, stützt mich und ich nehme nur widerwillig die Hand weg. Meine Nase pocht, das Blut fühlt sich warm an. Ich lasse den Stock fallen und halte mich an Jim fest, um nicht vor Schwindel umzukippen.
»Du hast nicht gesagt, dass es schon losgeht«, nuschele ich.
»Mach jetzt keine Witze! Deine Nase sieht zum Glück nicht gebrochen aus.« Er drückt kräftig aufs Nasenbein und ich zucke leicht zusammen. »Nicht gebrochen. Sonst wärst du jetzt schreiend zu Boden gegangen.«
»Soll mich das jetzt trösten?« Blut fließt mir in den Mund und ich verziehe vor Ekel das Gesicht. Hinzu kommt die unerträgliche Hitze dieses Sommers, die mir den Schweiß über die Stirn laufen lässt, auch ohne dass ich trainiere.
Jim lacht schon wieder. Wenigstens einer von uns.
»Komm mit. Wir machen dich erst mal sauber. Wo warst du nur mit deinen Gedanken?«
Ich antworte nicht. Auch nicht, als er mich zur Toilette schleppt. Oder als er mich durch den Spiegel grimmig ansieht, während ich versuche, so viel wie möglich von dem roten Zeug wegzuwischen, das mir im Gesicht hängt, und die Blutung zu stillen.
»Muss ich noch mal fragen? Scheiße, Lynn! Du übst seit Monaten mit dem Stock und wirst immer besser. Was zur Hölle war los?«
»Bo Jutsu ist nicht mein Ding, befürchte ich.«
»Schwachsinn! Nichts liegt dir besser als der Stock. Erzähl keinen Mist.«
Während ich mir einen Waschlappen unter die Nase halte, verschränkt Jim die Arme vor der Brust und erdolcht mich mit Blicken. Großartig. Jim ist ein Riese. Ihm gehört der kleine Sportclub, den ich durch Zufall entdeckt habe. Er ist der einzige Freund, den ich habe, und er weiß das nicht einmal. »Ich hatte einen schlechten Tag?«
»War das eine Frage?«
»Wenn du so weitermachst, fange ich wie du an zu fluchen. Ich war einfach woanders mit meinen Gedanken, okay?« Der Waschlappen wandert nochmals unter kaltes Wasser. Die Nase hört zum Glück langsam auf zu bluten, aber es tut höllisch weh.
»Und wo warst du mit deinen Gedanken?«
Ich stöhne auf. Vor Schmerz und wegen Jim. Er wird nicht lockerlassen.
»Ich … bei meinem Geburtstag. Ich habe morgen Geburtstag.« Meine Lider senken sich beinahe von selbst.
Andere freuen sich auf diesen Tag. Sie tun es, weil ein weiteres wundervolles Jahr auf sie wartet, weil sie es mit Menschen verbringen können, die sie lieben. Ich wünsche mir Jahr um Jahr, dass der abgepackte Kuchen nicht noch widerlicher schmeckt als zuvor.
»Endlich siebzehn, stimmt’s?« Als ich Jim lachen höre, öffne ich abrupt die Augen und drehe mich samt Waschlappen und pochender Nase zu ihm um.
»Woher weißt du das?«
»Du hast einen Anmeldebogen für den Club ausgefüllt, weißt du nicht mehr?« Er zwinkert mir zu und sein diebisches Grinsen verwirrt mich zutiefst.
»Das habe ich vergessen«, stottere ich.
»Der Gedanke an deinen Geburtstag hat dir eine dicke, blutige Nase beschert. Meinen Glückwunsch! Wenn du hier fertig bist, komm kurz ins Büro.« Ohne ein weiteres Wort verlässt er den Waschraum.
Ich habe Angst. Jedes Jahr. Nur vor diesem Tag. Denn ich hasse ihn so sehr. Vielleicht, weil ich selbst mich an diesem Tag nicht ausstehen kann. Weil ich mich immer wieder frage, wer ich eigentlich bin und warum niemand da ist, der wirklich gerne bei mir sein will. Natürlich ist das bescheuert, denn es ist, wie es ist. An jedem Tag im Jahr komme ich damit klar, nur dieser eine zwingt mich immer wieder aufs Neue in die Knie.
Seufzend schüttele ich den Kopf, nur um kurz darauf zischend die Luft einzuziehen vor Schmerz. Ein letztes Mal kühle ich meine Nase, dann wische ich das restliche Blut weg. Mein Shirt kann ich wohl nicht mehr retten.
Ganz vorsichtig beuge ich mich näher zum Spiegel, bewege den Kopf zur Seite und begutachte die Nase aus jedem Winkel. Sie ist leicht geschwollen, besonders am Rücken, der den Holzstock mit voller Wucht abbekommen hat. Eine gebrochene Nase wäre das i-Tüpfelchen des morgigen Tages gewesen.
Meine Sportsachen nehme ich mit, Jim wartet bereits auf mich. Ich erspähe seinen rotblonden Lockenkopf durch die Glasscheibe der Bürotür, bevor ich eintrete. Mit seinem Vollbart sieht er aus wie ein Wikinger. Grinsend stellt er sich vor mich und drückt mir plötzlich etwas an die Brust, sodass ich aus Reflex danach greife. Irritiert registriere ich seinen freudigen Ausdruck, dann sehe ich nach unten auf meine Hände.
Ein Langstock aus Holz. Filigrane Schnitzereien sind an einem Ende zu erkennen, von dem sich helle Linien durch das ansonsten dunkle Holz ziehen. Er ist wunderschön. Ich drehe ihn, betrachte ihn von jeder Seite, bis ich eine Gravur unterhalb der kleinen Schnitzereien entdecke.
Mut im Herzen, Liebe in der Seele.
Völlig betreten stehe ich da, mit offenem Mund, und merke, wie sich ein Schleier über meine Augen legt, als ich meinen Kopf hebe, um Jim anzusehen.
»Ich weiß, du hast erst morgen Geburtstag, aber ich dachte, weil ich deine Nase beinahe zertrümmert habe …« Er wedelt komisch mit seiner Hand herum, dann räuspert er sich. »Ich habe ihn extra für dich anfertigen lassen. Er ist perfekt für deine Größe, robust, nicht zu schwer. Ich dachte, er würde dir gefallen.«
Samt Stock falle ich Jim um den Hals. So gerne würde ich mich bedanken, aber ich kann nicht reden. Ein riesiger Kloß sitzt in meinem Hals und schnürt mir die Luft ab. Hoffentlich versteht Jim auch so, wie sehr ich ihm danke, wie glücklich und gerührt ich bin.
Er schiebt mich sachte von sich, klopft mir ein-, zweimal auf den Rücken, bevor er seine Hände auf meine Schultern legt.
»Du bist so oft hier, du gehörst beinahe zum Inventar.« Er lacht kurz auf, bevor er ernst wird. »Mut im Herzen und Liebe in der Seele. Das wünsche ich dir, Lynn. Vergiss das nie! Du brauchst beides, um für das Richtige kämpfen zu können – und es vom Falschen zu unterscheiden.«
Durch den Mund atmend, mit pochender Nase, laut klopfendem Herzen und einer unbändigen Freude in mir, umarme ich Jim zum Abschied, schnappe mir meine Sachen und den Stock. Ich lächle – und ich kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal so unglaublich guttat.
Draußen scheint mir die Sonne ins Gesicht und ich stelle fest, dass die Hitze nicht besonders hilfreich dabei ist, den Schmerz zu vergessen. Immer wieder muss ich mich selbst ermahnen, mir nicht an die Nase zu fassen. Trotzdem ist es halb so schlimm, denn ich habe jetzt meinen eigenen Langstock, den ich fest umklammere, und ich sage mir, dass das kein Traum ist, dass er wirklich mir gehört und dieser Geburtstag vielleicht anders wird. Dass ich diesen Tag mögen könnte. Deshalb kann meine pochende Nase mich nicht davon abhalten, mich zu freuen und auf dem Weg zurück ins Heim unaufhörlich zu lächeln.
Nach zehn Minuten trennen mich nur noch wenige Meter und eine breite, viel befahrene Straße von dem alten Gebäude, in dem ich leben darf, wie Ellie, unsere Hausmutter, es stets betont. Jeden Tag erzählt sie uns, dass wir es schlechter hätten treffen können. Dass es besser ist, sich ein kleines Zimmer mit fünf anderen Mädchen zu teilen, als keines zu haben.
Ich seufze tief, bevor ich das Haus betrete und mir die warme, stickige und abgestandene Luft entgegenschlägt. Es gibt einen kleinen Empfang, an dem immer eine Hausdame sitzt, die darauf achtet, wer ein und aus geht und natürlich, dass die Besuchs- und Ausgehzeiten eingehalten werden. Gerade senkt sie die Zeitung und schaut grimmig über ihren Brillenrand, weil ich summend die kleine Halle betrete. Ihre buschige Augenbraue schnellt nach oben, ihre Augen verengen sich zu Schlitzen und wie immer kräuselt sie angewidert die Lippen. Sie hasst Kinder. Einen Flur weiter befinden sich außerdem Räume, die für Termine mit dem Jugendamt oder ähnlichen Institutionen genutzt werden. Außerdem sind hier die Privaträume unserer Betreuer.
Die knarzende, beengte Holztreppe führt nach oben und jeder meiner Schritte entlockt ihr einen anderen Ton. Das Holzgeländer ist nicht zu gebrauchen, es fällt beinahe auseinander und es splittert. Einmal habe ich es vergessen und mir einen Holzsplitter in den Finger gerammt. Die letzte Stufe knarzt am lautesten, der modrige Geruch unseres Heims dringt in meine Nase, aber ich lächle immer weiter, denn ich fühle mich noch beschwingt und zuversichtlich. Zu meiner Rechten ist der Waschraum, bis zur Mitte des Ganges befinden sich Schlafräume, hinten der Aufenthaltsraum und die Küche. Hier links ist mein Zimmer. Ich biege ab und noch bevor ich jemanden sehe, höre ich bereits die durchdringende, schrille Stimme von Anna. Meine allerbeste Freundin – weder in diesem noch im nächsten Leben.
»Unglaublich, nicht wahr? Da kommt sie einfach nicht …«
Als ich unser Zimmer betrete, verstummt sie. Sie dreht sich zu mir um, wickelt sich schelmisch grinsend eine Strähne ihres blond gefärbten Haares um den Finger, legt den Kopf schräg und mustert mich abschätzig. Nichts Neues.
Ich hasse diese Momente, denn es gibt zu viele davon. Zu viele, in denen ich stark sein muss und irgendwie jemand anderes. Diese Momente zwingen mich dazu, eine Maske aufzusetzen und einen Schalter umzulegen, der jegliche Emotionen in mir dämpft. Die mich zwingen, einen Schutzschild anzulegen. Aber ich spüre bereits, wie sich Risse bilden.
»Gott, wie siehst du denn aus?«
»Wieso fragst du? Ist mir ein zweiter Kopf gewachsen?« Ich schmeiße den Rucksack vors Bett, lege den Stock darauf und sehe Anna an. Die Hände lege ich an die Hüfte. Es soll keck wirken und selbstbewusst. Nur ich weiß, dass ich versuche, die einzelnen Stücke meiner Fassade davor zu bewahren, einzustürzen. Ich versuche mich zusammenzuhalten.
»Nein, aber eine zweite Nase. Und irgendein ekelhaftes Zeug klebt an deinem Shirt. Sieht aus wie Ketchup von vor vier Wochen. Nicht, dass du sonst besser aussiehst.« Sie kaut auf einem Kaugummi herum und kommt auf mich zu. »Übrigens, du hast die Putzstunde verpasst.«
»Es ist doch erst …«
»Sechs, genau. Heute war Putztag. Aber keine Sorge, wir haben dir etwas übrig gelassen.«
Verdammt! Gerade als ich Luft hole zum antworten, stürmt Ellie herein. Ihr dicker Bauch bebt im Takt mit ihrem fast genauso dicken Hintern. Ihr Blick ist mörderisch.
Sie hat stets ein gutes Timing.
»Lynn! Wo. Warst. Du?« Wenn sie böse ist, gleicht jedes Wort einem ganzen Satz.
»Es tut mir leid, ich habe die Zeit nicht im Blick gehabt …«
»Ja, das haben wir gemerkt. Die Mädchen mussten deine Arbeit miterledigen. Du wirst verstehen, dass ich das nicht zur Gänze dulden konnte. Das Bad gehört also dir. Du hast eine Stunde Zeit, dann gibt es Abendessen.« Keuchend, voller Wut steht sie im Türrahmen.
»Aber ich …«
»Aber was, Lynn?« Sie spuckt die Worte förmlich aus und zieht die Augenbrauen nach oben.
Ich hole Luft. Aber ich habe um Mitternacht Geburtstag! Ich schlage mir schnell die Hand vor den Mund. Beinahe hätte ich mich verplappert. »Nichts. Es ist nichts.«
»Das will ich hoffen. Und jetzt beeil dich.« So schnell wie sie kam, verschwindet sie. Annas Unschuldsmiene verschwindet mit Ellie, macht ihrem ekelhaften Grinsen Platz und als sie sich zu mir beugt, wird mir schlecht von dem widerlichen Melonengeruch ihres Kaugummis.
»Keine Sorge, das Bad ist halb so schlimm.«
Kichernd verschwinden die zwei aus dem Zimmer. Für einen Moment sinke ich aufs Bett und hole tief Luft. Mein Kopf hämmert so heftig wie meine Nase. Ich bin wütend, dass ich nicht ich sein darf, dass es hier mehr Regeln als Rechte gibt – zumindest für mich. Ich bin wütend, dass ich noch ein Jahr durchhalten muss, weil meine Eltern nicht den Mut hatten, mich bei sich zu behalten.
Sorgfältig verstaue ich die Tasche im Schrank und den Stock unter meinem Bett. Ich glaube nicht, dass Anna ihn gesehen hat. Trotzdem bringe ich ihn morgen zurück zu Jim und lasse ihn dort, denn hier ist er nicht sicher. Es ist besser so, denn bei meinem Glück würde er konfisziert werden, weil ich ihn als Waffe gegen die anderen Mädchen einsetzen könnte. Schnaufend stehe ich auf. Wenn Anna mich weiter so behandelt, wäre das nicht einmal besonders abwegig.
Ich versuche mich auf etwas Positives zu konzentrieren, auf nachher. Dann habe ich Zeit für mich und schon bald beginnt ein neuer Tag. Einer, der mich weiter an das Ende in diesem Gefängnis bringen wird.
Als ich das Zimmer verlasse, habe ich mich wieder gefasst. Zumindest bis ich das Bad betrete, den ersten Blick hineinwerfe und mir Annas Worte in den Sinn kommen. Verdammt, sie haben alles mit Absicht verdreckt. Klorollen stecken in den Toiletten, das Papier klebt durchnässt an den Wänden, bedeckt den Boden. Ein Hahn ist leicht geöffnet, der Abfluss verstopft und das Wasser läuft in einem gleichmäßigen Rhythmus über den Beckenrand und flutet den Boden.
Wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob das Glas meines Lebens für mich halb voll oder halb leer wäre, dann würde ich lachen. Mein Leben gleicht eher einem leeren Glas Nutella …
Kapitel 3
Die Einsamkeit kann unser größter Freund oder unser größter Feind sein. Sie kann uns erdrücken oder befreien.
Lynn
»Happy Birthday!«
Ich puste die kleine, mickrige Kerze auf meinem Supermarkt-Törtchen aus und starre es an. In genau dreihundertfünfundsechzig Tagen bin ich achtzehn. In dreihundertfünfundsechzig Tagen bin ich frei. Der Gedanke daran, bald hier rauszukommen, treibt mir die Tränen in die Augen. Das und vielleicht auch die Tatsache, dass ich hier allein mit einem Billigkuchen meinen Geburtstag feiere, der im Übrigen trotz meiner Gebete ekelhafter ist als der vom letzten Jahr. Er schmeckt schlicht widerlich, vor allem, weil Wachs drauf getropft ist. Aber ich würge ihn herunter, denn es wird der einzige sein, den ich heute zu Gesicht bekomme.
Dass mir das noch etwas ausmacht, macht mich wütend, denn eigentlich kenne ich es nicht anders. Ich bin sauer auf mich selbst, weil ich an diesem Tag stets hoffe, dass sich etwas ändert. Dabei wird mir eine Sache jedes Jahr wieder klar: Es gibt nur zwei Arten der Einsamkeit. Die eine, die wir uns selbst aussuchen, und die andere, die wir nicht ändern können. Egal, welche uns umgibt, das wirklich Schlimme daran ist, dass wir uns viel zu schnell an sie gewöhnen.
Ich lege meine Hand auf den Langstock, der neben mir liegt wie ein alter Freund und den ich zuvor heimlich und leise unter dem Bett hervorgekramt habe, während ich weiter auf dem Kuchen herumkaue. Egal, wie ekelerregend er ist, mein Magen dankt es mir, denn ich habe das Abendessen verpasst. Dass ich mit dem Bad überhaupt fertig geworden bin und danach selbst noch duschen konnte, gleicht einem Wunder.
Nachdem kein Kuchen mehr da ist, streiche ich ein paar Krümel von meinen Klamotten und lege die Kerzen neben mich. Ich hebe den Blick und starre in den Himmel. Der Mond gehört zu den Dingen, die mich beruhigen. Die Nacht ist etwas, das mich anzieht. Das war schon immer so, deshalb komme ich fast jeden Abend hierher, aufs Dach des Waisenhauses, und sehe mir den Himmel an, die Sterne und den Mond. Immer dann, wenn alle schon schlafen. Es ist kaum zu glauben, aber man sieht sogar in der Großstadt den Sternenhimmel recht häufig. Vor der Kulisse der Skyline all dieser großen Häuser sieht er noch beeindruckender aus. Natürlich leuchten die Sterne nur halb so hell, aber sie tun es. An Abenden, an denen es bewölkt ist, legt sich auch auf mich etwas, eine Schwere, die ich kaum beschreiben kann. Aber nicht heute. Heute schimmert der flache Boden des Daches leicht, der Mond erleuchtet den rauen Belag vollkommen. Es ist, als würde ich die Sterne nicht nur ansehen, sondern zwischen ihnen sitzen, einer von ihnen sein.
Am Tag ist die Welt hektisch und unruhig, in der Nacht steht sie still und erholt sich – sie kommt zur Ruhe – und ich mit ihr. Dann kann ich vergessen, wer ich bin und wo ich wohne. Dann sehe ich meine zerrissenen Jeans, meine ausgelatschten Turnschuhe und das verblichene Shirt und vergesse, warum sie so aussehen … warum ich sie trage. Zumindest bilde ich mir das ein. Denn sind wir ehrlich: Niemand kann vergessen, wo er wohnt oder herkommt. Man kann es verdrängen und vielleicht auch irgendwann akzeptieren, aber vergessen tut man es nicht.
Vielleicht bin ich die Ausnahme. Schließlich kann ich nichts vergessen, das ich nie wusste. Ich weiß, wo ich bin, aber nicht, wo ich herkomme. Warum meine Eltern mich nicht mehr wollten und ich hier gelandet bin. Darüber nachzudenken bringt nichts, aber nur in den seltensten Fällen kann ich meine Gedanken davon abhalten, sich damit zu beschäftigen.
Bald. Bald hat alles hier ein Ende und ich kann neu beginnen. Dann ist die Schule vorbei, die Zeit im Heim und mein Leben als Fußabtreter von Anna. Natürlich habe ich mich früher oft gewehrt und genauso oft wurde ich bestraft. Ich, nicht Anna. Niemand traut ihr zu, gehässig zu sein oder etwas anderes als eine Prinzessin, die nur durch einen tragischen Fehler ins Heim musste. Wer könnte so ein Kind nicht lieben? Dass mir auf Anhieb die ganze Menschheit einfällt, interessiert niemanden. Jeden Streich, den man sich vorstellen kann, hat sie mit mir gespielt und jedes Mal habe ich dafür zusätzlich eine Strafe kassiert, weil mir niemand geglaubt hat. Weil sie brav aussieht, mit ihren Wimpern klimpert und versichert, dass sie nichts tut, außer mir vielleicht zu helfen. Wohingegen ich stets aufmüpfig und temperamentvoll bin. Immerzu habe ich widersprochen, bis ich begriff, dass ich niemals gewinnen konnte. Und so gab ich auf, legte meine Rüstung an, meinen Schutzschild. Ich zog mir diese andere Lynn über, die sich versprach, sich auf niemanden mehr zu verlassen und sich von niemandem mehr verletzen zu lassen. An den besseren Tagen funktioniert es, aber meist scheitere ich daran.
Ich wünsche Anna nichts Schlechtes. Ich wünsche mir nur, dass sie mich in Ruhe lässt.
Mein Blick wandert von den Lichtern am Himmel über die der Stadt bis zu den Reflexionen des Daches, auf dem ich sitze. Gedankenversunken streiche ich über den Langstock zu meiner Linken.
Es wird heller. Zumindest kommt es mir so vor. Irritiert sehe ich mich um, bis mein Blick an meinem rechten Unterarm hängen bleibt. Langsam hebe ich ihn an und drehe ihn so, dass ich die Innenseite im Schein des Mondes erkennen kann. Ich blinzle, einmal, zweimal, reibe mir sogar über die Augen, weil ich sicher bin, dass es die Müdigkeit ist, die mir einen Streich spielt. Aber selbst danach bleibt der Anblick der gleiche: Teile meiner Haut, nahe der Hand, leuchten ganz sanft. Es reicht, um mich nervös werden zu lassen.
Wenn der Arm nicht an mir hinge, würde ich wegrennen. Aber das wäre wohl genauso effektiv, wie vor einer Spinne davonzulaufen, die auf der eigenen Schulter sitzt. Zögerlich strecke ich den Arm, hebe ihn noch höher. Jim würde jetzt kräftig fluchen, ich hingegen verschlucke mich bei dem Versuch nur an meinen Worten und starre wie eine Irre auf das Licht, das von mir ausgeht, das ich nicht verstehe und mir eine höllische Angst macht.
Plötzlich leuchtet es heller, breitet sich aus und es fühlt sich an, als brenne es sich in meinen Arm. Nur mit Mühe unterdrücke ich einen Schrei. Mein Atem beschleunigt sich, Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn. Hastig stehe ich auf, stolpere zur Luke und stürze hektisch die Treppe nach unten. Ich achte nicht darauf, leise zu sein, ich drücke meinen Arm an mich, der brennt und leuchtet, und beiße die Zähne zusammen. Im Bad halte ich ihn unter fließendes kaltes Wasser, aber es ändert nichts. Es passiert nichts. Frustriert und gleichzeitig ängstlich stöhne ich auf und sogleich halte ich schnell meine Hand vor den Mund. Anna und die anderen zu wecken, wäre mein Untergang.
Ich bin ein Freak.
Panisch umwickle ich den Arm mit einem kleinen Handtuch, aber selbst das dämpft nur schwach das Licht. Und schon gar nicht den Schmerz. Mit aller Macht versuche ich dagegen anzukämpfen, beiße mir die Lippe blutig. Eine Träne läuft über meine Wange und ich bin kurz davor, zusammenzubrechen. Weil ich niemanden habe, der mir helfen kann. Weil ich selbst nicht verstehe, was hier gerade passiert.
»Scheiße!«
Egal, was Anna je getan hat, ich habe sie nie fluchen gehört. Aber jetzt steht sie vor mir in ihrem pinken Nachthemd und starrt mich an, als wäre ich eine Außerirdische. Die trügerische Stille, die darauf folgt, der Moment, in dem wir uns in die Augen sehen und ich ihr stumm sage, dass ich ihre Hilfe brauche, dass ich keine Ahnung habe, was passiert, vergeht, als sie kreischend aus dem Bad rennt und alle aufweckt.
Ich stürme in unser Zimmer, schmeiße mich auf mein Bett und drücke den Arm fest an mich. Auf der Seite liegend umwickle ich ihn mit der Bettdecke, ziehe die Beine an und schließe die Augen. Ich kneife sie zusammen und kann mein Schluchzen nicht mehr unterdrücken. Ich gebe auf.
Nur noch gedämpft dringt Annas Geschrei zu mir durch, wie ein sanftes Hintergrundrauschen. Die Decke schmiegt sich schützend um mich und einige Sekunden lang ist alles vergessen.
Bis Ellies Geschrei sich mit Annas mischt, das Licht im Zimmer angeht und mich blendet. Bis Ellie an mir rüttelt und mich anmeckert, was ich wieder angestellt habe. Als wäre ich ein ungezogenes Balg von zehn Jahren und nicht eine junge Frau, die heute siebzehn wurde.
Ich öffne die Augen und sehe in die ihren. Sie und die anderen Mädchen blicken mich an, neugierig, verwundert, aber vor allem genervt, weil man sie geweckt hat. Ich schlucke schwer, der Kloß in meinem Hals dehnt sich aus. Selbst bei dem Versuch, etwas zu sagen, versagt meine Stimme. Ich schmecke das Salz meiner Tränen auf den Lippen.
»Lynn! Hörst du mich? Lynn!« Ellie rüttelt weiter an mir, während ich verzweifelt versuche, das Zittern zu unterdrücken und meinen Arm unter der Decke zu halten. Ich weiß nicht, warum sie so weiterschreit, ich sehe sie schon längst an, ich kann nur einfach nichts sagen.
»Was ist hier los? Warum schläfst du nicht? Wo warst du? Warum lagst du nicht im Bett?«
So viele Fragen, die ich ihr nicht beantworten kann. Aber das muss ich auch gar nicht, denn Anna fasst sich sofort theatralisch ans Herz und reißt ihre hellblauen Augen auf.
»Ellie, es war schrecklich! Sie ist nicht normal. Sie leuchtet! Ellie, ihr Arm leuchtet!« Sie zeigt nun auf mich und ihr Schock mischt sich mit dem ekelhaften Grinsen, das regelmäßig ihr Gesicht ziert.
»Das ist doch … Ich meine … Das kann nicht sein! Zeig mal her, Lynn.« Voller Tatendrang beugt sich Ellie vor und zieht an meiner Bettdecke, will meinen Arm entblößen. Das kann ich nicht zulassen. Ich kämpfe gegen sie an, halte die Decke fest und strample wild um mich, egal, wie kindisch oder bescheuert es aussieht.
»Was soll denn das? Hör auf damit!« Sie zieht mit einem kräftigen Ruck und ich kann die Decke nicht mehr halten. Ich liege da, in Jeans und Shirt, und fühle mich nackter als je zuvor. Den Arm, um den noch das kleine Handtuch gewickelt ist, drücke ich an meine Brust. Ich setze mich hin, rutsche auf dem Bett ganz nach hinten, weg von allen. Still flehe ich sie an, mich in Ruhe zu lassen. Ohne Erfolg.
»Jetzt hör auf mit diesem Unsinn, du bekommst schon genug Ärger.«
Das weiß ich. Es war schließlich nie anders. Trotzdem klammere ich mich an meinen Arm und an das Bett, als würde mein Leben davon abhängen. Ellie steigt zu mir auf die Matratze, redet auf mich ein und schnappt nach meinem Arm. Sie reißt das Handtuch ab.
»Nein!«, schreie ich und will nach dem Handtuch greifen. In meiner Verzweiflung stoße ich Ellie beinahe auf den Boden.
»Mein Gott, Lynn! Was soll das Theater? Und das Gleiche könnte ich dich fragen, Anna! Da ist nichts.« Ellie starrt zuerst mich, dann Anna böse an, während sie meinen Arm wie einen nassen Lappen in die Luft hochhält und damit herumwedelt. Das Pochen in meinen Ohren ist kaum auszuhalten und genauso laut wie mein Atem, der Druck in meiner Brust droht mich zu ersticken. Da ist nichts. Drei Wörter, die ich immer wieder leise sage. Mein Arm, er tut nicht mehr weh, er leuchtet nicht mehr.
»Aber … aber … da war … Sie ist ein Monster!« Anna dreht durch. Sie schreit und rauft sich die Haare, ihre Lippen beben, ihre Augen sind weit aufgerissen und sie beginnt zu zittern, während die anderen Mädchen versuchen, sie zu beruhigen.