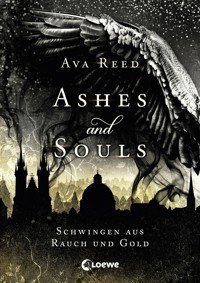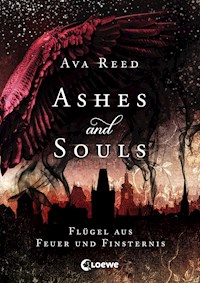9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Loewe Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Familie«, wispert er. »Das ist auch nur ein Wort mit sieben Buchstaben.« Mika weiß nicht, was es bedeutet, eine richtige Familie zu haben. Seine Eltern sind gefangen in ihrer Sucht und kümmern sich kaum um ihn. Die Hoffnung, dass sich etwas ändert, stirbt endgültig, als er eines Tages selbst mit Drogen erwischt wird. Das Jugendamt schickt Mika gegen seinen Willen fort: raus aus der Stadt, auf einen Bauernhof zu einer perfekt scheinenden Pflegefamilie. Er hat so gar keinen Bock darauf, heile Welt zu spielen, aber nach und nach bringt vor allem Joanna seine harte Mauer zum Bröckeln. Und während Mika lernt, wieder zu hoffen, tut er alles, um sein Herz nicht zu verlieren … Ein gefühlvoller Roman über die Vielseitigkeit der Familie In ihrem neuen Jugendroman für Leser*innen ab 14 Jahren geht SPIEGEL-BestsellerautorinAva Reed einfühlsam auf schwierige Themen wie Drogensucht, Gewalt und Ausgrenzung ein und zeigt auf, dass Familie so viel mehr ist als nur ein Wort mit sieben Buchstaben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 360
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Content Note und Vorwort
1 MikaMit Rückenwind bergab, in ein Fass ohne Boden.
2 MikaÜber Hoffnungen, Träume und Wirklichkeiten.
3 JoannaNicht perfekt, aber verdammt nah dran.
4 MikaWillkommen im Kaninchenbau.
5 JoannaAm besten lebt es sich bei Menschen, die man liebt.
6 MikaEs gibt immer ein Schlimmer.
7 JoannaManchmal kommt es, wie es kommen soll.
8 MikaDie Mauer bricht, die Mauer fällt.
9 JoannaUnverhofft kommt oft.
10 MikaWie Schnee im Sommer.
11 JoannaDer Junge von nebenan ist nur eine Tür entfernt.
12 MikaIst ein Zuhause ein Ort oder ein Gefühl?
13 JoannaDiese Veränderung ändert nichts – und doch alles.
14 MikaEinsam und allein ist nicht dasselbe.
15 JoannaEinen Schritt vor, zwei Schritte zurück.
16 JoannaDer Teller vor der Tür.
17 MikaOhne Worte, mit Karotte.
18 JoannaDas ist nicht meine Geschichte.
19 MikaEin anderes Universum.
20 JoannaAm schlimmsten ist, was man nicht will, aber dennoch bleibt.
21 MikaSo klingt Hoffnung.
22 JoannaGenug Schwung für den Weg nach oben.
23 MikaUnd plötzlich ist es nicht mehr unbekannt.
24 JoannaEs ändert sich immer etwas, wenn sich etwas ändert.
25 MikaDie Sonne ist zurück.
26 MikaZwischen den Wendepunkten.
27 JoannaGänsehaut.
28 MikaAlle Wege führen in die Hölle.2 Jahre zuvor
29 JoannaWas man sich nicht vorstellen kann …
30 MikaDer Blick zurück.
31 MikaWas wir nicht mehr ändern können.
32 JoannaWas passiert ist, ist passiert.
33 MikaÜber die Flamme, die lieben wollte, aber nichts als Schmerz brachte.
34 JoannaDer Morgen danach.
35 MikaHeilung tut weh.
36 JoannaUnerwartet, aber nicht unerwünscht.
37 MikaDas ist das Schöne an der Zukunft – alles ist möglich.
Nachwort und Danksagung
Für jeden Menschen, der weiß, dass Familie nicht nur durch Blut definiert wird und mehr ist als ein Wort mit sieben Buchstaben.
Sie ist Gefühl und Liebe, sie ist Herz und Geborgenheit.
Familie ist eine Entscheidung.
Für meine Tochter Charlotte. Ich hoffe, wir können dir Wurzeln und Flügel geben und all die Liebe, die du brauchst.
Content Note und Vorwort
Nur ein Wort mit sieben Buchstaben beinhaltet Themen, die triggern können.
Es befasst sich unter anderem mit den Themen Pflegefamilie, Adoption, häusliche Gewalt sowie Gewalt an Kindern und Jugendlichen, emotionaler Missbrauch, toxische Beziehungen, zwischenmenschliche Abhängigkeiten, körperliche Behinderung, Gehörlosigkeit, Ableismus, Beleidigungen, Feuer, Erpressung, Zigaretten-, Drogen- und Alkoholkonsum/-missbrauch sowie einzelnen Traumata. Die genannten Bereiche werden angeschnitten und/oder ausführlich behandelt.
Achtet bitte auf euch und eure Gefühle. Besonders, da die Liste keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
Außerdem möchte ich hiermit auf das Nachwort hinweisen. Darin sage ich ein paar Worte zum Inhalt und zur Entstehung der Geschichte, die mir persönlich wichtig sind.
Ich hoffe, ihr werdet das Buch trotz der etwas schwereren Themen mit einem Lächeln schließen und Mika und Jo im Herzen behalten. Denn wie ihr wisst, findet ihr in meinen Jugendbüchern eines immer: Zuversicht.
Eure Ava
1
Mika
Mit Rückenwind bergab, in ein Fass ohne Boden.
Keine Ahnung, was die ganzen Zahlen am Whiteboard bedeuten und welche Worte gerade aus Frau Schuhmanns Mund kommen. Verdammt, ich hätte einfach woanders hingehen sollen, vielleicht in irgendein Café. Ich hätte mit der S-Bahn nach Frankfurt reinfahren und mich unter die Menschen mischen können. Stattdessen sitze ich an einem Freitag etwas mehr als zwei Wochen vor den Sommerferien in meinem Mathekurs, und das nicht nur vollkommen high, sondern mit dem Wissen, dass ich dieses Schuljahr absolut vergessen kann. Meine Noten gehen seit Monaten kontinuierlich den Bach runter, und wenn ich ehrlich zu mir bin, interessiert es mich mit jedem Tag weniger. Nicht, dass das Ganze überhaupt irgendwen interessieren würde …
Ich habe meinen Realschulabschluss in der Tasche, das reicht. Mir ist ohnehin schleierhaft, wie ich das geschafft habe, aber ich habe ihn und das ist das Einzige, was zählt. Die Oberstufe und das Abi können mir egal sein, denn ich habe den Plan, Architektur zu studieren, längst über Bord geworfen. Nicht nur, weil ich mir ein Studium nicht leisten könnte, sondern auch, weil ich gemerkt habe, dass ich etwas mit meinen Händen machen möchte. Ich will etwas Praktisches erlernen. Ich will etwas erschaffen, wo in meinem Leben doch so viel kaputtgeht.
Eine Ausbildung habe ich bereits im Auge. Dieses Mal ist es kein Plan, es ist ein Traum, denn ich weiß noch nicht, wie alles weitergehen soll. Kann ich meine Mutter im Stich lassen, sobald ich achtzehn bin? Schaffe ich es, fortzugehen? Muss ich das? Kann ich eine Ausbildung machen und neu anfangen, ohne mich von meinem Zuhause zu lösen? Muss es eine andere Stadt sein? Ein ganz neues Leben? Habe ich diese Option? Was ist mit den Drogen, den Schulden? Wie soll das funktionieren? Ich habe überhaupt kein Geld …
Fahrig wische ich mir den Schweiß von der Stirn und blinzle heftig, aber es ändert nichts an meiner Sicht. Mein Mund fühlt sich pappig an, und wenn ich könnte, würde ich jetzt eine Flasche Wasser exen. Nur leider habe ich mich heute Morgen, nachdem mein Vater mal wieder in seiner eigenen Kotze im Wohnzimmer gelegen hat, an seinem Zeug bedient und das Wasser daraufhin vergessen. Es war nur etwas Gras, nichts Hartes, trotzdem bin ich von mir selbst genervt, dass ich es angerührt habe. Ich schlucke angestrengt und unterdrücke danach ein Schnauben.
Die meisten Menschen denken, in Deutschland wären Drogen kein großes Problem und eher schwer zu bekommen. Die haben keine Ahnung. Es ist keine Kunst, in einer deutschen Großstadt welche zu kaufen, weil die Leute, die sie nicht haben wollen, einfach wegschauen. Und was man nicht sehen will, ist auch nicht da. Mein Vater beweist mir das jedes Mal aufs Neue, wenn er wieder ohne Probleme seinen Vorrat aufstocken konnte. Marihuana, LSD, Kokain … Seit er nicht mehr Polizist sein kann, hat er alles andere aufgegeben: sich, seine Familie, seine Prinzipien.
»Mika«, dringt es an mein Ohr und ich schaue verwirrt zu Tom, der mich angestupst hat und nun mit dem Kopf nach vorne deutet. Die Klasse ist still und Frau Schuhmann sieht mich abwartend an.
»Kannst du die Gleichung lösen, Mika?«
Ich habe keinen Schimmer, von was sie redet. Das Whiteboard ist voll mit irgendwelchen Zahlen und Buchstaben, unsere Bücher sind aufgeschlagen, aber in meinem Kopf ist kein Platz für Schule. Da passt nicht mal mein Privatleben rein.
»Nein«, gebe ich zu und bereue, mich nicht vorher geräuspert zu haben. Meine Stimme klingt fremd in meinen Ohren und meine Zunge ist schwer.
Demütig senke ich den Blick, als der unserer Lehrerin mich zu durchbohren droht. Das Letzte, das ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass sie mir zu nahe kommt, an mir schnuppert oder meine mit Sicherheit trüben Augen wahrnimmt.
Ich darf nicht mehr so unvorsichtig sein. Je mehr Angriffsfläche ich meinem Vater biete, umso schlimmer wird es werden.
Ein paar quälend lange Sekunden halte ich die Luft an, bis der Unterricht fortgesetzt und jemand anderes aufgerufen wird. Die Aufmerksamkeit scheint nicht länger auf mir zu liegen und ich hebe kurz den Blick, um das zu kontrollieren, erst danach atme ich erleichtert durch.
»Echt jetzt? Du solltest das nächste Mal wenigstens den Pulli wechseln oder so«, nuschelt Tom noch kopfschüttelnd, bevor auch er sich wegdreht.
Klugscheißer, denke ich. Einer wie er nimmt Drogen doch höchstens aus Spaß. Für den Kick. Für neue Erinnerungen. Tom weiß doch gar nicht, wie es ist, ich zu sein. Einer wie er hat keine Ahnung, was es bedeutet, Drogen zu hassen und nicht nehmen zu wollen, es aber trotzdem tun zu müssen, weil es zu viele Dinge gibt, die man vergessen will. Es sind zwar nur Joints, nichts von dem harten Zeug, aber mir wäre es lieber, ich hätte nicht das Gefühl, mich ab und an damit betäuben zu müssen.
Ich will keine neuen Erinnerungen, ich will einfach nur weniger davon.
Es klingelt, ich packe mein Zeug ein und verschwinde, denn zwei Stunden Englisch ertrage ich in diesem Zustand ganz sicher nicht.
Für einen Moment verharre ich draußen an der Mauer, die den Schulhof umschließt, und frage mich, wohin ich jetzt gehen soll. Dann wird mir klar, dass es keinen Ort gibt, an den ich kann, außer der Hölle, die auf mich wartet.
Zuhause.
Erstickt lache ich auf, bevor ich mich meinem Schicksal ergebe.
Doch um das Ganze etwas in die Länge zu ziehen, nehme ich nicht den Bus, sondern gehe wie benommen zu Fuß heim. Ganze drei Kilometer. Einmal übergebe ich mich am Straßenrand und mit jedem Schritt verstärken sich meine Kopfschmerzen. Vielleicht wegen der starken Tüten, die ich heute früh vor der Schule geraucht habe und deren Wirkung nahezu verflogen ist, vielleicht aber auch von jedem Meter, der mich näher an mein Zuhause bringt.
Egal, was es davon ist, irgendwann komme ich an. Ich stehe vor unserem kleinen Haus und halte den Schlüssel in meiner Hand. Eine ganze Weile kann ich mich nicht dazu durchringen, ihn zu benutzen, um die Tür zu öffnen, sondern nur dastehen und das dunkle Braun anstarren, das vermutlich das letzte Mal gestrichen wurde, als Oma noch lebte. Für unsere Nachbarn muss das ein ziemlich schräges Bild abgeben: der Junge, der nicht reingeht, aber auch nicht fort.
Es ist immer gleich: Die Leute geben vor, sich zu kennen oder kennenlernen zu wollen, manchmal hängen sie auch an ihren Fenstern wie kleine Spanner, aber wenn es drauf ankommt, interessiert es in Wirklichkeit niemanden, was hinter den Türen der anderen Menschen passiert.
Jeder ist sich selbst am nächsten.
Ich sollte das auch sein. Also, mir selbst am nächsten. Schließlich könnte ich nächstes Jahr endlich verschwinden. Ich sollte es jetzt schon tun und auf all das hier scheißen. Aber das schaffe ich nicht, weil ich bisher keinen Weg gefunden habe, wie ich mich und auch meine Mutter aus diesem Loch ziehen kann. Ich kann sie nicht hierlassen. Sie ist die Einzige, bei der ich Hoffnung habe … Hoffnung, dass sie wieder der Mensch wird, der sie einmal war, und dass es für sie möglich ist, den Scheiß der letzten Jahre hinter sich zu lassen. Wenn ich ohne sie verschwinde, ertrinkt sie in all dem Chaos und dem Dreck, die mein Vater geschaffen hat.
Meine Mutter ist die einzige Person, die ich noch nicht ganz verloren habe. Selbst wenn ich mir das nur einbilde: Ich kann sie nicht aufgeben. Noch nicht …
Tief einatmend öffne ich endlich die Haustür und augenblicklich schlägt mir die stickige und abgestandene Luft entgegen, die beim nächsten Atemzug in meinem Hals kratzt. Es ist nicht besonders hell. Wie so oft sind die schweren, staubigen Vorhänge zugezogen, damit das Licht und die Welt draußen bleiben. Tag um Tag hat sich hier eine eigene Welt geformt, die nur um sich selbst kreist. Ein ganzer Kosmos, vollgepackt mit all den schlimmen Dingen, von denen man selbst immer dachte, sie würden einem nie passieren.
Ich verkneife mir ein Hallo oder ein Ich bin daheim. Es interessiert sowieso niemanden – falls es überhaupt einer mitbekommt. Der Fernseher läuft im Hintergrund, ich habe das Rauschen schon gehört, bevor ich den Flur hinter mir gelassen habe und ins Wohnzimmer getreten bin.
Überall leere Flaschen, Müll, altes, teils verschimmeltes Essen und feines weißes Pulver auf dem Glastisch. Drogen, die sich mit kleinen Graskrümeln und Staub mischen. Meine Mutter sitzt auf dem Sofa und starrt an die Wand. Sie hat Hämatome am Arm. Neue.
Meine Kehle schnürt sich zu. Ich lasse meinen Rucksack an Ort und Stelle auf den Boden fallen und eile zu ihr, setze mich neben sie und nehme ihre Hand.
»Wo ist er?«, frage ich leise und erst jetzt nimmt sie mich wahr. Dreht ihren Kopf zu mir. Ihr Blick findet meinen, während ein leichtes, wackeliges Lächeln ihre schmalen, farblosen Lippen umspielt.
»Oh, hallo, mein Schatz. Dein Vater kommt heute später von der Arbeit, er hat noch einen Einsatz.« Sie tätschelt meine Hand. Keine Ahnung, was sie heute genommen hat. Keine Ahnung, ob es die Drogen sind oder die Verzweiflung, die sie in ihren Klauen hält.
»Er ist nicht auf der Arbeit, Mama«, wispere ich erstickt und schlucke schwer. Ich habe immer noch kein Wasser getrunken und schmecke weiterhin das Erbrochene von vorhin, während mein Mund von Minute zu Minute trockener wird.
Verwirrt hebt sie die Augenbrauen, bevor sie sie zusammenzieht und über meine Worte nachdenkt. Doch sie erwidert nichts, sie sagt keinen Ton mehr.
Manchmal frage ich mich, ob es ein Limit an schlechten Dingen gibt, die einem Menschen im Leben passieren können.
»Lass uns abhauen. Bitte. Lass uns unser Zeug packen und gehen.« Ich rede so leise, dass ich mich selbst kaum verstehe. Sie könnte einen Entzug machen, ich beginne die Ausbildung und wir mieten uns eine kleine Wohnung. Wir brauchen nicht viel.
»Ich kann nicht.« Ihre Stimme bricht, wie so oft. Sie weiß, dass ihr Mann nicht auf der Arbeit ist. Sie wünscht sich nur, alles wäre anders.
»Doch, du kannst.« Ich würde gern schreien, aber ich reiße mich zusammen. Ohne sie kann ich auch nicht weg. Meine Mutter ist wie ein Anker – ein Halt und gleichzeitig das, was mich in die Tiefe zieht. Vielleicht ist meine Hoffnung wie eine leere Hülle. Sie ist da und gleichzeitig nicht – und das ist mir klar. Das macht mich fertig.
»Mama?« Ihre Augen rollen nach hinten, dann schließen sich die Lider. Ihre Hand fällt herab, ihr Kopf rollt zurück. Sie driftet weg.
Sie ist schon lange fort, wispert eine Stimme in mir, die ich nicht hören will.
Ohne ein weiteres Wort stehe ich auf, schnappe mir meinen Rucksack, ein Glas Leitungswasser aus der Küche und gehe hinauf. Ich kenne das. Ich kenne das alles hier.
Das laute Schnarchen meines Vaters dringt zu mir, er ist im Schlafzimmer nebenan und schläft vermutlich seinen Rausch aus. Soweit er das überhaupt noch kann.
Ich verschwinde in meinem Zimmer und schließe die Tür. Das Erste, was ich tue, nachdem ich alles abgestellt habe, ist, die Fenster zu öffnen und die Sonne reinzulassen. Sonne und frische Luft.
Mein Zimmer ist weder groß noch besonders gemütlich, aber es reicht aus. Ein wackeliges Bett, ein Schreibtisch und eine Kommode, die als Kleiderschrank dient und halb auseinanderfällt und auf der ein kleiner, in die Jahre gekommener Fernseher steht. Ein paar alte Bücher … und eine schwere mittelgroße Metallkiste unter meinem Bett, die ich jetzt vorsichtig hervorziehe.
Der Deckel klemmt etwas, braucht immer einen kräftigen Ruck, bevor er nachgibt und ich ihn abnehmen und zur Seite legen kann. Darin liegen eine große und eine kleine Feile, etwas Schleifpapier, das seine besten Tage bereits hinter sich hat, ein Messer sowie ein paar Holzstücke in allen Formen und Farben.
Ich lese gern, aber nie besonders lange, weil ich mich meistens nicht gut konzentrieren und nicht so lange still sitzen kann, ohne wirklich etwas zu tun. Ich schaue zu oft fern und höre zu selten Musik. Ich brauche Ablenkung, kann aber mit niemandem reden. Nicht nur, weil ich nicht gut darin bin, sondern vor allem, weil es nichts nützen würde. Ich wüsste nicht, was ich sagen sollte oder wie. Deshalb fällt das Aufschreiben irgendwie auch weg. Das macht es nur noch realer. Aber diese Kiste hier, die rettet mich. Ihr Inhalt verschafft mir Momente der Ruhe in diesem nie enden wollenden Sturm. Innerlich und äußerlich.
Ich schnitze oder schleife Holz. Heraus kommen kleine Figuren oder unbestimmbare Elemente. Die Arbeit mit Holz liegt mir und es macht Spaß, deshalb möchte ich eine Ausbildung zum Tischler machen. Vorher stand ein Studium im Raum, aber ich brauche mehr Praxis und weniger Theorie. Mehr Taten und weniger Worte. Ich muss etwas zu tun haben, mit den Händen und dem Geist. Und oft muss ich den Händen etwas zu tun geben, um den Kopf abzuschalten. All die Gedanken und Sorgen darin. Wenn ich mit Holz arbeite, meinen Fokus darauf richte, werden die Stimmen in meinem Kopf leiser – und meine Sorgen.
Mit den Fingern fahre ich über das abgenutzte Schleifpapier. Die Werkzeuge sind teils aus der Schule, teils von alten Ersparnissen gekauft. Ich kann mir seit Ewigkeiten keine neuen oder besseren leisten. Wie auch? Wir haben an den meisten Tagen nicht mal Geld für etwas zu essen. Deshalb versuche ich, sie so gut wie möglich zu pflegen – mit den wenigen Mitteln, die ich habe.
Und sie zu verstecken.
Wenn mein Vater von dieser Kiste wüsste … Ich schüttle den Kopf. Er würde sie zerstören, einfach so. Er hat verlernt, Freude zu empfinden, etwas zu mögen. Für ihn existiert dieses Gefühl nicht mehr. Er kennt keine Zukunft und keine Ziele und er sorgt dafür, dass es uns auch so geht.
Mit einem fetten Kloß im Hals sperre ich meine Träume wieder ein, indem ich den Deckel schließe und alles zurück unter das Bett schiebe. Dabei streift meine Hand die zweite Kiste, die ihr Dasein im Schatten fristet. Jedoch aus ganz anderen Gründen. Erst zögere ich, weil ich diese andere Kiste hasse – fast so sehr wie meinen Vater –, doch dann ziehe ich sie hervor und öffne sie. Vielleicht in der Hoffnung, dass darin auf magische Weise etwas Besseres liegt als Drogen im Wert von tausend Euro.
Hätte ich damals eine Wahl gehabt, wäre heute alles anders. Vielleicht. Vielleicht auch nicht.
Doch dann schnaube ich, ärgere mich über mich selbst. Eine Wahl? Ich hatte sie. Ich hätte mich einfach nur anders entscheiden müssen …
2
Mika
Über Hoffnungen, Träume und Wirklichkeiten.
»Wo ist das verschissene Bier?« Die aggressive, lallende Stimme meines Vaters dröhnt durch das ganze Haus und lässt mich zusammenzucken.
Gestern wollte ich nicht in der Schule sein, heute wünsche ich mir, ich wäre es. Nur, damit ich diesem Albtraum hier entfliehen kann. Wenn auch bloß für wenige Stunden.
»Verfluchter Dreck, Mika! Wo bist du? Bring mir endlich mein Bier. Sofort!«
Etwas kracht. Etwas bricht. Das ist nichts Neues. Es ist jeden Tag dasselbe. Und das schon so lange, dass ich manchmal vergesse, dass es einmal anders war. Dass es einmal anders gewesen sein muss. Auch wenn ich mich kaum daran erinnern kann, sind meine Eltern und ich irgendwann glücklich gewesen. Das beweisen die unzähligen unsortierten Fotos in einer der verstaubten Kisten im Keller, auf denen wir lachen oder lächeln, und das nur, weil wir zusammen sind. Sie verliebt und ich als kleines Kind.
Scheint in einem anderen Leben gewesen zu sein …
Seufzend lege ich meine zerfledderte Ausgabe von Die unendliche Geschichte weg und erhebe mich von meiner in die Jahre gekommenen Matratze, unter der das Bettgestell jedes Mal laut quietscht, sobald ich mich bewege. Manchmal wünsche ich mir, ich könnte fliehen. In ein anderes Leben. In eine andere Welt. Aber da das wohl niemals passieren wird, höre ich besser auf zu träumen und komme der geschrienen Aufforderung meines Vaters so schnell wie möglich nach.
Es zu tun, obwohl es scheiße ist, ist besser als die andere Konsequenz. So viel habe ich gelernt.
»Komme schon!«, rufe ich, während ich auf dem Weg nach unten zwei Stufen auf einmal nehme. In dem Holz der Treppe sind unzählige Kratzer und Macken, die mich an meine Oma erinnern. Bis vor elf Jahren war es ihr Haus, und obwohl ich noch ein kleines Kind war, erinnere ich mich an sie. Wenn sie wüsste, was aus ihrem Sohn geworden ist – es würde ihr das Herz brechen. Sie würde es nicht glauben wollen, das konnte ich schließlich auch lange Zeit nicht. Doch jeder Tag, der bis heute verging, hat mir gezeigt, dass es meinen Vater nicht mehr gibt. Nicht wirklich.
Ich eile durch den Flur, in die Küche und hole zügig ein kaltes Bier aus dem Kühlschrank. Im selben Moment, als ich meine Finger um den Flaschenhals lege, höre ich Schlüssel klimpern und kurz darauf die Haustür zuschlagen. Wenige Sekunden später steht meine Mutter im Zimmer. Sie sieht abgespannt aus. Müde. Ringe zeichnen sich unter ihren Augen ab, ihre strohblonden Haare sehen ungepflegt aus, ihre Haut fahl, ihr Gesicht eingefallen.
Ich sehe ihr die letzten Jahre an. Die Jahre nach dem Tod meiner Oma und die Jahre nach dem einen Augenblick, der meinen Vater für immer verändert hat. Es ist so lange her, dass es mich kaltlassen müsste, aber es tut immer noch weh.
Meine Mutter ist abgestürzt und gealtert, schnell und ohne Kontrolle. Ohne dass ich es hätte verhindern können. Mein Vater hat sie mitgerissen, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste. Zumindest rede ich mir das ein, damit der Schmerz in mir nicht zu groß wird, zu einnehmend. Letzten Endes weiß ich nicht, ob ich mehr hätte tun können, egal, ob ich noch ein kleines Kind war oder nicht. Nicht, dass das meine Aufgabe war, aber manche Gedanken verschwinden nicht, egal, was man tut. Heute bete ich einfach nur jeden Tag, er möge schnell vorübergehen, und hoffe, meine Eltern kaum anzutreffen. Oder zumindest meinen Vater. Ich versuche, das Ganze durchzustehen und nicht zu viel darüber nachzudenken, was ich tue oder was er tut.
»Alles okay?«, frage ich meine Mutter trotzdem, die sich mit ihrer bleichen Hand ein paar Strähnen aus der Stirn schiebt und sich danach auf einen der zwei Küchenstühle mit der abgeblätterten hellblauen Farbe niederlässt. Tränen sammeln sich in ihren Augen, ihre Unterlippe bebt und ich wünschte, wie so oft, ich wäre gegangen und hätte nicht gefragt. Ich wünschte wirklich, es wäre leichter, sich nicht für all das hier zu interessieren oder keine Hoffnung mehr zu haben. Doch das ist es nicht. Meine Mutter ist der einzige Grund, warum ich noch nicht loslassen konnte. Und jetzt kann ich nicht mehr anders – ich halte sie fest und diesen kleinen beschissenen Funken an Hoffnung auf … Ich schnaube. Keine Ahnung. Auf alles. Denn alles ist besser als das hier.
»Mama?«, hake ich nach. Als ihr Blick meinen findet, ahne ich, was sie antworten wird.
»Hab meinen Job verloren.« Ihre Stimme klingt rau. Gebrochen. Das kennt sie schon, das Brechen. Sie und ich …
Und anstatt meine Mutter nach all den Jahren endlich mal anzuschreien, ihr wieder und wieder verzweifelt ins Gesicht zu brüllen, dass die Drogen und der Alkohol sie kaputtmachen – genau wie ihr Mann –, oder sie zu fragen, wie man drei simple Minijobs in einem Monat verlieren kann, kneife ich die Lippen zusammen. Ich nicke, als würde ich es verstehen. Was bleibt mir auch anderes übrig, als es hinzunehmen?
Es ist Samstag. Ihr letzter Job war der einer Putzkraft bei Privatkunden, bei denen sie flexibel auch am Wochenende gearbeitet hat. Der davor war in einem Laden, in dem sie beim Klauen erwischt wurde, und der andere in einer Tankstelle. Leider erschien sie dort für drei Schichten hintereinander nicht, weil sie zugedröhnt auf der Couch lag … ohne sich wenigstens abzumelden. Ich will gar nicht wissen, was sie dieses Mal für einen Scheiß gebaut hat. Aber so zugedröhnt, wie sie gestern war, so schlecht, wie es ihr ging, wundert es mich nicht, dass sie heute noch neben sich steht. Vermutlich ist sie immer noch berauscht.
»Es tut mir leid, Mika«, flüstert sie. Das sagt sie jedes Mal. Vier leere Worte – und meinen Namen. Ob es stimmt oder nicht, spielt keine Rolle, denn ich glaube es ihr nicht mehr, obwohl ich es gern würde.
Aber auch das spreche ich nicht aus. Keinen einzigen Gedanken werfe ich ihr entgegen. Wie immer schlucke ich es runter, weil es keinen Unterschied macht.
Stattdessen nicke ich erneut. Es ist eine Art Automatismus. Das Abspielen einer von vielen Regungen, die mein Körper im Umgang mit meinen Eltern verinnerlicht hat.
Erst als ich ein lautes Fluchen und energische Schritte höre, die näher kommen, erinnere ich mich an das kalte Bier in meiner Hand und an meinen Vater, der bereits viel zu lange darauf wartet. Scheiße.
Ich blicke auf in Richtung Wohnzimmer. Mit verschleierten Augen und geröteten Wangen stürmt er leicht humpelnd in die Küche. Sein Haar steht kreuz und quer von seinem Kopf ab, sein Gesicht ist zu einer widerlichen Fratze verzogen.
»Wieso stehst du hier rum? Wo ist mein Bier?« Mit jedem Wort wird er lauter und meine Mutter auf dem Stuhl kleiner, das erkenne ich aus dem Augenwinkel. Währenddessen schlägt mir seine Fahne, gemischt mit dem säuerlichen und strengen Geruch nach Erbrochenem, entgegen. Nur mit Mühe kann ich ein Würgen unterdrücken. »Und was machst du schon hier, verfluchte Scheiße?« Jetzt zeigt er mit seinem vor Wut zitternden Finger auf meine Mutter.
»Hier ist dein Bier«, sage ich so vorsichtig, als wolle ich ein wildes Tier beruhigen, nicht meinen eigenen Vater, »und ich war gerade dabei, es dir zu bringen. Komm mit ins Wohnzimmer, ich kann dir auch noch etwas zu essen holen.« Ich muss ihn ablenken, er soll seine Wut und seinen Frust auf mich projizieren. Nicht auf sie. Vermutlich weiß er, irgendwo tief in sich drin, dass er nicht auf mich oder seine Frau wütend ist, sondern auf sich selbst. Weil er vor Jahren in seinem Leben die falsche Abzweigung genommen hat. Er hat sogar deutlich mehr als einmal eine falsche Entscheidung getroffen und das verfolgt ihn. Weil es kein Zurück mehr gibt.
Nicht für ihn – daran glaube ich nicht.
»Willst du mir etwa sagen, was ich zu tun habe?«
Ich hebe abwehrend die Hände und schiebe mich so unauffällig wie möglich zwischen ihn und meine Mutter. »Natürlich nicht. Das war ein Vorschlag. Damit du dich ausruhen kannst.« In dem Moment, in dem mir die Worte über die Lippen kommen, erkenne ich meinen Fehler und halte unwillkürlich die Luft an. Scheiße, scheiße, scheiße.
»Mich ausruhen«, nuschelt er und hebt die Augenbrauen, bevor er anfängt zu lachen. Laut, fast bellend. Ein Geräusch, das mir durch Mark und Bein geht, als wolle es sich in jedem einzelnen Winkel meines Körpers festsetzen.
Bis er ruckartig stoppt, sich seine Miene und seine Augen verfinstern. Für eine Sekunde ist es viel zu still.
»Du denkst wohl, ich sei zu nichts anderem mehr fähig, als mich auszuruhen?«, zischt er mir ins Gesicht und kommt mir mit dem erhobenen Zeigefinger drohend nahe, bevor er mich zur Seite schubst. Selbst nach all der Zeit, nach den Drogen und dem Alkohol, ist er noch kräftig. Obwohl ich damit gerechnet habe, schwanke ich, torkle ein paar Schritte und kann mich gerade so an der Küchentheke festhalten, statt ganz über meine Füße zu stolpern und zu Boden zu gehen. Das Bier schwappt trotzdem über und verteilt sich auf meinem Shirt und vor mir auf den Fliesen. Ich hasse diesen Geruch. Genauso sehr, wie ich es hasse, mich hilflos zu fühlen. Nein, hilflos zu sein. Ich bin ihm unterlegen, und das über meinen Vater denken zu müssen, hasse ich am allermeisten.
»Du hast deinen Job wieder verloren, was? Du faules, unnützes Stück.« Er achtet nicht mehr auf mich, sondern baut sich vor seiner Frau auf. Ich hasse, was er aus und mit uns macht.
»Lass sie in Ruhe!«, rufe ich, doch mein Vater hat längst seine Hand erhoben und sie auf meine Mutter niedersausen lassen. Das Klatschen von Haut auf Haut, von seiner Hand auf ihrer Wange, hallt von den Wänden wider, lässt mich erzittern und für eine Sekunde die Augen fest schließen. Als ich sie öffne, kann ich beobachten, wie der Stuhl kippt, und höre meine Mutter schluchzen, bevor sie auf dem Boden aufprallt.
»Sonst was? Willst du wieder zur Polizei gehen?«, verhöhnt er mich, wie jedes Mal, und er hat allen Grund dazu.
Vor zwei Jahren habe ich den Schritt gewagt und bin zur Polizei gegangen. Ich dachte, es wäre egal, dass mein Vater jahrelang selbst Polizist war. Ich dachte, man würde mir glauben, wenn ich erzähle, dass er nach seinem Unfall in eine ewige Abwärtsspirale gerutscht ist, die keiner aufzuhalten vermag. Dass er ohne Maß trinkt und Drogen konsumiert. Dass er seine Frau beleidigt und schlägt. Und mich.
Aber es spielte keine Rolle, denn bevor alles eskaliert ist, war mein Vater ein vollkommen anderer Mensch. Auf dem Revier gab es zu viele ehemalige Kolleginnen und Kollegen, die sich daran erinnerten, wie gut er seinen Job gemacht hat, wie loyal, freundlich und ehrlich er war. Ich war kaum fünfzehn Jahre alt, als ich ihn gemeldet habe. Ein Teenager. Es sah aus, als würde ich ihm trotzig eins auswischen wollen – zumindest für sie.
Kurzum: Niemand glaubte mir. Nicht richtig, sonst hätten sie etwas unternommen.
Bist du sicher?, fragten sie. Wir reden hier von deinem Vater. Von Philipp Haas.
Ja verdammt, ich war sicher. Aber auch das spielte keine Rolle. Und als einer von ihnen dennoch sagte, er würde vorbeikommen und sich umsehen, dachte ich ehrlich, ich würde direkt im Revier zu weinen anfangen. Dabei habe ich das seltsame Gefühl ignoriert, das in mir brodelte. Die Tatsache, dass mir die Konsequenzen meiner Handlung nicht gefallen könnten.
Am Ende hat es nichts gebracht. Nichts, außer dass mein Vater mir weiterhin drohte, mich bewusstlos schlug und unsere Situation verfahrener wurde, als sie es bereits gewesen war. Ich wollte damals etwas ändern und das habe ich – ich habe alles nur schlimmer gemacht …
Er versprach mir, er würde mir zeigen, wie es ist, wenn er uns wirklich das Leben zur Hölle macht, sollte ich so was noch einmal tun. Und er würde bei meiner Mutter anfangen.
Ich glaube nicht mehr an allzu viel, aber daran schon. Diese Warnung hallt in mir nach. Deshalb bin ich nie wieder zur Polizei gegangen. Und genau deshalb lege ich jedes Mal sofort wieder auf, wenn ich mich doch dazu durchgerungen habe, das Jugendamt zu verständigen. Weil ich Angst vor ihm habe. Weil ich Angst habe, was er meiner Mutter antut, wenn ich es durchziehe. Aber noch mehr, was passieren könnte, wenn ich nicht mehr hier bin. Wenn ich einfach gehe und das hier hinter mir lasse, obwohl ich noch nicht volljährig bin. Verdammt, ich bin erst siebzehn und sollte mich nicht seit Jahren mit so was beschäftigen müssen. Nicht mal eine Minute lang!
Meine Mutter versucht oft, mir zu erklären, dass mein Vater nicht immer so war. Als ob ich das nicht wüsste, aber das ändert nichts. Scheißegal, was früher war! Jetzt ist er so und es wird für ihn kein Zurück mehr geben und das Akzeptieren dieser Tatsache scheint ihr mehr abzuverlangen, mehr wehzutun als die Worte meines Vaters. Oder als seine Handgreiflichkeiten.
Obwohl ich meine Mutter dafür verachte, dass sie mich nicht beschützt und sich nicht wehrt, sondern weiterhin zu ihm hält, schaffe ich es nicht, sie im Stich zu lassen. Irgendwo tief in mir weiß ich, sie ist auch ein Opfer. Sie leidet unter ihm genau wie ich, aber doch anders.
Wir sind eben beide keine Wärter in diesem Gefängnis …
Es sind seit meinem Fehler, jenem verhängnisvollen Tag vor zwei Jahren auf dem Revier, zwar nicht mehr körperliche und verbale Attacken geworden – weder bei ihr noch bei mir –, aber weniger sind es eben auch nicht. Nicht, dass weniger Schläge und Tritte gut wären. Einer, zwei, hundert – es sollten nie mehr als null sein.
Auch wenn es seltsam klingt: Schmerzhafter als das bleiben seine Worte, die er, wann immer er kann, in Salven auf uns abfeuert. Dabei tun sie auf andere Art weh, gehen tiefer und hinterlassen unsichtbare Wunden. Von kleinen Schnitten über klaffende Löcher. Seine Worte gleichen langen Nägeln, die in unsere Haut gehämmert werden, die wir spüren, aber die niemand sehen kann. Die uns immer wieder wie ein Echo erklären, wozu wir nicht in der Lage sind … Die uns sagen, was wir sind.
Wertlos.
Nutzlos.
Machtlos.
Armselig.
Unwichtig.
Verletzlich.
Willst du wieder zur Polizei gehen?, hallt es in meinem Kopf wider. Seine Frage, die eher eine Drohung war, steht weiterhin zwischen uns, aber ich bleibe still. Wir wissen beide, dass jede Antwort, die ich darauf geben könnte, falsch ist. Zumindest in seiner Welt.
Mit zusammengekniffenen Augen und Lippen umklammere ich die versiffte Bierflasche in meinen Händen, als wäre sie ein Rettungsanker, und starre den Mann vor mir an. Ein Fremder, der einmal mein bester Freund war. Jemand, der für mich da war, dem ich vertraute. Jemand, vor dem ich keine Angst hatte.
Ein anderer Mensch, von dem nun nichts mehr übrig ist.
Ein Monster.
Eines, das erneut auf mich zukommt und direkt vor mir stehen bleibt.
Das braune Haar, die braunen Augen. Er sieht aus wie ich – oder ich wie er. Es gab mit Sicherheit eine Zeit, da war ich stolz darauf … Jetzt widert mich sein Anblick an.
Sein Atem fühlt sich heiß an auf meiner Haut, er riecht bestialisch und ich kann nicht einmal mehr identifizieren, wonach. Mir kommt die Galle hoch, während ich das Kinn ein Stück recke und seinem verärgerten, abschätzigen Blick begegne. Mit einem Ruck reißt er mir die Flasche aus der Hand und betrachtet sie, bevor er sie plötzlich in die nächste Ecke schleudert, in der sie an einem der Schränke zerschellt. Sie bricht wie Wellen an einer Klippe.
Aus dem Augenwinkel nehme ich wahr, wie meine Mutter dabei erneut zusammenschreckt und sich noch kleiner macht als zuvor, während sie sich die Wange hält und weint. Wäre ich nicht eingeklemmt zwischen meinem Vater und der Theke hinter mir, würde ich zu ihr gehen und sie fragen, warum sie da weiterhin liegt, warum sie – verflucht noch mal – nicht aufsteht. Aber wenn ich ehrlich zu mir bin, ist die Wut auf sie nichts weiter als die Wut auf mich selbst. Ich weiß, warum sie es nicht tut. Es ist der gleiche Grund, warum ich nichts tue.
Es ist Ungewissheit. Es ist Angst, Angst, Angst. Sie ist überall, füllt dieses Haus wie ein Geschwür, das man nicht mehr entfernen kann.
Und in solchen Momenten ist sie derart groß und einnehmend, dass ich mich wundere, noch atmen zu können.
Es bleiben nur Furcht und Wut und Resignation.
Nichts weiter …
Meine Mutter bleibt liegen, weil da nicht mehr viel in uns ist, das uns aufhelfen kann.
»Du gehst zu niemandem! Ich bin dein Vater, das hier ist dein Zuhause und du solltest verflucht noch mal dankbar dafür sein.« Er ist oft unfreiwillig komisch und merkt es nicht einmal. »Räum das auf«, befiehlt er und deutet auf die Scherben, bevor er mich zur Seite stößt und die Küche verlässt. Natürlich nicht, ohne sich vorher ein neues Bier aus dem Kühlschrank zu holen und noch dazu irgendein weißes Pulver aus einem seiner Verstecke. Es ist ihm egal, dass ich sie alle kenne. Es ist ihm egal, dass ich etwas tue, das ich nicht tun will, damit wir nicht vollkommen verhungern und alles verlieren. Dass ich mich mit Drogen herumschlagen muss, weil er ohne Ende Schulden angehäuft hat.
Ich verliere mich selbst. Nur wegen ihm und seiner Ignoranz. Seinem Selbstmitleid. Wegen all der Dinge, die ihn nicht mehr interessieren, und jenen, die es tun.
3
Joanna
Nicht perfekt, aber verdammt nah dran.
»Das ist mehr als unfair.« Meine genuschelten Worte gehen ziemlich schnell in dem Gewusel unter, das jedes Mal herrscht, wenn es sonntags Frühstück gibt. Für gewöhnlich ist das der einzige Tag, an dem wir es auch wirklich alle nach unten an den großen Esstisch schaffen. Und zwar gleichzeitig.
Papa seufzt, also zumindest einer von beiden.
Papa Ben möchte mir antworten, aber Papa Paul versucht in dieser Sekunde, eines unserer Hühner daran zu hindern, einmal quer über den Esstisch zu laufen.
»Verdammt, Hilde. Wer hat dich reingelassen?«
Während also Paul das Huhn Hilde einfängt und damit alle Aufmerksamkeit auf sich lenkt, verzieht mein Bruder Oskar das Gesicht und flucht lautlos.
»Entschuldige. Das kann eben gerade passiert sein, als ich Betty gefüttert hab«, gibt Oskar zu und meint damit die ehemalige Streunerkatze, um die wir uns seit Anfang des letzten Jahres kümmern. Oskar und Ben haben ihr sogar ein Katzenhaus gebaut und einen eigenen Kratzbaum. Beides steht in einer überdachten Ecke hinterm Haus, Richtung Weide.
»Bekommt Hilde genug Futter?«, fragt Paul skeptisch, wobei er die Brauen zusammenzieht und das Huhn nach draußen Richtung Garten trägt. Natürlich nicht, ohne sie genauestens unter die Lupe zu nehmen.
»Ja, Schatz.« Ben verdreht die Augen und lächelt. Paul fragt uns das gefühlt jeden Tag. Er ist Tierarzt und kann gar nicht anders, dabei ist ihm klar, dass Hilde einfach nur alt ist und es ihr ansonsten blendend geht. Genau wie der Katze. Das hindert beide nicht daran, riesige Nervensägen zu sein. Erst gestern hat Betty es für wenige Minuten ins Haus geschafft, nur um auf meinen Teppich zu kotzen.
»Wer möchte noch etwas essen?«, durchbricht Oma Elli mit ihrer fröhlichen Stimme das Chaos und meine Gedanken, während sie strahlend mit einer großen Ladung Pfannkuchen auf dem Teller aus der Küche kommt. Ihre Wangen sind leicht gerötet, ihr lockiges weißes Haar, das sie mit einer riesigen Haarklemme am Hinterkopf befestigt hat, leuchtet im Kontrast zu ihrem braun gebrannten Gesicht. Ihre rote Brille sitzt dabei schief auf der Nase. Wie immer.
Oskar will sofort Hier schreien – ich sehe es ihm an –, verschluckt sich dabei aber an seinem Orangensaft und muss kräftig husten. Tränen schimmern in seinen Augen. Meine Schwester Kati hebt sofort die Hand, weil auch sie dieses Frühstück liebt, und mit der anderen klopft sie auf Oskars Rücken, damit der aufhört zu röcheln. Wenn unsere Oma mit diesem Teller zum Esstisch kommt, muss niemand für Kati übersetzen, denn dann weiß sie, was gemeint ist und worum es geht. Natürlich hebe ich meine Hand genau wie die anderen.
Oma Ellis berühmte Pfannkuchen gibt es nur an Wochenenden und sie schmecken jedes Mal himmlisch. Seit Jahren versuchen wir, sie zu überreden, sie mal unter der Woche zu machen, aber da bleibt sie eisern. Sie meint, dann wäre es nichts Besonderes mehr und das wäre wiederum schade. Schließlich sollte man im Leben stets versuchen, das Besondere zu erhalten.
Ich bin mir sicher, die Pfannkuchen würden nie aufhören, besonders zu sein … vor allem besonders lecker. Aber auf mich hört ja keiner.
Während Oma Elli zuerst meinen Geschwistern die Teller füllt, warte ich auf Antwort von Ben, der genüsslich seine zweite Tasse schwarzen Kaffee trinkt. Ohne Koffein würde er nicht funktionieren, da bin ich sicher.
»Findest du nicht, dass es unfair ist?«, hake ich ungeduldig nach, doch er legt nur fragend seine Stirn in Falten.
»Was meinst du?«
»Hast du mir wirklich nicht zugehört?«
»Natürlich, Kleines.« Ben seufzt. »Tut mir leid, hier ist gerade so ein Tohuwabohu.«
»Kati sollte endlich einen zusätzlichen Rollstuhl bekommen. Einen, der auf ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist, während sie auf dem Hof, der Weide und im Stall unterwegs ist.« Meine zwölfjährige Schwester ist von der Hüfte abwärts gelähmt.
»Du weißt, dass sie längst einen hat, der für sie gemacht wurde und sehr gut zu ihr passt.« Papa schaut mich verständnisvoll an. Dieses Gespräch führen wir nicht zum ersten Mal. »Und du weißt, dass wir weiterhin alles versuchen, aber …«
»… die Krankenkasse zahlt keinen zweiten, zumindest nicht ohne triftigen Grund, und ein Geländerollstuhl dieser Art kostet verdammt viel Geld. Schließlich kommt Kati ja auch so irgendwie überallhin. Ja, ich weiß.« Ich stochere in meinem Pfannkuchen herum und bin frustriert. Kati redet genauso oft mit Paul und Ben darüber, schließlich geht es um sie, aber sie ist dabei diplomatischer als ich. Geduldiger. Das bewundere ich.
»Es tut mir leid, Jo.«
»Das muss es nicht. Ich finde die Begründung nur unsinnig, ein Rollstuhl wäre genug. Man könnte Kati noch mehr Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit schenken. Sie lebt eben auf einem Hof mitten auf dem Land und nicht in einer Großstadt. Obwohl auch da überall Barrieren zu finden sind. Mit ihrem Rollstuhl kommt sie allein gerade so zum Stall – und das auch nur über den gepflasterten Weg. Der, nebenbei gesagt, mal saniert werden müsste.«
Papa schmunzelt. »Danke für die dezente Kritik.«
»Ich hab’s nicht so gemeint.« Ich lächle ihn an, weil ich nicht wie ein undankbares Gör klingen wollte, und er lächelt zurück, bevor er meinen Arm tätschelt.
»Schon okay. Uns geht es wie dir, wir sind damit auch unglücklich. Aber wir geben alles. Es ist schön, sehen zu dürfen, dass du dich so für deine Schwester einsetzt.«
»Ich hab gestern erst wieder mit Paul darüber geredet«, grätscht Kati dazwischen und verzieht das Gesicht.
»Oh, das wusste ich nicht, entschuldige.« Kati kann ihre Schlachten selbst schlagen, das ist mir bewusst.
»Reden wir über die Rollstuhl-Sache?«, fragt Paul, der ohne Huhn zurückgekommen ist, Ben einen Kuss gibt und sich dann den letzten Pfannkuchen von Oma Ellis Teller stibitzt.
»Hey! Das war meiner«, piepe ich empört.
»Da musst du schneller sein, Jo.« Er wackelt mit den Augenbrauen und beißt genussvoll hinein.
»Ja, tun wir«, erwidere ich auf seine Frage von eben.
»Paul und Ben rufen noch mal bei der Krankenkasse an«, erklärt Kati. »Wir schaffen das, auch wenn es schwer wird. Ich bekomme meinen Rollstuhl.« Sie nickt ernst.
»Genau!«, bestätigt Paul und zwinkert meiner Schwester zu. »Ich muss jetzt rüber zu Jan, seine Kuh hat wieder Magenprobleme.« Paul gibt seiner Mama einen Kuss auf die Wange, wird dabei aber von ihr mit erhobenem Zeigefinger ermahnt wegen meines Pfannkuchens, den er genüsslich verputzt.
»Bist du sechsundvierzig oder vier?«, rufe ich ihm viel zu spät hinterher. Paul ist längst weg und mein Bruder Oskar schüttelt mitleidsvoll den Kopf.
»Meinst du, es wird in diesem Leben noch was mit der Schlagfertigkeit, Jo?«, fragt er, während er seine Worte und die Situation für Kati in Gebärdensprache übersetzt, kommentiert und dabei das Ganze theatralisch mit seiner Mimik untermalt. Meine kleine Schwester lacht und muss nicht lange über seine Frage nachdenken, sondern schüttelt sofort bedauernd den Kopf, genau wie Oskar zuvor.
»Kati sagt Nein«, erklärt er überflüssigerweise laut und ich verziehe das Gesicht, weil mir ein passender Konter wohl frühestens in vierundzwanzig Stunden einfällt. Und weil ich mir ein Lachen verkneifen muss …
»Jo, Liebling. Das war der letzte Pfannkuchen. Ich habe leider keinen Teig mehr, um neue zu machen«, verkündet Oma mit traurigem Blick und leicht vorgeschobener Unterlippe, nachdem sie neben mich getreten ist und mir ihre warme Hand auf die linke Wange gelegt hat. »Nächstes Wochenende bekommst du dafür einen ganzen Haufen extra, nur für dich, versprochen.«
»Wir auch?«, fragt Kati voller Begeisterung mit ihren Händen und zeigt dabei auf sich und Oskar, während ich für alle Anwesenden übersetze – wie jedes Mal –, auch wenn die meisten von uns mindestens die Grundlagen der Gebärdensprache beherrschen. Es ist zu einer Gewohnheit geworden.
Omas Gesicht hellt sich auf, ihre Lippen verziehen sich zu einem Lächeln, ihre Augen beginnen wieder zu strahlen.
»Aber natürlich.«
Meine Familie ist wundervoll.
4
Mika
Willkommen im Kaninchenbau.
Die Schulden werden nie beglichen sein. Leute wie mein Vater – zumindest so, wie er heute ist – oder Drogendealer und ihre Bosse kriegen den Rachen nicht voll. Da gibt es kein Genug und kein Ende. Zumindest habe ich das bisher gedacht. Ich habe gedacht, bei ihnen wäre es so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz.
Doch ich habe mich geirrt. Ich bin raus.