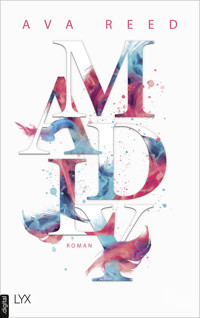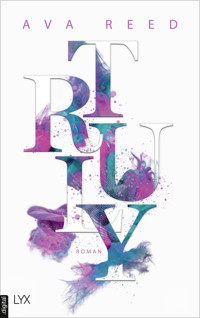9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Whitestone Hospital
- Sprache: Deutsch
Alles, was ich mein Leben lang aufgebaut habe, die Mauern, die Fassade, meine Schutzschilde - alles wird zu Chaos
Als es im Whitestone Hospital zu einem verheerenden Unfall kommt, steht die Welt für einen Moment still. Die Assistenzärztin Dr. Sierra Harris ist eine der Ersten vor Ort, doch dass unter den Verletzten ausgerechnet ihr Kollege Mitch Rivera ist, reißt ihr den Boden unter den Füßen weg. Sierra will sich von ihm fernhalten, will nichts von alldem an sich heranlassen, denn um eine Top-Herzchirurgin zu werden, kann sie keine Ablenkung gebrauchen. Dabei hat Mitch sich längst in ihre Gedanken geschlichen - und in ihr Herz ...
"Spannend von der ersten Seite an. Ava Reed schafft es ein weiteres Mal, mich mit einer einzigartigen und emotionsgeladenen Geschichte zu verzaubern. Drowning Souls ist wie ein Adrenalinrausch, gespickt mit einer ordentlichen Dosis Liebe." NICOLE BÖHM
Band 2 der vierbändigen Serie rund um die jungen Ärzt:innen des WHITESTONE HOSPITALS
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Leser:innenhinweis
Triggerwarnung
Soundtrack
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
Nachwort & Danksagung
Glossar
Die Autorin
Die Romane von Ava Reed bei LYX
Impressum
Ava Reed
Drowning Souls
WHITESTONE HOSPITAL
Roman
Zu diesem Buch
Für einen Moment steht die Welt still, als es im Whitestone Hospital zu einer Explosion kommt. Dr. Sierra Harris, die zusammen mit Dr. Laura Collins alles beobachtet hat, leistet Erste Hilfe. Unter den Verletzten ist auch Dr. Mitch Rivera, der für ihren Geschmack viel zu fröhliche und attraktive Assistenzarzt. Irgendwie hat er es geschafft, sich in ihr Herz zu schleichen – was er aber niemals erfahren darf, denn wenn sie eine Top-Herzchirurgin werden will, kann sie keine Ablenkung gebrauchen. Die Sorge um Mitch lässt Sierra allerdings nicht los, und so besucht sie ihn regelmäßig heimlich auf Station, während er sich von seinen Verletzungen erholt. Doch nachdem Mitch entlassen und wieder für diensttauglich erklärt wird, kann sie ihm nicht mehr aus dem Weg gehen. Und Mitch hat längst gemerkt, dass Sierra ihm gegenüber nicht so gleichgültig ist, wie sie vorgibt. Können beide nach dem traumatisierenden Unfall zueinander finden und sich ihre Gefühle eingestehen?
Für jeden Menschen, der manchmal nicht weiß, wo er hingehört, oder denkt, er wäre nicht gut genug.
Für die PJs – ich hatte nie bessere Freundinnen und Freunde als euch. Ihr seid Teil meiner Familie.
Liebe Leser:innen,
vorab eine Erinnerung: Dies ist der zweite Band der Reihe. Obwohl die Paare und Sichtweisen wechseln, zieht sich die Storyline kontinuierlich und chronologisch durch alle Bände. Sie sind daher nicht in falscher Reihenfolge oder unabhängig voneinander lesbar. Drowning Souls knüpft direkt an das Ende von High Hopes, dem ersten Band der Reihe, an.
Hinten im Buch findet ihr nach der Danksagung, wie bereits in Band 1, ein Glossar mit den wichtigsten medizinischen Begriffen.
Die medizinischen Aspekte innerhalb der Reihe wurden meinerseits nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert und von erfahrenem Fachpersonal geprüft. Falls dennoch Fehler durchgerutscht sein sollten, war das natürlich keine Absicht. Wir sind alle nur Menschen. Teilt sie daher gerne direkt dem Verlag mit, damit sie korrigiert werden können.
Ich freue mich, dass ihr nun auch zu Mitchs und Sierras Geschichte gegriffen habt, wünsche euch tolle Lesemomente und eine wundervolle Zeit im Whitestone Hospital.
Danke für eure Geduld und Unterstützung.
Eure Ava
Triggerwarnung
In der gesamten Whitestone-Hospital-Reihe werden – auch aufgrund des Settings – verschiedenste Themen ihren Platz finden, die unter Umständen triggern können.
In Drowning Souls sind es unter anderem Leistungsdruck, körperliche Verletzungen jeglicher Art, diverse Körperflüssigkeiten, explizite Erwähnung und Beschreibung von Krankheiten, Operationen sowie teils erfolglose Reanimationen, Verbrennungen, Traumata, Krebs, Tod, eigene Sterblichkeit, Trauer, Alkoholmissbrauch, Atemnot, emotionaler Missbrauch und toxische Beziehungen.
Diese Liste erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Bitte achtet auf euch und eure Gefühle.
Soundtrack
DARK FOUR DOOR – BILLY RAFFOUL
SATELLITE (ACOUSTIC) – CHARLOTTE OC
HEARTS (ACOUSTIC) – JESSIE WARE
NOT WHO WE WERE – EM BEIHOLD
HOW TO SAVE A LIFE (COVER) – SHELBY PARK
BROKEN – JONAH KAGEN
LET’S HURT TONIGHT – ONE REPUBLIC
LOST (ACOUSTIC) – JONATHAN ROY
KEEP YOU DRY – JUKE ROSS
LOST FOR WORDS – PLESTED
FALLIBLE CREATURES (ACOUSTIC) – SCOTT QUINN
THE SCIENTIST (COVER) – GABRIELLA
I DON’T WANT TO LOSE YOU – LUCA FOGALE
YOU SAY – LAUREN DAIGLE
LONG TIME – WILD RIVERS
SOLA – LUIS FONSI
I’LL BE GOOD – JAYMES YOUNG
TREAD LIGHTLY – FOREST BLAKK
WHAT IF – RHYS LEWIS
YOU BE LOVE (ACOUSTIC) – BILLY RAFFOUL
SWEETEST THING – ALLMAN BROWN
HALF LIGHT – BANNERS
SORRY – HALSEY
1. Kapitel
Sierra
So fühlt es sich also an, Angst zu haben. Nicht um mich, nicht um mein Leben, sondern um das der anderen.
Dabei dachte ich, zu wissen, was Angst bedeutet, schließlich hat sie mich mein Leben lang begleitet und nie ganz verlassen. Angst, das Studium nicht zu schaffen und zu versagen – besonders im Job – und nie meinen Platz in der Welt zu finden; nichts Halbes und nichts Ganzes zu sein. Nicht gut genug zu sein. Nicht wichtig genug. Nicht wertvoll genug.
Einfach nicht genug zu sein.
Die Angst, mich zu verlieren, bevor ich mich gefunden habe.
Aber das hier – das ist etwas anderes. Das hier ist eine Angst, die nicht nur als Wort in meinem Leben existiert, nicht nur als begleitender Schatten, als dumpfer Magenschmerz oder leichtes Ziehen. Nein, diese hier drückt meine Lunge zusammen und zerquetscht meine Innereien. Sie will mein Herz daran hindern, weiterzuschlagen. Diese hier ist definitiv mehr ein Gefühl als ein bloßer Name.
Und während sie mich verzehrt, wird mir klar: Das alles kann unmöglich real sein.
Was ist da eben passiert? Wie ist es passiert und warum? Laura und ich wollten Feierabend machen, wir hatten gute Laune, und es war schön, dass sie endlich wieder voll zurück ist. Dass es ihr nach der Sache mit Nash und all dem Mist, der folgte, wieder besser geht, sie keine Spätfolgen davonträgt und ihre Rippe geheilt ist.
Wir schlenderten Richtung Fahrstuhl, aus dem Ian genau in der Sekunde ausgestiegen ist, in der wir um die Ecke gebogen sind. Zur selben Zeit wollten Nash, Mitch und ein paar Pflegekräfte einsteigen, um den zuvor eingelieferten Patienten schnellstmöglich in den OP zu bringen. Sie waren noch nicht ganz drin, die Türen noch nicht geschlossen, da explodierte etwas, das uns die Luft aus den Lungen getrieben und unsere Welt ein Stück aus den Angeln gehoben hat.
Und jetzt, einen Wimpernschlag später, weiß ich nicht, wo ich hinschauen, was ich denken oder als Erstes tun soll.
Ian liegt bewusstlos und dreckverschmiert auf dem Boden. Durchsagen dröhnen durch die Lautsprecher, doch ich verstehe kein einziges beschissenes Wort, weil es zu sehr rauscht und meine Gedanken viel zu laut sind. Es ist, als hätte mein Gehirn auf Stand-by geschaltet, damit es das hier erträgt und mein Körper nicht vollkommen kollabiert. Ich fühle mich wie gelähmt – und das, obwohl ich Laura bereits beiseitegeschoben habe und deutlich spüre, wie ich einen Schritt vor den anderen setze. Wie ich mich bewege. Schneller und schneller.
Ich renne dem Chaos entgegen, hinein in die Arme dieser alles vernichtenden Angst, deren Lachen ich in den tiefsten Winkeln meines Selbst hören kann. Und das ist verrückt, weil ich es war, die bis eben rational gedacht und Laura zurückgehalten hat. Die nicht wollte, dass ihre Freundin impulsiv handelt, weil wir nicht wissen, was genau passiert ist, wie gefährlich es war oder noch ist. Doch als sie Mitchs Namen erwähnt hat und die der anderen, sickerte in meinen Verstand, dass es nicht einfach irgendein Unfall ist. Die Namen sagten mir, dass wir mehr als sonst zu verlieren haben – und was diese Explosion für uns bedeuten kann …
Der Knall dröhnt noch immer in meinen Ohren, und ich muss husten von dem vielen Rauch, den ich unablässig einatme, während Laura mich längst wieder überholt hat.
Ich halte direkt hinter ihr an, als sie sich neben Ian auf die Knie fallen lässt, um ihn zu untersuchen, und ich weiß nicht, wie sie das schafft. Ich weiß nicht, wie sie Ian – obwohl er die logische Wahl ist, da wir zuerst auf ihn getroffen sind – Nash vorziehen kann. Nash, dessen Zustand mich schwer schlucken lässt, als ich meinen Blick aus leicht zusammengekniffenen, tränenden Augen endlich ganz auf den geöffneten Aufzug richte.
Ich keuche auf, ziehe ein Stück meines Kasacks vor Mund und Nase, weil der beißende Geruch, der mich plötzlich erreicht und den ich nicht benennen kann, zu viel für mich ist.
Was auch immer das eben war: Dieser Knall hat das Innere des Fahrstuhls fast komplett zerstört. Nahezu jede Lampe ist kaputt, Scherben liegen überall, das restliche Licht flackert wild, ohne festen Rhythmus, Funken fliegen, und alle Menschen, die sich im Aufzug befanden, liegen reglos auf dem Boden oder sind auf irgendeine Art eingequetscht.
Lisha, eine Pflegerin der Notaufnahme, wurde halb rausgeschleudert, und ihr Körper hindert die Türen daran, sich zu schließen. Sie gehen zu, drücken Lisha leicht zusammen, springen wegen des Widerstandes jedoch sofort wieder auf, um von vorne anzufangen, und ich kann nichts tun, als diesen Wahnsinn in mich aufzusaugen und dabei zu hoffen, ihm nicht zu verfallen.
So viel Schutt, so viele Scherben, so viel Blut und Chaos. »Oh mein Gott«, hauche ich und huste kurz danach erneut.
Ich will Lisha versorgen, checken, wie es ihr geht, bis ich das Feuer bemerke, das sich viel zu schnell im hinteren Teil des Fahrstuhls ausbreitet und immer mehr Rauch produziert. Von den Brandgasen ganz zu schweigen.
»Scheiße!«, fluche ich, und sofort ist Laura bei mir.
»Sierra, wir dürfen nicht …«, beginnt sie, doch beim Anblick von Nash bricht ihre Stimme. Beim Anblick des Feuers.
Zusammenbrechen.
Diesem Schmerz nachgeben.
Die Nerven verlieren.
Ich bin sicher, eines davon wollte Laura eben sagen, weil sie mein Fluchen gehört hat. Aber als sie das ganze Ausmaß erblickt, als sie Nash sieht – nicht bei Bewusstsein, vorne links zwischen dem umgekippten Patientenwagen und der Fahrstuhlwand eingeklemmt –, versteht sie es.
Wo ist Mitch? Wieso sehe ich ihn nicht? Ist er doch nicht eingestiegen? Scheiße, der Rauch wird immer dichter, und meine brennenden Augen sind keine Hilfe. Ich muss da rein, aber vorher sollte eine von uns dem Feuer Einhalt gebieten.
Laura wispert Nashs Namen, ballt die Hände zu Fäusten, und ich weiß, wie sehr sie zu ihm will. Aber die Ärztin in ihr gewinnt, kneift die Augen ein, zwei Sekunden zusammen und sagt eindringlich zu mir, was mir gerade selbst klar geworden ist: »Wir kommen nicht schnell genug durch, wir müssen zuerst das Feuer löschen. Besorg Decken. Wir können den CO2-Feuerlöscher nicht nehmen, weil wir damit nicht umgehen können und im schlimmsten Fall unsere Atemwege schädigen, besonders in dem Aufzug. Hinten ist noch einer mit Pulver, aber das verunreinigt die Wunden und macht eine riesige Sauerei. Ian ist so gut wie möglich versorgt.« Sie rattert all ihr Wissen, all ihre Gedanken herunter, und auch wenn nichts davon neu für mich ist, unterbreche ich sie nicht. Bestimmt macht Laura das gerade, um den Fokus nicht zu verlieren. Also nicke ich nur, während die ersten Helfer eintreffen. »Ich kümmere mich um Lisha und all den Schutt, der im Weg liegt, bis du zurück bist. Vorher erreichen wir die anderen kaum«, spricht Laura weiter, und ich mache den Fehler, den Fahrstuhl noch einmal genauer anzusehen … Dieses Mal erkenne ich Mitch. Es sind nur Schemen und Umrisse, aber ich bin mir sicher, dass er es ist. Er ist dort drin. Ein Teil von mir wusste das, es war logisch, es war klar; doch der andere Teil, der hoffte, sich zu irren, bricht gerade zusammen.
Nein! Ich …
»Sierra!«, presst Laura hervor und hält mich auf. Dabei habe ich nicht mal gemerkt, dass ich mich bewegt habe. Dass ich mich gegen sie stemme und dieses Nein nicht nur gedacht, sondern geschrien habe. Und ich schreie noch immer. Stumm. Weil mir die Luft ausgeht und ich wieder husten muss.
»Das Feuer«, wiederholt sie, und ich renne los. Wieder renne ich vor Angst, doch dieses Mal bin ich nicht wie gelähmt. Mein Zögern hat nicht lange gedauert, aber es hat uns wertvolle Sekunden gekostet. Es hat unsere Freunde und Freundin wertvolle Sekunden gekostet …
So schnell ich kann, schnappe ich mir einen Erste-Hilfe-Kasten aus der Notaufnahme, inklusive Löschdecken.
Der Alarm ist zu einer Hintergrundmusik geworden, der Flur verwandelt sich in einen Ameisenhügel. Immer mehr Menschen wuseln umher, immer mehr Personal trifft ein. Sie rufen durcheinander, eilen über die Treppen zu uns nach unten, um zu helfen oder die Notaufnahme unter Kontrolle zu halten. Um – falls nötig – zu evakuieren.
Als ich zurück bin und vorm Fahrstuhl ankomme, wird Ian vorsichtig umgebettet und über EKG-Elektroden zur Überwachung an den Monitor angeschlossen. Sauerstoff wird er wohl gleich bekommen, sobald er aus dem Gefahrenbereich gebracht wurde. Neben Dutzenden anderen Pflegekräften, Ärztinnen und Ärzten erkenne ich Dr. O’Leary und Grant, der nun fluchend und keuchend dabei hilft, Lisha zu stabilisieren. Währenddessen können Laura und ich endlich in den Fahrstuhl rein, dessen Türen nun permanent offen bleiben und eingerastet sind, und ich beginne, das Feuer mit einer Decke zu löschen. Die Flammen fressen sich bereits durch die umliegenden brennbaren Stoffe. Sogar durch Mitchs Kleidung. Aber diesen Gedanken verdränge ich sofort vehement, denn sonst würde er mich lähmen.
Der Rauch wird nicht weniger, die Sicht nicht besser, aber das ist egal. Ich mache weiter, schwitzend, mit kratzendem Hals, bis ich keine einzige Flamme mehr sehe, keinen Funken. Bis es geschafft ist.
Das Feuer ist weg und damit die potenziell größte Gefahrenquelle. Abgesehen von den möglichen giftigen Gasen, die wir gerade einatmen. Ich bräuchte eine Maske, die bräuchten wir alle, denn ein feuchtes Tuch allein würde nichts bringen. Eigenschutz hat immer oberste Priorität – das ist das, was wir lernen. Nur ist das im Moment für mich nicht der Fall. Ich werde nicht gehen, um mir eine Maske zu besorgen, ich kann nicht, egal, wie fahrlässig oder gedankenlos das sein mag.
Ich pfeffere die Decke keuchend in die Ecke und huste mir die Seele aus dem Leib. Laura ist bereits bei Nash, versucht, ihn zu befreien, mit ihm zu reden, und ich erkenne, wie ihr Verstand mit ihrem Herz um die Vormachtstellung kämpft.
Ich verstehe es. Denn zum ersten Mal kann ich sie fühlen. Diese innere Zerrissenheit. Alles in mir will zu Mitch. Dabei liegt der Notfallpatient auch da, mitten im Aufzug, halb begraben unter dem Gestell des Bettes in einer Lache aus Blut, und daneben George, der mit uns heute die halbe Schicht gearbeitet und uns unermüdlich unterstützt hat. Weder Laura noch ich haben viel mit ihm zu tun gehabt, er war als Pfleger stets in der Notaufnahme eingesetzt, und unsere Schichten haben sich bisher selten überlappt. Er war eher still, manchmal grummelig, aber nie unhöflich, und er hat seinen Job gut gemacht. Ich kenne ihn. Er ist ein Kollege. Scheiße …
Ich schwitze, ich friere, ich bin kurz davor, den Verstand zu verlieren. Es kommt mir vor, als wären wir bereits eine Ewigkeit hier. Als würden wir uns in Zeitlupe bewegen, während alles um uns herum zerbricht und zerfällt. Dabei sind es nur wenige Minuten. Sekunden.
Es sind nur Wimpernschläge.
»Ich bin so schnell gekommen, wie ich konnte«, höre ich jemanden neben mir sagen und weiß, ohne mich zur Seite zu drehen, es ist Zeenah. Ihre klare, beruhigende Stimme ist unverkennbar. Außerdem ist sie die Einzige von uns, die es schafft, nicht sofort lauthals zu fluchen, wenn alles den Bach runtergeht.
»Kümmer dich um George und ruf jemanden für den Patienten«, sage ich und hoffe, ich klinge dabei nicht zu schroff oder überheblich, schließlich ist Zeenah verdammt gut und weiß, was zu tun ist. Aber ich kann das jetzt nicht übernehmen und ihr Mitch überlassen. Ich muss zu ihm, und mir ist egal, was das über mich aussagt. Über mich als Mensch. Über mich als Ärztin.
Es ist egal.
Ich stolpere über eine Stange, falle hin, aber auch das ist egal. Kriechend bewege ich mich zu Mitch und schaffe es, mich neben ihn zu knien, in all den Dreck. Ich schlucke schwer, als meine Hand sich plötzlich selbstständig macht und statt nach ihm nach links greift, sich auf den Hals des Patienten legt, den sie nach oben in den OP bringen und retten wollten. Wegen dem sie in den Fahrstuhl gestiegen sind.
Kein Puls.
Aber es ist nicht nur das. Seine Augen sind aufgerissen, und sein halbes Gesicht ist zerfetzt, während nahezu sein kompletter Körper unter der Liege begraben wurde. Sein Zustand war bereits bei seiner Einlieferung sehr kritisch, aber das?
Er hatte keine Chance.
»Er ist tot«, sage ich und weiß, dass Zeenah mich gehört hat, denn ich vernehme ihr »Okay« und erkenne aus dem Augenwinkel, wie sie professionell und ruhig arbeitet, wie sie sich ein Bild von Georges Verletzungen macht.
Dann bin ich wieder ganz bei Mitch. Ich huste ein letztes Mal, fahre mir über die Augen und weiß, dass es ein Fehler war, weil ich einen Moment brauche, bevor der Film darüber verschwunden ist und ich Mitch untersuchen kann. Dabei wirken dieser Fahrstuhl, der Gestank, die stickige Luft, dieses ganze Chaos und das verbleibende flackernde Licht wie ein Käfig auf mich. Wie das Maul eines Monsters, das uns alle zu verschlingen droht.
Mit schnell klopfendem Herzen fühle ich seinen Puls und schaue, ob er atmet – dabei halte ich selbst plötzlich die Luft an. Ich kann nicht anders.
Und als ich seinen schwachen Atem endlich spüre, seinen Herzschlag, als ich das Heben und Senken seines Brustkorbs erkenne, kann ich ein erlösendes Keuchen nicht unterdrücken. Beinahe sinke ich vor Erleichterung nach vorn. Ich würde Mitch am liebsten umarmen und gleichzeitig anschreien.
Er atmet.
Sein Herz schlägt.
Dabei mag ich Mitch nicht einmal. Er ist quasi noch ein Baby. Er nervt und treibt mich in den Wahnsinn.
Aber wenn er jetzt stirbt, egal wie oder warum, schwöre ich, hole ich mir seine Seele zurück, wo auch immer sie sein mag – und bringe ihn erneut um. Weil er das hier mit mir macht. Weil er mir so eine verschissene Angst einjagt.
Ich hole ihn zurück … Dieser Entschluss gibt mir neue Kraft, gibt mir den Fokus zurück, den ich brauche, um das hier durchzustehen.
Mitchs Augen sind geschlossen, er ist nicht bei Bewusstsein, und wären da nicht all der Ruß, das Blut, die Schrammen, müsste ich denken, er würde friedlich schlafen.
Als ich damit beginne, ihn zu untersuchen, mir den Raum verschaffe, den ich benötige, wird meine Hose an den Knien feucht. Vermutlich saugt sie sich gerade mit Blut und Dreck voll. Zusätzlich spüre ich, wie Splitter und Scherben sich schmerzhaft in meine Beine drücken.
Es spielt keine Rolle. Nichts davon.
»Ich brauche Hilfe! Eine Trage, einen venösen Zugang …«, zähle ich weiter all das auf, was ich benötige, nachdem ich mich einen Moment lang umgedreht und aus vollem Hals geschrien habe, um den ganzen Lärm um mich herum zu übertönen. Keine Ahnung, ob mich jemand gehört hat.
Lisha ist weg, wird behandelt, deshalb haben Laura, Grant und ein weiterer Arzt keine Schwierigkeiten mehr, an der umgekippten Trage vorbeizukommen, und ziehen und heben das Ding endlich raus. Bei dem Chaos hier drin ist es momentan auch so zu eng und zu stickig für so viele Leute. Danach schaffen sie Nash so schnell es geht aus dem Fahrstuhl und aller Wahrscheinlichkeit nach in den OP oder zumindest zum CT – je nach Verletzungen. Das MRT kann nachgeholt werden, falls eine weitere Diagnostik nötig sein sollte.
Plötzlich schlägt das EKG von George aus, an das er eben erst über den mobilen Überwachungsmonitor angeschlossen wurde. Hektische Bewegungen, aber dennoch gezielte Handgriffe folgen. Jetzt kommt der Defi zum Einsatz, um Georges Herzrhythmusstörungen in den Griff zu kriegen. »Alle weg!«, ruft Zeenah, und ich schaue fort, ich kann das nicht mit ansehen und schäme mich dafür. Es ist das eine, fremde Menschen zu behandeln, das andere, sie zu kennen und zu mögen. Das macht aus ein und derselben Sache zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Das macht aus einer Kopf- eine Herzenssache. Und dann geht es unter die Haut. Dann beginnt es, so richtig wehzutun.
Ich schlucke schwer, blinzle mehrmals, während ich Mitch weiter untersuche. Der Rauch hier drin verfliegt schneller als gedacht, und ich muss nicht mehr so oft und heftig husten. Immer mehr Details dringen zu mir durch, doch ich wünsche mir fast, es wäre nicht so. Denn das, was ich jetzt erkennen kann, bringt mein Herz für einen Moment zum Stolpern, lässt meinen Mund fluchen und meine Lunge stillstehen. Eine Sekunde, eine weitere … danach schaffe ich es endlich zu reagieren.
Mitch hat schwere Verbrennungen. Bevor ich es löschen konnte, hat es das Feuer geschafft, auf seinen Kasack überzuspringen, hat den Stoff mit seinem Maul aus Flammen zerfressen und bei Mitchs Haut nicht haltgemacht. Feuer kennt kein Erbarmen. Es ist ein Parasit, der nicht begreift, dass er sich nur selbst schadet, wenn er andere zerstört. Dass er sich selbst umbringt. Genau wie Krebs. Vielleicht geht es aber auch genau darum. Ums Zerstören. Nicht ums Überleben.
Sogar unter diesen Bedingungen erkenne ich, was es mit Mitchs Oberkörper, seiner linken Seite und seinem linken Oberschenkel gemacht hat. Dabei hatte ich gehofft, die Flammen hätten es nicht so weit geschafft, und ich wäre rechtzeitig zurück gewesen, um sie zu löschen. Aber das war ich nicht. Wenn Mitch erfährt, dass ich diejenige war, die das Feuer nicht rechtzeitig hat löschen können, diejenige, die nicht schnell genug war, wird er mich hassen.
Am liebsten würde ich meine Wut und Verzweiflung hinausschreien, stattdessen beiße ich mir nur auf die Innenseite der Wange und mache weiter. Halte den Fokus mit aller Macht dort, wo ich ihn brauche.
Ich kann ihm den Kasack nicht ausziehen, Mitch muss woanders versorgt werden und in den OP, denn das verfluchte Ding klebt jetzt an seiner Haut, ist an manchen Stellen damit verschmolzen, vor allem an den Hüften und der Taille. Um nicht doch noch laut aufzuschreien, beiße ich mir fest auf die Lippe. So lange, bis ich Blut schmecke. Den Oberschenkel hat es auch erwischt, seinen Arm ebenso. Wie viel Haut noch, kann ich nicht genau erkennen. Aber wenn ich mir das alles ansehe und an diesem Punkt die Verbrennungen abschätzen müsste, würde ich sagen, achtzehn bis zwanzig Prozent. So viel ist von seinem Körper verbrannt.
Es könnte mehr sein, es könnte weniger sein. Ich bin kein Profi, was dieses Gebiet angeht, aber ich erinnere mich daran, dass Verbrennungen in Kategorien eingeteilt sind. Je höher die Stufe, umso schlimmer ist es. Die Haut am Bein bis über seine linke Seite zur Brust ist rot, hat keine weißen Stellen. Das ist gut. Mitch hat vielleicht Glück und ist dort nicht über Stufe IIa. Aber der Brustkorb bis zur Taille, der Oberarm und die Schulter sind nicht nur tiefrot, sondern mit weißen Stellen und Dutzenden Blasen übersät, die sich gebildet haben. Die Haut wirkt weißlich, trocken, die Hautkonsistenz ist, nachdem ich sie mir genauer angesehen habe, eher hart als weich. Scheiße. Eine dermale Verbrennungstiefe. Könnte an manchen Stellen sogar Stufe III sein, aber dafür kenne ich mich mit Verbrennungen wirklich nicht gut genug aus und das Licht hier drin, dieses Flirren und Flimmern, ist nicht besonders hilfreich. Außerdem werden die Ausmaße der Verbrennungen oft erst intraoperativ erkannt.
Ich fluche erneut, weil tiefere Hautschichten, Nerven und Blutgefäße betroffen sein können und ich nicht sicher bin, wie ich weitermachen soll.
Meine Finger zittern, ich kneife die Augen zusammen und zwinge mich dazu, mit meinen Gedanken im Hier und Jetzt zu bleiben, die Sorgen nicht die Oberhand gewinnen zu lassen.
Mitch braucht Wärme. Auch wenn es paradox klingt, bei einer Verbrennung kühlt der Körper aus. Außerdem braucht Mitch Sauerstoff, und zumindest die oberflächlichen Brandwunden müssen gekühlt werden, um ein Nachbrennen zu verhindern. Er muss so schnell wie möglich eingehend untersucht werden, um Knochenbrüche, innere Blutungen und weitere Verletzungen auszuschließen.
Ich bin vermutlich keine zwei Minuten hier bei ihm, dennoch kommt es mir deutlich länger vor. Zwei Minuten können eine Ewigkeit sein, wenn man keine Ahnung hat, wie es weitergeht. Wie es endet …
Mir ist schwummrig, als ich mich umschaue und erkenne, dass der Weg nach draußen komplett frei ist. Nash, Lisha und Ian sind versorgt und umgebettet oder bereits im OP, wie es um George steht, weiß ich nicht. Eine Pflegerin und ein Pfleger sind endlich auf dem Weg zu mir, um mir zu helfen. Um Mitch zu helfen. Wären die Umstände andere, würde ich mich mies fühlen, weil ich mir ihre Namen nicht gemerkt habe.
Gott, ich wünschte, die Umstände wären anders …
»Seid vorsichtig, er hat starke Verbrennungen. Gebt in der Verbrennungschirurgie Bescheid, die sollen sich vorbereiten«, beginne ich, »und bringt die Trage so weit rein wie möglich.« Ich erkläre ihnen alles, rattere runter, was wir sonst noch brauchen, alles, was mir einfällt, und sie nicken, hören aufmerksam zu, bevor sie sich an die Arbeit machen und mir unter die Arme greifen.
Bevor wir Mitch endlich hier rausholen.
2. Kapitel
Sierra
Man kann sich nicht vor Schmerz schützen oder vor all jenen Dingen, die einem wehtun könnten, denn dafür müsste man alles kennen, das einen verletzen kann. Das ist nicht möglich. Keine Mauer und kein Schutz können diesem Unwissen standhalten, wenn es über einen hereinbricht.
Das habe ich heute gelernt.
Schmerz ist wie Liebe. Schmerz durchdringt alles.
»Sie bleiben hier, übernehmen Sie zusammen mit den anderen die Koordination in der Notaufnahme. Polizei und Feuerwehr sind gerade eingetroffen, halten Sie also alles am Laufen, bis weitere Instruktionen kommen!«, tönt es von Dr. O’Leary. Dabei hält er Laura und mich auf. Lässt uns nicht zu Nash und Mitch. Er lässt uns, verflucht noch mal, nicht mit.
»Was?«, rufe ich, und es ist mir egal, dass ich nur Assistenzärztin bin und er ein angesehener Arzt der Klinik ist. »Wir wollen helfen«, zische ich. Ich hab es nicht bis hierhin geschafft, Mitch erstbehandelt und aus dem Fahrstuhl gezogen, nur damit ich jetzt nicht bei ihm bleiben darf.
»Dr. Rivera muss schnellstmöglich untersucht und behandelt werden, er muss in den OP. Dr. Brooks ist längst beim CT und muss in neurologische Behandlung. Sie beide«, meint er, und sein Blick wandert von mir zu Laura und wieder zurück, »helfen denen da oben nicht.«
»So ein Blödsinn.« Ich will an ihm vorbei, doch er hält mich fest.
»Dr. Harris.« Sein Tonfall ist energisch, duldet keinen Widerspruch. »Sie sind emotional zu sehr involviert. Dr. Collins ebenso. Dr. Brooks ist Dr. Collins’ Partner, und Dr. Rivera ist Ihr Kollege und ein Freund. Sie beide sind zu nah dran.«
Die Tür, die in den nächsten Gang führt, in Richtung Nebengebäude und Verbrennungschirurgie, schließt sich ohne uns. Mitch ist weg.
»Sagen Sie mir, Dr. Harris, glauben Sie, Sie könnten ihm mehr helfen als die anderen weit erfahreneren Ärztinnen und Ärzte, die ihn untersuchen und operieren werden? Liege ich etwa falsch? Schwören Sie mir, dass Sie Ihre Emotionen unter Kontrolle haben? Dann lasse ich Sie ohne weitere Einwände mitgehen.« Er wartet, behält mich von der Seite genau im Blick, während ich zu den geschlossenen Türen starre und seine Worte in meinem Kopf widerhallen.
Ich kann es nicht. Und das weiß er.
Mit aller Kraft balle ich die Hände zu Fäusten, presse sie an meine Oberschenkel und beiße die Zähne fest zusammen. Mein Kiefer schmerzt, und es ist, als gäbe es ein Echo davon, das ich im ganzen Körper spüren kann.
»Wir schließen die Notaufnahme nicht. Das ist bisher nicht nötig, da sie durch die Doppeltüren und die Schleuse vom Flur und der Unfallstelle getrennt ist. Abgesehen davon ist bereits zu viel los, hier und in den umliegenden Krankenhäusern, weil sich zeitgleich mit der Explosion mehrere Unfälle ereignet haben. Mir ist bewusst, dass das schwer ist. Aber Sie werden hier unten gebraucht.« Er mustert uns und fügt hinzu: »Außerdem sollten Sie sich durchchecken lassen.«
»Okay«, höre ich mich sagen, und das tut mir mehr weh als gedacht. Weil es sich nach Aufgeben anfühlt.
Dr. O’Leary ahnt nicht, dass wir Feierabend haben. Dass wir nach Hause wollten. Und ich erwähne es nicht, denn dann würde er uns garantiert ganz wegschicken, und das wäre schlimmer als alles andere. Deshalb drehe ich mich zu Laura, die für einen Moment sichtlich mit den Tränen kämpft, nehme ihre Hand in meine und drücke sie. Ihr Blick ist entrückt, sie ist blass, und das erste Mal in all diesen Wochen, in denen wir uns nun kennen, wirkt sie, als würde sie etwas nicht aushalten können. Rias Verlust hat sie zwar schwer mitgenommen, doch das hier macht sie auf eine andere Art fertig.
»Wir helfen und bleiben hier«, sage ich, und es ist, als wäre Dr. O’Leary endlich überzeugt, dass wir keinen Unsinn anstellen. Er nickt, macht sich auf den Weg und lässt uns irgendwie verloren zurück.
»Laura? Wir sollten …« Ich räuspere mich. »Wir sollten den anderen in der Notaufnahme helfen. Okay?« Sie reagiert nicht. »Oder möchtest du direkt heim?« Ich bin nach außen hin ruhig, lasse den Sturm in mir nicht hinaus, obwohl ich sie gerne anschreien würde. Sie und die ganze Welt. Doch was würde das ändern?
Falls Laura nach Hause möchte, kann ich es ihr nicht verdenken. Aber egal, wie sie sich entscheidet, ich bleibe. Es wäre nicht der erste Dienst mit Überstunden.
»Oh mein Gott«, haucht Laura schließlich neben mir, und in ihrem Gesicht spiegeln sich ihre Verzweiflung und ihre Hoffnung wider, die miteinander ringen. »Was ist da passiert? Was ist da gerade passiert, Sierra?«
»Ich weiß es nicht.« Um uns herum ist weiterhin die Hölle los, mittlerweile nehmen Polizei und Feuerwehr den Gang ein, inspizieren die Unfallstelle. Es wird alles geprüft, aufgenommen und geschaut, was die Ursache war, ob es ein Unfall oder Vorsatz war. Letztendlich spielt es für mich keine Rolle. Beides führte zu demselben Ergebnis und zu der Situation, in der wir uns nun befinden. Motive ändern nichts an dem Ergebnis, wenn die Handlung dieselbe bleibt. Motive ändern nichts, egal, ob sie gut waren oder schlecht, Unfälle und Versehen ändern nichts, wenn jemand verletzt wurde. Wenn es am Ende wehtut …
Ich räuspere mich leise, kneife die Augen kurz zusammen und schiebe den Gedanken daran beiseite.
»Wir müssen hier weg. Komm.« Sanft führe ich sie zurück in Richtung Notaufnahme, weil wir hier nichts mehr tun können und nur im Weg wären. Wir werden mit Sicherheit später auch noch befragt.
Sobald wir die Notaufnahme betreten, eilt Maisie zu uns. Trotz des Chaos.
»Hey. Ich … ich konnte nicht hin, nicht zu euch und helfen, es war plötzlich zu viel los. Ein großer Unfall, und gleich treffen auch schon weitere Rettungswagen ein. Ich konnte nicht … Ich meine …« Sie rückt ihre Brille zurecht. »Es tut mir leid«, fügt sie kleinlaut an, und ich weiß, sie meint es gut, trotzdem fühlt es sich scheiße an. Vor allem, weil es nicht ihre Schuld ist. Die Situation macht uns allen zu schaffen.
»Was können wir tun?« Ich übergehe ihre Worte, versuche stattdessen, sie nicht an mich heranzulassen und Lauras Anker zu sein. Sie war auch oft genug meiner, selbst wenn ihr das vermutlich kaum bewusst ist. Mir dafür umso mehr. Besonders heute. Besonders jetzt.
Maisie schaut uns überrascht an, ihre Augenbrauen heben sich weit über die Ränder ihrer roséfarbenen Brille mit den goldenen Bügeln. »Ihr solltet euch untersuchen lassen, wegen des Rauchs, und dann heimgehen, weil …«
»Maisie«, unterbreche ich sie harsch, weil Dr. O’Leary das eben bereits angesprochen hat und ich mir so was nicht schon wieder anhören kann oder will. Sie stoppt sofort, wirft einen weiteren Blick auf Laura und nickt schließlich.
»Wascht euch wenigstens kurz, spült die Augen aus und zieht frische Kasacks und Hosen an. An euch klebt zu viel Dreck, Blut und Rauch. Trinkt etwas, dann kommt zurück, wir werden ein Team bilden.«
Ich wende mich Laura zu, die bis jetzt nichts dazu gesagt hat. Ihre Miene ist undurchdringlich. Emotionslos. Lediglich ihre blasse Haut und ihre leicht geröteten Augen verraten mir, dass es ihr nicht gut geht. Sie atmet tief ein und aus, wir schauen uns an und verstehen uns ganz ohne Worte.
Wir schaffen das. Wir bleiben hier. Gemeinsam. Egal, wie lange es dauert. Und wir geben unser Bestes. Genau wie alle anderen.
Genau wie Mitch und Nash.
Eine halbe Ewigkeit später können wir uns kaum noch aufrecht halten, sind vollkommen erschöpft und sitzen zusammen mit Maisie im Aufenthaltsraum. Wir wurden bereits vor Stunden in der Notaufnahme abgelöst und haben uns am Ende auf Lauras Wunsch hin, nach den Aufforderungen durch Dr. O’Leary und Dr. Gardner, doch noch untersuchen lassen. Es ist alles okay, wir haben nur gereizte Atemwege und Schleimhäute, keine Vergiftung. Es ist keine Schwellung erkennbar oder eine Schädigung der Luftröhre, in ein paar Tagen sollen wir einen Kontrolltermin wahrnehmen. Zur Sicherheit, um ein toxisches Lungenödem auszuschließen.
Wir waren professionell und leichtsinnig zugleich. Trotzdem würde ich wieder so handeln, und ich bin sicher, Laura ebenso. Denn alles andere hätte uns weitere wertvolle Zeit gekostet. Womöglich sogar weitere Leben.
George konnten wir nicht retten. Ein Kollege hat es nicht geschafft, und irgendwie ist diese Tatsache noch viel zu abstrakt, um sie wirklich glauben zu können.
Die Polizei war bei uns, wir haben, soweit es die Situation zuließ, die drängendsten Fragen beantwortet, damit man sich ein erstes Bild von der Gesamtsituation machen könne, so hieß es. Wahrscheinlich kommen sie wieder, oder ein paar von uns werden auf die Wache gebeten, je nachdem, was die ersten Ergebnisse sagen. Ob es ein Unfall war oder nicht. Es gibt bereits Theorien und bisher geht man nicht von Vorsatz aus. Nichts spricht dafür.
Müde reibe ich mir über meinen verspannten Nacken und unterdrücke ein Gähnen. Ich sollte anständig duschen, heimgehen, schlafen, etwas essen. Aber nichts davon fühlt sich richtig an. Nichts davon fühlt sich notwendiger an, als hierzubleiben, zu warten und zu beten, dass es den anderen gut geht.
Dabei war Laura eben kurz weg, hat sich vorher unter die Dusche gezwungen und umgezogen, ist mit dem Taxi zu Nash heimgefahren, um seinen Kater zu füttern, und sofort wieder zurück, weil sie hier sein will, sobald er aufwacht.
Wenn er aufwacht …
Nash ist auf der Intensiv, nicht bei Bewusstsein. Laura darf noch nicht zu ihm, es folgen zu viele Untersuchungen. Sie haben in den letzten Stunden alles aufgefahren: CT, MRT mit MR-Angiographie und EEG sowie transkranielle Doppler-Sonografie. Zumindest ist das der letzte Stand. »Sie geben ihr Bestes«, meinte Bella vorhin, als sie uns die Nachricht überbracht hat, »aber sie wissen noch nicht, wie viel beschädigt wurde. Wann er wieder aufwacht.«
Geschlossenes Schädel-Hirn-Trauma. Diese Diagnose schwebt über Laura wie ein Damoklesschwert. Über uns allen. Wenn Nash ein Trauma dritten Grades haben sollte, wenn die Langzeitschäden zu groß sind und er nicht mehr als Arzt arbeiten kann, dann wird das beide zerbrechen. Aber ich glaube, am Ende macht es dennoch keinen Unterschied für sie. Laura will nur, dass er lebt. Und das will ich auch.
Von Mitch gibt es keine Neuigkeiten, und das macht mich echt fertig. Das heißt vermutlich, dass etwas schiefgeht oder bereits schiefgegangen ist, vielleicht auch, dass es gut läuft und sie noch etwas Zeit benötigen. Ich weiß es einfach nicht. Keine Neuigkeiten bedeutet, dass sie entweder keinen Grund haben, Bescheid zu geben, oder keine Zeit, weil gerade alles den Bach runtergeht …
Dieses Warten, diese Ungewissheit, all diese Möglichkeiten lassen einen nicht zur Ruhe kommen, und ich hasse das. Ich hasse es, auf dieser Seite zu sein und nichts tun zu können.
Keine Neuigkeiten – wenn man sich sorgt, können einen diese beiden Worte um den Verstand bringen.
Als Bella da war, um uns auf den neuesten Stand zu bringen, war Mitch noch im OP. Deshalb warte ich weiter und gehe nicht eher, bevor ich weiß, wie es um ihn steht.
Maisie ist in Gedanken versunken und spielt mit einem losen Faden ihrer dünnen Strickjacke herum, die sie vor ein paar Minuten aus dem Spind geholt und sich übergezogen hat. Es ist kalt. Hätte nie gedacht, dass mir in Phoenix mal kalt sein würde, aber so ist es. Es ist keine äußere Kälte, sondern eine, die im Inneren wächst. Jene, die von Angst, Schlafentzug und Erschöpfung herrührt und nicht so leicht zu vertreiben ist, wie man denkt.
Wir sind alle müde und beunruhigt, es ist also kein Wunder, dass es uns so geht. Wir haben alle unsere Grenzen überschritten. Wenn nicht körperlich, dann emotional, und ich kann mich nicht erinnern, mich je so gefühlt zu haben. So machtlos, so leer. Es ist, als hätte man uns gebogen, weiter und weiter, und so zurückgelassen. Kurz vorm Brechen. Manche sagen, gebogen ist besser als gebrochen, aber das ist Schwachsinn. Ein sauberer Bruch tut ein Mal weh und heilt gut ab. Es ist ein schneller Schmerz. Wird man jedoch gebogen, ist es ein langsamer Schmerz, der lange anhält. Es ist, als könne man nicht vor und nicht zurück, weil nichts richtig kaputt ist, aber auch nicht richtig heil.
»Ich werde heimgehen«, murmelt Zeenah, die ich das erste Mal so tief erschöpft sehe. Ohne ein Funkeln in den Augen, ohne Lächeln oder herausfordernden Blick. Da sind nur Leere und Unglauben.
Sie war es, die George erstversorgt und danach mit behandelt hat. Sie war es, die seinen Tod feststellen musste. George ist quasi in ihren Armen gestorben, und es gibt nichts, was wir sagen oder tun könnten, um ihr das abzunehmen. Ich wünschte, es wäre anders …
»Kann ich … ich meine …« Zeenahs Blick schwankt zu Laura, die inzwischen mit dem Kopf auf dem Tisch eingeschlafen ist und es nicht einmal geschafft hat, sich ihren Arm richtig unters Gesicht zu schieben, damit es bequemer wird. Ihr blondes Haar verdeckt ihre Stirn und Wange, schlängelt sich bis auf den Tisch, weil es sich aus dem Zopf gelöst hat.
»Nein. Geh und ruh dich aus«, erwidere ich und versuche, sie anzulächeln, aber es will mir nicht gelingen. Sie sollte sich das hier nicht antun, es reicht, dass wir hier sind. Sie kann nichts machen, selbst wenn sie wollte. »Wir schreiben, sobald wir etwas wissen.«
Zeenah nickt mit zusammengepressten Lippen, bedankt sich und geht an Maisie vorbei, die sie einmal schnell tröstend in die Arme schließt.
»Und du schreibst uns, wenn du etwas brauchst, ja?«, sagt Maisie eindringlich und lässt Zeenah nicht eher los, bevor sie genickt hat. Ich kriege keinen Ton mehr heraus, aber ich hoffe, sie weiß, dass wir da sind, wenn sie uns braucht. Sie sollte sich um sich kümmern und tun, was sie tun muss, um das alles zu verarbeiten.
Maisie setzt sich wieder, und nachdem sich die Tür hinter Zeenah schließt, kommt es mir noch kälter vor.
Im Gegensatz zu Maisie und Laura habe ich noch nicht richtig geduscht oder mich umgezogen, nachdem wir die Notaufnahme verlassen haben. Ich sitze immer noch in meinem Kasack und der Arbeitshose da, voller Dreck und Blut. Ich könnte das jetzt nachholen, schnell duschen und bequeme Sachen anziehen, weil ich ohnehin nichts Besseres zu tun habe, aber ich schaffe es nicht, mich aufzuraffen.
Leise seufzend betrachte ich Laura ein weiteres Mal, danach stehe ich auf, hole meinen sauberen Kittel aus dem Spind und beuge mich zu Laura hinüber, um ihn über sie zu legen, bis auf ihre Schultern und ihre Arme, damit er sie wenigstens ein wenig wärmen kann. Sie hat sich bei Nash bequeme Hosen und ein Shirt übergezogen, das nicht viel gegen die Kälte des Schlafverlusts und der Ängste ausrichten kann.
Selbst im Schlaf macht sie sich Sorgen. Ihr Gesicht wirkt angespannt – die Lippen, die Augen, die Brauen. Und sie ist blass wie ein Gespenst.
Ich lasse mich zurück auf meinen Platz fallen, nur um im nächsten Augenblick, als plötzlich die Tür aufschwingt, so heftig aufzuspringen, dass mein Stuhl wackelt und Maisie zusammenzuckt.
Doch es ist nur Jane, die reinkommt und uns verwundert mustert. Maisie lässt den Kopf sinken, stützt ihn mit der Hand ab, und ich setze mich enttäuscht, aber mit wild klopfendem Herzen wieder hin.
Einatmen, ausatmen, befehle ich mir stumm.
Es geht ihm gut. Es muss ihm gut gehen …
Laura hat zum Glück nichts mitbekommen, sie hat sich nicht einmal gerührt, und das macht deutlich, dass sie die Pause bitter nötig hat – und ich bin froh, dass sie unter diesen Umständen überhaupt schlafen kann. Das zeigt eigentlich nur, wie sehr sie am Limit war, deshalb werde ich sie erst wecken, wenn es nötig ist und wir etwas Neues erfahren.
»Hey«, grüßt uns Jane mit einer gewissen Skepsis im Blick, während sie zu ihrem Spind geht. Ihre klare, weiche Stimme ist das Einzige, das diesen Raum gerade mit etwas Leben füllt. »Ist bei euch alles in Ordnung? Ich meine, ihr seht …«
»… furchtbar aus«, beendet Maisie Janes Satz, und ich reibe mir ein paarmal übers Gesicht.
»Was du nicht sagst«, murmle ich und drehe mich zu ihr um, weil sie weiterredet.
»Es fühlt sich heute anders an. Also im Whitestone. Unten ist viel los, und alle sind so nachdenklich oder gestresst. Weit mehr als sonst. Riecht es hier nach Rauch?«, fragt sie verwundert und streicht sich ihre Haare hinters Ohr. Ihr Bob ist so kurz, dass sie kaum einen Zopf hinbekommt, und der Pony endet bereits ein gutes Stück über den Augenbrauen. Eine freche Frisur, glänzendes hellbraunes Haar und manchmal sogar knallbunte Klamotten. Etwas, das ich bis heute nicht mit der stillen, in sich gekehrten Frau vor mir vereinbaren kann, die in den ersten Wochen kaum drei Sätze mit uns gewechselt hat. Das ist kein Ding. Es hat mich nur verwundert. Doch langsam taut Jane auf. Besonders bei Maisie.
»Hast du es noch nicht gehört?«, meint Maisie geschockt und redet dabei so leise wie möglich, um Laura nicht zu wecken. »Es gab eine Rundmail, und im Fach liegt auch etwas.«
Jane stellt sich direkt zu uns an den Tisch, und plötzlich zeichnen sich so etwas wie Schuldgefühle und eine gewisse Traurigkeit in ihrem Gesicht ab. Nicht lange. Eigentlich ist es so schnell vorbei, dass ich glaube, es mir eingebildet zu haben. Sie war nicht hier, aber sieht so erschöpft aus wie wir.
»Nein, ich war … beschäftigt«, erwidert sie, bevor sie die Arme vor der Brust verschränkt und die Augenbrauen zusammenzieht. »Also, was meinst du? Was ist passiert?«
»Nash liegt auf der Intensiv, Mitch ist wohl noch im OP oder vielleicht auch schon auf Station, wir wissen es nicht. Ein Patient ist tot, Ian hat auch was abbekommen, schläft aber und wird wieder, von Lisha haben wir nichts gehört. Und George …« Ich schlucke gegen den Kloß in meinem Hals an, bevor ich weiterrede. »George hat es nicht geschafft. Er ist auf dem Weg in den OP gestorben.« Ich versuche, nicht daran zu denken, weil es jedes Mal realer wird, und weiß im selben Moment, dass das nicht richtig ist. Denn nicht daran zu denken bedeutet, dass es seinen Wert verliert. Dass es unwichtig war. Und das war George nicht. Kein Leben ist unwichtig. Aber in diesen letzten Stunden musste ich es verdrängen und muss es auch weiterhin, weil ich sonst zusammenfalle wie ein Kartenhaus im Wind.
Janes Augen weiten sich, ihr Mund steht offen. Kein Wunder, ich habe mit den schlimmsten Sachen angefangen.
»Es gab eine Explosion«, erklärt Maisie, weil ich nicht weitermachen kann. Stattdessen knete ich meine Hände, presse sie auf meine Schenkel und schaue zurück auf den Tisch. »Ich war in der Notaufnahme, ein Patient musste in den OP. Mitch, George und Nash wollten mit ihm hoch, Lisha kam wohl dazu, Laura und Sierra hatten Feierabend. Ich hab es nicht gesehen, aber gehört.« Sie macht eine Pause und atmet durch. »Es war im Fahrstuhl. Ian war auch da und … Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber es war schlimm, Jane. Wirklich schlimm.«
»Was?«, haucht sie, und jetzt hebe ich erneut den Blick, sehe sie an und nicke. Sie kann es nicht glauben. Kann ich ihr nicht verdenken, ich glaub es ja selbst nicht. Dabei war ich dort.
»Oh mein Gott.« Ihre Stimme klingt belegt, in ihren Augen sammeln sich Tränen, und als die erste über ihre Wange rollt, schüttelt sie kurz den Kopf und wischt sie hastig weg.
Jane ist anscheinend noch sensibler als Laura, es war gut, dass sie nicht hier war, gut, dass wenigstens eine von uns das nicht sehen und erleben musste.
»Kann ich was tun? Braucht ihr etwas?«, fragt sie, und wir verneinen. Das, was wir brauchen, was wir uns wünschen, kann Jane uns nicht geben.
Sie nickt, fängt sich schnell, und ich bin dankbar, dass sie nicht so einen Schwachsinn sagt wie: Geht nach Hause, ruht euch aus, ihr seid schon zu lange hier, zu lange wach.
»Nash«, nuschelt Laura im Schlaf und rührt sich, dreht den Kopf und legt die andere Wange auf die Tischplatte.
Scheiße, ich wünschte, das alles wäre nur ein Albtraum. Aber das ist es nicht.
Es ist real.
Es tut weh.
Und es ist noch nicht überstanden.
3. Kapitel
Sierra
»Okay, ich gebe das weiter. Danke, Jada.« Sofie legt den Hörer auf und richtet das Wort an mich, als sie mich sieht. »Sierra, gut, dass ich dich hier treffe. Ist Laura auch noch hinten?« Ich trete mit dem Kaffee, den ich eben für uns geholt habe, an den Tresen und spüre meinen rasenden Herzschlag. Nach allem, was bisher war, frage ich mich, wie mein Herz das manchmal schafft. Das Nicht-müde-Werden. Besonders nach dem, was die letzten Stunden geschehen ist.
»Ist etwas passiert? Gibt es Neuigkeiten?«, frage ich schwach und erwartungsvoll zugleich.
»Nash«, sagt sie und lächelt. »Er ist aufgewacht. Vorhin hat man bereits durchgegeben, dass die Ergebnisse besser sind als gedacht, und die Neuro ist guter Dinge. Er ist jetzt auf Station, nicht mehr auf der Intensiv. Sagst du Laura Bescheid? Ihr findet ihn in Zimmer 709.«
Zitternd atme ich ein und wieder aus, lehne mich gegen den Tresen. Ich bin erleichtert. Wenigstens einer von beiden ist über den Berg. »Ich sag es ihr sofort.«
Sofie nickt. »Danke dir. Ian ist auch wach und soll zur Beobachtung auf der Inneren bleiben, ihn hat es aber zum Glück nicht allzu schlimm erwischt. Lisha«, erzählt sie weiter und verzieht kurz das Gesicht, »hat ein paar Quetschungen und ein leichtes Schädel-Hirn-Trauma, aber sie wird wieder.«
»Okay. Das klingt nicht so übel wie zunächst befürchtet.« Ich freue mich wirklich, auch wenn ich es nicht zeigen kann. Es reicht, dass wir den Patienten verloren haben. Und George. Er wird fehlen.
»Hast du was von Mitch gehört?« Ihre Frage schnürt mir die Kehle so unerwartet zu, dass ich glaube, auf der Stelle zu ersticken. Deshalb schaffe ich es nur, den Kopf zu schütteln.
»Das gibt es doch nicht. Ich ruf mal drüben an.« Bevor ich was dazu sagen kann, hebt sie den Hörer ab und wählt eine Kurztaste. »Hallo? Hier ist Sofie Vega, Herzchirurgie. Ich wollte mich nach einem Patienten erkundigen, Dr. Mitch Rivera. Genau. Das ist richtig. Okay, danke.« Während Sofie spricht, ringe ich mit mir, weiß nicht, ob ich zuhören soll oder nicht. Ob ich das, was ich vielleicht hören werde, ertragen kann.
»Er ist aus dem OP raus?« Bei Sofies Worten lasse ich fast die Kaffeetassen fallen, die ich in Händen halte. »Wieso habt ihr nicht Bescheid gegeben? Ich hatte extra darum gebeten, Ethan«, zischt sie wütend ins Telefon, während sich unsere Blicke treffen. Ich muss den Kaffee abstellen, weil meine Hände zu zittern beginnen. Die OP ist vorbei. Das ist gut, oder?
Sofie sagt noch etwas, aber es dringt nicht bis zu mir durch. Dafür ist der Sturm in meinem Kopf zu laut. Was verrückt ist, weil ich das Gefühl habe, komplett leer zu sein. Ausgelaugt.
Er ist raus aus dem OP, zieht es in Dauerschleife durch meine Gedanken. Er hat es geschafft.
»Du mich auch«, murmelt Sofie, als sie auflegt. Ich bin sicher, der Typ am anderen Ende hat es noch gehört. Danach atmet sie tief durch und notiert etwas auf einem Zettel, den sie anschließend auf den Tresen legt, direkt vor mich. »Mitch hat alles gut überstanden und ist stabil. Er liegt auf der Intensivstation. Ich bin froh, dass wir im Whitestone ein paar der besten Verbrennungschirurgen und -chirurginnen haben, sonst hätten wir Mitch woanders hinbringen müssen«, sagt sie, und ich nicke. Wenn man Mitch in ein anderes Klinikum hätte verlegen müssen, wäre ich vermutlich ganz durchgedreht.
»Das hier ist seine Zimmernummer. Ich habe die von Nash noch mit draufgeschrieben, damit ihr sie nicht vergesst«, fügt Sofie an und schiebt mir den Zettel zu.
Wie in Trance starre ich auf die Zahlen vor mir, die Sofie in Schönschrift auf das kleine gelbliche Papier geschrieben hat. Ich sollte mich freuen – aber ich kann es irgendwie nicht. Ich kann es nicht, weil …
»Wie schlimm waren seine Verbrennungen?«, wispere ich, ohne den Blick zu heben.
»Sierra«, beginnt sie mit dieser Stimme, die sagen möchte: Ichbinsicher,esistallesgut.Undwennesdasnichtist,wirdesdasnochwerden. Doch sie stoppt, hält inne und sagt stattdessen ehrlich: »Ich weiß es nicht. Das hat man mir nicht mitgeteilt. Nur, dass die OP gut verlaufen sei, Mitch sich jetzt ausruhen müsse. Auch wenn ich es ungern zugebe, sein behandelnder Arzt ist einer der besten auf seinem Gebiet.« Die Art, wie sie das betont, klingt nach einer Geschichte. An einem anderen Tag hätte ich sie danach gefragt oder sie damit aufgezogen. Aber nicht heute.
Nein, nicht heute.
»Danke«, bringe ich hervor und stecke den Zettel in meine Tasche, bevor ich nach den Bechern, gefüllt mit Ediths lauwarmem Gebräu, greife und es endlich schaffe, Sofie erneut in die Augen zu sehen.
»Geh und sag es Laura«, meint sie lächelnd. »Ich schaue nach Feierabend auch mal nach allen. Und, Sierra? Gönn dir endlich eine Pause.«
Ich nicke und mache mich auf den Weg. Meine Füße bewegen sich wie von selbst, meine Beine tragen mich in Richtung Laura, die noch immer mit dem Kopf auf dem Tisch schläft, als ich bei ihr ankomme. Maisie ist längst nach Hause gegangen. So, wie wir es auch hätten tun sollen. Stattdessen sind wir zwei sture Esel hiergeblieben, als würde das irgendwem helfen. Doch nur ein Blick auf Laura, und mir wird klar, dass das nicht stimmt. Es hilft ihr. Weil sie nicht allein sein kann und es so nicht muss. Vielleicht tut mir das auch auf seltsame Weise gut. Das Hier-Sein und Nicht-nach-Hause-Müssen.
Ich sollte mich besser nur auf die Arbeit konzentrieren, auf diesen Job, auf mein Ziel.
Verdammter Dreck. Ich wollte keine Freunde finden, wollte mich nur um mein Zeug kümmern. Und jetzt? Wenige Monate nach meinem ersten Tag am Whitestone habe ich nicht nur eine gute Freundin, sondern auch noch ein nettes Kollegium, und das hat mich manchmal mein eigentliches Ziel aus den Augen verlieren lassen. Hat mich vergessen lassen, dass ich die Beste sein will. Dass ich die Beste sein muss. Denn dann bin ich etwas. Dr. Sierra Harris, beste Assistenzärztin im Bereich Herzchirurgie. Ich will nicht eine von vielen sein, irgendwo in der Mitte bei denen, deren Name am Ende niemand kennt. Ich musste hart für das Studium kämpfen und für diesen Job, und ich werde nicht damit aufhören.
Während ich Laura mustere, stelle ich den Kaffee ab, streiche ihr eine Strähne aus dem Gesicht und seufze. Ich werde nicht aufhören – aber vielleicht mache ich heute eine kleine Ausnahme. Und an allen jenen Tagen, an denen andere Sachen wichtiger geworden sind.
»Laura«, wispere ich und rüttle sanft an ihrer Schulter, weil ich sie nicht erschrecken will. Sie gibt niedliche Geräusche von sich, bevor sie leise grunzt und mich damit unerwartet zum Lachen bringt.
»Die Socke schmeckt nicht!«, ruft sie, während ihr Kopf nach oben schnellt.
»Was?«, frage ich irritiert.
»Was?«, fragt sie nuschelnd zurück und gähnt. Ihre weiße Haut, die mittlerweile ein bisschen Farbe durch die Sonne Arizonas bekommen hat, sieht fahl aus, sie hat dunkle Augenringe und trockene Lippen. Laura ist total hinüber, man sieht ihr jedes Gefühl, jeden Gedanken und vor allem die letzten vierundzwanzig Stunden förmlich an.
»Vergiss es. Ich versuche, dasselbe zu tun«, entgegne ich und ziehe die Nase kraus. Danach will ich ihr endlich die gute Nachricht überbringen, doch sie redet bereits weiter.
»Hab ich lange geschlafen?« Sie reibt sich über das Gesicht, bevor sie mich fixiert. »Warum weckst du mich? Ich meine …« Ihre Augen werden größer und größer, dann springt sie ruckartig auf, sodass der Kittel, den ich ihr übergelegt hatte, regelrecht von ihren Schultern auf den Boden fliegt. »Ist er … Ich meine, geht es ihm gut?«
Ich würde gerne einen Witz machen, sie aufziehen, weil sie sich so benimmt. Weil sie nicht direkt fragt: Lebt er? Aber ich tue es nicht. Vielleicht, weil ich nicht genau weiß, wie es sich anfühlt, jemanden so sehr zu lieben. Deswegen, und weil Laura ein Mensch ist, den ich zu schätzen gelernt habe. Den ich mag.
Ich lächle. »Er ist auf Station und wach.«
Tränen fluten Lauras Augen, sie keucht auf und muss sich am Tisch abstützen. Ich hatte erwartet, dass sie sofort losrennen würde, dass sie wie ein Tornado aus dem Raum und zum Aufzug stürmen würde, um zu Nash zu gelangen. Doch sie steht einfach da und weint. Sie weint sich die Seele aus dem Leib. Es ist, als würde ein ganzer Ozean aus ihr herausbrechen.
Während ihr Körper von Schluchzern geschüttelt wird, beobachte ich sie und weiß nicht, ob ich etwas tun soll oder sagen kann. Denn Laura macht das gerade mit sich selbst aus. Sie bebt und bricht und heilt. Sie lässt alles raus, damit sie das nicht vor Nash tun muss, da bin ich sicher. Und vielleicht auch, weil sie keine andere Wahl hat, als es jetzt zuzulassen. Das ist beeindruckend – und ich beneide sie um diese Stärke.
Keine Ahnung, ob ich je ein besonders emotionaler Mensch gewesen bin, heute bin ich es jedenfalls nicht mehr. Ich weine nicht schnell oder oft, nicht laut, und ich lasse mich von nichts allzu lange oder nachhaltig beirren. Weder im privaten Bereich noch auf der Arbeit. Ich brauche einen klaren Kopf, um meine Ziele zu erreichen und durch den Tag zu kommen. Emotionen machen es kompliziert, und das kann ich nicht gebrauchen. Sie tun viel zu oft weh, das hat mich meine Mom gelehrt. Das und dass ich es nicht verdient habe, geliebt zu werden. Nicht wirklich. Es ist also nicht nur so, dass ich diese Gefühlsduseleien nicht will, sondern auch, dass ich nicht besonders gut darin bin, all diese Dinge an mich heranzulassen. Zumindest dachte ich das bisher, und deshalb erschrecke ich mich, als ich mich urplötzlich schniefen höre, während ich vor Laura stehe.
»Verfluchte Scheiße«, fluche ich so leise, dass sie es nicht bemerkt, räuspere mich und gebe alles, damit ich keine einzige Träne vergieße.
So was passiert, wenn man Menschen an sich heranlässt.
Ich kann das nicht gebrauchen. Ich kann das einfach nicht gebrauchen …
Ohne Vorwarnung überbrückt Laura den Abstand zwischen uns, unterbricht meine Gedanken und umarmt mich stürmisch. Gott, hat die Frau Kraft.
»Du erwürgst mich«, zische ich.
»Danke, Sierra«, sagt sie so ehrlich, so aufrichtig, dass es mir eine Gänsehaut über den Körper jagt.
»Ich hab nichts getan.« Laura löst sich von mir und lächelt mich an. Mit verschmiertem Mascara, vom Weinen roten Wangen und geröteten Augen, mit verknoteten Haaren und dem fettesten Lächeln auf den Lippen. »Doch. Du warst hier. Bei mir. Du bist nicht gegangen. Selbst wenn ich natürlich weiß, dass es wohl auch an Mitch liegt.«
»Halt die Klappe, und geh zu Nash!«, meckere ich, damit sie dieses Thema erst gar nicht vertieft, und sage ihr, in welchem Zimmer er liegt. Danach schiebe ich sie energisch in Richtung Tür, was sie laut zum Lachen bringt. Doch nach wenigen Schritten verstummt sie und hält wieder an.
»Mitch?«, wiederholt sie nur fragend seinen Namen und mustert mich. Dieses Mal will sie nur wissen, ob es ihm gut geht.
»Er ist aus dem OP raus. Aber sie konnten mir nicht sagen, wie schwer die Verbrennungen sind«, kläre ich sie auf. »Ian ist auch wach und mit Sicherheit schnell wieder auf den Beinen, bei Lisha folgen weitere Untersuchungen, aber nach aktuellem Stand ist ihr Zustand nicht kritisch.«
Laura atmet erleichtert ein und aus. »Gut. Das ist gut.«
»Jetzt geh, ich ertrage diese Gefühlsduselei nicht länger, das ist ja gruselig.«
»Komm mit.« Sie nimmt meine Hand und zieht mich hinter sich her.
»Was? Er ist doch wach, er hat es geschafft. Wieso …« Ich rede nicht weiter, weil ich Lauras Antwort kenne, bevor sie sie ausspricht. Sie lächelt wieder, aber dieses Mal nicht so strahlend wie eben, umklammert meine Hand und geht dicht neben mir, und als wir eine Minute später vor dem Fahrstuhl anhalten und sie den Knopf drückt, verrät sie mir, was ich schon geahnt habe.
»Ich kann das nicht allein«, murmelt sie. »Bitte bleib noch, bis wir da sind.«
Sie hat Angst. Ich bin nicht sicher, wovor, aber sie hat eindeutig Angst.
»Okay. Ich bringe dich hin.« Ich drücke ihre Hand.
Was für ein Desaster. Was für eine Nacht. Was für ein beschissener Start in ein Wochenende.
Erneut wandern meine Gedanken zu Mitch. Sollte ich zu ihm? Sollte ich es lassen? Kann ich zu ihm? Und mit diesem Kann meine ich nicht, ob man mich lässt, sondern einzig und allein, ob ich das aushalte. Immer wieder sehe ich ihn vor mir, wie er bewusstlos daliegt, und jedes Mal aufs Neue rieche ich die verbrannte Haut, den Dreck, atme stickige Luft ein. Immer wieder denke ich: Wäre ich nur schneller gewesen. Besser.
Aber es ist nicht nur das. Wenn ich Mitch sehe oder auch Nash, ist alles real, und es gibt keine Möglichkeit mehr, mir einzureden, es wäre anders.
Und das will ich nicht. Ich möchte noch eine Weile daran glauben, dass das alles ein Traum ist. Dass es nicht echt ist.
Beim Ping des Fahrstuhls, der für uns seine Türen öffnet, zucke ich zusammen. Wir treten schweigend ein, und mir entgeht Lauras Zögern nicht, bevor sie auf den runden Knopf mit der Nummer sieben drückt.
»Etage sieben, Neurologie und Neurochirurgie«, tönt es, bevor ein weiteres Ping erklingt und wir aussteigen können. Ich war erst zweimal hier in der Neuro. Ohne Frage ein spannendes Gebiet, aber das Gehirn und Nervensystem sind für mich nicht so faszinierend wie das menschliche Herz.
Bei einer durchschnittlichen Lebensdauer schlägt das Herz bei jedem Menschen etwa drei Milliarden Mal. Dabei schlägt das einer Frau schneller als das eines Mannes. Das Herz schafft es, sich pro Minute circa siebzigmal zusammenzuziehen, um so genug Blut durch den Körper zu pumpen. Und zwar ungefähr sechs bis acht Liter. Es ist so vielseitig, so spannend und so einzigartig. Man sagt sogar, Musik verbessere seine Funktion bei einer koronaren Herzkrankheit, sofern sie den Betroffenen gefällt. Herzen brechen nicht wirklich, aber wenn emotionaler Stress und psychische Belastungen zu groß werden, kann sich das negativ auf sie auswirken. Schmerz und Trauer können dafür sorgen, dass das Herz nicht mehr richtig pumpt. Als hätte es selbst Gefühle. Eine Seele. Als wäre es alles, was uns ausmacht. Das Herz. Nicht der Verstand.
Herzen können vielleicht nicht brechen, aber sie können wehtun. Und Schmerz, den man nicht sieht, tut oft mehr weh als der offensichtliche.
Verrückte Gedanken, irgendwie naiv, aber ich mag sie dennoch. Doch das behalte ich für mich.
Ich bin keine Träumerin und rede die Dinge nicht gern schön, und ich will nicht, dass die anderen etwas in mir sehen, das es nicht gibt. Ich kann kaum für mich da sein, wie sollte ich das für andere können? Es genügt, dass Laura zu einer guten Freundin geworden ist. Nicht, dass ich sie wieder hergeben würde, aber die Angst, ihr nicht gerecht werden zu können, bleibt. Ich will einfach nur meinen Job machen. Und das verdammt gut. Ich will beweisen, dass ich es kann. Ohne Hilfe, ohne andere. Dass ich allein gut genug bin.
»Welches Zimmer war es noch mal?«, fragt Laura, während wir in einem der Gänge stehen und sie sich umsieht.
»709«, sage ich und rucke mit dem Kopf nach links. »Wir müssen hier entlang, komm.« Ich ziehe sie weiter, sie folgt mir, und dabei lässt sie meine Hand keine Sekunde lang los. Ihre ist schwitzig und kalt, und meine Finger tun langsam weh, weil ihre wie ein Schraubstock sind. Trotzdem beschwere ich mich nicht. Aber ich werde mit jedem Schritt unruhiger. Dieser beschissene Gang nimmt gar kein Ende. 703, 704, 705 … Wir müssen noch mal abbiegen. Nash liegt wohl in einem der Privatzimmer am Ende des Flurs.
Laura will noch weitergehen, nur halte ich dagegen, sodass sie mit einem Ruck zum Stehen kommt.
»Stopp! Hier ist es.« Ich spähe durch die geöffneten Lamellen der halb geschlossenen Jalousien an dem Fenster in Nashs Zimmer. Großes Einzelzimmer, wie gedacht. Was anderes hätte mich stark gewundert bei einem Stationsarzt des Whitestone. Die Nummer an der Tür und der Name auf der Akte bestätigen, dass er hier liegt.