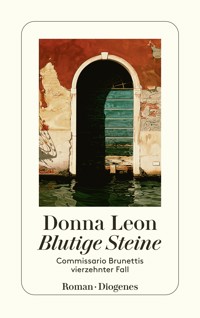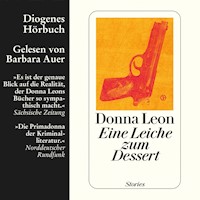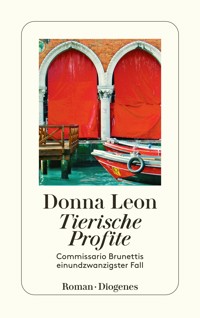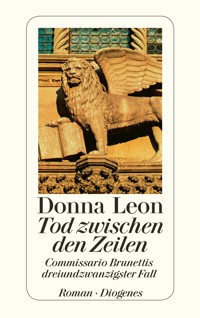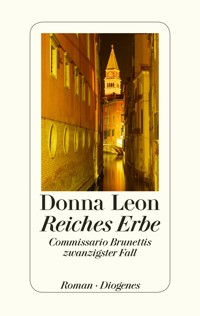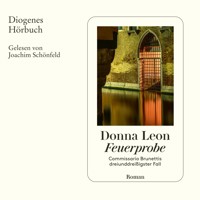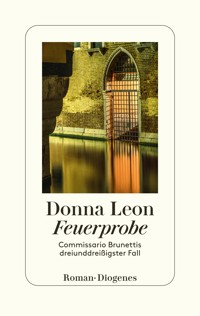11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Commissario Brunetti
- Sprache: Deutsch
Brunetti will gerade zu Bett, als Vianello ihn hinausruft in die kalte Novembernacht: In einem Kanal ragt eine Hand aus dem Wasser. Die Leiche ist schnell geborgen. Um wen es sich handelt, erfährt der Commissario per Zufall. Doch welche Feinde könnte der Tote gehabt haben? Da er sich ohne Papiere in Italien aufhielt, steht die Polizei ohne Spuren da. Erst als Brunetti tief in die eigene Vergangenheit eintaucht und sich das Italien seiner Studentenzeit vergegenwärtigt, nähert er sich der Lösung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 334
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Donna Leon
Wie die Saat, so die Ernte
Commissario Brunettis zweiunddreißigster Fall
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Werner Schmitz
Diogenes
Für Cecily und Johannes Trapp
O blinde Raserei der Wut,
durch Weisheit nicht beschränkt!
Ein jedes Band reißt sie entzwei,
kein Zaum, der die Unbändge lenkt:
auf Schuld häuft Schuld sie sinnlos auf,
und stürmt zum Untergang in ihrem Lauf.
GEORG FRIEDRICH HÄNDEL, SAUL
1
An einem Samstag Anfang November hatte Guido Brunetti keine Lust rauszugehen und beschloss, stattdessen seine Bücher auf den Regalbrettern in Paolas Arbeitszimmer auszusortieren. Sein früheres Arbeitszimmer hatte er vor Jahren ausgeräumt, einige Monate vor der Geburt ihrer Tochter, damit auch ihr zweites Kind ein eigenes Zimmer hätte. Paola gewährte Brunettis Büchern in vier Regalfächern Asyl. Schon damals hatte er befürchtet, der Platz werde nicht reichen, und jetzt war es so weit: Zeit für das große Ausmisten. Aber was konnte er entbehren? Auf dem oberen Brett standen die Bücher zum Wiederlesen; das zweite, auf Augenhöhe, enthielt welche, die er noch nicht gelesen hatte; das dritte jene, die er nicht beendet hatte, auch wenn er sie noch fertiglesen wollte; und zuunterst waren Bücher, von denen er manchmal schon beim Kauf gewusst hatte, dass er sie nie lesen würde.
Am besten fing er unten an. Er ließ sich auf ein Knie nieder und studierte die Buchrücken. In der Mitte des Bretts sah er das vertraute Porträt von Proust, das vertraute Porträt von Proust, das vertraute Porträt von Proust. Er schob die eine Hand vor den ersten, die andere hinter den letzten Band, sagte laut: »Jetzt«, und hob sie alle auf einmal heraus. Dann trug er den Stapel zu Paolas Schreibtisch, deponierte den wackligen Turm und begradigte ihn. Er machte einen Schritt zurück und zählte die Proustköpfe auf den Buchrücken: sieben.
Er stapelte die Prousts sorgfältig in eine Tüte aus der Küche, die von der Stadt zum Sammeln von Altpapier ausgegeben wurde. Dann nahm er die Tüte mit zum Regal, ging wieder in die Knie und sortierte erbarmungslos die übrigen Bücher aus, ohne ihnen auch nur durch einen Zwischenhalt auf Paolas Schreibtisch die Chance zu geben, um Gnade zu flehen. Moby Dick; Der Mann von Gefühl; Die Brautleute, verhasste Pflichtlektüre am Gymnasium. Überlebt hatte Manzoni nur deshalb so lange, weil Brunetti nicht glauben mochte, dass ein »Klassiker« dermaßen langweilig sein konnte. Ab damit in die Tüte. Er stieß auf vier Bände Theaterstücke und Gedichte von D’Annunzio und wusste sofort, dass die weggehörten: Weil D’Annunzio ein schlechter Autor war – oder ein schlechter Mensch? Er schlug einen Band aufs Geratewohl auf und las die erstbeste Gedichtzeile: »Voglio un amore doloroso, lento …«
Brunetti ließ das Buch sinken. »Eine lange währende, schmerzhafte Liebe willst du?«, fragte er den verblichenen Dichter. »Wie wär’s mit kurz und schmerzlos?« Und schon gesellten sich die sechzehn Zentimeter D’Annunzio zum Manzoni. Er blickte in die Tüte und dachte zufrieden: ›Wenn jemals eine Ehe im Himmel geschlossen wurde.‹ Das Antiquariat am Campo Santa Maria Nova würde sich freuen.
Der Commissario musterte die Lücken im Regal und überlegte schon, womit er sie füllen würde, da klingelte das Handy, und noch bevor er sich melden konnte, sagte Vianello: »Guido, komm schnell zum Piazzale Roma.«
»Es ist Samstag, Lorenzo«, erinnerte er seinen Freund und Kollegen. »Es regnet, und es ist kalt.«
»Und es ist wichtig«, konterte Vianello.
»Erzähl.«
Vianello stöhnte einmal laut, ehe er sagte: »Fazio hat mich angerufen.« Brunetti brauchte einen Moment, um sich an den Namen zu erinnern: ein Sergente aus Treviso, mit dem er und Vianello schon mal zu tun hatten. »Alvise wurde verhaftet.«
»Alvise?« Als traute Brunetti seinen Ohren nicht, wiederholte er ungläubig: »Alvise?«
»Ja.«
»Wo?«
»Drüben. In Treviso.«
Was um Himmels willen hatte Alvise in Treviso verloren, fragte sich Brunetti. Ja, was hatte überhaupt irgendwer dort verloren, erst recht an einem Tag wie diesem?
»Was hat er dort gemacht?«
»Er war bei der Demonstration.«
Brunetti stutzte. Wer bloß hatte denn für dieses Wochenende eine Demonstration angekündigt? Nicht die Lokführer, nicht die verbliebenen Impfgegner, nicht die Arbeiter in Marghera – die doch praktisch pausenlos demonstrierten –, und auch nicht die medizinischen Fachkräfte, die erst vor zwei Wochen demonstriert hatten.
»Welcher?«
»Gay Pride«, sagte Vianello tonlos.
»Gay Pride? Alvise?« Brunetti konnte sein Erstaunen nicht verbergen. »Wir sind für einen Polizeieinsatz in Treviso nicht zuständig«, erinnerte er den Ispettore.
»Er war nicht im Einsatz.«
»Was hatte er denn sonst dort zu tun?«
»Deswegen fahren wir nach Treviso. Um das herauszufinden.«
»Was ist passiert?«
Man hörte ein Vaporetto zum Anlegen den Rückwärtsgang einlegen. Dann eine Stimme – nicht die von Vianello: »Ca’ Rezzonico.«
Brunetti war schon auf dem Weg zur Tür, vor der er Regenmantel und Schirm gelassen hatte, nachdem er am Morgen kurz Zeitungen kaufen und einen Kaffee trinken gegangen war.
Er nahm das Handy in die linke Hand und tastete in der Manteltasche nach den Schlüsseln. »Gut. Wir treffen uns am Taxistand«, sagte er, und bevor Vianello sich ausklinken konnte: »Weswegen wurde Alvise verhaftet?«
»Widerstand gegen Festnahme.«
Brunetti fehlten die Worte.
»Und Gewalt gegen Staatsorgane«, fügte Vianello hinzu.
Brunetti wusste, was das zu bedeuten hatte. »Gewalt? Alvise?«
»Fazio hat nicht mitbekommen, was sich da zugetragen hat. Er hat mich angerufen, als man Alvise in die Questura brachte. Er meinte, ich soll kommen. Und dich mitbringen.«
»Gut. Bin schon unterwegs«, beendete Brunetti das Gespräch.
Trotz Regen und Kälte ging der Commissario lieber zu Fuß zum Piazzale Roma: Bei diesem Wetter wären die Vaporetti überheizt und gerammelt voll. Allein schon der barbarische Mief in der feuchtwarmen Passagierkabine!
Auf dem Marsch zum Piazzale Roma dachte er über Vianellos Anruf nach. Alvise? Alvise war so lange bei der Polizei wie er selbst, doch während Brunetti in dieser Zeit immer weiter aufstieg, war Alvise – schwerfällig, wohlerzogen, ungeschickt, begriffsstutzig und (obwohl man ihn allseits für einen Trottel hielt) nicht unbeliebt – auf der untersten Stufe stehen geblieben. Und doch war Alvise mit all seinen widersprüchlichen Eigenschaften zum Maskottchen, ja geradezu zum Lieblingsmaskottchen in der Questura geworden. Er hatte nie von seiner Dienstwaffe Gebrauch gemacht und noch nie einen Täter aufgespürt, aber sich mehr als einmal für einen Kollegen selbst in Gefahr begeben. Mittlerweile war sein Haar schütter und an den Schläfen weiß geworden; sein Bauch runder und seine Züge waren gealtert. Er sprach nie von sich, nahm Anteil am Leben seiner Kollegen, wusste die Namen ihrer Ehepartner und Kinder, war loyal und gab sein Bestes. Und jetzt war Alvise auf der Gay Pride Parade in Treviso verhaftet worden und hatte sich, wie es aussah, einem Polizisten widersetzt.
Brunetti versuchte sich zu erinnern, ob er Alvise jemals außer Dienst gesehen hatte, fand aber nichts. Alvise nahm als Privatmann nicht recht Gestalt an, vielleicht weil er von seinen Kollegen nicht wirklich ernst genommen wurde. Brunetti blieb unwillkürlich stehen, als ihm dämmerte, dass er Alvise ohne Uniform womöglich gar nicht erkennen würde. Er starrte in ein Schaufenster und versuchte sich ins Gedächtnis zu rufen, wie Alvise aussah: Ihm fiel nicht viel mehr ein als ein rundliches Gesicht, kein Schnauzer oder Bart, braun melierte Haare, dass Alvise die Augen beim Lächeln zusammenkniff und er nie vollkommen still stehen konnte. Ansonsten glich Alvise der Karikatur eines Mannes in Uniform, dessen Dienstmütze immer eine Nummer zu groß schien.
»Als ob er gar nicht wirklich existiert«, murmelte Brunetti, was ihn auf die Frage brachte, wie viele der anderen Beamten für ihn nicht wirklich existierten, und ob sie alle Privat- und Berufsleben so scharf voneinander zu trennen vermochten. Schließlich wandte er sich von den Schuhen im Schaufenster ab und ging weiter, da Vianellos Boot bald eintreffen würde.
Er rief sich Fälle ins Gedächtnis, an denen Alvise beteiligt gewesen war, und wie Alvise jedes Mal für Chaos gesorgt hatte: Einmal hatte er an der falschen Adresse eine Festnahme durchführen wollen, ein andermal eine Mappe mit Zeugenaussagen im Bus liegen lassen. Andererseits hatte Alvise einmal einen Mann entwaffnet, der seine Frau mit dem Küchenmesser bedrohte, und eine Schlägerei in einem Restaurant verhindert, als ein unzufriedener Gast einen Teller Pasta nach dem Kellner geworfen und den Tisch umgestürzt hatte. Irgendwie war es Alvise am Nebentisch gelungen, den Mann so lange zu beruhigen, bis dieser sich beim Kellner entschuldigte und half, den Tisch wieder auf die Beine zu stellen.
Die Mutter dieses Mannes, hatte Alvise dem Inhaber erzählt, liege sterbenskrank im Hospital. Die Pasta habe den Mann, der sich nun unter Tränen entschuldigte, so sehr an seine Mutter erinnert, dass er durchgedreht sei. Als sich die Sache am nächsten Tag in der Questura herumsprach, meinte Alvise nur, das einzige Opfer sei die sehr gute Pasta gewesen.
In diesem Moment erspähte der Commissario Vianello in Cordhose und dickem Parka am Anfang der Taxischlange. Als Vianello Brunetti näher kommen sah, öffnete er ihm den Wagenschlag und stieg selbst auf der anderen Seite ein. Erst nachdem der Ispettore dem Fahrer die Adresse der Questura in Treviso genannt hatte, lehnte er sich zurück.
»Nun?«, fragte Brunetti.
Vianello beugte sich vor und schob die Glasscheibe zwischen ihnen und dem Fahrer zu. Dann drehte er sich zu Brunetti um und sagte mit gedämpfter Stimme: »Der Umzug war das Übliche: rund zweihundert Leute mit Transparenten, die Slogans skandierten. Fazio meint, die Stimmung sei ziemlich gut gewesen, trotz des Regens.«
»Wo sind sie losgezogen?«, fragte Brunetti.
»Am COIN. Sie hatten Genehmigung, die Via Lazzari runterzugehen. Es sollte Musik und ein paar Ansprachen geben, aber man hatte nicht mit dem Regen gerechnet, so geriet einiges durcheinander, und sie sind erst nach elf vom COIN weggekommen.«
»Und?«, fragte Brunetti. Bei zweihundert Leuten ließen sich Verzögerungen kaum vermeiden.
»Plötzlich sind Störenfriede aufgetaucht«, fuhr Vianello fort.
»Was?«, fragte Brunetti. »Bei diesem Regen? An einem Samstagmorgen?«
»Fazio hat sie mit eigenen Augen gesehen. Er sagt, es waren ungefähr zwanzig. Das Übliche: dicke Männer mit Bibelzitaten auf Pappschildern. Keine Frauen. Üble Beschimpfungen. Sie kämen alle in die Hölle.«
»Hört sich so verrückt an wie das Geschrei der Abtreibungsfeinde.«
»Vergiss nicht die Impfgegner«, sagte Vianello.
Brunetti nickte und seufzte, als ihm eine besonders unerfreuliche Demonstration vor dem Krankenhaus einfiel. »Was ist passiert?«
»Fazio war als Begleitschutz eingeteilt. In Uniform. Er sagt, einer der Gegendemonstranten …« Das Wort schien Vianello nicht zu gefallen, und kopfschüttelnd fuhr er fort: »… rannte mit seinem Schild als Rammbock mitten in die Menge hinein. Drei oder vier wurden umgestoßen.«
»Verletzt?«
»Wohl eher nicht. Nur überrascht.«
»Und weiter?«
»Fazio sagt, der Mann habe mit dem Schild ausgeholt und sei damit auf die Leute losgegangen. Noch bevor Fazio eingreifen konnte, hatte ein Demonstrant dem Mann das Schild bereits entrissen, hatte es ein paarmal auf den Boden geschmettert und es zertrümmert.«
»Was hat der andere getan?«
»Er hat den Mann angebrüllt, der ihm das Schild weggenommen hat, sagt Fazio; das Übliche: ›verdammte Schwuchteln‹, ›ihr seid alle Sünder‹. In diesem Moment meldete sich Fazios Vorgesetzter per Funk. Als er wieder hinsah, legte einer seiner Kollegen dem Burschen, der das Schild kaputt gemacht hatte, Handschellen an.«
»Willst du mir etwa sagen, das war Alvise?«, fragte Brunetti fassungslos.
Vianello nickte.
»Gibt es Zeugen des Vorfalls?«
»Fazio hat Personalien von ein paar Leuten notiert, aber – du weißt ja, wie es ist – keiner hat etwas gesehen.«
Brunetti kannte das. Falls sie es nicht mit ihren Handys gefilmt hatten und damit prahlen konnten, waren die wenigsten bereit, als Zeugen eines Verbrechens aufzutreten, weil sie nicht in das träge Mahlwerk der Justiz geraten wollten.
Das Taxi hielt an, und Brunetti erkannte vor dem Fenster die Questura von Treviso.
Vianello zahlte und stieg aus; Brunetti folgte ihm und stand wie vor Jahren, als er zum ersten Mal hier gewesen war, staunend vor den Hochhaustürmen und versuchte die Stockwerke zu zählen. Und wieder scheiterte er an dem Trick des Architekten, über die einzelnen Stockwerke jeweils mehr als nur einen horizontalen Fensterstreifen laufen zu lassen. Brunetti gab das Zählen auf und überquerte hinter Vianello die Schwelle. Während er dem Ispettore durch die Korridore folgte, hielt niemand sie auf, um sich zu erkundigen, was sie hier verloren hatten. Eine Sicherheitslücke? Oder erkannte man sie irgendwie als Polizisten und ließ sie deshalb in Ruhe? Oder machte es, wie Kriminelle ihm schon oft erzählt hatten, keinen Unterschied, wo und wohin man ging: Solange man nur den Eindruck erweckte, man wisse den Weg. Sie stiegen in der zweiten Etage aus dem Aufzug, wo der Ispettore erst rechts, dann links abbog und schließlich vor einem Büro mit dem Namen Danieli an der Tür haltmachte.
Vianello klopfte an, eine Männerstimme antwortete, und sie traten ein. Hinter einem Schreibtisch saß ein kleiner dicker Mann mit kurz geschorenem dunklem Haar. Grauer Anzug, weißes Hemd und rot-blau gestreifte Krawatte. Er blickte auf und erhob sich. Die äußeren Lidwinkel seiner blassblauen Augen zeigten leicht aufwärts. »Ah, Signori, freut mich, dass Sie kommen konnten. Man hat mir gesagt, Sie seien verständigt worden.« Und zu Brunetti gewandt, als wittere er dessen höheren Rang: »Danieli.«
Brunetti stellte sich und Vianello mit Rang und Namen vor. Ohne ihnen die Hand zu reichen, wies Danieli auf die Stühle vor seinem Schreibtisch und wartete, bis sie Platz genommen hatten, bevor er sich selbst wieder setzte.
Brunetti überlegte vergebens, wo ihm der Name schon einmal begegnet war.
»Sie sind wegen Ihres Kollegen hier«, sagte Danieli – nicht als Frage, sondern als Feststellung.
»Ja«, sagte Brunetti, »Alvise.« Und setzte noch den Vornamen hinzu: »Dario.«
Danieli hatte eine Akte aufgeschlagen vor sich liegen; er warf einen Blick hinein und fragte: »Wie lange ist er schon bei der Polizei in Venedig?«
Brunetti sah zu Vianello, der antwortete: »Seit Jahrzehnten.«
»Wie schätzen Sie ihn ein?«, fragte Danieli sie beide.
Brunetti erklärte: »Zuverlässig, ehrlich, kommt gut mit Menschen aus.«
Danieli sah Vianello fragend an, und der sagte: »Er ist einer der Beliebtesten bei uns, hatte nie disziplinarische Probleme und hat bereits mehrmals Situationen entschärfen und Gewalt abwenden können.«
Brunetti nickte zustimmend.
»Hatte er aufgrund seiner Homosexualität schon mal Schwierigkeiten?«
Brunetti fuhr auf seinem Stuhl zurück, als habe das Wort ihm einen Stoß versetzt. Er faltete die Hände und fixierte den Stadtplan von Treviso an der gegenüberliegenden Wand. Alvise? Schließlich erklärte er aufrichtig: »Nicht dass ich wüsste. Nein.« Wie denn auch. Und um einer unangenehmen Wendung des Gesprächs zuvorzukommen, fügte er hinzu: »Ich möchte meinen, diese Zeiten sind vorbei.«
»Welche Zeiten?«, fragte Danieli höflich.
»Die Zeiten, die wir alle durchgemacht haben«, sagte Brunetti. »Als unsere schwulen Freunde lügen und sich verstellen mussten, oder sich gezwungen sahen, zu heiraten und Kinder zu haben.« Er zuckte mit den Schultern, sah zu Vianello und wieder zu dem anderen. »Und all das wozu?«
»Vor allem wohl, um ihren Job zu behalten«, antwortete Danieli. »Und was man damals ihr Ansehen genannt hat.«
Vianello schaltete sich ein: »Verzeihen Sie, Signore, könnten Sie mir sagen, warum Sie nachgefragt haben?«
Danieli klappte die Aktenmappe zu – die nur ein einziges Blatt enthielt, wie Brunetti bemerkte. »Ich habe widersprüchliche Aussagen zu dem Vorfall gehört«, erklärte er. »Ein Augenzeuge behauptet, Ihr Beamter habe Widerstand geleistet, als mein Beamter ihm Handschellen anlegen wollte.« Er ließ Vianello nicht zu Wort kommen. »Ein anderer, mein Beamter sei bewusst unnötig grob mit Ihrem umgesprungen.«
»Und was sagt Alvise?«, fragte Brunetti.
Danieli klopfte mit dem Zeigefinger auf die Akte. »Bis jetzt hatte er keine Möglichkeit, sich zu äußern.«
»Das heißt, er sitzt mutterseelenallein in einer Zelle und wartet, dass wir ihn befreien?«, wollte Brunetti wissen.
Wie erhofft, lächelte Danieli. »Ja, so in etwa. Er wurde in Verwahrung genommen. Einer meiner Beamten im Einsatz hat ihn als Polizisten aus Venedig erkannt.«
»Verstehe«, sagte Brunetti.
»Also habe ich Fazio gebeten, jemanden von der Polizei in Venedig anzurufen, den er kennt … und dem er vertraut … wir hätten hier einen Ihrer Männer, es wäre gut, wenn jemand herkommen und uns helfen könnte, die Sache zu regeln.«
»Gütlich unter Freunden?«, fragte Brunetti.
»Selbstverständlich. Das fehlt uns gerade noch, dass der Gazzettino anfängt, über Polizeibrutalität zu stänkern.« Danieli starrte auf die Wand hinter den beiden, als prangte dort bereits die Schlagzeile des Gazzettino. »Man könnte meinen, wir wären in der Bronx, so wie die sich jedes Mal ereifern, wenn irgendwer behauptet, es sei bei seiner Festnahme zu Übergriffen gekommen.«
Brunetti fiel auf, dass Danieli nicht von »Verhaftung« sprach.
»Aber es kommt vor, oder?«, meinte Vianello.
»Selten«, gab Danieli tonlos zurück. Er sah zwischen den beiden hin und her. »Das sehen Sie doch auch so.«
Brunetti nickte, und Vianello bekräftigte: »Wahrscheinlich liegt es daran, dass Venedig so klein ist – ein winziger Genpool –, da greifen wir womöglich den Cousin von jemand auf, den wir kennen, oder den Mathelehrer unseres Sohns.« Brunetti mochte es, dass Vianello von »aufgreifen« sprach. »Berüchtigte Gewalttäter, diese Mathelehrer«, erklärte er, um die Stimmung aufzuheitern.
Danieli quittierte dies mit einem kleinen Lachen. »Also versuchen wir, uns gütlich zu einigen unter Kollegen?«
Brunetti entging nicht, dass »Freunde« zu »Kollegen« herabgestuft worden waren; er überlegte kurz und fragte dann: »Können wir zuerst einmal mit Alvise reden?«
Die Überraschung war Danieli anzumerken, doch er antwortete ruhig: »Natürlich. Ich lasse ihn holen.« Er drückte zwei Tasten auf seinem Telefon. Während er wartete, machte er eine einladende Geste: »Sie können hier mit ihm sprechen.«
Bevor sie dankend ablehnen konnten, hob er eine Hand und sagte ins Telefon: »Gianluca, bringen Sie mir den Mann ins Büro, der heute früh festgenommen wurde? Er ist unten in einer Arrestzelle. Hier sind zwei Herren, die ihn sprechen möchten.« Er hörte kurz zu und antwortete dann: »Ja, bei der Demonstration.« Der andere sagte noch etwas, Danieli dankte und beendete das Gespräch. Dann meinte er noch: »Er kommt gleich.«
Eigentlich müssten sie jetzt anfangen, über Sport zu reden, dachte Brunetti, oder irgendein anderes unverfängliches Thema, womit Männer Zeit totschlagen. Aber sie hatten offenbar alle drei keine Lust darauf oder sich einfach nichts zu sagen.
Vier Minuten vergingen schweigend – eine lange Zeit, wenn man auf etwas wartet.
Da klopfte es forsch. Danieli rief »Avanti«, und die Tür ging auf.
Ein uniformierter Polizist trat ein, salutierte lässig Richtung Danieli und gab dem Mann hinter sich den Weg frei.
Alvise, die Hände an den Hosennähten, kam zögernd näher. Als er Vianello erblickte, entspannten sich seine Züge, erstarrten aber sofort wieder, als er merkte, dass auch Brunetti gekommen war. Er schlug die Hacken zusammen und salutierte zackig, sagte aber kein Wort.
Alvise, der gute alte Alvise, in Jeans und dickem dunkelblauem Sweater mit Reißverschluss, darüber eine dunkelblaue Windjacke, wie man sie auf einem Boot oder bei Regen trägt.
In Zivil sah er irgendwie anders aus: kleiner, aber mit klareren Konturen. Was ihn noch stärker veränderte, waren der dunkelrote Fleck auf seiner linken Wange und der breite, blutgetränkte Kopfverband, der die Wunde an der Stirn größtenteils bedeckte, eine Schürfwunde, als sei er mit dem Gesicht über eine raue Oberfläche geschleift worden.
Brunetti sprang auf und schob seinen Stuhl heran. »Setzen Sie sich, Alvise.«
Offenbar unsicher, wie er sich in Gegenwart von Ranghöheren verhalten sollte, salutierte Alvise noch einmal und nahm Habachtstellung an.
Vianello schaltete auf Veneziano um und sagte: »Großer Gott, Alvise, was ist denn mit dir passiert?«
Immer noch stocksteif, als seien ihm die Finger an der Stirn festgeklebt, antwortete Alvise im Dialekt: »Ich bin die Treppe runtergefallen.«
2
Wie auf ein Stichwort schloss Danieli die Akte und erhob sich. »Ich lasse Sie mit Ihrem Mann allein, Commissario«, sagte er, an Brunetti gewandt. »Wenn Sie fertig sind, finden Sie mich im ersten Büro links.« Ohne die Mappe mitzunehmen, verließ er den Raum.
Alvise, immer noch starr wie eine Statue, ließ die Hand sinken.
Vianello stand auf und rückte den dritten Stuhl in Alvises Richtung. »Setz dich, Dario, und erzähl uns, was passiert ist.«
Endlich taute Alvise ein wenig auf und näherte sich von hinten dem Stuhl. Er legte eine Hand auf die Rückenlehne, umrundete ihn und setzte sich. Sein Blick wanderte zu Vianello, zu Brunetti, dann schlug er die Augen nieder, als fürchte er eine Standpauke.
Schließlich wandte er sich an Brunetti: »Ich bin nicht wirklich die Treppe runtergefallen, Commissario.« Er presste die Lippen aufeinander.
Sie warteten schweigend, bis Alvise erklärte: »Ich will nicht, dass die Leute hier Ärger kriegen.«
»Das interessiert jetzt nicht, Alvise«, sagte Brunetti betont ruhig. »Erzählen Sie, was passiert ist.«
Alvise hob die Schultern und ließ sie gleich wieder sinken. »Es gibt nicht viel zu erzählen, Commissario. Außerdem war es nur einer.«
»Wer?«, fragte Vianello.
»Petri«, antwortete Alvise. »Den kenne ich schon eine Weile.« Vianello nickte, als kenne auch er den Mann.
»Er hat früher in der Stadt gearbeitet«, sagte Alvise – damit war offenbar Venedig gemeint –, »wurde aber vor zwei, drei Jahren nach Treviso versetzt.«
»Haben Sie mal mit ihm zusammengearbeitet?«, fragte Brunetti.
»Ein paarmal, Signore«, antwortete Alvise, ohne sich genauer darüber auszulassen.
»Und er hat Sie nicht erkannt?« Brunettis Ton machte deutlich: Dies war keine einfache Frage, sondern die Aufforderung, mehr zu erklären.
Alvise klemmte seine Hände mit den Handflächen nach unten unter die Oberschenkel, als fürchte er, sich mit irgendeiner Geste zu verraten. »Er tat so, als ob er mich nicht kennen würde, Signore, und ich tue dann lieber auch so.«
»Damit er keinen Ärger bekommt?«, fragte Vianello.
»Damit niemand Ärger bekommt.«
»Könnten Sie uns noch etwas mehr erzählen, Alvise«, bat Brunetti.
Alvises Hand war schon auf halbem Weg zu seiner Stirn, ehe ihm einfiel, dass sie saßen und Brunetti lediglich eine Bitte aussprach. Er fuhr sich stattdessen mit den Fingern durchs Haar und legte die Hand dann auf der Armlehne ab.
»Er ist …«, begann Alvise, wusste aber nicht weiter. »… Hm, manche hatten Ärger mit ihm.«
»Aber du nicht?«, fragte Vianello.
»Nein, nie, heute zum ersten Mal«, antwortete Alvise, sah zu Vianello und senkte den Kopf, als habe er sich selbst bei einer Lüge ertappt. »Was Handgreiflichkeiten angeht.«
Als Brunetti das auseinanderklamüsert hatte, hakte er nach: »Aber Ärger anderer Art hatten Sie schon mit ihm?«
Alvise geriet in die Bredouille: Ein Ja könnte ihn in Schwierigkeiten bringen, ein Nein wäre eine Lüge.
»Verbale Auseinandersetzungen?«, fragte Brunetti.
Alvise dachte angestrengt über den Sinn dieser Frage nach. Schließlich fragte er zurück: »Sie meinen, ob er mich mal beleidigt hat?«
»Ja«, bekräftigte Brunetti.
»Er war schon immer so, Signore«, sagte Alvise leise, und es klang beinahe, als wolle er Petri in Schutz nehmen, oder doch eher, als wolle er der Frage ausweichen.
»Was soll das heißen?«, mischte Vianello sich ein.
»Na ja, er sagt Sachen zu den Leuten. Und über Leute.«
»Ja was denn?«, fragte Vianello ungeduldig.
Alvise schaute auf die Ärmel seines Sweaters, stülpte sorgfältig erst den einen, dann den anderen um. Als er aufblickte, traf ihn Vianellos Blick. »Du kennst doch Biozzi?«
Vianello und Brunetti tauschten einen raschen Blick. Wer in der Questura kannte Biozzi nicht, oder seine Geschichte? Dass seine Frau von dem Lover ermordet worden war, wegen dem sie sich sechs Jahre zuvor von Biozzi getrennt hatte?
Beide warteten schweigend auf Alvises Erklärung.
»Er war im Bereitschaftsraum, als er wieder zu uns zur Arbeit kam.«
Am liebsten hätte Brunetti Alvise geschüttelt, bezwang sich aber und bemerkte ruhig: »Ich kann Ihnen nicht folgen, Alvise. Wer ist ›er‹?« Auch Vianello kam ganz offenkundig nicht mehr mit.
»Petri war im Bereitschaftsraum«, erklärte Alvise. »Und Biozzi kam rein.« Er sah sich um: Seine Zuhörer nickten, jetzt hatten sie verstanden. »Das muss vor ungefähr drei Jahren gewesen sein. Petri war mit jemandem im Gespräch – mit wem, weiß ich nicht mehr.« Alvise machte mit der Hand einen Schlussstrich und fing noch einmal von vorne an. »Als Petri Biozzi hereinkommen sah, wurde seine Stimme plötzlich lauter, und er sagte etwas wie: ›Sorgt wenigstens für klarere Verhältnisse, als eine Scheidung abzuwarten.‹«
Alvise verzog angewidert das Gesicht, und schon bereute Brunetti seine Ungeduld.
»Was ist passiert?«, fragte er.
Alvise antwortete nicht.
»Nun?«, fasste Vianello nach.
Alvise gab seinen Widerstand endlich auf und erzählte: »Ich hatte gerade Zeitung gelesen. Die hab ich genommen, bin zu Petri und habe sie vor ihm auf den Tisch geknallt. Dann bin ich zu Renato, habe ihm einen Arm um die Schultern gelegt und gesagt: ›Schön, dass du wieder bei uns bist.‹«
Die drei schwiegen lange, bis Brunetti auf das aktuelle Problem zurückkam und fragte: »Als man Sie hierhergebracht hat, wusste also nur Petri, was vorgefallen war?«
Alvise sah ihn überrascht an und nickte. »Ja, Commissario, und ich wollte nichts wie weg, bevor jemand erfährt, dass ich Polizist bin.« Schulterzuckend fügte er hinzu: »Ich wollte kein Aufsehen und ganz bestimmt nicht Sie und den Ispettore beunruhigen, Signore.«
»Bis jetzt beunruhigt mich nur, dass es zu diesem Übergriff gekommen ist während der Demonstration.«
»Es war nur der eine, Signore. Ein anderer hat ihn angeschrien, er soll aufhören.«
»Bist du sicher, dass es Petri war?«, fragte Vianello.
Was bei einem anderen als Kunstpause gegolten hätte, war bei Alvise ein Zaudern, doch schließlich antwortete er widerstrebend: »Nein, Lorenzo. Die waren hinter mir.« Neugierig die Augen aufreißend fragte er: »Macht das einen Unterschied?«
»Vermutlich nicht«, meinte Vianello. »Wenn wir dich hier rausholen«, begann er und fuhr dann langsam fort, jedes Wort betonend, »dann ist die Sache gar nicht passiert.«
Alvise brauchte ein wenig, bis er verstanden hatte. »Das wäre das Beste, oder?«
Brunetti überlegte kurz: »Vermutlich. Für uns alle.«
»Was ist damit?«, fragte Alvise und klopfte auf seinen Wundverband. »Wie soll ich das erklären?«
Betont freundlich, wie jemand, der seine Ungeduld nur mühsam zügelt, erklärte Vianello: »Das hast du doch schon, Dario. Du bist die Treppe runtergefallen.« Und damit Alvise nicht davon anfing, dass es auf der Straße keine Treppen gebe, fügte Vianello hinzu: »In der Questura.«
Brunetti und Vianello beobachteten, wie Alvise das verdaute. »Ach so. Ja, jetzt erinnere ich mich.« Sein Lächeln bewies, dass er endlich verstanden hatte.
Brunetti erhob sich, machte zwei Schritte zur Tür, hielt inne und drehte sich zu den beiden um. »Also abgemacht, Alvise?«
»O ja, Signore«, sagte Alvise. »Ich muss nur lügen, dann wird es wahr.« War das Ironie? Oder Sarkasmus? Oder typisch Alvise, der sich an die Devise hielt: Sag die Wahrheit, doch sag sie schräg. Er ließ Alvise Zeit, sich genauer zu erklären, aber der nickte nur lächelnd, und so ging Brunetti davon aus, dass dies geklärt war.
Er ging auf den Flur und klopfte an die erste Tür links. Danieli öffnete und meinte nur: »Das ging ja schnell.«
»Alvise hat uns alles erzählt«, sagte Brunetti beiläufig. »Ihm ist wieder eingefallen, er hat sich so aufgeregt, als er hierhergebracht wurde, dass er auf der Treppe ins Stolpern geraten und gestürzt ist.«
»Genau das hatte ich mir auch schon gedacht, Commissario«, erwiderte Danieli mit breitem Grinsen. »Freut mich sehr, dass Ihr Mann es bestätigt. Wie heißt er noch gleich?«
»Alvise«, sagte Brunetti.
»Ach ja. Also erledigen wir den Papierkram, dann können Sie alle nach Venedig zurück.« Die Erleichterung war Danieli mehr als deutlich anzuhören.
»Schön, dass Sie mit dem Ergebnis zufrieden sind«, sagte Brunetti.
Eine Hand bereits auf der Türklinke, drehte Danieli sich noch einmal um. »Es kommt nicht oft vor, dass Dinge sich so einfach lösen lassen, Commissario.« Und dann fragte er ohne Umschweife: »Hat er Ihnen gesagt, wer tätlich gegen ihn geworden ist?«
Brunetti antwortete mit einer Gegenfrage: »Warum fragen Sie?«
»Weil ich Schlägertypen nicht mag.«
Brunetti nickte: Es gab kaum etwas, das er mehr verabscheute. »Ich finde, er sollte selbst entscheiden, ob er den Täter nennen will oder nicht. Ich halte mich da raus.«
Danieli war einverstanden. »Ich an Ihrer Stelle würde es genauso halten.« Er nahm die Hand von der Klinke und hielt sie Brunetti hin. »Filippo.«
»Guido«, erklärte Brunetti lächelnd und streckte ihm seine entgegen.
3
Danieli bot ihnen für die Rückfahrt nach Venedig einen Wagen samt Fahrer an, und Brunetti willigte ein, schließlich war Samstag, und sie hatten eigentlich dienstfrei. Dann bekam Alvise seine persönlichen Habseligkeiten zurück, und kaum hatten sie die Questura verlassen, entfernte er sich ein paar Schritte, um zu telefonieren. Brunetti sah genau, wann der Angerufene sich meldete: Alvise wandte sich strahlend ab und ließ Brunetti nur noch seinen Rücken sehen. Einen ziemlich glücklichen Rücken, wie Brunetti zufrieden bemerkte.
Brunetti, Vianello und Danieli warteten vor den acht orangen Türmen der Questura. Jedes Mal wieder staunte Brunetti über deren schiere Größe. Venedig, einst Herrscherin eines Weltreichs – auch wenn die Machthaber clever genug gewesen waren, es nie so zu nennen –, hatte heute für seine Polizei nur einen heruntergekommenen Palazzo und ein paar moderne Kästen übrig. Treviso, nie eine Großmacht, besaß acht vielgeschossige Hochhäuser, die aussahen wie Aktenschränke mit Lüftungsschlitzen.
Der Wagen kam, und Brunetti war froh, dass es kein hellblauer Streifenwagen war, sondern eine nachtblaue Limousine, wie sie Politiker benutzten. Er bedankte sich bei Danieli, sie stiegen ein, und er schob die Glasscheibe zwischen ihnen und dem Fahrer zu. Der Motor lief nahezu geräuschlos. Ob dies ein Elektroauto war?
Auf der Rückbank nestelten sie an ihren Sicherheitsgurten, Alvise hektischer als die anderen. Erst als sie alle angeschnallt waren, ließen sie die Piazza und die Türme hinter sich und fuhren Richtung Venedig. Alvise wandte sich steif Brunetti zu: »Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und mich abgeholt haben, Commissario«, sagte er und fügte, an Vianello gewandt, etwas weniger förmlich hinzu: »Dir auch, Lorenzo.« Und dann zu beiden: »Tut mir leid, dass ich Ihnen den Samstag ruiniert habe.«
»Ich denke, da ist Ihnen der Regen zuvorgekommen, Alvise«, meinte Brunetti. Jetzt oder nie, dachte er. Wenn er ihn jetzt nicht fragte …
Doch bevor Brunetti seine Frage formuliert hatte, räusperte sich Alvise, machte ein paarmal »Hm« und erklärte dann: »Ich habe eben meinen Lebensgefährten angerufen.«
Brunetti und Vianello warteten schweigend.
»Er ist Tischler«, sagte Alvise. »Er hatte versucht, mich zu erreichen. Er hat sich Sorgen gemacht.«
»Verständlich«, sagte Brunetti.
Alvise legte seine Hände auf die Oberschenkel, bewegte die Finger auf und ab: »Das ist das erste Mal, dass ich jemandem davon erzähle.«
»Wovon?«, fragte Vianello.
»Von meinem Lebensgefährten.«
»Und wie hört es sich an?«
»Ungewohnt«, sagte Alvise und fügte hastig hinzu: »Aber schön. Es gefällt mir. Wie es sich anhört. Ich sage es gern.«
»Gut so, wenn er Ihr Lebensgefährte ist«, bestätigte ihm Brunetti.
»Versuch’s doch noch einmal, mit seinem Namen«, bat Vianello und stupste Alvise mit dem Ellbogen an. »Das hört sich vielleicht noch besser an.«
»Machst du Witze?«, fragte Alvise nervös.
»Über so etwas macht man keine Witze, Dario.«
Alvise nickte eifrig und sagte: »Cristiano. Mein Lebensgefährte.«
Brunetti fragte im Plauderton: »Wie lange kennen Sie sich schon?«
»Sechs Jahre.«
Brunetti war sprachlos. Sechs Jahre, und alle in der Questura glaubten, Alvise lebe auf dem Lido mit seiner verwitweten Mutter.
»Meine Mutter brauchte einen Tischler für die Doppeltür eines Walnussschranks, der schon lange im Besitz unserer Familie ist. Und da erschien er«, erzählte Alvise. »Er hat ihr gesagt, er müsse mit seinem Lieferwagen wiederkommen und ihn abholen, in der Rückwand sei ein breiter Sprung, das könne er nur in seiner Werkstatt ausbessern.«
Brunetti war beeindruckt, wie flüssig Alvise mit einem Mal seine Geschichte erzählte. Sonst brachte er bei Berichten, ob mündlich oder schriftlich, immer alles durcheinander: Chronologie, Personenbeschreibungen, Zeugenaussagen – alles wertlos. Und oft genug widersprüchlich.
Hier hingegen plötzlich lauter präzise Angaben: die Holzsorte, die Doppeltür, und warum der Schrank in die Werkstatt gebracht werden musste. Machte der Umstand, dass Alvise von jemandem sprach, den er liebte, die Geschichte so einmalig, dass sie leichter im Gedächtnis blieb?
Das Auto schwenkte kurz nach links aus. Das brachte Alvise aus dem Konzept. Er schlug die Hand vor den Mund. »Entschuldigung«, meinte er, sah zwischen den beiden hin und her und dann zum Hinterkopf des Fahrers, als fürchte er, der könnte alles mitgehört haben.
Brunetti fragte sich, ob irgendwer von den Kollegen über Alvise Bescheid wusste, und erkannte schnell, dass er das unmöglich herausfinden konnte. Und dass es, gestand er sich ein, unerheblich war. Alvise war glücklich: Alles andere zählte nicht.
Plötzlich platzte Alvise heraus: »Samstags muss er sich um die Kinder seiner Schwester kümmern.« Nach einer Weile fügte er hinzu: »Deswegen konnte er nicht mit.«
Den Rest der Fahrt zum Piazzale Roma verbrachten sie schweigend. Der Wagen hielt hinter einem abfahrenden Bus. Vianello öffnete die Tür auf seiner Seite, und die drei stiegen aus.
Sie bildeten ein Dreieck auf dem Bürgersteig. »Ist die Sache damit erledigt, Commissario?«, fragte Alvise.
»Ich denke schon. Auf Danieli ist Verlass, glaube ich. Schließlich sind Sie nur gestürzt.«
Vianello nickte bekräftigend.
»Und wenn jemand fragt, was ich dort gemacht habe, Signore?«, fragte Alvise mit zaghafter Stimme.
Fast hätte Brunetti ihm geraten, einfach zu behaupten, er habe seinen Kollegen in Treviso beigestanden, als es zu Ausschreitungen kam, doch jetzt wo er Alvise von einer neuen Seite kennengelernt hatte, die ihm gefiel, sagte er nur: »Das müssen Sie selbst entscheiden, Alvise.«
Der Beamte nickte steif, sein Rücken starr wie ein Brett, das vor und zurück pendelte, als bräuchte Alvise zum Nachdenken den ganzen Körper, nicht nur den Kopf.
Schließlich stöhnte er auf und meinte schulterzuckend: »Ich werde wohl die Wahrheit sagen müssen, Commissario.« Wieder machte er diese seltsame Bewegung. »Ich war dort, weil ich denke, wir alle sollten den Menschen lieben dürfen, den wir lieben.« Er stand still und sah zu Brunetti hoch, der beträchtlich größer war als er. »Ganz einfach, oder?«
»Wenn’s nur so wäre«, sagte Brunetti.
Vianello meinte: »Ich nehme das Boot. Kommst du mit, Dario?«
»Danke, Lorenzo, aber ich bin heute Abend mit Kochen dran, da muss ich noch was einkaufen.« Mit resigniertem Lächeln fügte er hinzu: »Wenn ich gewusst hätte, dass es so spät wird …«
»Also dann«, sagte Brunetti. »Wir sehen uns am Montag.«
Er beobachtete Alvises Hand, die wie üblich zum Salut vor seinem Vorgesetzten nervös nach oben zuckte. Doch Alvise tat nur einen Schritt zurück, weg von den beiden, und legte die Hand aufs Herz. »Ich fühle mich so leicht. Wie früher als Kind nach der Beichte, wenn ich wusste, dass mir vergeben worden war.«
»Nur dass es diesmal nichts zu vergeben gibt«, sagte Brunetti.
Alvise ließ die Hand sinken, schenkte Vianello und Brunetti ein Lächeln, wie sie es noch nie an ihm gesehen hatten, wandte sich rasch ab und ging die Stufen zum imbarcadero der Nummer eins Richtung Lido hinunter.
4
Mit ihnen war die Sonne nach Venedig zurückgekehrt. Brunetti machte sich zu Fuß auf den Heimweg, um den Rest des nun freundlichen Tags auszukosten. Er hatte mehrere Möglichkeiten, je nachdem, an welcher Kirche er vorbeikommen wollte. Wenn er die Tolentini-Brücke nahm, kam er an der Frari vorbei, oder er machte einen Rechtsschwenk zu San Pantalon und war von da schnell zu Hause.
Er entschied sich für San Pantalon, weil er die Frari erst kürzlich gesehen hatte, bei einer Totenmesse, die so entsetzlich eintönig gewesen war, dass nicht einmal Tizians Assunta ihn darüber hinwegtrösten konnte. Stattdessen hatte sich ihm der Gedanke aufgedrängt, die Ekstase der Jungfrau entspringe der Freude über die Entdeckung, wie sie schleunigst hier wegkomme. Wann und warum nur war die Liturgie so fade und inhaltsleer geworden? Den Priestern merkte man an, dass sie nichts von den Verstorbenen wussten; und die Angehörigen hielten Gedenkreden voller Gemeinplätze, als hätten auch sie den Toten nicht gekannt. Und erst die Musik. Schon mindestens zweimal hatte sie ihn aus der Kirche verjagt. In der Geburtsstadt eines Gabrieli, Vivaldi oder Benedetto Marcello ertönte heutzutage irgendein todlangweiliges modernes Gitarrengeklimper aus der Konserve, das kein bisschen dazu anregte, sich über das irdische Jammertal zu erheben und im Gesang die Erlösung des Verstorbenen zu erflehen. Das einzige Gefühl, das die Musik bei den Trauergästen auslöste – soweit Brunetti das nach seinen seltenen Kirchbesuchen beurteilen konnte –, war nervöse Unruhe.
Manchmal fragte er sich, ob er als Einziger unter dem Gegensatz zwischen dem prächtigen Anblick und dem akustischen Horror litt. Angesichts eines hässlichen Gemäldes konnte er die Augen zusammenkneifen; die Ohren bei hässlicher Musik hingegen nicht.
Einer Eingebung folgend, bog er nach links ab zu San Giacomo dell’Orio, wo er seit Monaten nicht gewesen war. Zum Glück hatte diese Kirche kein einziges berühmtes Gemälde zu bieten – es sei denn, man hielt eine Handvoll Palma il Giovane für berühmt. Was für eine Labsal nach all den Kirchen mit ein, zwei Meisterwerken, in denen alles Übrige als »Jugendwerk« oder »zugeschrieben« abgetan wurde. Die Besucher pflegten dort bewundernd vor einem der »bedeutenden« Gemälde stehen zu bleiben, während sie die anderen – manchmal ebenso schönen oder noch schöneren – unbeachtet links liegen ließen. Brunetti schlenderte gemächlich von einem frommen Bild zum andern, befremdet, dass die Menschen darauf nichts Besseres zu tun hatten, als sich in den Staub zu werfen, und wie viele nackte, muskulöse Arme sie dabei gen Himmel reckten.
Auf dem kleinen Campo vor der Kirche sah er auf die Uhr: kurz vor vier. Der Samstag war verflogen, ihm blieb nur noch die leere Hülse des Tages mit dem nun rasch schwindenden Licht. Er nahm sein Handy, wählte Paolas Nummer und erklärte, als sie sich meldete: »Ich bin auf dem Campo San Giacomo dell’Orio.« Bevor er weitersprechen konnte, fragte Paola beiläufig: »Wie war dein Tag?« Ruhig, neugierig und keine Rechenschaft verlangend.
»Interessant«, antwortete er. »Ich musste nach Treviso, Alvise aus der Patsche helfen.«
»Alvise? In Schwierigkeiten?«, fragte sie. »Ich kann mir vorstellen, dass er Fehler oder eine Dummheit macht, aber doch keinen Ärger.«
»Er ist schwul«, sagte Brunetti.
Paola reagierte nicht. In der Questura wäre es die Sensation des Jahres, Paola aber blieb stumm. »Hast du gehört?«, fragte er.
»Ja. Aber du hast gesagt, er sei in Schwierigkeiten geraten. Was war denn?«
»Er wurde während der Gay Pride Parade in Treviso von einem Gegendemonstranten angegriffen, und da hat die Polizei ihn festgenommen.«
»Und der, der ihn angegriffen hat?«
»Das weiß ich nicht.«
»Bestimmt ein älterer Mann mit einem Kreuz um den Hals«, zischte Paola voller Verachtung.
»Anzunehmen. Etwas in der Art.«
»Und da musstest du nach Treviso?«
»Ja. Mit Lorenzo.«
»Ist Alvise mit euch zurückgekommen?«
»Ja.«
»Das hast du gut gemacht«, meinte Paola spontan.
Und Brunetti war darüber glücklich. Auch nach all den Jahren, den Jahrzehnten mit ihr, war Paolas Meinung ihm wichtiger als fast alles andere und wichtiger als die Meinung aller anderen.
»Er hat ein wenig erzählt.«
»Von sich?«, fragte Paola.
»Von seinem Lebensgefährten. Cristiano. Ein Tischler.«
»Musstet du und Lorenzo ihn dazu ins Kreuzverhör nehmen?«, fragte sie.
»Du hast versprochen, nichts über unsere Methoden auszuplaudern«, spielte Brunetti den ruppigen Polizisten.
»Komm nach Hause und erzähl mir alles.«
Eine halbe Stunde später hatte er einen Kaffee getrunken und saß in seiner braunen Wollhose und dem dicken beigefarbenen Pullover auf dem Sofa, dank denen er den vorigen Winter in einem Haus überlebt hatte, das gut fünfhundert Jahre alt war. Paola hatte ihm gegenüber in einem Sessel Platz genommen.
Als er mit seinem Bericht fertig war, fragte sie: »Der Gedanke ist dir nie gekommen?«
»Welcher Gedanke?«
»Dass er schwul sein könnte?«
»Alvise?«, fragte Brunetti, und dann noch einmal, als sei damit bewiesen, dass dies außerhalb jeder Vorstellung lag.
»Er ist nicht verheiratet, dürfte mittlerweile in den Fünfzigern sein und lebt dem Vernehmen nach mit seiner Mutter in einem Haus auf dem Lido«, fing Paola an, »und da ist niemand auf die Idee gekommen, dass er schwul sein könnte?«
»Nein, niemand«, beharrte Brunetti. »Davon ist mir nie etwas zu Ohren gekommen.«
»Männer«, sagte Paola in wegwerfendem Ton.
»Wie meinst du das: ›Männer‹?«
»Dass keiner von euch sich genug für ihn als Menschen interessiert hat, sonst wärt ihr draufgekommen.«
»Das ist absurd«, sagte Brunetti. »Auf so etwas kommt doch keiner.«
Das Knirschen eines Schlüssels im Schloss der Wohnungstür ließ Paola innehalten. So behutsam, wie die Tür zugemacht wurde, konnte es nur Chiara sein.
Paola nahm die Hand vor den Mund und hustete, ihre Tochter sollte wissen, dass jemand zu Hause war. Und schon kam Chiara zur Tür herein und begrüßte die beiden mit Wangenküssen.
»Chiara«, sagte Paola, »kann ich dir eine Frage stellen?«
Wie erwartet gab Chiara lächelnd zurück: »Kannst du mich eine Antwort fragen?«
Paola ging darüber hinweg. »Was würdest du über einen unverheirateten Mann sagen, der mit seiner Mutter auf dem Lido lebt?«
Chiaras Lächeln erstarb. »Ist das eine Fangfrage?«
»Nein.«
»Wie alt ist er?«, fragte Chiara.
»Anfang fünfzig, schätze ich«, antwortete Brunetti.
»Schon mal verheiratet gewesen?«, fragte Chiara wie ein Staatsanwalt in einem B-Movie.
»Nein«, antwortete Paola.
»Er ist schwul«, sagte Chiara und verschwand in ihr Zimmer.
»Nun?«, fragte Paola.
»Na schön. Aber das liegt daran, dass wir über diese Dinge nicht reden.«
»Wer ist ›wir‹?«
Die Frage stand im Raum, während Brunetti sich die Antwort zurechtlegte. »Also gut«, sagte er. »Männer.«
»Ihr stellt über das Sexualverhalten eurer Kollegen keine Vermutungen an?«
»Na ja«, meinte Brunetti nach längerem Überlegen. »Schon möglich, dass wir das tun. Aber nur jeder für sich, oder mit unseren besten Freunden.«