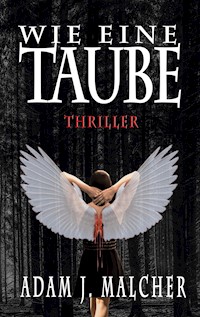
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Der Autor schildert in seiner Geschichte, Trauer und Verlustängste, sowie Gewalt und Tod. Niemand hörte, als sie schrien... Ein einsames Haus tief im Wald. Zwei Jungen, gerade erst Teenager, in der Gewalt zweier Menschen, die vorgeben, ihre Eltern zu sein. Ein grausames Martyrium, das Spuren in die jungen Seelen brennt und sie für immer prägen wird. Als Dennis und Lars die Flucht gelingt, scheint ein Neuanfang möglich. Doch die Vergangenheit holt sie unbarmherzig ein. In dem kleinen, verlassenen Haus treffen die Brüder wieder aufeinander - und die Situation eskaliert. Währenddessen betet Rouven um das Leben seiner geliebten Frau Katrin. Wie soll er ihrem gemeinsamen Sohn Kai nur erklären, dass seine Mama sterben wird? Noch ahnt er nicht, dass seine "kleine Taube" auch ein dunkles Geheimnis aus ihrer Vergangenheit hat...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Adam J. Malcher, geboren 1975, in Zabrze, zog 1988 nach Deutschland, wo er die deutsche Sprache lernte. Seither lebt er in Wadern. Er ist verheiratet und hat zwei Töchter. Bereits im Jahre 2009 schrieb er Drehbücher, die er in Eigenregie als Kurzfilme umsetzte. Seine Vorliebe zum Lesen inspirierte ihn nun zum Schreiben seines ersten eigenen Buches.
Für meine Frau Yvonne und meine Töchter
Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern! So möchte es der Herr, dem ihr gehört; so ist es gut und richtig. »Ehre deinen Vater und deine Mutter!« – das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage: »Dann wird es dir gut gehen, und du wirst lange auf dieser Erde leben.« Und ihr Väter, verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen; erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut.
Epheser 6:1-4 NGU2011: Neue Genfer Übersetzung
Jeder kann wütend werden, das ist einfach. Aber wütend auf den Richtigen zu sein, im richtigen Maß, zur richtigen Zeit, zum richtigen Zweck und auf die richtige Art, das ist schwer.
Aristoteles, Nikomachische Ethik
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Damals
Kapitel 1: Dreizehn Jahre danach.
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34: Damals - Die Flucht.
Kapitel 35
Kapitel 36: Drei Wochen später.
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39: Einige Tage zuvor.
Kapitel 40
Epilog: Sommer
Nachwort
Prolog
Damals
Dennis! Komm mit«, fauchte die Mutter, als sie das dreckige Zimmer ihrer Kinder betrat. Der Gestank nach Schweiß im Raum, den die Jungs in der unerträglichen Augusthitze absonderten, bohrte sich in ihre Nase. Und als der Geruch von Abfall und Exkrementen hinzukam, kehrte sie angewidert um. Sie wedelte mit den Händen die Fliegen vor ihrem Gesicht weg und zog sich hustend zum Türrahmen zurück.
Dennis saß auf einem alten, wackeligen Stuhl. Er lehnte seinen Kopf an die dunkelbraunen Paneelen der Dachschräge und starrte gedankenlos durch ein stark verschmutztes Fenster, das sich nicht mehr öffnen ließ. Als er seinen Namen hörte, presste er seine Augenlider fest zusammen.
Während gleichaltrige Jungs heimlich die erste Flasche Bier tranken, probierten, wie Zigaretten schmeckten, sich mit Mädchen trafen und sie zum ersten Mal küssten und mit den Bikes ohne Sorgen und Ängste einen Hügel hinunter rasten, sehnten sich die Brüder danach, aus diesem Verlies, diesem Haus, das von einem dichten Wald umzingelt war, zu entkommen.
»Dennis, komm jetzt endlich«, wiederholte seine Mutter mahnend und schlug mit ihrer flachen Hand gegen das Türblatt aus Buche-Nachbildung, mit zahlreichen Kratzern, Dellen und Flecken auf der Folie.
Dennis erhob sich langsam und drehte sich mühsam um. Nach ein paar schleichenden Schritten über den alten, abgelaufenen, fleckigen Teppich stützte er sich am Tisch ab und schaute mit leeren Augen auf Lars, seinen Bruder, der mit angewinkelten Beinen auf seinem Bett saß.
Lars formte mit seinen Lippen ein: »Du schaffst das« und versuchte, Dennis einen aufmunternden Blick zu schenken. Es gelang ihm durch sein tränenüberströmtes Gesicht nicht.
Dennis hatte Angst. Wie jedes Mal.
Die Frau packte Dennis kräftig am Arm und zog den Jungen aus dem Zimmer. Laut fiel die Tür ins Schloss. Lars zuckte zusammen und drückte sein altes Plüschtier, eine gelbbraune Giraffe, bei der die Watte bereits an den Ohren herausragte, fest an sich. Er konnte sein Schluchzen kaum unterdrücken.
Wie gewöhnlich sperrte die Mutter die Zimmertür ab. Im Flur des ersten Geschosses holte sie aus und verpasste Dennis eine Ohrfeige; einfach nur, weil ihr danach war und sie ihm ihre Macht demonstrieren wollte.
Anfangs hatten sie sich bemüht und beobachteten, wie die Kinder heranwuchsen - die Frau mit ihrem Mann - , wenn auch eher ohne Anteilnahme. Wie jemand, der keine Bindung zu den Kindern aufbauen konnte oder wollte.
Die Frau versprach ihnen vor einigen Jahren ein besseres Leben. »Wir fangen neu an … Wir werden es da gut haben«, versicherte sie ihnen und stellte eine Bierflasche auf dem Wohnzimmertisch ab. Den Zigarettenstummel warf sie durch den Flaschenhals, wo er mit einem Zischen erlosch.
Dennis nahm die Nachricht, dass sie an das siebenhundert Kilometer entfernte Meer ziehen würden, in etwa so auf, als teile man ihm mit, dass es heute Nudeln anstatt Pommes gäbe.
Lars hingegen sah die Dinge anders. Er war knapp zwei Jahre älter als sein Bruder. Doch er verstand viel mehr. Er sah auf die Bierflasche, die seine Mutter abgestellt hatte. Es war die zweite an diesem Morgen, und es sollte nicht die letzte bleiben. Er fragte sich, ob es tatsächlich möglich wäre, dass sie sowas wie eine Familie werden könnten - eine Familie, wie er sie aus Erzählungen seiner Freunde aus der Schule, der Klasse 1b, kannte.
Wie sehr wünschte sich Lars eine Familie; so, wie er es vom Zuhause seiner besten Freundin Emma kannte. Bei ihr aß er oft zu Mittag, erledigte Hausaufgaben oder durfte auch mal mit Dennis zum Spielen kommen. Emmas Eltern hatten beide Jungs zu Ausflügen eingeladen - eine Familie, die sich mehr um ihn kümmerte als seine eigenen Eltern, als würde er eher zu ihnen gehören.
»Ist es weit von hier?«, fragte Lars seine Mutter.
Mit einem Zischen öffnete sie sich die dritte Bierflasche und nickte aufgeregt. »Ja.« Sie nahm einen kräftigen Schluck. »Papa hat eine gute und sichere Arbeit an der Ostsee gefunden. Da, wo er aufgewachsen ist. Und wir können von vorne anfangen und glücklich werden«, log sie ihnen ins Gesicht. Die Jungs sollten die Botschaft in der Schule und im Kindergarten verbreiten, dass sie bald wegziehen würden. Noch im selben Sommer zogen sie aus einem Stadtteil der Stadt Wadern aus. Aber sie zogen nicht an die Ostsee, wie sie behauptete, sondern sie bezogen ein kleines Haus mitten im Wald, vierzig Kilometer weiter, in einem kleinen Dorf namens Rorodt.
Lars wünschte sich, dass es stimmte. Dass sie eine glückliche Familie würden. Er näherte sich seiner Mutter und nahm ihre Hand in seine. Aber nur für einen Augenblick, denn sofort entriss sie sich seiner Berührung, als ob sie sich an seinen Händen verbrannt hätte, und zündete sich nervös noch eine Zigarette an.
In den Sommerferien meldete sie die Kinder ab, aber nie woanders an.
Die Jahre vergingen. Dennis, der mittlerweile etwas größer als seine Mutter war, nahm die Ohrfeige ohne Regung hin, weil er zu schwach war, um sich zur Wehr zu setzen.
Die Frau zog ihn am Arm, ging die drei ungleichmäßigen Stufen nach oben, über die Dennis stolperte, und drückte ihn in das Nebenzimmer, das der Vater vor sechs Jahren eingerichtet hatte. Die Suite.
An jenem Tag war Vater nicht im Haus. Er kaufte in Dörfern ein, die mehrere Kilometer entfernt waren; dort, wo ihn niemand kannte oder hätte erkennen können. Er ging keine Risiken ein und trug eine Verkleidung mit falschem Bart und Perücke. Zudem hinkte er absichtlich und krümmte seinen linken Fuß deutlich nach innen.
Die Suite war ein deutlicher Gegensatz zum Kinderzimmer, das mit zwei alten Betten, einem Tischlein, einem alten Schrank und einer Glühbirne in einer Fassung eingerichtet war. Die Suite dagegen war wie eine Wellness-Oase ausgestattet. Sie hatte ein Waschbecken aus Porzellan und einen vergoldeten Wasserhahn, daneben eine große Eckbadewanne und eine bodenebene, geflieste Dusche. Der Fußboden war mit echtem Parkett ausgelegt. In der Ecke stand ein großer und breiter, dunkelroter Sessel. Das Bett maß zwei mal zwei Meter. Es war immer frisch bezogen und stand mitten im Raum. Sein Edelstahlrahmen war ein geschwungenes Gestell und hatte an jeder Ecke Ösen zum Anbinden oder Anketten. An der Decke befand sich ein abgedunkeltes Dachschrägenfenster.
»Zieh dich aus«, befahl Mutter und wies mit dem Zeigefinger auf die Dusche. »Kundschaft kommt gleich. Geh und dusch dich!«
Dennis zog seine Kleider aus. Er war so dürr, dass man jede seiner Rippen zählen konnte. Unzählige Narben schmückten seinen entstellten Körper, der für sein Alter bereits stark behaart war.
Die Frau saß auf dem großen Sessel und beobachtete Dennis, während er duschte. »Beeil dich jetzt! Die Kundin hat nicht ewig Zeit«, rief sie, schaute auf ihre Armbanduhr und hatte ein Lächeln der Vorfreude aufgesetzt.
Frauen, die ihre eigenen Kinder nie schlugen, aber es so gerne täten, bezahlten dafür, um sich an Dennis oder Lars abzureagieren. Mal mit der Hand. Mal mit dem Gürtel. Mal mit dem Hausschuh.
Eine pensionierte Lehrerin kam nahezu regelmäßig einmal die Woche. Nicht, um die Kinder etwas zu lehren, obwohl sie ihnen Aufgaben stellte. Nein. Sie wollte sie nur bestrafen. Sie stellte Rechenaufgaben, die sie nie hätten lösen können, wie Bruchrechnen und Wurzel ziehen aus der Hochschule. Die ehemalige Gymnasiallehrerin zog die Kinder an den Ohren, ließ sie in der Ecke stehen und drosch mit einem Lineal auf die Finger, bis sie sich blutig rot färbten. Manche Frauen bezahlten auch fürs Anfassen oder mehr.
Eines Tages brach ein Mann eine der wenigen Regeln, die es einzuhalten galt. Er schnitt Lars mithilfe einer eigens mitgebrachten Gartenschere die Fingerkuppe des kleinen Fingers der linken Hand ab. Lars schrie so laut vor Schmerzen, bis er in Ohnmacht fiel. Daraufhin brach Vater dem Kunden die Nase, schnitt ihm bei vollem Bewusstsein mit derselben Gartenschere beide kleinen Finger ab und setzte ihn mit verbundenen Augen etwa fünfzig Kilometer entfernt mitten im Wald aus.
Auf einen der unzähligen Kunden freuten sich die Kinder allerdings sehr: einen Mann, der unregelmäßig kam, aber wenn er durch die Nebeneingangstür der Suite trat, war die Freude groß. Wohlwissend, dass er die Kinder mit dem Gürtel den Hintern versohlte, nahm sich der ältere Herr Zeit für sie und las ihnen eine Kurzgeschichte aus einem Buch vor, wie es ein Großvater für seine Enkel getan hätte. Die Kinder genossen es und hörten gebannt in den zwanzig bis dreißig Minuten dem Fremden zu. Seit drei Jahren kam er nicht mehr.
Alle Kunden waren angesehene und wohlhabende Personen. Sie kamen aus der höheren Gesellschaftsschicht. Die Leute bezahlten gut und mussten sich über Diskretion keine Sorgen machen.
»Setz dich«, sagte Mutter zu Dennis, nachdem er sich abgetrocknet hatte. Seine linke Gesichtsbacke glühte noch rot, und drei Finger zeichneten sich auf der Wange ab, wo sie ihm die Ohrfeige verpasst hatte.
Dennis war mit seinen Kräften am Ende und gehorchte, um nicht noch mehr Prügel und Ärger zu erhalten.
»Trink das!« Sie reichte ihm ein Glas Wasser, angereichert mit K.-o.-Tropfen.
Dennis leerte zitternd das Glas, gab es seiner Mutter zurück und schaute sie verängstigt an. Nach kurzer Zeit fiel er rückwärts aufs Bett und schlief ein.
Die Frau legte den nackten Dennis mitten auf die Matratze und deckte seinen Intimbereich mit einem weißen, weichen Handtuch ab.
Es dauerte fünfzehn Minuten, ehe eine schlanke Frau Anfang vierzig das Zimmer betrat. Ihre leicht angegrauten, dunkelbraunen Haare umrahmten ein schmales Gesicht mit braunen Augen. Sie trug einen weißen Bademantel, den sie am Bett fallen ließ. Ihr einst so straffer Busen hing schlapp an ihr herunter. Ihre Pupillen waren geweitet, und unter ihrer Nase war noch etwas weißes Pulver zu sehen, das sie sich, bevor sie das Zimmer betrat, durch die Nase gegönnt hatte.
Sie legte sich neben Dennis und streichelte mit ihren rot lackierten Fingernägeln seinen zarten Flaum auf der Brust. Ihr Gesicht war so nah an dem des Jungen, dass sie seinen Atem spürte.
Je mehr sie darüber nachdachte, dass er doch noch ein Kind war, desto mehr erregte es sie.
Ihre Lippen legte sie auf die Stirn des Kindes und küsste ihn zärtlich. Zuerst die Stirn, dann die Schläfen, die Wangen, und zum Schluss legte sie ihre Lippen auf die des Jungen und küsste ihn. Es schien ihr nichts auszumachen, dass die noch nicht ausgereiften, bleibenden Zähne ungepflegt und dunkelgelb aussahen.
Sie hob ihre Hand und streichelte sein kurz geschorenes Haar. Während sie ihn küsste, zog sie das Handtuch weg und legte ihre Hand auf seine Scham.
Trotz des künstlichen Schlafes rührte sich Dennis’ Körper, während die Frau mit der Hand nachhalf und das Blut sich staute.
Dennis hob kaum merklich seine Hand und ließ sie wieder fallen. Unter starken Kopfschmerzen und Schwindelgefühlen öffnete er seine Augen. Alles bewegte sich, drehte sich. Alles schien verschwommen zu sein, und das Licht war gedämpft. Er hob erneut seine Hand und streckte sie nach der Frau aus. Seine Augen verzog er zu kleinen Schlitzen und versuchte, etwas zu erkennen. Dann glaubte er, die Frau erkannt zu haben, die auf ihm saß.
»Mama?«, flüsterte Dennis kraftlos.
Die Frau, die aus schlafenden Kindern Männer machte, unterbrach ihren Ritt. Sie sah die ausgestreckte Hand und schlug sie mit aller Kraft, die sie hatte, von sich. Sie versetzte ihm wieder eine Ohrfeige und drückte ihm ein Kissen aufs Gesicht.
Dennis erlangte langsam wieder das Bewusstsein. Aber er konnte Realität von Traum nicht unterscheiden.
Was war passiert? Habe ich geträumt?
Kopf und Brust schmerzten heftig. Er versuchte, den Kopf leicht zu heben. Er konnte aber nicht genügend Energie aufbringen und blieb liegen. Mit der Hand strich er sich über seine Brust und sah sie blutverschmiert, als er sie hob. Schnitte.
Er legte seine Hand auf den Bauch, ließ sie hinunter gleiten und spürte, dass er seine Hose anhatte. Also doch nur ein Traum, hoffte er.
Das Atmen fiel Dennis schwer. Er war zu erschöpft, um sich zu setzen, und blieb liegen. Er wartete, bis seine Mutter ihn wieder ins Zimmer zurück führte, wie sie es sonst auch tat. Aber heute kam sie nicht mehr.
Erst nach über zwei Stunden, die Dennis wie eine Ewigkeit vorkamen, ging die Tür auf, und der Vater betrat den Raum. Der Mann sagte kein Wort. Mit finsterer Miene sah er sich kurz um und blickte auf das rot verschmierte Laken, auf dem Dennis regungslos lag. Er näherte sich dem Waschbecken und drehte das Wasser auf. Aus dem Hängeschrank nahm er einen Waschlappen und befeuchtete ihn kurz. Dann ging er auf Dennis zu, setzte sich auf den Bettrand und beugte sich über ihn. Mit dem Waschlappen wusch er seine Wunden und das bereits verkrustete Blut ab.
Es war das erste Mal seit über sechs Jahren, dass Dennis so etwas wie Zuneigung, besser gesagt Zärtlichkeit, von seinem Vater wahrnahm. Er hob kaum merklich seinen Kopf und schenkte seinem Vater ein zartes Lächeln.
Doch der Mann schaute ihn nicht einmal an. Er erhob sich und warf den Waschlappen in eine Ecke. Dann packte er Dennis grob am Arm, zerrte ihn vom Bett, öffnete die Tür der Suite und schleppte ihn unsanft aus dem Raum.
Lars hörte Schritte in dem kleinen Flur und jemanden über die Stufen stolpern. Die Tür wurde von außen aufgesperrt, und Dennis schlich wortlos auf sein Bett zu, auf den er erschöpft zusammensank. Er starrte auf seine Hände, die zusammengefaltet zwischen seinen Knien lagen. Die Tür fiel schwungvoll zu.
»Was haben sie mit dir gemacht?«, wollte Lars wissen. Er eilte zu Dennis und setzte sich neben ihn. »Du warst eine Ewigkeit weg. Ich habe mir große Sorgen gemacht.«
Dennis antwortete nicht. Er schüttelte nur leicht den Kopf. Das Shirt, das er trug, färbte sich langsam rot.
»Dennis! Wir müssen von hier verschwinden, sonst sterben wir«, sagte Lars, hob seine linke Hand, an der die Fingerkuppe des kleinen Fingers fehlte, und legte sie auf Dennis’ knochige Schulter.
»Ich habe Angst«, sagte Dennis nach einer Weile. Er erinnerte sich daran, was geschah, als sie es schon einmal probierten.
»Ich auch, aber wir müssen es riskieren!«
Dennis atmete schwer. »Lars. Das haben wir schon einmal versucht. Er hat uns halb tot geprügelt. Hast du das schon vergessen?« Er legte eine kurze Pause ein. »Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin doch nur ein kleines Kind.«
»Nein. Nein. Du bist ein großer Junge, hörst du? Du bist ein großer, starker Junge!« Lars versuchte, Dennis Mut zu machen. Doch er wusste, dass sie nicht mehr als hilflose, ausgehungerte und kraftlose Teenager waren. »Ich haue nicht ohne dich ab. Entweder du kommst mit oder wir krepieren beide hier.«
Dennis hob seinen Kopf und schaute Lars in die Augen. Sie wirkten leer und resigniert. »Hau ab ohne mich, für mich. Bitte. Vielleicht schaffst du es. Dann kannst du Hilfe holen. Ich bleibe hier.« Er senkte den Kopf und ließ sich auf das Bett fallen.
Lars blieb auf dem Bett seines Bruders sitzen. Er versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, wie und wann er den Versuch starten sollte, wieder zu fliehen. Die Erinnerung holte ihn ein, als sie im Hof Arbeiten verrichteten und sie von ihrem Vater, der im Hinterhof eine Zigarette rauchte, beobachtet wurden.
»Schaffst du es, über den Zaun zu klettern?«, fragte Lars damals seinen Bruder, der auf das Hindernis starrte.
»Ich weiß es nicht«, antwortete Dennis und zuckte mit der Schulter. »Was ist auf der anderen Seite?« Er wusste, dass es unendlich viele Bäume waren. Er sah sie täglich aus seinem Fenster. »Wie weit ist es, bis wir in Sicherheit sind?«
»Ich weiß es nicht. Aber wir müssen es riskieren. Was meinst du?«, fragte Lars.
Völlig unvorbereitet und ohne jegliche Absprache war Dennis plötzlich mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, los gelaufen und hatte: »Jetzt!« gerufen.
Lars war völlig überrascht gewesen, denn er meinte nicht jetzt und nicht heute. Er hatte den Laubbesen zur Seite geworfen und war Dennis hinterher gelaufen. Noch bevor sie an dem Zaun hochklettern konnten, hatten sie zwei Pranken am Shirt gepackt und sie zu Boden gedrückt. Vater tränkte sie in dem feuchten Schlamm, der sich vor dem Zaun angesammelt hatte, bis sie kurz davor waren zu ertrinken. Er zog ihre Köpfe aus dem Matsch und schlug die Kinder kurzerhand zusammen.
Tagelang konnten sie sich nicht bewegen und nicht richtig essen. Lars konnte sogar ein paar Tage nichts aus seinem linken Auge sehen. Beide erlitten Prellungen, sodass über mehrere Wochen kein Kunde sie mehr besuchen kam.
Damals waren sie allerdings noch ein paar Jahre jünger. Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Jahr für Jahr verloren die Brüder das Gefühl für die Zeit. Sie wussten nicht einmal mehr, wie alt sie überhaupt waren. Die Zeit heilt alle Wunden, sagt man, aber bei ihnen verursachte die Zeit immer größere Seelenschmerzen.
Lars schluckte einen schweren Kloß herunter, während er sich erinnerte. »Einverstanden. Ich werde Hilfe holen«, sagte er. »Ich hol dich hier raus, das schwöre ich dir«, versprach er. Dennis war eingeschlafen und hörte ihn nicht mehr.
Vater, ein großer, kräftiger Mann mit einer rasierten und tätowierten Glatze, betrat das Zimmer der Kinder. Er stellte ein Tablett mit zwei Scheiben Brot, Käse und zwei Gläsern Wasser, auf den Tisch mitten im Raum, eine Mahlzeit, die Lars und Dennis täglich serviert bekamen. Morgens gab es Brot mit Wurst, die meistens abgelaufen war, und ungesüßten Tee. Zu Mittag gab es oft die Reste, die die Eltern nicht zu essen schafften. Wenn überhaupt.
Vater schaute auf den schlafenden Dennis und drehte sich um, um nach Lars zu sehen, der ihn in diesem Moment ansprang und ihn mit der Faust auf die Stirn traf. Der ein Meter neunzig große Mann hatte seinen Kopf kaum bewegt und fasste Lars im Nacken, als dieser die Flucht durch die Tür versuchte. Er zog ihn zu sich und versetzte ihm einen Schlag in die Bauchgegend. Wie damals. Mit der anderen Hand schlug er die Tür von innen kraftvoll zu.
Dennis wurde wach und schlug die Augen auf.
An Schmerzen war Lars gewöhnt, trotzdem krümmte er sich, hielt sich mit seiner Hand die Rippen und richtete sich langsam wieder auf. Mit zitternden Knien schaute er seinem Vater in die Augen. Der Vater sagte kein Wort und kam erneut auf Lars zu. Alleine sein Blick und seine Körperhaltung waren furchteinflößend.
Hasserfüllt hielt Lars dem Blick stand und atmete tief und schnell. Ehe Lars reagieren oder nachdenken konnte, traf ihn erneut die Faust des Vaters, dieses Mal ins Gesicht, und Lars fiel auf den Tisch, auf dem das Essen stand. Ein Glas, das zu Boden fiel, zerbrach, als Lars mit dem Gesicht auf ihm aufschlug. Ein langer Schnitt bildete sich über seinem Auge und zog sich über die Wangen bis zu Lippe. Lars hielt sich seine Hände vor das blutige Gesicht, zuckte schmerzhaft zusammen und zog sich eine Scherbe aus seiner Augenbraue. Das Blut tropfte auf den Teppich.
Es ist vorbei, dachte er sich. Wir werden hier nie wegkommen.
Im selben Augenblick hörte Lars, wie Dennis vor Schmerzen winselte. Als er den Kopf hob, sah er seinen kleinen Bruder auf dem Boden vor Vaters Füßen liegen.
»Dennis!«, rief Lars.
Dennis, der zwei Kopflängen kleiner war als der Vater, hatte den Riesen von hinten angegriffen, indem er auf seine Schulter gesprungen war. Mit nur einer Hand riss der Vater Dennis von sich und warf ihn mühelos zu Boden. Dann trat er den am Boden liegenden, wehrlosen Dennis in den Bauch.
»Nein! Hör auf!«, flehte Lars.
Der Traum von Freiheit war endgültig vorbei.
Der Mann hörte nach nur wenigen Tritten auf.
»Ihr kommt sofort runter, ihr kleinen Bastarde«, brüllte der Vater den Kindern zu. »Sofort«, fügte er hinzu. »Ihr werdet es bereuen, jemals geboren worden zu sein, ihr kleinen Wichser.«
Der Mann schlug die Tür mit einem Knall hinter sich zu. Dann lief er die Treppen hinunter ins Wohnzimmer, um eine angemessene und gerechte Strafe für die Kinder vorzubereiten.
Eine Zeitlang lagen beide Jungs auf dem Boden und stöhnten vor Schmerz. Dennis, der sich kraftlos robbend als erster bewegte, kroch mühsam auf Lars zu. Er zog einen Stuhl, der umgekippt war, aus dem Weg, schob das Tablett zur Seite, kniete sich vor Lars hin und wischte ihm vorsichtig das Blut aus dem Gesicht.
»Tut es sehr weh?«, fragte Dennis und reichte Lars seine Hand. Er sah in seinem Gesicht, dass die Schmerzen unerträglich sein mussten. »Komm, Lars«, fügte er hinzu, ohne eine Antwort abzuwarten. »Lass uns runtergehen. Vielleicht haben wir Glück und sterben noch heute Abend.«
Lars wischte sich mit seinem Handrücken das Gemisch aus Blut und Tränen von den Wangen und schaute Dennis durchdringend an. Er versuchte, sich zu erheben, ließ sich aber gequält wieder auf den Boden sinken. Zitternd streckte er Dennis seine Hand entgegen, und unter Schmerzen erhoben sie sich beide.
Dennis’ Augen wirkten müde, erschöpft und eingefallen. »Das ist dann doch auch eine Art von Freiheit ... Oder nicht?«, fügte er hinzu und schenke Lars ein schmerzhaftes, aber ehrliches und ernst gemeintes Lächeln. Er hoffte, ja, er wusste, dass es heute passierte und sie ihre längst verlorene Freiheit Erlangen würden, indem sie sterben.
1
Dreizehn Jahre danach.
Fear your heart in the wintersun, prefer one part and the better side in me. Fear your heart to attract the wintersun, you will find some purple things inside! ... ”
Katrin Raaf unterbrach ihren schiefen Gesang. Sie näherte sich in ihrem schwarzem Ford Puma einer schmalen Kreuzung am Stadtrand von Saarlouis. Sie ließ sich von zwei Jugendlichen zu ihrer linken Seite ablenken. Die Jungs hielten ihre Köpfe zum Smartphone gesenkt. Aufgrund der ungewöhnlich warmen Tage trugen sie bereits sommerliche Kleidung, kurze Shorts und T-Shirts. Einer von ihnen trug eine Baseballmütze, den Schirm nach hinten gezogen, der zweite trug einen Pork-Pie-Hut.
»Hey, pass doch auf, du blöde Kuh«, schrie ein Mann in den Vierzigern. Er fuhr, trotz zunehmender Dunkelheit ohne Licht auf seinem Fahrrad, und mit hoher Geschwindigkeit mitten auf der Kreuzung. Er konnte der Frau in dem Kleinwagen gerade noch ausweichen, indem er bremste. Dabei löste er seine Schuhe von den Klicks und fing mit seinem rechten Bein den drohenden Sturz ab.
»Es ist Februar, Jungs«, sagte Katrin leise zu sich selbst. Ihre Worte wurden von der lauten Musik in ihrem Auto übertönt. Aber sie befand sich schon mitten auf der Kreuzung, auch wenn sie nur noch Schrittempo fuhr. Sie sah zu den Jungs und schüttelte den Kopf.
Die Jugendlichen blieben stehen und senkten ihre Smartphones. Dabei drehten sie ruckartig ihre Köpfe zum Auto, in dem Katrin saß.
Katrin war sichtlich überrascht, dass die jungen Männer sie gehört hatten. Sie ahnte noch nicht, dass die beiden durch die Schreie des Radfahrers auf sie aufmerksam geworden waren. Sie wollte ihre Fahrt fortsetzten, schaute nach rechts und zuckte leicht zusammen. Sie sah einen Mann, wild mit seinen Händen gestikulierend und schreiend. Sie hielt sofort an und öffnete die Scheibe.
»Hast du keine Augen im Kopf?«, rief der Radler.
»Tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Ist alles in Ordnung?«, fragte Katrin, nachdem sie die Musik im Auto ausgeschaltet hatte.
Der Mann hob seine flache Hand. »Rechts vor links, du blöde Nudel«, beschimpfte er leicht gebeugt die Frau in ihrem Auto. Sein Kopf war rot vor Zorn und Anstrengung.
»Ich habe mich doch entschuldigt. Ich habe Sie wirklich nicht gesehen. Und beleidigend müssen Sie auch nicht werden«, meinte Katrin und schloss kopfschüttelnd das Fenster ihres Wagens. Sie legte den Gang ein und setzte ihre Fahrt fort.
Der Radler schrie Katrin noch etwas hinterher und schüttelte ebenfals energisch den Kopf.
Einer der Jungs machte einen Schritt auf die Bordsteinkante. »Ist alles in Ordnung?«, fragte er den Radfahrer.
»Alles okay, danke«, antwortete dieser und hob dankend seine Hand.
Der andere Junge schaute der Frau hinterher, wie sie etwa einhundert Meter weiter rechts abbog, in die Straße, in der sie wohnte.
Katrin klopfte mit ihren Zeigefingern den Rhythmus von „Behind your Fear - Wintersun“. Sie näherte sich ihrer Doppelhaushälfte mit weißer Front und einem Steingarten, in dem zwei große Bambussträucher wuchsen. Links neben dem Haus befand sich ein gepflasterter Stellplatz. Sie parkte ihren Ford neben dem Auto ihres Mannes, stieg aus und nahm ihre Sporttasche aus dem Kofferraum.
Ihre Lippen formten ein Lächeln, als sie aus dem Wohnzimmerfenster bunte Discolichter strahlen sah. Laute Rockmusik schallte bis auf die Straße.
Auf der anderen Straßenseite bellte ein Hund am Zaun.
»Hallo Katrin«, rief jemand.
Katrin schaute auf die benachbarte Doppelhaushälfte. Steffan - ihr Nachbar - grüßte sie freundlich mit erhobener Hand. In seiner Hand leuchtete wie ein Glühwürmchen in der Dämmerung die Glut einer Zigarette. Er stand in seinem liebevoll gepflegten Vorgarten.
»Hallo Steffan, alles klar?«, antwortete Katrin kurz und wollte weiter zur Haustür gehen.
»Katrin, warte mal!«, rief Steffan ihr hinterher und hob seine Hand.
Katrin stellte ihre Tasche ab und näherte sich ihm. Sie begrüßte ihn mit einer Umarmung und einem Duckfacekuss links, rechts auf die Wangen.
»Hör mal, es ist mir unangenehm, aber ... die Musik«, Steffan zog an seinem Glimmstengel, »könnt ihr die etwas leiser machen? ... Nicht, dass es mich stört ... aber ich habe Nachtschicht, und es war ein beschissener Sonntag für mich.« Er schaute kurz auf den Boden, wo er die Glut der Zigarette abstreifte. »Ich möchte mich gerne noch etwas hinlegen. Verstehst du?«
Steffan Kirschbaum arbeitete im DRK-Krankenhaus als Krankenpfleger. Er war Mitte fünfzig, klein, kräftig, hatte eine Mönchfrisur, die er momentan mit einer Mütze abdeckte, und er hatte eine leicht krumme Nase. Sein Äußeres war nicht das Ansehnlichste, und es erschwerte ihm, eine Frau zu finden, die ihn so liebte, wie er war, und so blieb er alleinstehend.
»Natürlich, tut mir leid, ich mach die sofort aus«, sagte Katrin, wich ein paar Schritte zurück, weil sie es eilig hatte, und hob ihre Tasche wieder auf.
»Leiser würde schon genügen ... danke dir, Katrin«, sagte Steffan und zog erneut kräftig an seiner Zigarette.
»Du solltest damit aufhören, die bringen dich noch um.«
»Als wenn ich das nicht wüsste.« Steffan verzog seine Lippen zu einem übertriebenen Grinsen und winkte ab. Er zog noch einmal kräftig und schaute Katrin hinterher, wie sie die zwei Stufen hoch ins Haus ging.
Als Katrin das Haus betrat, bemerkte niemand ihr Kommen. Sie stellte ihre Sporttasche vor der Kellertreppe ab, neben einem bereits fertig gepackten Reisekoffer und einem kleinen Handgepäck. Dann zog sie ihre Jacke aus, hängte sie an die Garderobe und durchquerte den Flur, der mit zahlreichen Familienfotos versehen war. Sie betrat mit tänzerischer Körperbewegung das Wohnzimmer. Zwei Schritte links, zwei rechts, eine Drehung. Die Arme hatte sie erhoben und die Lippen nach oben gepresst. Als sie in der Mitte des Raumes stand, zwischen den weißen Kissen, die sonst die dunkelbraune Couch schmückten und nun verstreut auf dem Boden lagen, schüttelte sie kreuz und quer ihre Haare.
Die bunten Lichter, die aus einer kleinen Discokugel strahlten, erhellten den Raum.
Auf der Couch tanzte ein kleiner Junge, der eher unrhythmisch hüpfte, die Hände abwechselnd links, rechts, hoch, runter schwang und laut: »Flyyyyinnnng Spagheeetti Monsteeer« schrie. Er trug ein blaues T-Shirt mit der Figur von Bob, dem Baumeister und eine schwarze Freizeithose mit einem weißen Streifen an der Seite.
Kai sprang Katrin um den Hals und klammerte sich mit seinen Beinchen um die Hüfte seiner Mutter. »Hallo Mama! Wir machen eine Party«, rief er, als die Musik, die aus den Hi-Fi-Stereolautsprechern dröhnte, aufhörte.
»Das sehe und höre ich, Schatz«, sagte Katrin und gab ihm einen dicken Kuss auf den Mund. Sie schaute zu Rouven, der vor dem stumm geschalteten Fernseher auf den Knien Luftgitarrensolo spielte. Er trug eine graue Freizeithose mit Gummizug und ein schwarzes Shirt mit „Tortuga“ – Aufschrift aus der Saaribik.
Gerade, als das nächste Lied begann, beendete Katrin die Party, indem sie die Hi-Fi-Anlage ausschaltete.
»Hallo mein Täubchen«, sagte Rouven ganz außer Atem. Er erhob sich übertrieben mühsam und gab Katrin einen kurzen, flüchtigen Kuss auf den Mund.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte Katrin. »Oder soll ich wegen deiner epileptischen Anfälle einen Arzt rufen?« Sie lachte laut auf.
Rouven richtete sich seine Jogginghose und grinste zu Katrins Bemerkung. Seine langen Haare band er sich mit einem Haargummi zu einem Pferdeschwanz zusammen.
»Wow, da habe ich aber was verpasst«, sagte Katrin freudestrahlend zu Kai. Sie schaute zu Rouven und sagte: »Steffan hat mich gebeten, die Musik leiser zu stellen. Er will sich vor der Nachtschicht noch hinlegen.«
Rouven verzog sein Gesicht. »Oh weh, das wusste ich nicht«, sagte er und fragte Katrin: »Wie war dein Lauf?«
»Anstrengend. Vero kam auf die Idee, HIIT zu laufen. Aber ja - es hat Spaß gemacht«, sagte Katrin und drückte Kai fest an sich.
»Ich hatte Spaß«, sagte Kai mit kindlicher Stimme und drückte seine Mutter fest zurück.
»Spaß? Laufen ist ja okay, aber sich durch das Intervalltraining so kaputtmachen zu müssen? Ich weiß nicht, ob das Spaß macht«, meinte Rouven, der nicht viel weniger außer Atem war, als Katrin nach ihrem Training.
»Probiere es doch auch mal aus. Würde deinem Bauch sicherlich auch gut tun«, meinte Katrin und klopfte Rouven zwei Mal auf seinen Bauch, der alles andere als dick war. Sie hatte jedoch Spaß daran, so zu tun, als wenn er es wäre.
Katrin verließ das Wohnzimmer mit Kai auf den Armen und ging in die Küche. Rouven zog den Stecker der Halbkugel mit den bunten Lichtern, die Kai gehörte, und folgte ihr.
Sie setzte Kai an den Esszimmertisch, an dem bis zu zwölf Personen Platz fanden, der auf der rechten Seite des offenen Küche-Esszimmer-Kombiraums stand. Sie stellte ihm Nusscreme, Brot und Kakao hin, Kais Lieblingsabendessen.
Auf der linken Seite stand die Küche, die in einer L-Form angeordnet war. Die Wände waren zum Teil mit Naturstein verkleidet und zum Teil hellbraun auf Rauhputz gestrichen.
»Was habt ihr heute noch so Schönes gemacht?«, fragte Katrin Kai und beugte sich tief zu ihm, um in seine nahezu schwarzen Augen schauen zu können. Sie strich ihm über seine kurzen, schwarzen Haare.
»Ich habe sieben Zombies und neun Monster gekillt, Mama!«
Rouven zuckte zusammen. Er stand gerade am Herd der freistehenden Kochinsel, die die Küche vom Esszimmer trennte, und schmeckte die Soße ab, die er für sich und Katrin kochte. Er würde sich jetzt nicht umdrehen, auch wenn er die ganze Soße kosten müsste, denn er wusste, dass Katrin ihn vorwurfsvoll anstarren würde. Und er hatte recht.
Katrin schaute streng auf Rouven und wusste auch, dass er sich jetzt nicht umdrehen würde.
»Ich mache Lachsfilet mit Bandnudeln für uns«, sagte er, als er sich mit dem Löffel im Mund doch langsam zu Katrin umdrehte. Ihre Blicke trafen sich, und Katrin setzte einen strengen Blick auf.
»Du weißt, dass ich das nicht leiden kann, wenn du so was mit ihm zockst. Er ist erst fünf«, flüsterte Katrin mit ernster Stimme.
Rouven nahm langsam den Löffel vom Mund und senkte seinen Kopf. »Sieben Zombies«, murmelte er kaum hörbar.
Katrin weitete mahnend ihre Augen und schüttelte ihren Kopf.
»Und neun Monster«, fügte Kai hinzu, blies durch den Strohhalm Luftblasen in den Kakao und hielt die Finger seiner beiden Hände hoch, die er wie Pistolen nach einem abgegebenen Schuss bewegte.
Rouven fuhr erneut zusammen. »Ich koche für uns«, wiederholte er sich. »Ich mach das Essen fertig, wenn Kai im Bett liegt.«
Katrin antwortete nicht. Sie war sauer. Sie hasste es, wenn Rouven gewalttätige Spiele mit Kai spielte. Es gab genügend andere, altersgerechte Spiele im Regal: Holzpuzzle mit Buchstaben, ein Malkasten, „Unbongo Junior“, „Lotti Karroti“ oder „Zicke Zacke Hühnerkacke“.
Kai schob sich das letzte Stück Brot in den Mund und trank den Kakao aus. »Fertig«, rief er mit noch vollem Mund und einem süßen Schnurrbart aus Kakao und Nusscreme über den Lippen.
»Na, dann spring auf meine Schulter, jetzt gehen wir uns waschen.« Katrin drehte sich um, Kai sprang auf ihren Rücken, und sie gingen ins Bad.
»Mama, wenn Papa weg ist, fahren wir dann mal wieder Schwimmen?«, fragte Kai und schäumte sich ordentlich die Hände ein.
»Ja, das ist mal eine gute Idee! Ich habe noch zwei Tage Urlaub. Sollen wir dann da hinfahren, wo die drei Rutschen sind?«, schlug Katrin vor.
»Oh ja! Morgen?« Kai freute sich schon.
»Dienstag. Okay? Morgen kann ich leider nicht.«
»Okay«, meinte Kai und wusch sich sein Gesicht. »Mama, ich fahre mit Opa Louis in den Baumarkt. Er baut mit mir eine Schaukel mit einer Rutsche!«
»Ja, ich weiß, du wirst noch ein richtiger Handwerker«, sagte Katrin.
Kai hob seinen Kopf. »Haw, haw, haw«, rief er, wie einst der beliebte Heimwerker-King aus der Fernsehserie.
»Wer hat dir denn das beigebracht?«, fragte Katrin lachend.
»Opa Louis«, sagte Kai und steckte sich die Zahnbürste in den Mund.
»Aber glaubst du nicht auch, dass in deinem Zimmer zu wenig Platz für eine Schaukel mit einer Rutsche ist?«, sagte Katrin und hielt den Schlafanzug für Kai bereit.
Kai legte sich eine Hand an die Stirn. »Doch nicht in meinem Zimmer«, sagte er mit der Zahnbürste im Mund und lachte. Er zog die Zahnbürste aus dem Mund und hielt sie in der Hand. »In seinem Garten. Dann kann ich bei Opa Louis und Oma Thalia immer im Garten spielen, wenn wir da sind. Und einen Sandkasten baut er mir auch.« Kai steckte sich wieder die Zahnbürste in den Mund und putzte sich weiter die Zähne.
Der Schaum, den Kai nach dem Zähneputzen ausgespuckt hatte, war zart rosa verfärbt. »Mama, guck mal«, rief Kai leicht erschrocken.
»Mach mal deinen Mund auf«, sagte Katrin und schaute sich seine Milchzähne an. »Du hast einen Wackelzahn«, sagte sie und strahlte vor Freude.
»Wenn er ausfällt, dann kommt die Zahnfee zu mir!« Kai freute sich. Er streckte beide Arme aus, damit Katrin ihm sein Schlafanzug Oberteil anziehen konnte, dann beugte sie sich zu ihm und zog ihm die Schlafhose an.
»Mama, ich will mal wieder in den Zoo. Fahren wir morgen in den Zoo? Bitte!«
»Morgen kann ich ja leider nicht. Und Dienstag gehen wir Schwimmen. Aber vielleicht fährt Oma Ilona mit dir am Mittwoch in den Zoo? Sie kommt dich ab Mittwoch wieder von der Kita abholen, weil Mama wieder arbeiten muss. Wir fragen sie morgen. Okay?«
»Juhu!«, rief Kai laut und hob beide Hände, während er im Badezimmer hin und her sprang. »Ich gehe Papa meinen Wackelzahn zeigen!«
Kai lief vom Bad in die Küche, wo Rouven für sich und Katrin den Tisch deckte und gerade die Weingläser auf die Tafel stellte.
Rouven hob Kai auf seine Arme und drückte ihn ganz fest an sich. Er schaute noch einmal in den Flur, wo er Katrin erwartete. Aber sie kam nicht.
»Papa guck, mein Zahn wackelt. Du musst unbedingt der Zahnfee das Fenster aufmachen!«
Rouven lachte. »Zeig mal.«
Kai breitete sein Lächeln aus. »Hier«, sagte er und drückte mit seinem Finger gegen den Schneidezahn, der sich ganz leicht bewegte.
»Ja, dein erster Wackelzahn. Das ist schön. Dann müssen wir unbedingt achtgeben, dass das Fenster aufsteht, wenn er dir ausfällt«, sagte Rouven und drückte Kai einen Kuss auf die Wange.
»Bringst du mich ins Bett, Papa?«
»Aber natürlich.«
Rouven ging mit Kai die Treppen nach oben in den ersten Stock und schaute noch einmal in Richtung Bad. Aber Katrin kam immer noch nicht raus.
»Ich glaube, Mama ist sauer auf Papa«, sagte Rouven und verzog die Lippen.
Ein vertrauter Schmerz überkam Rouven beim Betreten des Kinderzimmers. Wie schon so oft trat er auf ein Bauklötzchen, das auf dem Boden im Zimmer rumlag, und grölte einen lauten Schrei aus.
Kai lachte laut auf, als Rouven mit ihm an der Hand auf einem Bein durch Zimmer hüpfte.
»Wann kommst du wieder, Papa?«, fragte Kai und sprang ins Bett.
»Ich bin in zehn Tagen wieder da. Ich ruf dich auch jeden Tag an, versprochen«, sagte Rouven und nahm ein Gute–Nacht–Bilderbuch aus dem Regal.
»Wie viel ist das?«
»Zehn Mal schlafen.«
»Ich werde dich vermissen und deine Gute-Nacht-Geschichten.« Kai riss die Bettdecke zur Seite und fiel Rouven nochmal um den Hals, der sich zu ihm auf das Bettchen setzte. »Hab dich lieb, Papa.«
»Ich dich auch, mein Großer. Ich dich auch. So, jetzt legst du dich aber hin, und ich lese dir noch eine Geschichte vor«. Rouven deckte Kai zu und schlug das Bilderbuch mit Tieren und Gegenständen auf.
»Nein, du liest nur Blödsinn«. Kai lachte. »Erzähl mir eine ausgedachte Geschichte mit ohne Buch, eine von dir, die mag ich am liebsten.« Kai nahm sein Lieblingskuscheltier, einen grauen Elefanten, in die Hand. Er drehte sich zu Rouven, der sich jetzt auf den Boden kniete und mit einer seiner frei erfundenen Geschichten begann, in denen Kai immer die Hauptrolle spielte und von seinen Freunden aus dem Kindergarten begleitet wurde.
Als Rouven mit der Geschichte fertig war, beugte er sich über Kai und küsste ihn noch einmal auf die Stirn. »So, und jetzt schlaf schön, mein Großer. Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Papa. Hab dich lieb.«
Rouven drehte sich um, machte einen großen Schritt über das Bauklötzchen und verließ das Zimmer. Einen Moment verharrte er noch an der Tür und schaute auf seinen Sohn.
Jedes Mal, wenn er beruflich weg musste, schmerzte es ihn. Dabei spielte es keine Rolle, ob es für drei Tage oder drei Wochen war. Aber er mochte seine Arbeit und tat sie auch gerne. Und den extra Verdienst konnten sie auch gut gebrauchen, wenn sie sich etwas Außerplanmäßiges gönnen wollten.
»Bis bald, mein Zombie-Killer«, flüsterte er und schloss die Tür.
Rouven stockte der Atem, als er durch die Tür zur Küche eintrat. Katrin hatte sich für den heutigen Abend umgezogen. Er sah sie in ihrem dunkelroten, schulterfreien Minikleid, das nur wenig ihrer schlanken Beine bedeckte. Ihr pechschwarzes, noch etwas nasses Haar hing ihr leicht gelockt bis über die Schulter. Sie stand barfuß vor dem Tisch im Esszimmer, in dem sie für eine romantische Atmosphäre sorgte. Sie zündete Kerzen auf dem Tisch an und schaltete das Licht aus. Im Hintergrund ließ sie über einen Bluetoothlautsprecher, der auf einer alten, massiven Vitrine stand, in der das „Manufacture Rock Glow”-Geschirr von Villeroy & Boch verstaut war, „Lighthouse in Darkness“ leise abspielen, eine melancholische Band, die ihrer beider Geschmack traf.
Rouven, der immer noch das „Tortuga“-Shirt, seine graue Jogginghose und schwarze Socken mit Loch an der Ferse trug, schlich sprachlos auf Katrin zu, die gerade den Wein entkorkte.
»Wow!« Rouven sah Katrin tief in ihre schwarzen Augen, nahm ihr den Wein und den Korken aus den Händen und stellte beides auf dem Tisch hinter ihr ab, sodass er sie bereits umarmte.
Katrin hob lächelnd ihre Hände und legte sie um seinen Nacken.
»Du siehst umwerfend aus, mein Täubchen.« Er legte seine Nase auf ihre, strich durch ihr feuchtes, schwarzes Haar und küsste sie feurig. Katrin legte ihr Bein um seines.
Piep piep ... piep piep ... Das Geräusch der Herdplatte unterbrach sie. »Die Bandnudeln sind fertig«, sagte Rouven fast schon enttäuscht und nahm seine Hand von Katrins Hintern. Er schaute auf den Backofen. »Das Lachsfilet ist auch gleich fertig«, fügte er hinzu und kniff ihr noch in die Po-Backe.
»Hör mal, Rouven«, sagte Katrin mahnend und schenke den Wein in die Rotweingläser ein. »Du machst mit Kai Sachen, die mir nicht gefallen. Zombies killen und so einen Scheiß. Unternimm doch mal etwas Altersgerechtes mit ihm. Geh mit ihm auf den Spielplatz, bring ihm das Schwimmen bei. Viele Kinder in dem Alter haben schon das Seepferdchen. Oder bring ihm das Fahrradfahren bei. Er ist fünf, in April schon sechs, und fährt immer noch mit Stützrädern.«
»Du hast Recht«, gab Rouven zu, während er die Nudeln in ein Sieb schüttete und sie in eine Schüssel umfüllte. Er nahm den Fisch aus dem Backofen, den Katrin nach dem Duschen hineingestellt hatte, und servierte liebevoll das Essen. Wie ein Gentleman zog er Katrin den Stuhl zurück. »S’il vous plaît, ma colombe.«
»Merci«, sagte Katrin und setzte sich. »Hast du bereits alles gepackt?«
»Natürlich. Sollte ich etwas vergessen haben, muss ich es mir halt vor Ort kaufen.« Rouven ging um den Tisch und nahm Katrin gegenüber Platz.
»Zehn Tage. Ich mag es nicht, wenn du verreisen musst«, meinte Katrin, nahm eine Gabel mit dem zarten, in Soße getunkten Lachsfilet und zog eine Augenbraue hoch, während sie mit ihrem Kopf anerkennend nickte.
»Kommt ja zum Glück nicht so oft vor.«





























