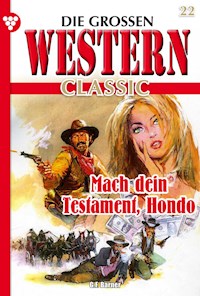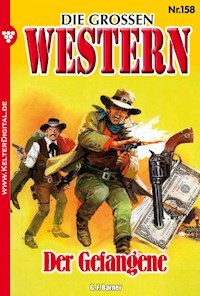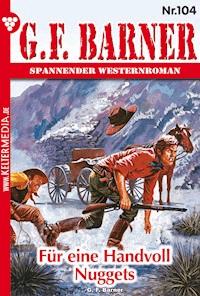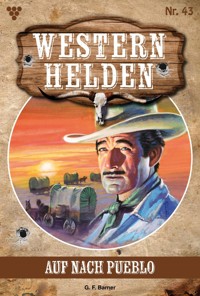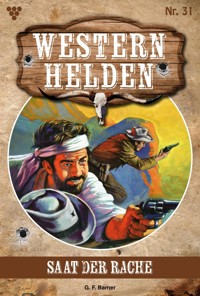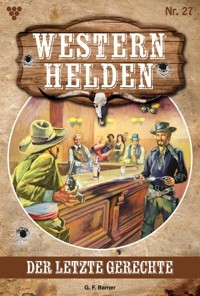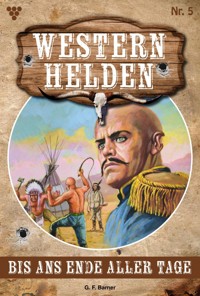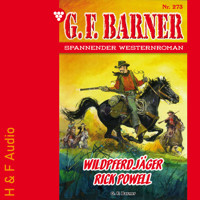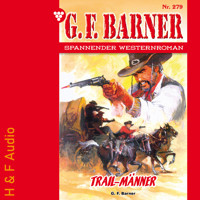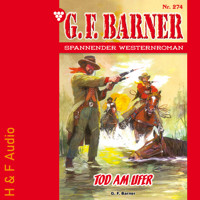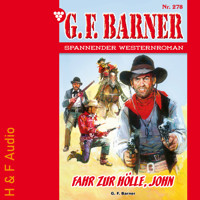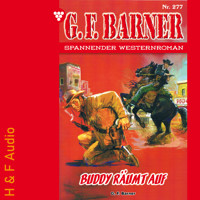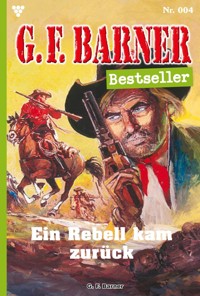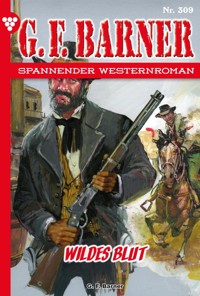
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. »Da hast du den Rest, du verdammter Feigling!« sagt der eine. Eine junge Stimme, aber grimmig. »Dir werden wir die Flausen austreiben, Spinner!« sagt der andere. Eine Stimme, aber krächzend, abschreckend rauh, wie wenn Mühlsteine sich reiben. »Du schwarzer Donovan-Teufel sollst auf den Knien rutschen, wenn du in Zukunft einen von den McBruns begegnen wirst!« sagt der eine voller Gift und Galle. Er weiß nicht, was er sagt, aber der Haß gegen alles, was Donovan heißt, muß wohl tief in ihm sitzen. »Da liegst du mit deiner hübschen Larve im Dreck«, sagt der andere zischelnd und mit ausgemachter Boshaftigkeit. Aber er weiß, was er sagt, denn er hat in seinem Leben nie anders geredet. Zwanzig Jahre hat der großohrige, dicknasige, ewig unrasierte Pedro Alondra hinter sich gebracht. Bärbeißiger Streithahn aus Leidenschaft, unzufrieden von Geburt an. Wenn es was auf der Welt anzupöbeln gibt, ist er dabei. Pedro Alondra – Mexikaner, aber einer von der ganz miesen Sorte. Und Tony Donovan liegt mit der Nase im Dreck. »Laß ihn liegen!« sagt der eine wieder. »Daran schluckt er noch lange.«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 309 –Wildes Blut
G.F. Barner
»Da hast du den Rest, du verdammter Feigling!« sagt der eine.
Eine junge Stimme, aber grimmig.
»Dir werden wir die Flausen austreiben, Spinner!« sagt der andere.
Eine Stimme, aber krächzend, abschreckend rauh, wie wenn Mühlsteine sich reiben.
»Du schwarzer Donovan-Teufel sollst auf den Knien rutschen, wenn du in Zukunft einen von den McBruns begegnen wirst!« sagt der eine voller Gift und Galle.
Er weiß nicht, was er sagt, aber der Haß gegen alles, was Donovan heißt, muß wohl tief in ihm sitzen.
»Da liegst du mit deiner hübschen Larve im Dreck«, sagt der andere zischelnd und mit ausgemachter Boshaftigkeit.
Aber er weiß, was er sagt, denn er hat in seinem Leben nie anders geredet. Zwanzig Jahre hat der großohrige, dicknasige, ewig unrasierte Pedro Alondra hinter sich gebracht. Bärbeißiger Streithahn aus Leidenschaft, unzufrieden von Geburt an. Wenn es was auf der Welt anzupöbeln gibt, ist er dabei.
Pedro Alondra – Mexikaner, aber einer von der ganz miesen Sorte.
Und Tony Donovan liegt mit der Nase im Dreck.
»Laß ihn liegen!« sagt der eine wieder. »Daran schluckt er noch lange.«
Und Pedro Alondra spritzt das letzte Gift hinterher: »Schlucken – das ist gut, Cliff! Dreck reinigt den Magen. Dieses hochnäsige Donovan-Gesindel sollte nie mehr was anderes im Kochtopf haben, nur Dreck.«
Der schwarzköpfige Cliff McBruns mit dem kantigen Irenschädel ist zwei Jahre jünger als der giftspeiende Mexikaner-Bursche.
Der dickschädlige, breitschultrige, schmalhüftige Cliff in dem buntkarierten Hemd und der enganliegenden Levis-Hose geht auf den im Dreck liegenden Tony Donovan zu und kniet vor dem Jungen nieder.
*
»He, komm schon, wach auf, du lumpiger Donovan! Für heute reicht’s!«
Aber Anthony Donovan tut ihm den Gefallen nicht. Erst hat er sich gewehrt, aber dann kamen die beiden über ihn und haben ihre Wut ausgelassen.
Einer gegen zwei?
Tony liegt mit der Nase im Dreck und schläft. Wenn er aufwacht, wird er um eine Erfahrung reicher sein und sich etwas vornehmen.
Dann wird er den McBruns die Pest an den Hals wünschen – dieser verbohrten Sippschaft mit ihrem Stolz, der ihnen noch mal das Genick brechen wird.
Cliff ist aufgestanden und schiebt seinen hochkrempigen Stetson umständlich zurecht. Dann lockert er das dunkelrote Halstuch, als hätte es ihm bis dahin die Luft abgeschnürt.
»Ist noch etwas?« fragt in diesem Augenblick der dicklippige Pedro bissig. Er hat sich vor seinem grauhaarigen Klepper postiert und spielt den Gelangweilten.
Cliff McBruns hört nichts – oder er will nichts hören.
»Wie wär’s mit ein paar Krokodilstränen zum Abschied? Aber das dürfte wohl nicht gut passen, nachdem der junge Mr. McBruns auf die Idee gekommen war, dem jungen Mr. Donovan eins auszuwischen, he?«
Cliff gibt eine Antwort, die wie ein zu großer Deckel für einen zu kleinen Topf wirkt.
»Komm her, Mex, ich brauche einen Steigbügel! Du bist doch stolz darauf, einem McBruns in den Sattel zu helfen, oder?«
Pedro steht immer noch wie gelangweilt vor seinem Zossen. Aber der ewig Unrasierte hat die Worte, die beleidigend und verächtlich geklungen haben, sehr genau gehört. Nur, er reagiert anders als jemand, dessen Ehre dadurch verletzt worden wäre.
Pedros wulstige Nasenflügel blähen sich schnaufend, dann fährt sich der Mexikaner in der abgewetzten grauen Leinenjacke mit dem dichtbehaarten Handrücken der Rechten über das stoppelbärtige Kinn.
Pedro macht die fünf Schritte auf den zweitältesten Sohn der Mabel McBruns zu und steht dann direkt vor dem rassigen Araber-Hengst und dessen Reiter, der den Mexikaner kaltblütig fixiert.
Pedro neigt seinen Oberkörper nach vorn, verschränkt die Finger beider Hände und formt sie dann wortlos zu einem Steigbügel.
Cliff schiebt sofort seine linke Fußspitze hinein und drückt sich mit dem rechten Fuß kräftig ab, schwingt sich in den Sattel und umklammert fest die beiden Zügelenden.
Sekunden später reiten die beiden ungleichen Gefährten nebeneinander auf ihren galoppierenden Pferden zurück nach Riverby.
Zurück zur Lucky Hole Ranch.
Lucky Hole – Glückliches Loch!
Das Gebiet der Ranch dehnt sich über 650 acres. Fruchtbare Weiden ziehen sich entlang des gewaltigen Red River hin.
1200 wohlgenährte Rinder mästen sich mit dem saftigen Gras für die Schlachthöfe in California.
80 prächtige Hengste und Stuten stehen in den Corrals, um eines Tages zu einem durchschnittlichen Stückpreis von 400 Dollar ihren Besitzer zu wechseln.
Lucky Hole – Bonanza!
Cliff und Pedro reiten zurück in diese Goldgrube mit dem befriedigenden Gefühl, einem allzu ruppigen Sproß dieser Donovans eine nachhaltige Lektion erteilt zu haben.
Anthony Donovan war aus der Reihe getanzt, er wollte nicht mehr mitmachen.
*
»Tony?«
Jemand gleitet aus dem Sattel. Der junge Donovan hört es ganz deutlich und beginnt zu zittern. Aber warum kommt denn nur einer? Was habt ihr jetzt schon wieder vor?
Tony winkelt langsam die Arme an, schiebt die Hände unter seine Brust und stemmt sich leicht hoch, hebt den Kopf an. Da fällt sein Blick auf die Stiefelspitzen dicht vor sich.
Die sind ja dunkelbraun, denkt Anthony Donovan. Die von Cliff waren schwarz. Das – verdammt, was blendet mich denn da? Das ist doch…
Als Tony seinen Blick höher wandern läßt, trifft er genau mit dem des breitschultrigen Mannes mit der ärmellosen Elchleder-Weste zusammen.
»Sie – Sie, Sheriff?« fragt Tony verstört und atmet befreit auf.
Er hatte Angst, wahnsinnige Angst. In diesem Augenblick ist sie plötzlich wie weggewischt. Aber gleichzeitig kommt auch die Reaktion auf die vorangegangene Tortur.
Tony kippt zur Seite und bleibt auf dem Rücken liegen, atmet ganz flach.
Sheriff Bob Taylor geht vor dem Jungen in die Hocke und streicht mit der Rechten die verklebte schwarze Haarsträhne aus der faltenlosen Stirn mit der samtenen Haut.
»Tony«, sagt Bob Taylor und tupft mit seinem Taschentuch das Blut von den Schläfen, »was ist passiert? Tony, wer war’s? – Rede doch, Junge.«
Anthony Donovan hat sich von dem Schwächeanfall wieder etwas erholt. Er richtet sich langsam in Sitzstellung auf und blickt direkt in die graugrünen Augen des Sternträgers.
Ich kann es ihm nicht sagen, denkt Tony verbittert, sonst werde ich keinen Tag mehr Ruhe vor denen haben. Es ist oft genug deutlich gesagt worden: Wer quatscht, gilt als gemeiner Verräter.
»Ich habe dich etwas gefragt, Junge, und ich denke, du wirst mir eine Menge zu erzählen haben. Am hellichten Tag mitten in der Woche und zu einer Zeit, wo du eigentlich auf der Weide sein solltest – da passiert so etwas. Tony, wer war das? Rede, sonst wirst du deinem Dad noch einiges mehr erzählen müssen.«
Der junge Donovan wischt sich mit der lehmverschmierten Hand durchs Gesicht und fährt mit der Zunge über die Oberlippe.
»Sheriff, wenn – wenn ich einen Schluck zu trinken haben könnte?«
Bob Taylor richtet sich auf, steckt sein Taschentuch in die graugestreifte Wollhose.
»Warte, ich hol dir was«, sagt er und will nicht verstehen, warum Tony seinen Fragen ganz offensichtlich ausweicht.
Hinter dem Felsblock rascheln im dichten Gebüsch die Blätter. Ein trockener Ast bricht knackend.
Sheriff Taylor geht auf seinen Grauschimmel zu, schnallt die Satteltasche auf und zieht die pelzumschlagene Flasche mit dem Whisky heraus.
Als er die Kappe losschraubt und sich dabei umdreht, richtet rechts neben dem Felsblock der Mann in dem verdreckten roten Hemd und dem schwarzen Tuch, das das halbe Gesicht verdeckt, seinen langläufigen Colt auf den Sternträger.
Der dunkelhäutige Bursche mit dem ledernen Hutband und der schwarzen Cordjacke hat Anthony Donovan genau vor sich und hält ihn mit dem linken Arm fest umklammert. Die grobknochige Rechte liegt flach auf dem Mund des Rancher-Sohnes.
Auch von dieser Schwarzjacke ist nur das funkelnde Augenpaar zu sehen.
Links von dem Felsblock steht ein verwegener Typ, dem der rechte Arm fehlt. Die Manschette des graufarbenen Hemdärmels steckt locker in der Seitentasche. Die zurückgeschlagene grüne Cordjacke gibt eine grellrote Schleife frei.
Bob Taylor ist nie in seinem Leben so überrascht worden. Dies ist eine Situation, die ihm für Sekunden den Atem stocken läßt. Den Atem aber eines Mannes, dessen stählerne Nerven jene Kaltblütigkeit freilegen, die unheimlich wirkt.
»Was versprecht ihr Halunken euch von diesem Spiel?« fragt Taylor mit rauher Stimme.
»Halt’s Maul!« stößt die Schwarzjacke, die den jungen Donovan im Arm hält, zischelnd hervor. »Du fühlst dich groß, aber dein verdammter Blechstern hilft dir nicht, jetzt den kürzeren zu ziehen. Nimm die Pfoten hoch, Mann! Aber schnell, sonst…«
Sheriff Bob Taylor zeigt sich in seiner aufreizenden Gelassenheit so gelehrig, daß es fast unnatürlich aussieht.
Als die Aufforderung kommt, hat er die Hände auch schon in Schulterhöhe. Aber seine wachsamen Augen haben längst jede Einzelheit registriert.
Diese Rustler, sollten sie ihm jemals wieder begegnen, würde er unter tausend anderen herausfinden.
Der Schwarzhaarige mit dem ledernen Hutband macht drei Schritte zurück. Jetzt steht er dicht vor dem Buschrand, den Rancher-Sohn immer noch vor sich.
»Und nun dreh dich um, du Kröte!« geifert der dunkeläugige Bandit. »Steig auf deinen verschimmelten Klepper und hau ab. Na los, wird’s bald?«
Aber bevor sich Bob Taylor umdreht, gibt er gelassen und nicht ohne Grimm zurück: »Ich werde euch Ratten einen Strick drehen, wie ihr ihn noch nie gesehen habt! Diesmal habt ihr mich ausgetrickst, aber ihr seid nicht clever genug, einen Bullen wie ein sanftes Lamm abzuhäuten.«
Dann sieht Bob Taylor noch einmal den jungen Donovan an, dessen Mund noch immer von der Banditen-Pranke bedeckt ist, und fügt erbittert hinzu: »Keine Sorge, Tony, dieses Gesindel wird dich nicht lange behalten.«
Und als Sheriff Taylor im Sattel sitzt, dringt fast schmerzend die Gift und Galle spritzende Stimme an seine Ohren – eine Stimme, die er nie mehr vergessen wird: »Hau ab, Sternträger, sonst verbrenne ich dir den Pelz! Und laß es dir bloß nicht einfallen, uns nachzukommen.«
Der Sheriff von Riverby reitet los.
Er läßt einen Jungen zurück, der schon geschlagen war, bevor er ihm helfen konnte.
Und drei Männer mit schwarzen Tüchern unter den Nasen – er hat sie sich eingeprägt. Er wird sie jagen!
*
Sie sind nicht nur kaltblütig, sondern auch vorsichtig, die drei so ungleichen Burschen. Sie warten ab, bis der Sheriff von Riverby nicht mehr zu sehen ist. Erst dann kommt Bewegung in die Männer.
»Komm her, Filby!« sagt der verwegen aussehende junge Bursche mit dem ledernen Hutband und der schwarzen Cordjacke. Dabei nimmt er die Hand, die bis dahin den Mund Anthony Donovans gepreßt hielt, nach unten. Aber der andere Arm umklammert noch immer fest die Brust des Rancher-Sohnes.
Filby, der Rustler mit dem verschmutzten roten Hemd und den viel zu weiten Hosen in den kniehohen Stiefeln, rammt seinen klobigen Colt in das Halfter am schräg hängenden Gurt und kommt auf die beiden zu.
»Los, pack schon an! Wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren.«
»Das werden wir gleich haben«, krächzt Filby und grinst satanisch. »Wenn du mich fragst, Lopus, der Junge ist Gold wert. Wir werden ihn behandeln wie ein rohes Ei – hähähä!«
Sie nehmen Tony zwischen sich und schleifen ihn an dem Felsbrocken vorbei die 30 Yard durch das dichte Buschwerk.
Die Zweige streifen ihre Körper, ratschen schmerzhaft über die Gesichter. Tony ist dem Zusammenbruch nahe, er kann einfach nicht mehr. Er hängt wie ein Mehlsack in den Armen der Banditen. Er ist kaum noch fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
Der Einarmige mit der grünen Cordweste hat die ganze Zeit kein Wort gesagt. Jetzt kommt er als letzter auf die kleine Lichtung, auf der die drei Pferde stehen.
Ein Pinto-Hengst, ein Falbe mit einer dreieckigen Blesse und der Rotfuchs mit dem schwarzen Schweif.
Tony wirft nur einen kurzen Blick auf die Tiere, registriert sie nur im Unterbewußtsein. Aber dort prägen sie sich für den Tag ein, wo es diesen drei Rustlers an den Kragen gehen wird.
»Du, Lemmon, machst den Schluß!« bestimmt der schmalgesichtige Lopus. »Filby reitet voraus! Ich nehme dieses Greenhorn vor mir auf den Sattel und bleibe zwischen euch. Klar?«
»Klar!« brummt Filby und hält den jungen Donovan, bis sein Kumpan im Sattel des Falben sitzt. Gemeinsam wuchten sie dann den Jungen auf den Pferderücken. Lopus umklammert Tony sofort mit dem linken Arm.
Die kleine Gruppe der unheimlichen Reiter mit den düsteren Gesichtern setzt sich in Bewegung. Die Tiere bahnen sich hintereinander und mit hängenden Köpfen den Weg auf dem schmalen Pfad zwischen den Büschen.
Nach knapp einer Meile stoßen sie auf die weitflächige Senke, die sich mit ihren fruchtbaren Weiden bis zum Red River hinzieht und nur ab und zu noch mit kleinen Buschgruppen bestanden ist.
Bis zu diesem Augenblick ist kein Wort zwischen den Männern gefallen. Nun reiten sie im Schritt über die flachen Hügel entlang des schmalen Wasserbeckens, in dessen spiegelglatter Fläche sich die Sonnenstrahlen tausendfach wie in einem Bergkristall brechen.
Die flimmernde Hitze treibt immer neue Schweißperlen auf die glatte Stirn des Jungen, der ständig damit beschäftigt ist, die Angst niederzukämpfen.
Die Angst vor dem, was ihn noch erwarten mag.
Und Tony stößt die Frage heraus, ehe es ihm richtig bewußt wird.
»Was – was habt ihr mit mir vor?«
Der schwarzhaarige Kid, den sie Lopus genannt haben, und der Tony fest umklammert hält, räuspert sich.
»Ah, reden kannst du also auch«, meint er höhnisch. »Ich dachte schon, es hätte dir für immer die Sprache verschlagen.«
In Anthony Donovan beginnt es zu kochen – langsam, aber unaufhaltsam. Und dann fällt es wie Schuppen von seinen Augen. Eine Ahnung überkommt ihn, eine schreckliche Ahnung. Und mit ihr kehrt das in Tony zurück, was die Donovans zu einem harten Geschlecht werden ließ: der stählerne Wille, der unbeugsame Stolz, der Ekel vor Ratten, wie diese drei Rustler.
»Ich habe dich etwas gefragt, schwarzer Skunk!« stößt Tony zischelnd und verächtlich hervor. Dabei wendet er ruckartig den Kopf nach hinten und wirft einen lauernden Blick in das junge, aber verschlagene Gesicht des Banditen.
»Ich bin nicht schwerhörig«, kommt es schläfrig leiernd von hinten und mischt sich in das mißmutige Prusten des Falben, dem die doppelte Last nicht zu behagen scheint.
»Also, hör zu, du nachgemachter Pferdehändler: bevor wir unser hübsches Versteck erreichen, werde ich dir deine bösen Augen verbinden. Im übrigen wirst du dich über unsere Behandlung nicht zu beklagen brauchen. Hm, weißt du, unser Geschäft geht in letzter Zeit sehr schlecht, und du wirst uns helfen, na – sagen wir – uns als stiller Teilhaber wieder auf die Beine zu bringen.«
»Du mußt mich für einen ausgemachten Idioten halten«, gibt Tony bissig zurück.
»Das kannst du drehen, wie du willst, Kleiner«, erwidert die Schwarzjacke ungerührt. »Aber selbst wenn es so wäre, bleibst du für uns ein wertvolles Faustpfand. Dein Vater wird ja nichts unversucht lassen, dich so schnell wie möghich wieder zurückzukaufen. Kapiert?«
Tony kann nicht anders. Es würgt ihn in der Kehle. Das muß er erst mal ausspucken – so und so.
»In deinem bißchen Gehirn muß der Holzwurm sitzen, wenn du dir einbildest, damit einen Donovan einschüchtern oder aufs Kreuz legen zu können. Wenn Dad dich zwischen die Fäuste bekommt, wird er dich zerquetschen wie eine dreckige Laus! Du bist noch jung, Lopus, jung wie ich, aber du reitest einen Trail, der direkt in die Hölle fuhren muß. Ich kann dir nur eins raten: laß mich laufen, und für uns beide ist die Sache erledigt.«
»Du solltest Pastor werden, Kleiner«, erwidert die Schwarzjacke gähnend. »Und jetzt ist Schluß! Dein Geschwafel geht mir auf den Wecker. Einen Tag lang lasse ich deinen Alten noch ruhig schmoren, und übermorgen wird mein Freund Lemmon ihm einen Besuch abstatten und ein hübsches Angebot machen. Wenn das klappt – und es wird klappen, darauf kannst du dich verlassen, Bürschchen! –, darfst du anschließend gern deinem Alten eine Menge vorheulen.«
*
Die schwieligen Finger Ray Donovans krallen sich in das Hemd seines fünfzehnjährigen Bruders Brandon und beuteln ihn hin und her, stoßen ihn immer näher auf den wassergefüllten Trog vor dem Brunnen zu.
Der pfiffige Brandon, Trotzkopf der Familie und ohne Respekt, keucht wild und hämmert mit seinen kleinen Fäusten gegen den nackten Oberkörper von Ray.
»Du – du verdammter Kerl!« stößt er japsend hervor. »Nur weil du stärker… Ooah!«
Ray schlägt einmal blitzschnell zu, umklammert die Hüften seines kleinen Bruders, stemmt den Körper waagerecht hoch und wirbelt ihn drei-, viermal herum.
Dann streckt Brandan alle viere von sich und landet klatschend in dem breiten Trog. Das Wasser spritzt nach allen Seiten.
Und als Brandon schnaufend und prustend hochtaucht, das geschluckte Wasser ausspuckt und über den Trogrand wieder auf die Beine springt, hört er die grollende Baßstimme seines Vaters.
»Wollt ihr euch die Schädel einschlagen, ihr hitzköpfigen Burschen!«
Ray schnappt sich sein Hemd von der Fenz, stülpt es über den Kopf und geht breitbeinig auf seinen Vater zu. Dabei stopft Ray sich das Hemd hinter den Sattelgurt.
Elias Donovan hört auf zu klopfen und läßt den schweren Hammer sinken, als Ray vor ihm steht.
»Euch juckt wohl wieder das Fell, he?« brummt der Alte mit dem wettergegerbten Gesicht, den breiten Wangenknochen und den weit ausladenden Schultem. »Noch gibt es hier Arbeit für euch. Ray, da könnt ihr euch austoben. He, Brandon, hat er dir den Hitzkopf endlich abgekühlt? Komm her und pack an! Wenn Rupert und ich den Zaun allein setzen sollen, sind wir in drei Wochen noch nicht fertig. Wozu habe ich so prächtige Söhne, he?«
Ray will den Mund aufmachen, um etwas zu sagen, aber der hünenhafte Elias tut es ab mit einer wegwerfenden Handbewegung.
»Ich hätte dich für vernünftiger gehalten, Ray«, sagt er. »Als mein Ältester solltest du wissen, um was es geht. Ich habe dir oft genug eingebleut, daß wir der zänkischen Ziege Mabel McBruns zeigen wollen, wo ihre Macht zu Ende ist.«
Da meldet sich der zwölfjährige Peter, der rechts neben seinem Vater steht und die Tüte mit den fünfzölligen Nägeln hält. Seine Brüder nennen ihn nur Little Pit, aber der kleine Pfiffikus mit den schwarzen Haaren, die fast die ganze Stirn verdecken, hat das Herz am rechten Fleck sitzen und die seltene Fähigkeit, immer alles auf den einfachsten Nenner zu bringen.
»Was hast du eigentlich gegen Mrs. McBruns, Pa?« fragt er mit seiner hellen sympathischen Stimme. »Sie nimmt dir kein Wasser und kein Land. Warum brauchen wir da einen Zaun?«
»Was weißt du Grünschnabel schon davon, he?« brummt der Alte. »Dieses schrullige Weib ist schlimmer als ein störrisches Rind.«
»Halt dich da heraus, Little Pit«, mischt sich Ray ein und lächelt dabei ziemlich hintergründig. »Wenn du unbedingt sehen willst, wie Dad gleich der Kragen platzt, dann brauchst du ihm nur noch etwas mehr von der schönen Nachbars-Mabel vorzuschwärmen.«
Little Pit macht drei kleine Schritte und baut sich breitbeinig vor seinem Vater auf, dem bärbeißigen Besitzer der Eldo Ranch, dem Herrn über 700 acres Weide, 1000 wohlgenährte Rinder und 90 Warmblüter der edelsten Rassen.
»Pa, du hast mir immer noch nicht gesagt, warum wir diesen Zaun bauen«, sagt Little Pit in naiver Offenheit. »Warum tun wir das? Es kostet viel Geld…«
Der Alte verspürt plötzlich unter seiner rauhen Schale ein unangenehmes Gefühl.
Hölle und Teufel, denkt er. Ich hätte nie geglaubt, daß einen das junge Gemüse so in Verlegenheit bringen könnte. Und dieser kleine schwarze Zwerg ist mein Sohn – man sollte es nicht für möglich halten.