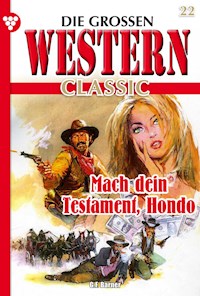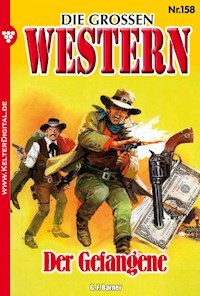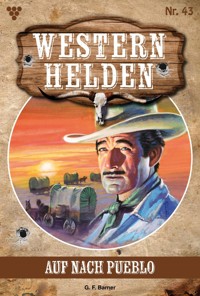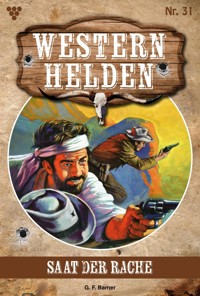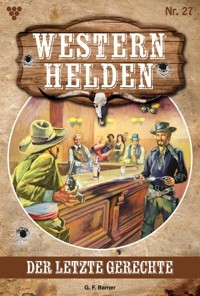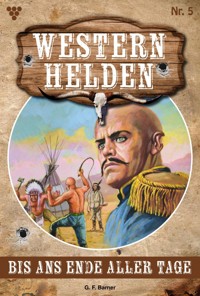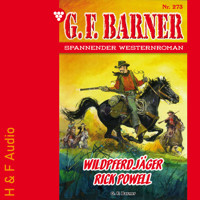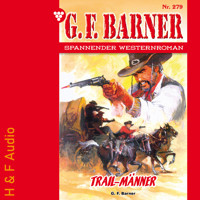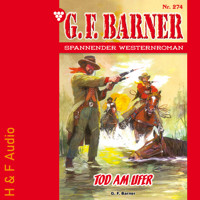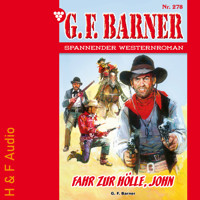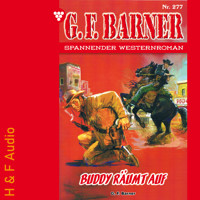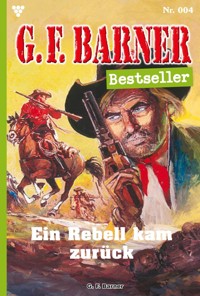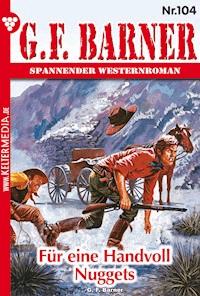
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Blattwerk Handel GmbH
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: G.F. Barner
- Sprache: Deutsch
Begleiten Sie die Helden bei ihrem rauen Kampf gegen Outlaws und Revolverhelden oder auf staubigen Rindertrails. G. F. Barner ist legendär wie kaum ein anderer. Seine Vita zeichnet einen imposanten Erfolgsweg, wie er nur selten beschritten wurde. Als Western-Autor wurde er eine Institution. G. F. Barner wurde als Naturtalent entdeckt und dann als Schriftsteller berühmt. Seine Leser schwärmen von Romanen wie "Torlans letzter Ritt", "Sturm über Montana" und ganz besonders "Revolver-Jane". Der Western war für ihn ein Lebenselixier, und doch besitzt er auch in anderen Genres bemerkenswerte Popularität. Snacky gähnt. Es ist das seltsamste Geräusch, das Morgan Clint jemals gehört hat. Früher, als sie Snacky noch nicht so gut kannten, sind sie jedesmal zusammengefahren und haben geglaubt, ein Puma schliche knurrend und heulend um die Wagen. Snacky gähnt so laut wie zehn Männer zusammen. Dabei öffnet er den Mund sperrangelweit. Der Wagen rollt. Snacky schielt von der Seite auf Morgan Clints Gesicht. Dann gähnt er noch einmal. Diesmal etwas länger und lauter. Und dann nimmt er die Flasche. Snacky trinkt für zehn. »Ja«, sagt Morgan, ohne den Kopf zu wenden. »Ja, ich weiß.« »Du weißt«, knurrt Snacky, und sein wuchernder, ungeheurer Bart, in dem sich angeblich ganze Völkerstämme verstecken können, klafft auf. »Du weißt gar nichts. Ich bin müde wie zehn Hunde zusammen. Und du, Kerl, fährst und fährst und fährst. Ich möchte wissen, warum die Räder noch nicht heißgelaufen sind.« »Steig ab und faß die Buchsen an, dann weißt du es genau.« »Du willst mich ja bloß munter machen, du weggelaufener Pavian. Den Gefallen tu dir selber. He, ist es nicht genug, wenn man sechzehn Stunden auf diesem alten, schaukelnden Conestoga sitzen muß? Ich bin ein alter Mann, nächstes Jahr werde ich hundertneunzig.« »Gestern hast du gesagt, du wärst hundertsieben.« »Na ja«, sagt Snacky mürrisch. »Mit jeder Viertelstunde bei dir auf diesem verdammten Bock werde ich eben drei Jahre älter. Ich bin der älteste Fahrer, den dieses Land jemals gesehen hat.« »Und dazu auch der schwatzhafteste, Snacky!« »Da hättest du mal meinen Bruder kennenlernen sollen«, erwidert Snakky lauthals. »Der redete, ich sage dir, so was ist dir
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
G.F. Barner – 104 –Für eine Handvoll Nuggets
Für diesen Traum gelebt und gestorben
G.F. Barner
Snacky gähnt. Es ist das seltsamste Geräusch, das Morgan Clint jemals gehört hat. Früher, als sie Snacky noch nicht so gut kannten, sind sie jedesmal zusammengefahren und haben geglaubt, ein Puma schliche knurrend und heulend um die Wagen.
Snacky gähnt so laut wie zehn Männer zusammen. Dabei öffnet er den Mund sperrangelweit.
Der Wagen rollt. Snacky schielt von der Seite auf Morgan Clints Gesicht. Dann gähnt er noch einmal. Diesmal etwas länger und lauter. Und dann nimmt er die Flasche. Snacky trinkt für zehn.
»Ja«, sagt Morgan, ohne den Kopf zu wenden. »Ja, ich weiß.«
»Du weißt«, knurrt Snacky, und sein wuchernder, ungeheurer Bart, in dem sich angeblich ganze Völkerstämme verstecken können, klafft auf. »Du weißt gar nichts. Ich bin müde wie zehn Hunde zusammen. Und du, Kerl, fährst und fährst und fährst. Ich möchte wissen, warum die Räder noch nicht heißgelaufen sind.«
»Steig ab und faß die Buchsen an, dann weißt du es genau.«
»Du willst mich ja bloß munter machen, du weggelaufener Pavian. Den Gefallen tu dir selber. He, ist es nicht genug, wenn man sechzehn Stunden auf diesem alten, schaukelnden Conestoga sitzen muß? Ich bin ein alter Mann, nächstes Jahr werde ich hundertneunzig.«
»Gestern hast du gesagt, du wärst hundertsieben.«
»Na ja«, sagt Snacky mürrisch. »Mit jeder Viertelstunde bei dir auf diesem verdammten Bock werde ich eben drei Jahre älter. Ich bin der älteste Fahrer, den dieses Land jemals gesehen hat.«
»Und dazu auch der schwatzhafteste, Snacky!«
»Da hättest du mal meinen Bruder kennenlernen sollen«, erwidert Snakky lauthals. »Der redete, ich sage dir, so was ist dir noch nicht untergekommen. Selbst im Schlaf hörte er nicht auf, Geschichten zu erzählen. Du hättest seine Beerdigung erleben sollen.«
»Mensch, wenn du jetzt sagst…«
»Ich sage gar nichts«, brummt Snacky beleidigt. »Wenn du denkst, daß ich lüge, dann hast du dich geirrt. Einen wahrhaftigeren Menschen als mich gibt es nicht auf der Welt. Aber was die Beerdigung anbelangt – mein lieber Mann, sagte ich nicht, daß mein guter Bruder niemals aufhörte zu reden?«
»Ja«, erklärt Morgan Clint trocken. »Das hast du gesagt. Und was war bei der Beerdigung?«
Snacky, unerfindlich alt – niemand weiß genau, wie alt er eigentlich ist, auch er nicht, seine Angaben schwanken zwischen neunundsechzig und vierundsiebzig Jahren, wenn er mal die Wahrheit zu sagen bemüht ist. Snacky schnüffelt, fährt sich mit dem glänzenden Ärmel unter der Nase entlang und sagt salbungsvoll: »Du wirst es nicht glauben, aber als der Reverend ihm die erste Schaufel auf den Sargdeckel warf, da schrie er von unten, die Gemeinheiten auf der Welt nähmen kein Ende. Sie sollten gefälligst leiser mit der Erde umgehen und ihm seine Ruhe lassen.«
»So, das tat er?« fragt Morgan zweifelnd. »Ich muß schon sagen, Snacky, du besserst dich nicht! Neulich hast du erzählt, er hätte geklopft, und sie hätten ihn herausgeholt, wonach er noch dreißig Jahre gelebt hätte.«
»Na ja«, brummt Snacky. »Das war erst, nachdem er sich über die Erde beschwert hatte. Habe ich vergessen zu erzählen, Junge. Hör mal, willst du bald halten?«
»Ich hörte dich irgendwann etwas davon murmeln, daß du schon hundertsechzig Stunden ohne zu schlafen gefahren wärst, Snacky.«
»Sagte ich das?« fragt Snacky und zieht den Kopf ein. »Ja, das habe ich gesagt, stimmt. Das war früher, als ich noch jung und schön war. Heute bin ich nicht mehr jung, nur noch schön.«
»Das weiß ich. In einer halben Stunde machen wir Rast, Alter.«
Snacky seufzt. Männer seiner Art haben die ersten Wagen quer durch den Kontinent gebracht. Wenn er von seinen Fahrten erzählt, dann hat er alles gekannt, was an berühmten Leuten auf der Welt ist. Und mit ihnen getrunken. Snacky säuft manchmal.
Als Snacky hörte, daß Morgan nach Westen wollte, hatte er ihm keine Ruhe gelassen, bis Morgan ihn mitnahm. Es gibt keinen Grund für Morgan, nicht froh darüber zu sein. So unglaublich es ist – der alte Snacky, der gerade noch zum Pferdebesorger der Kansas-Freighter-Line gut genug war, kennt sich hier aus.
Einen Moment ist Stille. Snacky beißt ein Ende Priem ab und nuckelt wie ein barfüßiger Säugling am Schnuller.
Dann sagt er murrend: »Drei Meilen weiter, und das schaffst du in einer halben Stunde bei dem Gelände, muß ein Lavafeld kommen. Da ist ein Wasserloch, eine halbe Meile nach rechts.«
»Snacky, woher weißt du das?«
»Soll ich wohl wissen«, erklärt Snacky. »Als Freemont seine erste Fahrt machte, war ich dabei. Ich sage dir, die Pferde hatten solchen Durst, daß sie sich gegenseitig den Schaum von den Nüstern leckten. Ich ritt wie immer vor dem Haufen und fand das Wasserloch. Hinterher hat Freemont gesagt, er hätte geführt. Dabei habe ich es die ganze Zeit, verstehst du? Aber ich bin nicht ruhmsüchtig.«
»Snacky, du lügst.«
»Ich? So wahr ich hier stehe. Ich verspreche dir, wenn der alte Freemont mich sieht, dann wird er schamrot werden. Alle Welt nennt ihn einen Entdecker, dabei müßte man diesen Weg nach mir benannt haben. Äh, das Wasserloch war ganz gut. Nur das andere…«
Er schiebt seinen Hut, der angeblich von seinem vor zehn oder fünfunddreißig Jahren gestorbenen Bruder stammen soll, in die Stirn.
Nun sieht er aus wie ein Bart mit Beinen, er hat gar kein Gesicht mehr. Dafür kratzt er sich am lichten Hinterkopf und stöhnt ein wenig.
»Was war mit dem anderen, Snacky?«
»Oach, nur ein paar Indianer«, versichert Snacky treuherzig. »Der eine sah mich und ging gleich auf mich los. Hast du mal ein fliegendes Schlachtbeil auf deine Haare zuschießen sehen, Junge?«
»Nein, geschossen haben sie schon auf mich, aber so nahe, daß sie mit einem Beil nach mir werfen konnten, ist mir noch keiner gekommen.«
»Aber mir«, versichert Snacky. »Ich sage dir, der blauweiß angemalte Paiute-Indianer wollte mir meinen klugen Kopf spalten. Dachte er sich so. Ich fing seinen Tomahawk auf.«
»Du lügst, Snacky.«
»Immer lüge ich«, sagt Snacky weinerlich. »Wenn du nicht so ein anständiger Kerl wärst die ganze Zeit, dann hätte ich es dir längst übelgenommen. Ich sage dir, ich fing das Ding auf. Und dann hackte ich mir mein Bein ab.«
»Was?« fragt Morgan Clint entgeistert. »Snacky, ich denke, ein Indianerpfeil hat dich das Bein gekostet.«
»Ach, das war doch viel früher«, berichtigt ihn Snacky. »Da hatte ich doch schon mein Holzbein, Junge. Ich muß ja sagen, ich war ein eitler Halunke, damals war ich auch noch jung und schön. Na ja, da habe ich auf meinem Holzstelzen unten einen Stiefel gezogen. Es sah wirklich so aus, als hätte ich zwei richtige Beine. Und als ich mir nun mein linkes Bein abhackte und ausholte, um es nach dem Kerl zu werfen – was meinst du, was geschah?«
»Weiß ich das?«
»Es waren sieben, genau sieben Paiutes«, sagt Snacky leise und geheimnisvoll. »Nach Jahren erzählte mir ein Trapper von der Pelztier-Company aus Alaska, er hätte einen vollkommen erschöpften Paiute-Indianer gefunden, stell dir vor, hoch im Norden, mehr denn tausend Meilen von hier. Das war der letzte Indianer, die anderen sind unterwegs gestorben. Junge, zu weit gelaufen, wie?«
»Soso«, erklärt Morgan Clint und grinst. »Bis nach Alaska, ganz schön weit, Snacky. Und du bist sicher, daß es einer deiner Indianer war?«
»Ganz sicher«, erwidert Snacky und hebt beschwörend zwei seiner ungewaschenen Finger. »Er hatte doch die Beule.«
»Was für eine Beule, Snacky?«
»Na, die von meinem Holzstelzen.«
Er sagt es und grinst. Nun hat sein Gesicht ein Loch. Der Bart klappt wieder mal wie ein Scheunentor auf.
Der Wagen rollt. Snacky steigt nach hinten, kramt in seinen Sachen.
Morgan Clint aber blickt nach vorn. Das Gewehr hat er neben sich. Im Südwesten steht der Mond. Dort hinten, denkt er, da ist sein Vater. Ich hätte ihn nicht allein lassen sollen. Aber als ich nach Hause kam, da war er schon dreieinhalb Wochen fort. Ich hätte ihn suchen müssen – irgendwo in Kalifornien.
Bleib da und warte, bis ich dir schreibe, wo ich gelandet bin, Junge. Das hat er auf einem Zettel zurückgelassen. Und schließlich aus Kalifornien geschrieben.
»Ich weiß nicht«, sagt Clint. »Seit zwei Wochen bin ich unruhig. Ich muß hin, so schnell ich kann. Jefferson ist alt und könnte krank geworden sein.«
In diesem Augenblick sieht er rechts von sich den hellroten Schein. Hinter den Hügeln des schwarz vor ihm liegenden Lavafeldes muß ein Feuer brennen, keine Meile mehr entfernt.
»Snacky?«
»Ja?«
Snacky steigt über den Bock nach vorn, blinzelt in die Richtung, in die Morgan Clint deutet, und runzelt die Brauen.
»Das ist an der Wasserstelle, wette ich«, sagt er dann brummig. »Na, dann sind wir nicht allein. Dabei dachte ich nicht, daß wir hier jemand treffen könnten. Die Strecke ist nicht viel befahren, die meisten Wagen nehmen den nördlichen Weg. Wir haben hundertsechzig Meilen Durststrecke hinter uns, da wagen sich andere kaum hin. Na, wir werden es ja sehen.«
Er bleibt neben Morgan sitzen, langt dann aber nach hinten und holt sein Gewehr.
»Was willst du damit, Snacky?«
»Mein Bein«, sagt Snacky mürrisch. »Morgan, habe ich dir schon mal gesagt, daß mich mein Stumpf kneift, wenn ich Indianer rieche?«
»Indianer würden kein so großes Feuer machen.«
»Vielleicht rösten sie gerade jemand?«
»Snacky, du redest Unsinn. He, was willst du hinten?«
»Mal sehen, wie die Gegend aussieht, wenn man hinten aus dem Wagen blickt, Junge.«
»Hör mal, Alter, wir sind nur vierzig Meilen vom nächsten Fort entfernt.«
»Du sagst es, vierzig Meilen«, antwortet Snacky mit plötzlicher Wortkargheit. »Ich hab schon Leute eine Meile vor einem Fort sterben sehen.«
Es kostet ihn jedesmal Mühe, nach hinten zu klettern. Mit seinem Holzbein geht das schlecht. Doch er schafft es und blickt hinten hinaus. Morgan, der einmal nach ihm sieht, entdeckt, daß sich der Alte an seinem Bein kratzt.
Verrückt, denkt Morgan, das gibt es nicht. Snacky ist der größte Lügenbeutel, der mir jemals über den Weg gerannt ist. Wer weiß, was ihn juckt. Und außerdem hat er zuviel getrunken.
Er biegt ab. Der scharfe Wind, der hier am Vormittag und Nachmittag regelmäßig riesige Staubwolken von Sand vor sich her treibt, ist fast eingeschlafen. Morgan Clint blickt auf den Boden, kaum, daß er im Schutz des ersten Lavahügels linker Hand ist. Und da sieht er eine Spur.
Eine Wagenfährte zieht sich in unregelmäßiger Linie vor ihnen hin. Auch sie biegt ab und führt nun genau auf die Wasserstelle zu.
»Snacky, sieh mal nach unten.«
»Ein Wagen«, sagt Snacky im nächsten Augenblick von hinten. »Der Wagen muß ein Rad verloren haben, wie?«
»Du sagst es, Alter. Sie scheinen einen starken Ast unter die eine Achse gebunden zu haben. Ein ziemliches Feuer, siehst du es?«
Snacky blickt hinten heraus, sieht nach vorn und nickt.
Im nächsten Augenblick führt die Spur um eine vorspringende Ecke des buckligen Lavagesteins. Vor Morgan Clint liegt eine steil abfallende Senke. Mitten in ihr glitzert das Wasserloch, dünnes Gras steht hier, einige Büsche wachsen am Rand des Wasserloches. Das Feuer brennt lodernd neben einem aufgebockten Wagen. Im Flammenschein taucht ein Mann auf und blickt ihnen entgegen. Dann wendet er sich dem Wagen zu, sagt etwas und kommt einige Schritt vor das Feuer.
»Hallo!« sagt er erleichtert, als Morgan an den Leinen zieht und die vier Pferde stehen. »Also hat doch jemand das Feuer gesehen. Ich dachte schon, wir müßten noch einen Tag hier hocken. Die Strecke ist zu wenig befahren. Mein Name ist Weldon, Jube Weldon.«
Morgan nennt seinen Namen, steigt ab und bleibt am Hinterrad des Wagens stehen, aus dem nun ein älterer Mann klettert.
»Hallo, Leute, ihr habt nicht zufällig ein Ersatzrad dabei?« fragt der Alte. »Unseres brach gestern früh etwa siebenundzwanzig Meilen von hier am Gordon-Cliff. Unser Glück, daß mein Junge sich schon vorher über das Rad Gedanken machte und einen anständigen Ast mitgenommen hatte, sonst hätten wir ohne Wasser festgesessen. Komm herunter, Tochter.«
Hinten steigt Snacky vom Wagen, humpelt näher und betrachtet den alten Weldon forschend.
»Dich kenne ich doch«, sagt er dann nachdenklich. »Weldon, hast du nicht am Salt Lake vor Jahren einen Viehhandel gehabt?«
Weldon blickt ihn überrascht an und nickt.
»Ja, aber kein Glück«, murmelt er bitter. »Meine Rinder bekamen die Rinderpest. Und dann schlug im Frühjahr der Blitz in mein Haus. Mir blieb nicht viel, mein Freund. Ich bin einfach zu alt, um noch mal mit Rindern ein Geschäft anzufangen. Da hinten liegt auch für mich vielleicht noch etwas im Boden.«
»Es soll nicht mehr so wild sein wie in den ersten Jahren«, sagt der Sohn. »Immerhin, warum soll ich es nicht versuchen? Man trennt sich schlecht von seinem Haus und Geschäft, aber wenn es abbrennt und einem nicht viel bleibt… Das ist Judy, meine Schwester.«
»Hallo!« murmelt Morgan, als das Mädel vom Wagen steigt und auf ihn zukommt. »Wir haben zwei Ersatzräder mit, sie müßten auch auf eure Achsen passen, laßt mal sehen.«
Er betrachtet das Mädchen einen Moment, während er an ihr vorbei zur Hinterachse des Wagens geht. Das Mädchen ist klein und zierlich. Was Morgan beim ersten Blick auffällt, sind die dunklen Augen, die ihn freundlich mustern.
Hinter ihm sagt Snacky – und niemand kann ihm seine großen Worte abgewöhnen: »Das ist Morgan Clint, Weldon, verdammt der beste Mann auf einem Wagen, den ich je gesehen habe. Er hat zweihundert Wagen geführt und kennt jede Wüste jenseits der Rocky Mountains. Ich bin Snacky Emmerson und kenne jede Wüste diesseits der Rockys. Als ich noch jung und schön war, verbrachte ich hier zwei Nächte.«
»Dann kennst du dich hier aus?« fragt Weldon. »Uns wurde gesagt, von hier bis zum nächsten Fort sollen es noch zwanzig Meilen sein.«
»Vierzig«, erwidert Old Snacky, »keine Sorge, Leute, wenn eins unserer Räder paßt, dann…«
»Es paßt«, meldet sich Morgan am Wagen der Weldons. »Weldon, wie sieht es aus, wollt ihr es gleich aufstecken oder hat es Zeit bis zum Morgen?«
Weldon wechselt einen Blick mit seinem Sohn, aber ehe er antworten kann, humpelt Old Snacky auf Morgan zu und sagt leise: »Laß sie es gleich aufziehen. Ich weiß verdammt nicht, Junge, mein Bein zwickt mich, als wenn der ganze Stelzen noch dran ist und der verdammte, lausige Indianerpfeil in ihm steckt. Laß uns Wasser nehmen und zur Höhe fahren, sobald die Leute den Wagen in Ordnung haben. Es gefällt mir in diesem Loch hier gar nicht.«
»Snacky, du redest zuviel.«
»Ich sage dir, ich merke es, wenn mir Indianer näher als drei Meilen sind, Junge. Wir müssen uns beeilen, hör auf den alten Snacky.«
Morgan sieht ihn einen Moment forschend an. Wenn er es bisher gewohnt war, den Alten schwatzen zu hören, nun wirkt Snacky unruhig und irgendwie gespannt. Er hat etwas, was er die ganze Fahrt nicht getan hat, sein Gewehr mitgenommen.
»Na gut, Alter. Hallo, Weldon, ziehen wir es gleich auf. Man kann nie wissen, ob nicht ein Sturm kommt, der uns zwingt, hinter einen der steileren Höhenzüge zu fahren, um Schutz vor dem Sand zu haben.«
Er dreht sich um, geht zum Wagen und macht eins der unter dem Wagen angebundenen Ersatzräder los. Der junge Weldon hilft ihm. Sie bocken, während der alte Snacky von plötzlichem Riesendurst befallen zu sein scheint und Wasser zum Wagen schleppt, Weldons Wagen hoch. Dann stecken sie das Rad auf. Und kaum ist Morgan am Wagen, um die Pfanne herabzunehmen, als Snacky leise sagt: »Wie bringen wir denen bei, daß wir aus dem Loch hier müssen, Junge? Laß dir was einfallen – oder soll ich lügen?«
»Du lügst doch sonst ohne rot zu werden«, gibt Morgan zurück. »Wie wäre es mit Schlangen, Alter?«
»Schlangen? Der Teufel, du kannst es sogar noch besser als ich«, brummelt Snacky. »Dann werde ich mal eine Geschichte loslassen. Schlangen, hast du mal eine Frau gesehen, die keine Angst vor Schlangen hat?«
»Nein, aber beeil dich!«
Snacky humpelt los, sein Gewehr in der rechten Hand und einen Revolver im Gürtel, während der andere im Halfter steckt.
»Hallo, Weldon«, wendet er sich an den alten Weldon. »Da habt ihr mächtig Glück gehabt, Leute, daß eure Pferde noch gesund sind und euch nichts passiert ist, schätze ich. Wißt ihr, daß es hier die verdammteste Art von Klapperschlangen gibt?«
Weldon fragt erstaunt: »Klapperschlangen, Snacky? Bist du ganz sicher?«
»Und ob ich sicher bin«, erwidert Snacky besorgt. »Ich sage euch, als ich vor einem Vierteljahrhundert hier herumstrich, da kamen in der Nacht eine Million dieser verdammten Klapperschwänze auf unser Camp zu. Einige krochen bis ins Feuer, wir verloren drei Pferde. He, sind eure Pferde nicht unruhig gewesen die Nacht? Klapperschwänze suchen gern ihre Nähe!«
Der junge Weldon wirft seinem Vater einen erschrockenen Blick zu. Das Mädchen blickt ängstlich auf den Boden.
»Tatsächlich, unruhig sind sie schon gewesen«, murmelt der junge Weldon. »Also Schlangen. Was machen wir da, Snacky?«
»Das beste ist, ihr spannt an und fahrt hinter uns hier auf den Hügel«, antwortet Snacky. »Das war damals schon der sicherste Platz. Na, Morgan, fahren wir voraus, wie?«
»Sicher, Snacky, sicher.«
Sie helfen den Weldons anspannen, fahren los und sehen sich dann um.