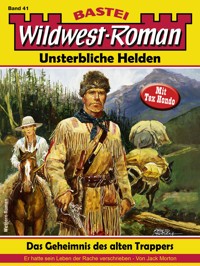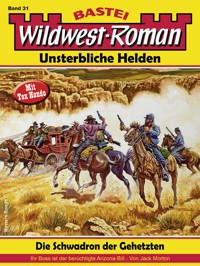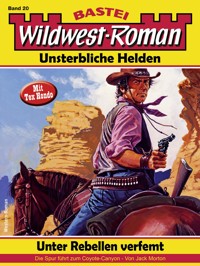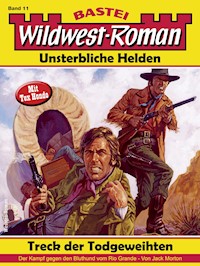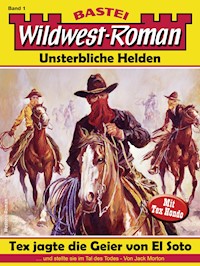
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Steve Wellston war ein großer schweigsamer Mann, in dem die Gefährlichkeit und die Wildheit eines Wolfes steckten. Man brauchte ihn nur anzusehen. Er besaß mächtig ausladende Kiefer und eine wuchtige Kinnpartie. Sein schmallippiger Mund und die blassblauen, stechend dreinblickenden Augen verstärkten das Unbehagen noch, das von diesem Gesicht ausging. Es waren Augen, die, selbst wenn er friedlich gestimmt war, nicht einen Funken Humor verströmten ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Tex jagte die Geier von El Soto
Vorschau
Impressum
Unsterbliche Helden hält niemand auf!
Nichts zeichnet den Western mehr aus als seine einzigartigen Helden! Sie sind mutig, haben Ausdauer und setzen sich für ihre Ideale ein. Dabei leben sie immer in der Gewissheit, durch ihr Handeln den eigenen Tod zu riskieren. Doch sie wissen auch um ihr Können, das sie nahezu unsterblich macht.
Mit dem Wildwest-Roman kehrt nun die erste Western-Reihe des Bastei Verlags zurück, die ab 1957 vierzig Jahre lang erschienen ist und es insgesamt auf 1859 Bände brachte. Sie kann auch als Ursprung des Western-Hits angesehen werden, der fünf Jahre später herauskam und dessen erste 414 Bände noch den Titel Wildwest-Roman Sonderband trugen.
Charakteristisch für diese beiden Western-Reihen war, dass sie in erster Linie aus Einzelromanen bestanden. Aber es gab auch immer wieder Subserien mit wiederkehrenden Hauptfiguren. Der Wildwest-Roman: Unsterbliche Helden vereint nun die besten Abenteuer von Titelhelden wie Tex Hondo, Old Jed & Jivaro, den Schlitzohr-Halunken und vielen anderen!
Mal sind die Helden auf sich allein gestellt, agieren als Duo oder in der Truppe. Ihr Tun hängt nicht unwesentlich von den Lebensumständen ab, die sie umgeben. Hierbei kommt es zu den verschiedensten Kombinationen: ein alter Totengräber und ein Halbblut, mehrere Südstaatler unter der Führung ihres ehemaligen Offiziers oder ein befreundeter Mexikaner und Texaner. Das Empfinden von Recht und Ordnung, die Moralvorstellungen und das Vorgehen, um Konflikte zu lösen, fallen dabei häufig recht unterschiedlich aus. Dies bietet den Nährboden für interessante Geschichten, in deren Mittelpunkt wirklich außergewöhnliche Helden stehen.
Begleiten Sie diese unsterblichen Helden bei ihren spannenden Abenteuern!
Ihre Wildwest-Roman-Redaktion
Tex jagte die Geier von El Soto
Von Jack Morton
Steve Wellston war ein großer schweigsamer Mann, in dem die Gefährlichkeit und die Wildheit eines Wolfes steckten. Man brauchte ihn nur anzusehen. Er besaß mächtig ausladende Kiefer und eine wuchtige Kinnpartie. Sein schmallippiger Mund und die blassblauen, stechend dreinblickenden Augen verstärkten das Unbehagen noch, das von diesem Gesicht ausging. Es waren Augen, die, selbst wenn er friedlich gestimmt war, nicht einen Funken Humor verströmten ...
Er hockte auf dem Sattel vor dem Feuer, dessen Flammen ein seltsames Spiel von Licht und Schatten auf seine dunkle und schwere Gestalt warfen, und genoss die wachsende Spannung seiner fünf Gefährten, die ihn anstarrten, unverwandt, und auf seine Entscheidung warteten.
Nach einer Weile hob er endlich den Kopf und blickte gelassen von einem zum anderen. Dabei stahl sich ein Lächeln tief in seine Mundwinkel hinein, dass es ihm die Lippen von den Zähnen zog.
»Ich bin einverstanden«, sagte er in seiner schwerfälligen Sprechweise. »All right, nehmen wir die Bank von El Soto auseinander. Gleich morgen Abend! Doch eine Einschränkung muss ich machen. Nicht mit den Pferden, die wir haben! El Soto hat einen erstklassigen Sheriff. Dieser Bastard würde uns hetzen und treiben, bis wir, einer nach dem anderen, auf der Nase liegen. Ist dir das klar, Limpy?«
Limpy war ein Mann von dreißig Jahren. Mithin in Steve Wellstons Alter. Doch er war nur halb so breit wie er und einen ganzen Kopf kleiner. Er war jedoch ein sehr erfahrener Mann, und in Arizona kannte er sich aus wie kein zweiter.
Limpy biss sich auf die Lippe und starrte auf die Stiefelspitzen. »Es wäre nicht schwer, Abhilfe zu schaffen. Keine zehn Meilen von hier entfernt, im Tal des Singenden Windes, steht eine Ranch, auf der sie wilde Pferde zureiten. Auf so einem halbzugerittenen wilden Bronco ist man schneller als jede Posse. Ich bin mit Gene dort vorbeigeritten, und wir haben von der Höhe aus eine Weile zugesehen. Sie haben mehr als zwei Dutzend von diesen gelbgezähnten Mistviechern in den Korrals. Ein stummer Apache und ein alter Grauschopf reiten die Biester zu.«
»Ein stummer Apache?«, fragte Steve Wellston. »Wie habt ihr das von der Höhe aus feststellen können?«
»Sie gaben sich fortwährend Zeichen«, erklärte Limpy. »Auch dann, wenn sie sich direkt gegenüberstanden. Ich habe einmal oben in Kansas Stumme miteinander reden sehen. Die haben es genauso gemacht. Ich habe gleich zu Gene gesagt, der Apache ist stumm. Stimmt's, Gene?«
Gene, ein junger Bursche aus Texas, nickte sofort zustimmend.
»Und diese beiden Komiker sind auch die ganze Besatzung«, resümierte Limpy. »Es dürfte also nicht schwierig sein, dort Pferde wegzuholen. Der Apache ist zwar ein riesiger Kerl, aber wenn er eins über den Schädel gezogen kriegt, kann er keine Zeichen mehr machen. Der Alte dürfte auch nicht gefährlich sein. Er ist zwar ein guter Reiter, aber er hat nicht einen Zahn mehr im Hals.«
»Das habt ihr auch von der Höhe aus beobachtet?«, wollte Wellston daraufhin bissig wissen.
Limpy nickte gelassen. »Ja! Er hat zu dem Gerede mit den Händen jedes Mal das Maul aufgerissen. Wir haben ihm von der Höhe aus direkt in den Hals sehen können. So groß ist ein Maul nur ohne Zähne. Stimmt's, Gene?«
Gene nickte abermals.
»Wir müssten aber sofort aufbrechen«, verlangte Limpy. »Es sind zehn Meilen. Keine weniger.«
Wellston stand auf. »Satteln!«, befahl er laut. »Löscht das Feuer! Wir reiten in drei Minuten.«
Die Männer erhoben sich, ergriffen ihre Packen und hasteten damit zu den Pferden. Gene und Limpy kehrten dann noch einmal zum Feuer zurück. Gene goss den Wasserkessel aus, dass Dampf, Funken und Holzrauch emporstoben. Dann traten sie den Rest der glühenden und qualmenden Scheite aus.
Ein paar Minuten später befand sich Steve Wellstons Bande auf dem Ritt zum Tal des Singenden Windes. Bügel an Bügel und dicht bei dicht ritten sie nach Westen in die Nacht hinein. Limpy, der sich in dieser Gegend auskannte, führte.
Roary Calhoun, der vollbärtige Oldtimer, erwachte früh am Morgen, stand auf und lief durch das Haus der Ranch im Tal des Singenden Windes. Bevor er in den Hof hinausging, um sich zu waschen, weckte er Chengo, den stummen Apachen, indem er ihn am großen Zeh packte und kräftig daran zerrte.
Chengo kam hoch, als wäre er von einer Tarantel gestochen worden, und riss das Bein zurück.
»Aufstehen! Aufstehen!«, krächzte Roary mit seiner heiseren Stimme und gab Chengo mit den Händen zu verstehen, was er meinte. »Tex kommt heute zurück. Wir müssen ihn in El Soto abholen«.
Der Apache verdrehte die Augen und machte ein Zeichen, das Roary von dieser Sprache als Erstes gelernt hatte. Er blieb deshalb stehen und stemmte die Fäuste wütend in die Hüften.
»Ich bin vom Affen gebissen worden? Du bist ...«
Der Oldtimer verstummte, da Chengo wieder ein Zeichen machte.
Roarys Mund klappte auf und zu. »Vom großen Affen?«
Chengo nickte und schwang die Beine von der Pritsche.
Roary holte tief Luft und wandte sich wütend ab, stapfte zur Tür und riss sie auf. Doch da prallte er auch sofort wieder zurück.
Die Tür flog vollends herum und knallte gegen die Wand. Zwei Männer sprangen über die Schwelle und richteten ihre schussbereiten Gewehre in den Raum.
Roary nahm erschrocken die Arme hoch. Chengo schnellte empor, blieb aber wie angewurzelt stehen und musterte die Eindringlinge aus schmalen Augen.
Es waren zwei hagere Männer, die einen heruntergekommenen Eindruck auf Roary machten. Sie trugen die typische Weidereitertracht, aus der sie beide seit Wochen nicht herausgekommen zu sein schienen.
»Was wollt ihr von uns?«, frage Roary.
»Halt die Hände oben, Alter!«, forderte der eine schroff und hielt Roary die Gewehrmündung vor den Bauch.
Sein Gefährte wandte sich dem Apachen zu, trat blitzschnell vor und nahm das Skalpmesser an sich, das im Gürtel steckte, der über dem Bett an der Wand hing.
»Umdrehen!«, befahl er Chengo.
Chengo warf einen Blick auf Roary. Da beide nicht bewaffnet waren und auch so keine Chance hatten, nickte der Scout dem Indianer zu, der daraufhin dem Befehl der Eindringlinge nachkam. Dabei machte er Roary ein Zeichen, das Pferde bedeutete.
Roary blickte an dem Mann vorbei zur Tür hinaus. Da drang auch schon ein Pferdewiehern von draußen herein.
»Unsere Pferde sind alle gebrannt«, wisperte Roary.
Der Mann vor ihm grinste. »Warum redest du so leise, Alter? Soll das niemand hören?«
»Ihr werdet nicht weit kommen«, entgegnete Roary.
Der Mann hatte ihn nicht verstanden. »Maul halten!«, brüllte er.
Hufgetrappel drang von draußen herein. Roary vernahm das Poltern von Korralstangen. Jemand fluchte laut. Der Korral lag außerhalb von Roarys Blickfeld. Aber dass da drüben etwas geschah, konnte er deutlich hören. Dann wehte auch Staub vom Korral her über den Platz.
»Unser Brandzeichen ist in ganz Arizona bekannt«, krächzte Roary. »So wie in ganz Arizona bekannt ist, dass Pferdediebe aufgehängt werden.«
»Du sollst dein Maul halten!«, fauchte der Mann. »Wenn du noch ein Wort verlierst, blase ich dir ein Stück Blei unter die Haut.«
Der Gefährte des Banditen wandte sich kurz um. Chengo schien die ganze Zeit darauf gewartet zu haben. Er schnellte zur Seite, ergriff den Lauf der Winchester und schleuderte den Banditen mit Wucht daran herum, sodass dieser gegen die Wand knallte und das Gewehr losließ.
Der Mann vor Roary riss die Waffe zur Seite und schoss. Chengo war jedoch nicht mehr dort, wo er zuvor noch gestanden hatte. Er flog wie ein Panther durch den Raum, das Gewehr des Banditen verkehrt herum in den Fäusten, griff dabei nach einem Stuhl, mit dessen Sitzplatte er die nächste Kugel auffing. Dann zischte der Gewehrkolben über Roary hinweg, der sich blitzschnell geduckt hatte, und traf den Banditen am Kopf, sodass dieser bewusstlos zusammenbrach.
Genau in diesem Moment tauchte ein dritter Mann im Rahmen der Tür auf, den Colt in der vorgereckten Faust. Chengo erstarrte und ließ das Gewehr fallen.
Roary richtete sich ächzend auf und reckte die Arme wieder empor.
Der dritte Bandit war ein großer, schwerer Mann. Sein Blick wanderte von einem zum anderen.
»Was soll das, Gene?«, wandte er sich dann an den Banditen, den Chengo gegen die Wand geschleudert hatte. »Warum macht ihr nicht kurzen Prozess?«
Bevor er eine Antwort bekam, bewegte er sich vorwärts und schlug Chengo den Coltknauf auf den Kopf, sodass der Indianer auf der Stelle zusammenbrach. Der massige Mann hatte sich mit einer Gewandtheit und Schnelligkeit bewegt, wie sie Roary bei ihm nicht vermutet hatte. Sicherlich auch Chengo nicht. Denn er war nicht einmal dazu gekommen, die Arme in einer Abwehrbewegung hochzureißen.
»Dieser Apachenhund ist schnell wie der Teufel!«, keuchte Gene und kam nach vorne. Während er sich nach seinem Gewehr bückte, stieß der dritte Bandit seinem bewusstlosen Gefährten die Stiefelspitze in die Seite.
»Wach auf, Limpy, du alter Schwachkopf!«, rief er grollend.
Doch dieser Limpy hatte den Gewehrkolben genau vor die Stirn bekommen. Er rührte sich nicht.
»Hol Wasser, Gene!«, bellte der massige Mann.
Gene warf noch einen spähenden Blick auf Roary. Dann rannte er hinaus.
»Nun zu dir, Alter!«, brummte der massige Bandit und musterte Roary von oben bis unten. »Willst du vernünftig sein, oder soll ich dir auch eins über den Schädel ziehen?«
Roary schluckte. »Unsere Pferde sind gut gebrannt, Mister«, wiederholte er mit heiserer Stimme. »Der Brand ist in ganz Arizona bekannt. Das kann Sie den Kopf kosten.«
Der Bandit grinste über Roarys seltsam heisere Stimme. »Setz dich, Alter! Dort, auf den Stuhl da!« Er hatte die Lassos neben der Tür erspäht, ging hin und nahm sie herunter. Dabei ließ er Roary und auch den am Boden liegenden Apachen nicht aus den Augen.
Roary setzte sich und schlang von selbst die Arme um die Lehne. Der Bandit fesselte ihn. Dann band er auch Chengo zu einem handlichen Paket zusammen. Das ging so schnell, dass er damit bereits fertig war, als Gene mit einem Ledereimer voll Wasser ins Haus zurückkam.
»Die Jungs sind schon fertig«, merkte Gene an.
Der schwergewichtige Mann nickte und wies auf ihren bewusstlosen Gefährten. Gene zielte, holte aus und schwappte ihm das Wasser mitten ins Gesicht. Der Bandit kam augenblicklich hoch, prustete und schlug um sich, als befürchtete er zu ertrinken.
»Du Sumpfbiber, Limpy!«, rief der große Mann und schüttelte den Kopf.
Limpy saß auf dem Hosenboden und schaute sich mit einem halbirren Ausdruck in den Augen um. Auf ein Zeichen des Großen griff ihm Gene unter die Arme und führte ihn hinaus.
»Mach keinen großen Wirbel, Alter!«, wandte sich der massige Bandit an Roary. »Wir haben euch zwölf Pferde genommen, aber dafür sechs andere in den Korral getrieben. Ich geb' zu, das ist kein besonderer Tausch für euch. Doch ein mieses Geschäft ist immer noch besser als gar keins.«
»Es ist auch für euch kein gutes Geschäft«, wisperte Roary.
Der Bandit grinste. »Du solltest dir mal einen Liter Feuerwasser vermischt mit einem Sud aus Pfefferkraut durch die Gurgel jagen. Das bringt deinen Hals wieder in Ordnung. Adios!«
Er wandte sich ab, stapfte an Chengo vorbei zur Tür und verließ das Haus. Die Tür knallte mit einem satten Schwung ins Schloss, sodass Roary nicht mehr verfolgen konnte, was da draußen geschah. Kurz darauf hörte er die Banditen wegreiten. Er bekam sie auch durchs Fenster nicht zu Gesicht. Er hörte nur, dass sie nach Süden ritten.
Roary lauschte eine Weile dem Hufschlag. Dann versuchte er sich zu befreien, was er jedoch nicht schaffte. Er schwitzte, fluchte und stöhnte. Doch die Stricke hielten.
Später rückte er mit dem Stuhl durch den ganzen Raum, von einer Ecke zur anderen, um an irgendeinem Gegenstand eine scharfe Kante zu finden, an der er den Strick durchscheuern konnte. Natürlich gab es solche Kanten. Doch sie befanden sich entweder zu hoch oder zu tief, sodass er sie in keiner Lage erreichen konnte.
Von dem Gepolter, das der Oldtimer dabei verursachte, kam Chengo zu sich. Er blieb noch eine ganze Weile reglos liegen und starrte Roary aus glasigen Augen an. Doch langsam kam Klarheit in diesen Blick. So dauerte es nicht lange, bis sich auch der Apache zu befreien versuchte. Aber auch er schaffte es nicht. Er mühte sich bis zur Erschöpfung. Der Bandit hatte auch ihn so geschickt gefesselt, dass er sich nicht zu befreien vermochte.
»Tex Hondo wird am Abend kommen«, sagte Roary einmal während einer Atempause. »Dann machen wir uns sofort auf den Weg.«
Der Apache schaute herüber und nickte.
»Aber es wird schwer sein, diese Hundesöhne zu verfolgen«, wisperte Roary nachdenklich. »Sie sind nur sechs, denn sie haben uns bloß sechs Pferde zurückgelassen. Sicherlich verdammt abgekämpfte Gäule. Nun besitzt jeder noch ein Pferd zum Wechseln. Da sind sie so schnell wie der Wind.«
Der Apache nickte abermals.
»Aber wir werden uns auch Wechselpferde mitnehmen.«
Der Apache nickte wieder.
Roary spie wütend aus. »Aber sicherlich haben die Aasgeier unsere besten Pferde genommen«, krächzte er. »Also wird es doch schwer werden.«
Chengo begann von Neuem an den Stricken zu zerren und zu reißen. Nach einer Weile rollte er sich quer durch den Raum bis an den eisernen Ofen. Roary verfolgte gespannt sein Bemühen. Doch nach einiger Zeit gab Chengo auf. Sein nackter bronzefarbener Oberkörper glänzte feucht.
»Diese Hundesöhne!«, schimpfte der alte Scout wieder. »Diesem Halunken werde ich Pfefferkraut geben!«
Er schaute zum Fenster hinaus.
»Es ist schon nach Mittag. Ich habe nicht nur Wut im Bauch, sondern auch einen mächtigen Hunger.«
Der Apache gab ihm mit einem Rücken des Kopfes zu verstehen, dass er zu ihm an den Ofen kommen sollte. Roary polterte hinüber. Chengo wies mit dem Blick auf das Schüreisen, das an einem Haken am Ofen hing und von Chengo deshalb nicht erreicht werden konnte. Roary drehte sich polternd und ruckelte sich rückwärts heran, bis er das Schüreisen mit den Fingerspitzen berühren und vom Haken werfen konnte. Dann schob er es mit der Stiefelspitze zu Chengo.
Das Schüreisen besaß zwei scharfe Kanten. Chengo strampelte sich auf den Rücken und bedeckte das Eisen mit dem Oberkörper. Roary furchte die Stirn und schaute gespannt zu.
Nach einer Weile begann Chengo hin- und herzupendeln. Sein Hals schwoll vor Anstrengung. An seinen Schläfen traten die Adern hervor. Während dieser Schufterei sah er starr an Roary vorbei. Plötzlich erschlaffte sein angespannter Körper. Die Andeutung eines Lächelns war in seinen Augen zu erkennen. Er keuchte und schnaufte. Dann schnellte er mit dem Oberkörper hoch und hielt Roary triumphierend die Hände hin.
Eine halbe Minute später rannten die beiden Männer ins Freie hinaus. Roary fluchte, als er den Korral erblickte. Die Torstangen lagen am Boden. Von den zwanzig kaum gezähmten und halb zugerittenen Wildpferden war keins mehr da. Nur sechs erschöpfte und keinesfalls besonders wertvolle Rappen, die alle aus derselben schlechten Zucht zu stammen schienen, standen am Zaun.
Der Apache stieß Roary an und wies nach Westen, wo sich weit draußen vor der Ranch einige von den Wildpferden tummelten, die die Banditen zurückgelassen hatten. Da sie den Korral nicht geschlossen hatten, waren diese Tiere geflohen.
»Bis wir diese Pferde eingefangen haben, vergehen Stunden«, flüsterte Roary missmutig. »Weiß der Teufel, ob sie nicht auch sofort Reißaus nehmen, sobald sie uns wittern. Halten wir uns lieber an die Halunken, die uns das alles eingebrockt haben.«
Sie liefen zum Stall, wo Chengos Rappe Nachtwind und Roarys Maultier Methusalem standen. Sie sattelten die Tiere und versorgten sich mit Waffen, Munition und Proviant. Roary hinterließ für Tex Hondo im Haus eine Nachricht. Dann machten sie sich auf den Weg und folgten der Fährte, die die Banditen hinterlassen hatten.
»Die Burschen haben schon einen Fehler gemacht«, stellte Roary zufrieden fest, als sie hinter der Ranch nach Süden einschwenkten. »Sieh dir das an, Chengo! Die Halunken haben eine Fährte wie ein Rudel Wildschweine hinterlassen. Sie unterschätzen uns. Wie mir das gefällt!«
Chengo nickte und deutete dem Scout durch Zeichen an, dass die weißen Pferdediebe einen Vorsprung von fast fünf Stunden besaßen.
Roary nickte bekümmert. »Well, wir werden ein paar Tage unterwegs sein«, wisperte er.
»Da haben wir vielleicht einen Fang gemacht«, warf Wellston zufrieden ein und musterte immer wieder seine beiden Pferde. »Sieh dir diese Brust an von dem Burschen, Limpy! Der besitzt Luft für eine Jagd bis zum Nordpol hinauf.«
Die Männer traten hinter ihm zusammen und betrachteten den braunen Wallach.
»Alle zwölf Pferde sind von der gleichen Sorte«, erwiderte Gene. »Der Sheriff von El Soto kann so brauchbar sein und wild, wie er mag. Gegen diese halbwilden Biester hat niemand eine Chance.«