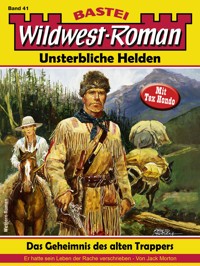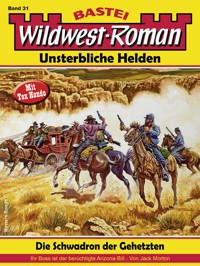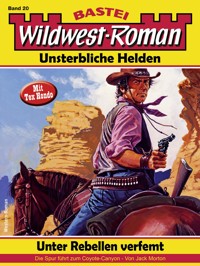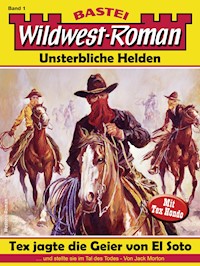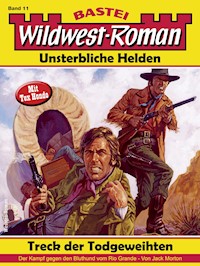
1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Wildwest-Roman – Unsterbliche Helden
- Sprache: Deutsch
Ein ganzer Wagenzug rollte ins Verderben. Nur zwei sollten überleben: Die schöne Virginia Murray und ihr Bruder Douglas. Die Geschwister hatten die Hölle durchlebt, und die Gier auf blutige Rache machte Douglas zu einem reißenden Wolf.
Doch dann tauchte Tex Hondo auf, der von seinem Bruder Chengo begleitet wurde. Und auch Old Roary, der schrullige Oldtimer, war mit von der Partie ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 148
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Cover
Treck der Todgeweihten
Vorschau
Impressum
Treck der Todgeweihten
Von Jack Morton
Douglas Murray duckte sich im Sattel, aber es war zu spät. Das Lasso senkte sich über ihn. Die Schlinge zog sich zusammen. Mit einem jähen, brutalen Ruck wurde der junge Mann aus dem Sattel des Kentuckypferdes gerissen. Der harte Aufprall raubte ihm fast die Besinnung. Wie aus weiter Ferne hörte Douglas den gellenden Siegesschrei eines Indianers.
Douglas versuchte aufzustehen und die Lederschlinge abzustreifen. Er musste kämpfen, musste um jeden Preis zum Wagenzug zurück, um die Menschen zu warnen, die sich langsam auf die tödliche Falle zu bewegten, die für sie aufgestellt war ...
Ein mageres, rot und weiß geflecktes Pintopferd jagte mit seinem Reiter aus den Büschen, passierte Doug Murray, und die Schlinge, die sich nur sekundenlang gelockert hatte, presste sich wieder um seinen Körper, riss ihn erneut auf die harte Erde.
Im vollen Galopp schlang der Reiter das Lasso um sein Sattelhorn, beugte sich kurz nach links, ergriff die Zügel von Murrays Kentuckypferd und jagte weiter.
Douglas Murray wurde über den harten, felsigen Boden geschleift. Sein Kopf stieß gegen Steine. Der junge Mann wurde bewusstlos.
Aber der grausame Reiter hielt nicht an. Er schleppte sein Opfer weiter durch den Staub und Dreck, durch dürres Mesquitegras, Creosotbüsche und Kakteen.
Murray spürte nicht, wie seine Haut am ganzen Körper aufgerissen wurde. Er merkte nichts davon, dass seine Kleidung zu einem Bündel Lumpen wurde.
Nach einer halben Meile bog der Grausame in einen winzigen Seitencanyon ein und erreichte nach wenigen Galoppsprüngen ein verwahrlostes Zeltlager, in dessen Mitte ein Feuer brannte.
Im Lager wurde es lebendig. Aus verschiedenen Zelten kamen Männer und scharten sich um den bewusstlosen Mann und um den Reiter, der Doug Murray hierhergebracht hatte.
Stolz sah sich der Reiter um. Sein langes pechschwarzes Haar war im Nacken zu einem Knoten geflochten. Im bronzefarbenen Gesicht regte sich kein Muskel. Nur die schwarzen Augen strahlten.
Vier verwegen aussehende, bärtige Männer standen um den Indianer herum, aber er missachtete ihre fragenden Blicke.
Er sprach erst, als aus einem der Zelte ein hochgewachsener, breitschultriger Mann trat und sich zu den Männern gesellte. Der Mann hatte eine tiefe Messernarbe auf der rechten Wange. Sein Gesicht war von einem ungepflegten schwarzen Bart bedeckt, und in den starren grauen Augen glühte ein verzehrendes Feuer.
»Einer vom Treck, Kiowa?«, fragte der Narbige.
Kiowa, der Indianer, nickte.
»Ein Greenhorn, Boss. Er ritt genau in die Falle, die ich ihm stellte. Er war so blind, wie es die Leute vom Treck sein werden.«
»Warum hast du ihn gefangen genommen, Kiowa?«
»Er hat die Falle entdeckt. Er wollte zurück, um seine Leute zu warnen. Das durfte ich nicht zulassen.«
Der Boss nickte zufrieden.
»Er ist also der Scout des Wagenzuges«, murmelte er. »Es ist gut, dass du ihn ausgeschaltet hast, Kiowa. Auf dich kann ich mich verlassen. Ist alles gut vorbereitet?«
»In einer Stunde wird der Treck den Canyon erreicht haben«, erwiderte Kiowa kehlig. »Wir werden gute Beute machen, Alvarez.«
Alvarez, der gefürchtete Banditenboss von der »blutigen Grenze«, lächelte still vor sich hin. Nachdenklich starrte er eine Weile auf den bewusstlosen Gefangenen und brummte schließlich: »Du hast ihn gefangen, Kiowa. Also gehört er dir. Du kannst mit ihm machen, was du willst.«
Kiowas Gesicht verzog sich zu einer grausamen Grimasse. »Danke, Alvarez.«
»Wirst du ihn töten?«
Kiowa schüttelte den Kopf.
»Er soll leben, Alvarez«, murmelte er kehlig. »Ich habe noch nie einen weißen Sklaven gehabt.«
»Leg ihn lieber gleich um«, riet Bob McDonald, der Leutnant des Banditenführers Alvarez. »Ich fürchte, er wird nicht lange am Leben bleiben, wenn du das tust, was du mit ihm vorhast.«
Alvarez machte eine unwillige Handbewegung.
»Misch dich da nicht ein, Bob. Kiowa hat ihn erbeutet, und deshalb gehört er ihm.«
Kiowa stieß ein zufriedenes Grunzen aus.
»Ich werde ihn gefügig machen wie einen Hund«, brummte er. »Nach zwei Tagen wird er mir die Stiefel lecken.«
Douglas Murray schlug die Augen auf und zwinkerte in die grelle Sonne, die steil über dem Canyon stand.
Kiowa war ein Indianer, aber er war wie ein weißer Mann gekleidet. Er trug ein hirschledernes Jagdhemd und ebensolche Leggins, die mit Skalphaaren besetzt waren. An seinen Füßen steckten schenkellange Mokassins. Er saß in einem Landissattel, und am Sattelhorn baumelte eine kurzstielige Peitsche.
Der Indianer nahm die Peitsche und schwang sich aus dem Sattel. Langsam ging er auf seinen Gefangenen zu.
Douglas Murray kämpfte sich mühsam auf die Füße. Er taumelte und sah sich gehetzt um.
Der Anblick der Zelte und der ausdruckslosen Gesichter der Männer verwirrte ihn.
Kiowa näherte sich. Die ledernen Schnüre der Peitsche schleiften neben ihm über die Erde.
»Wo bin ich? Was wollt ihr von mir?«, keuchte der Gefangene.
»Du mein Hund!«, grunzte Kiowa. »Hunde sprechen nicht ...«
Er schwang die Peitsche, und die dünnen Lederschnüre durchschnitten die Luft. Unter dem ersten Hieb brach Douglas Murray in die Knie. Er war viel zu erschöpft, um diesen brutalen Schlag aushalten zu können.
Alvarez und die anderen weißen Männer wandten sich entsetzt ab. Sie wussten, wie grausam Kiowa sein konnte. Sie gingen zu den Zelten hinüber, und hinter ihnen erstarben die gellenden Schreie Murrays in einem heiseren Winseln ...
»Ethels Sohn«, murmelte Alvarez vor sich hin, aber er sprach so leise, dass ihn niemand hörte. »Er ist der Erste. Und ich werde sie alle vernichten. Die ganze verdammte Murray-Sippe.«
Seine Stimme triefte vor Hass.
Langsam rollte der Wagenzug durch die Berge westwärts. Heiß glühte die Sonne vom wolkenlosen Himmel. Die fünf schwer beladenen Conestogawagen wurden von schwerfälligen Ochsengespannen gezogen. Seit vielen Wochen waren sie unterwegs, Männer, Frauen und Kinder. Eisenharte Pioniere zogen mit ihren Familien durch die Wildnis, um das gelobte Land zu finden.
Die Spitze des Trecks bildete Owen Murrays Wagen. Der grauhaarige Mann ritt neben dem Wagen, und hin und wieder klatschte seine Peitsche auf die knochigen Ochsenrücken.
Auf dem Bock saßen Ethel, seine Frau, und Virginia, seine Tochter. Die Pioniersfrau hielt mit ihren abgearbeiteten Händen die langen Zügelleinen.
»Douglas ist noch immer nicht zurück!«, rief die Frau. »Hoffentlich ist ihm nichts zugestoßen.«
»Der Junge passt schon auf«, gab der Alte zurück. »Ihm passiert so schnell nichts.«
Sie bogen in den dämmrigen Canyon ein, in dem Douglas von Kiowa überrascht worden war. Eine unwirkliche Kühle umfing sie.
»Hier ist er langgeritten, Ethel«, sagte der Pionier. »Siehst du die Hufspuren?«
Die Frau nickte stumm, und doch konnte sie die tiefe Sorge nicht verbergen, die in ihren Augen stand.
Der Treck rollte weiter. Bis er an die Stelle kam, an der Douglas von dem Indianer aus dem Sattel geholt worden war.
Mit einem jähen Ruck zügelte Owen Murray sein Pferd.
Er sah die Spuren auf der staubigen Erde und deutete sie richtig.
Und er bemerkte die tödliche Falle, in die sie hineingefahren waren und die jeden Moment zuschnappen konnte.
Er riss die langläufige Kentucky Rifle aus dem Scabbard und feuerte einen Warnschuss in Richtung Himmel ab. Dieser eine Schuss war wie ein Signal. Er war der Auftakt zu einem tödlichen Gemetzel.
Die fünf Wagen des Trecks befanden sich an einer der schmalsten Stellen des Canyons. Links und rechts schoben sich die glatten Felswände so nahe an den Weg, dass die hochrädrigen Conestogawagen nur knapp durch den Engpass kamen. Die Wagen hielten nun mitten in diesem engen Durchlass, und die Fahrer hatten keine Möglichkeit, mit ihren Gespannen auszuschwärmen, um etwa eine Wagenburg zu bilden. Sie hatten auch keine Möglichkeit, nach vorne durchzubrechen, denn riesige Felsbrocken waren mitten in den Weg gerollt worden.
Das alles erkannte Owen Murray, der Treckboss, in einer einzigen schrecklichen Sekunde.
Oben in den Felsen links und rechts des Engpasses donnerten die ersten Schüsse auf. Owen Murray war einer der ersten, die von einer heißen Kugel aus dem Sattel gefegt wurden. Der Treckboss war auf der Stelle tot.
Seine Frau Ethel sprang vom Wagen und riss das Gewehr an sich, das ihrem Mann entfallen war. Aber bevor sie den ersten Schuss abgeben konnte, wurde auch sie getroffen.
Nach wenigen Minuten war das grausame Gemetzel beendet. Über den Canyon senkte sich bleierne Stille.
Nur ein Mensch lebte noch – Virginia Murray. Schluchzend saß sie neben ihren toten Eltern auf der ausgedörrten Erde. Ihre Augen waren blind vor Tränen.
Sie sah nicht das raue Männerrudel, das von den Felsen herabkam und sich auf der grausigen Todesstätte versammelte.
Sie hob nicht einmal den Kopf, als Alvarez vor ihr stehen blieb und sich sein Schatten über sie senkte.
»Willst du sie am Leben lassen?«, hörte sie die eiskalte Stimme von Bob McDonald. »Ich werde ihr eine Kugel ...«
»Ich gebe hier die Befehle!«, gab Alvarez scharf zurück.
Jetzt blickte Virginia hoch. Sie sah Alvarez' narbiges Gesicht und die eiskalten Augen von McDonald, dem Killer.
»Tötet mich!«, schrie sie hysterisch. »So tötet mich doch ...«
Sie sprang auf die Füße, stürzte auf Alvarez zu und riss ihm das schwere Jagdmesser aus der Scheide am Gürtel. Der Banditenboss lachte rau, als Virginia sich die Klinge in die Brust stoßen wollte. Seine harten Fäuste packten ihre Unterarme, und mit einem Aufschrei ließ sie das Messer fallen.
Alvarez zog das Mädchen dicht zu sich heran. Sein heißer Atem streifte ihr Gesicht. Angewidert schloss sie die Augen.
»Du musst weiterleben«, knurrte er. »Du bist viel zu jung zum Sterben. Und viel zu schön.«
»Wer sind Sie?«, keuchte Virginia. »Was wollen Sie?«
»Ich bin Alvarez.«
»Alvarez, der ...«
Er lachte rau.
»Sprich es nur aus, Virginia Murray. Yeah, ich bin Alvarez, der Bluthund vom Rio Grande. So nennt man mich doch, nicht wahr? Aber du wirst den anderen Alvarez kennenlernen. Denn du sollst meine Frau werden ...«
Entsetzt prallte sie zurück.
»Niemals wird Ihnen das gelingen, Alvarez. Lieber sterbe ich.«
»Du wirst keine Gelegenheit haben, dich selbst zu töten. Ich werde ab heute dafür sorgen, dass du ständig unter Aufsicht bist.«
»Ich werde Sie verraten, sobald sich dazu eine Gelegenheit bietet.«
Er lächelte mitleidig.
»Auch dazu wirst du keine Gelegenheit haben. Denn ich nehme dich mit in meine Stadt. Es gibt dort auch einen Reverend, der uns beide zu Mann und Frau macht, wenn ich es befehle.«
»Warum das alles? Ich verstehe Sie nicht, Alvarez. Mussten Sie denn all diese unschuldigen Menschen umbringen, nur um mich zu bekommen? Das hätten Sie doch auf anderem Wege ebenso gut erreichen können. Vielleicht ...«
»Das verstehst du nicht«, unterbrach er sie grob. »Noch nicht. Eines Tages werde ich dir alles erklären ...«
»Meinen Namen ... Woher wussten Sie meinen Namen?«
»Ich kannte ihn schon lange. Aber auch das werde ich dir erst später erklären ...«
»Wo ist mein Bruder? Wo ist Doug? Habt ihr auch ihn getötet?«
Alvarez zuckte gleichmütig mit den Achseln.
»Ich habe ihn unserem indianischen Freund geschenkt, einem Kiowa. Diese Leute sind bekannt dafür, dass sie Sklaven halten. Kiowa hat sich schon immer einen weißen Sklaven gewünscht. Jetzt hat er deinen Bruder.«
Virginia schrie auf. Sie bäumte sich auf, aber aus den eisenharten Pranken des Banditenbosses gab es kein Entrinnen.
»Sie sind ein Schuft!«, rief sie. »Wie kann ein weißer Mann nur ein solches Verbrechen begehen!«
Er lachte höhnisch.
»Sei froh, dass er lebt, Muchacha«, sagte er. »Es wird an dir liegen, ob es ihm einigermaßen gut geht oder nicht. Wenn du mir eine liebe Frau bist, kann ich ihn vielleicht sogar eines Tages wieder zurückkaufen.«
Virginia senkte den Kopf.
»Ich – ich tue alles, was Sie wollen«, flüsterte sie.
Der Reiter kam vom Süden herauf. Er überquerte den Pass und sah unter sich in der Flussebene die kleine Stadt. Der Mann zügelte sein Pferd, einen mächtigen Rotschimmel. Das Tier musste schon einen weiten Marsch hinter sich haben, denn sein Fell war mit einer dicken Staubschicht bedeckt.
»Red Wing«, murmelte der Reiter und schob den Hut in den Nacken. Sein Haar hatte die Farbe reifen Weizens, braungebrannt war das hagere, scharfgeschnittene Gesicht. Die eisblauen Augen strahlten Zuverlässigkeit und Mut aus.
Der Hengst schnaubte unwillig, und sein Reiter gab die Zügel wieder frei.
Ein schmaler Pfad führte in zahlreichen Windungen talwärts. Ein dunkler Blautannenwald nahm den Reiter auf und spendete angenehme Kühle.
Der Reiter summte eine Melodie vor sich hin, und ein verlorenes Lächeln verklärte seine harten Züge.
Aber plötzlich verschwand dieses Lächeln. Der Hengst schnaubte warnend und blieb stehen.
Mitten auf dem Pfad stand ein bärtiger Mann. Er hielt eine Volcanic Rifle im Hüftanschlag, und die Mündung zeigte genau auf den Reiter.
»Keinen Schritt weiter!«
Der blonde Reiter stützte beide Hände auf das Sattelhorn.
»Bei mir ist nichts zu holen, Wegelagerer«, sagte er sanft. »Lass mich jetzt lieber reiten. Oder bist du scharf auf meinen Skalp?«
»Dreh deinen Gaul um und verschwinde!«, knurrte der Bärtige. »Wir dulden keine Fremden in unserem Tal.«
Der Reiter zeigte ein blitzendes Lächeln.
»Ich bin bisher noch in jede Stadt geritten, in die ich wollte, Hombre. Auch du wirst mich nicht hindern, ins Tal hinunterzureiten. Gib jetzt den Weg frei!«
Der Bärtige zuckte leicht zusammen.
Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. Er war solch einen scharfen und gleichzeitig verächtlichen Ton von Fremden nicht gewöhnt, und deshalb wurde er sekundenlang unsicher.
Aus dem Stand machte der Rotschimmel einen jähen Satz nach vorne. Der Bärtige riss das Gewehr hoch und schoss auf den Reiter, aber der Sattel war längst leer. Die Kugel des Wegelagerers riss ein Loch in den Himmel. Der Reiter aber hing nach Comanchenart an der Flanke des Pferdes.
Der Bärtige repetierte mit einem Fluch das Gewehr durch. Die Hand des Reiters zuckte hoch, ein silbern blitzender Gegenstand durchschnitt die Luft, prallte gegen die Stirn des Wegelagerers, der wie vom Blitz getroffen zu Boden ging.
Der blonde Reiter rief dem Hengst einen halblauten Befehl zu, und das sehnige Tier stand auf dem Fleck, als wäre es aus Stein gemeißelt. Vereinzelte Sonnenstrahlen, die einen Weg in den Wald hineingefunden hatten, spielten auf dem seidigen Fell.
Geschmeidig schritt der Mann zu seinem besiegten Gegner hin. Mit wenigen schnellen Griffen fesselte er den Bewusstlosen.
Der Bärtige schlug die Augen auf.
Der Mann bückte sich und hob einen silbernen Tomahawk von der Erde auf. Langsam schob er die Waffe in eine Lederscheide am Gurt und sagte mit seiner kehligen Stimme: »Das war der silberne Blitz, Mister. Manitu hat es gut mit dir gemeint. Hätte dich die Schneide getroffen, wäre dein Schädel jetzt in zwei Hälften gespalten. Es ist die Waffe vom Alten Adler, dem Häuptling der Mescaleros.«
Der Bärtige grinste vertraulich.
»Erbeutet, wie?«, fragte er. »Warst du dabei, als die Mescaleros im Tal der Toten so vernichtend geschlagen wurden?«
Der blonde junge Mann nickte ernst.
»Ja, ich war dabei«, murmelte er.
»Ich habe davon gehört«, erwiderte der Bärtige grinsend. »Die Rothäute sollen verdammt rau gekämpft haben.«
»Du redest wie ein altes Weib«, raunte der Blonde verächtlich. Er pfiff seinem Pferd, das sofort herantrabte, und schwang sich in den Sattel.
Die Augen des Bärtigen weiteten sich vor Entsetzen.
»He – du willst mich doch nicht hier allein lassen, Stranger?«, jammerte er. »Bind mich los, und ich tue dir auch einen Gefallen. Lass mich frei. Es soll dein Schaden nicht sein.«
»Ich reite jetzt in die Stadt Red Wing hinunter«, entgegnete der Reiter. »Ich werde den Männern dort sagen, dass du hier liegst.«
»Das kannst du nicht machen!«, schrie der Gefangene. »Hier im Wald gibt es allerlei Raubtiere, Wölfe und Pumas. Willst du, dass sie mich fressen?«
»Also gut«, murmelte der Reiter kühl. »Vielleicht lasse ich dich tatsächlich wieder frei. Aber vorher musst du mir erzählen, warum du mir den Weg versperrt hast. Warum darf kein Fremder nach Red Wing?«
»Kennst du Alvarez?«, fragte der Bandit.
»Meinst du den Bluthund vom Rio Grande?«
»Ja, den meine ich. Er ist der Herr dort unten im Tal. Ihm gehört alles. Das Land und die Stadt. Von Red Wing aus gibt es keine Verbindung zur Außenwelt, weil Alvarez das verboten hat.«
»Gibt es einen Saloon dort unten – und einen Store?«
Der Gefangene nickte.
»Warum fragst du? Sicher haben wir das.«
»Dann müssen doch auch Waren geliefert werden.«
»Alvarez lässt alle Waren holen. Und seine Leute fahren immer sehr weit, damit niemand aufmerksam wird.«
»Eine Banditenstadt also, wie?«
»Alvarez bietet uns Unterschlupf und Schutz auf seinem Land«, entgegnete der Gefangene hastig. »Als Gegenleistung reiten wir für ihn – und wir kämpfen auch, wenn er es befiehlt.«
»Was geschieht mit einem Mann, der trotz aller Sicherheitsvorkehrungen die Stadt erreicht?«
Der Gefangene grinste.
»Bis heute ist es noch keinem gelungen. Und wenn ... Nun, der Mann würde nicht mehr lange am Leben bleiben.«
»Was machst du, wenn ich dich losbinde, Hombre?«, fragte der Reiter.
»Ich kann nichts für dich tun, Stranger, wenn du das meinst«, brummte der Bärtige. »Aber immerhin habe ich eine Menge für dich getan, indem ich dir erzählt habe, was da unten im Tal los ist. Ich habe dir mit meiner Warnung das Leben gerettet.«
»Das hast du wirklich«, erwiderte der Reiter. »Ich möchte nämlich gerne noch viele Jahre leben. Hätte ich das gewusst, wäre ich niemals auf Red Wing zugeritten.«
In den Augen des Gefangenen blitzte es auf.
»He!«, zischte er misstrauisch. »Woher weißt du überhaupt, dass es diese Stadt gibt?«
»Ein Vogel hat es mir zugerufen«, erwiderte der Reiter lächelnd. »Ich ...«
Er brach ab. Er hatte ein Geräusch wahrgenommen, das nicht in den Wald passte. Hinter ihm zwischen den Bäumen schimpfte ein Häher. Gefahr!
Der Reiter warf sich aus dem Sattel. Es war keine Sekunde zu spät. Ein Schuss krachte, und die Kugel schlug über ihm in einen Baumstamm.
Blitzschnell feuerte der blonde Fremde zurück. Längst hatte sich der Hengst mit einem gewaltigen Sprung in Sicherheit gebracht.
Auf den Schuss des Fremden folgte ein lang gezogenes Stöhnen, dann ein dumpfer Fall.
Es war still. Die Wildnis mit ihren vielen Stimmen schwieg erschreckt. Ein kleiner Vogel brach als Erster das tiefe Schweigen.
Der gefesselte Bandit grinste jetzt nicht mehr. Sein Gesicht war schreckensbleich.
Er hatte auf seinen Kumpan gewartet und deshalb den Fremden hingehalten. Er war fest davon überzeugt gewesen, dass der Fremde verloren sein würde.