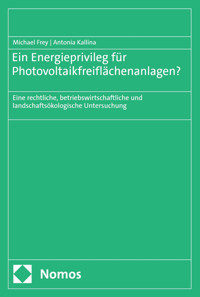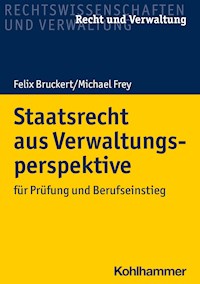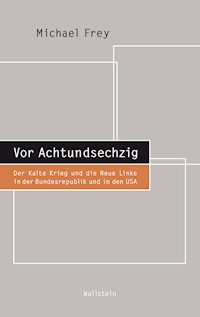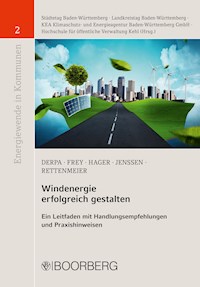
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Richard Boorberg Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Energiewende in Kommunen
- Sprache: Deutsch
Rückenwind für Ihr Vorhaben Das Buch bietet Kommunen und Vorhabenträgern einen umfassenden Einblick in die komplexen Zusammenhänge von Planung, Finanzierung, Rentabilität und Realisierung von Windenergieanlagen. Die Windenergie als zentraler Eckpfeiler der Energiewende ist aus der Perspektive der Kommunen längst ein Dauerbrenner. Wer noch kurz nach der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 glaubte, mit einzelnen Maßnahmen seine Hausaufgaben gemacht zu haben, sieht sich nunmehr einer Daueraufgabe gegenüber. Die Autoren erläutern: Technische und energiewirtschaftliche Rahmenbedingungen Genehmigung von Windenergieanlagen Planung von Standorten für Windkraftanlagen Rentabilität von Windenergieprojekten Kommunen als Moderator und Vermittler widerstreitender Interessen Typische Aspekte und Argumente der Windenergiediskussionen vor Ort In einem gesonderten Abschnitt sind zwei Beispiele für gut umgesetzte Windenergievorhaben auf Waldstandorten dargestellt (Best Practice). Leserinnen und Leser profitieren besonders von: einer detaillierten Zusammenstellung der vielfältigen Gestaltungs- und Umsetzungsinstrumente, passgenauen Daten und Fakten, zielführenden Handlungsempfehlungen. Unentbehrlich ... Für Kommunen ist dieser Ratgeber unentbehrlich. Aber auch den für die Standortsteuerung zuständigen Planungsträgern der Raumordnung und Bauleitplanung, den zuständigen Genehmigungsbehörden, Planungsbüros und Windenergiebetreiber-Gesellschaften ist der Band eine wertvolle Arbeits- und Orientierungshilfe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Windenergie erfolgreich gestalten
Ein Leitfaden mit Handlungsempfehlungen und Praxishinweisen
Herausgeber
Städtetag Baden-Württemberg Landkreistag Baden-Württemberg KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Schriftleiter
Prof. Dr. Michael Frey
Bearbeiter
Dr. Ulrich Derpa Prof. Dr. Michael Frey Prof. Dr. Gerd Hager Dr. Till Jenssen Andreas Rettenmeier
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek | Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Print ISBN 978-3-415-06467-6 E-ISBN 978-3-415-06500-0
© 2019 Richard Boorberg Verlag
E-Book-Umsetzung: Datagroup int. SRL, Timisoara
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlages. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Titelfoto: © RBV/lassedesignen – Fotolia
Richard Boorberg Verlag GmbH & Co KG | Scharrstraße 2 | 70563 Stuttgart Stuttgart | München | Hannover | Berlin | Weimar | Dresdenwww.boorberg.de
Vorwort der Herausgeber
Die Energiewende ist aus der Perspektive der Kommunen längst zu einem Dauerbrenner geworden. Wer noch kurz nach der Fukushima-Katastrophe im Jahr 2011 geglaubt hatte, mit einzelnen Maßnahmen seine Hausaufgaben gemacht zu haben, sieht sich nunmehr einer lebenslangen Lernaufgabe gegenüber.
Gerade auch die Vielschichtigkeit und Vielgestaltigkeit der Energiewende hat die Herausgeber, den Städtetag Baden-Württemberg, den Landkreistag Baden-Württemberg, die KEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH und die Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl bewogen, sich der gesamten Bandbreite des Themas anwendungsorientiert und aus kommunaler Sicht anzunehmen.
Nach dem bereits erschienenen ersten Band der Schriftenreihe, der einen breiten Überblick über die verschiedenen Themenbereiche der Energiewende sowie die Handlungsfelder und -möglichkeiten der Kommunen bietet, soll der nun vorliegende zweite Band sich dem konfliktreichen Themenfeld der Windenergieerzeugung aus kommunaler Sicht widmen.
Der Dank der Herausgeber geht zunächst an die Autoren dieses Bandes, nämlich an Dr. Ulrich Derpa, Prof. Dr. Gerd Hager, Dr. Till Jenssen, Andreas Rettenmeier, Sabine Häffner, Franziska Tucci und nicht zuletzt an Prof. Dr. Michael Frey, der zugleich die Schriftleitung inne hatte. Dem Richard Boorberg Verlag und namentlich Christine Class sind wir dankbar für die Begleitung der ambitionierten und zugleich in hohem Maße praxisrelevanten Schriftenreihe „Energiewende in Kommunen“.
Selbstverständlich freuen sich Autoren und Herausgeber über Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge aus dem Kreis der Leserinnen und Leser.
Dr. Alexis von KomorowskiHauptgeschäftsführerLandkreistag Baden-Württemberg
Gudrun Heute-BluhmGeschäftsführendes VorstandsmitgliedStädtetag Baden-Württemberg
Prof. Paul WittRektorHochschule für öffentliche Verwaltung Kehl
Dr.-Ing. Volker KienzlenGeschäftsführerKEA Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Württemberg GmbH
Inhalt
Autoren- und Schriftleiterverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Kapitel 1 Rahmenbedingungen der Windenergienutzung an Land – eine technische und energiewirtschaftliche EinordnungTill Jenssen/Andreas Rettenmeier
I. Grundlagen der Windenergienutzung
II. Zielsetzungen zur Windenergie
III. Anlagentechnik und deren Entwicklung
1. Standardisierung der Anlagentechnik
2. Aufskalierung der Windenergie
IV. Potenziale und Standorte zur Windenergienutzung
1. Flächenpotenzial der Windenergie
2. Bedeutung der Windhöffigkeit
3. Größe der Windparks
V. Ökonomische Entwicklung und Perspektiven
1. Langfristige Kostenentwicklung
a. Investitionskosten
b. Betriebskosten
2. Erfahrungen mit dem Ausschreibungsregime
3. Zielvorstellungen des Koalitionsvertrages
4. Bedarf und Perspektiven für Forschung und Entwicklung
5. Herausforderung Größenentwicklung
VI. Windenergie in flachem und komplexem Gelände
1. Umgebungsgrößen
a. Bestimmung der meteorologischen Voraussetzungen
b. Boden- und Felsmechanik
2. Anlagenkomponenten
a. Turmkonzepte
b. Gondel
c. Leichtbaukonzepte
d. Entwicklung neuer Rotorblätter
3. Smarte Windenergienutzung
4. Systemintegration
VII. Herausforderungen für die Windenergie an Land
Kapitel 2 Die rechtlichen Ebenen der WindenergienutzungUlrich Derpa (I.)/Gerd Hager (II.1.– 4.)/Michael Frey (II.5. u. III.)
I. Windenergie auf der Genehmigungsebene Ulrich Derpa
1. Rechtsgrundlage für die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb einer Windenergieanlage
2. Formelle Voraussetzungen der immissionsschutzrechtlichen Genehmigung
a. Genehmigungsantrag, Weichenstellung förmliches oder vereinfachtes Verfahren
b. Förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung
c. Vereinfachtes Verfahren
d. Weiteres Verfahren
3. Materielle Genehmigungsvoraussetzungen
a. Immissionsschutzrechtrechtliche Voraussetzungen
b. Bauplanungsrecht
aa. Geltungsbereich eines Bebauungsplans
bb. Nichtbeplanter Innenbereich
cc. Außenbereich
dd. Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung
ee. Bauplanungsrechtliches Rücksichtnahmegebot
ff. Erschließung
gg. Einvernehmen der Gemeinde
hh. Zurückstellung des Genehmigungsantrags
c. Bauordnungsrecht
d. Weitere öffentlich-rechtliche Vorschriften
4. Entscheidung über den Genehmigungsantrag
a. Die Genehmigungsentscheidung
b. Vorbescheid, Teilgenehmigung, vorzeitiger Beginn, Sofortvollzug
c. Änderungen der Genehmigungsentscheidung
5. Rechtsschutz
a. Bauherr
b. Drittschutz
c. Umweltvereinigungen
d. Anwendung auf natürliche und (andere) juristische Personen
e. Einsicht in Verfahrensunterlagen
f. Rechtsschutz der Gemeinde
6. Fazit und Ausblick
II. Planung von Standorten für WindkraftanlagenGerd Hager
1. Das Planungssystem
a. Planvorbehalt
b. Länderöffnungsklausel
c. Windenergieerlasse
2. Regionalplanung
a. Planinhalt
b. Ziele der Raumordnung
c. Regionalplanverfahren
3. Flächennutzungsplanung
a. Der Flächennutzungsplan und sein Plangebiet
b. Planinhalt
c. Besonderheiten der planerischen Entscheidung
d. Planungsverfahren
e. Einzelaspekte
aa. Immissionsschutz
bb. Denkmalschutz
cc. Naturschutz
dd. Artenschutz
ee. Weitere Belange
f. Plansicherung
g. Repowering
4. Bebauungsplan
a. Planungsoptionen
b. Rechtliche Bindungen
c. Festsetzungsmöglichkeiten
5. Die Ebene der Grundstückssicherung
a. Der Gestattungsvertrag zwischen Grundstückseigentümer und Realisierungspartner
aa. Rechtsnatur des Gestattungsvertrags
bb. Wesentliche Inhalte des Gestattungsvertrags
b. Flächenpooling als Möglichkeit gemeinschaftlicher Windenergieentwicklung bei mehreren Eigentümern innerhalb einer windhöffigen Fläche
III. Annex: Die Planung und die Rentabilität von Windenergieprojekten aus der Sicht der VorhabenträgerMichael Frey/Sabine Häffner
1. Planung von Windenergieprojekten durch Vorhabenträger
a. Flächenscreening
b. Grundstücksbeschaffung
c. Festlegung des Anlagentyps der WEA
d. Vorbereitung des Genehmigungsantrags
e. Einreichung des Genehmigungsantrags
f. Ausschreibungsverfahren
g. Bau der Windenergieanlage
h. Inbetriebnahme der Windenergieanlage
i. Laufender Betrieb und Wartung
2. Aspekte der Rentabilität von Windenergieprojekten
a. Erlösseite
b. Kostenseite
3. Fazit
Kapitel 3 Die Rolle der Kommunen als Moderator und Vermittler widerstreitender InteressenMichael Frey
I. Energiepolitischen Sachverstand vor Ort sichern
1. Gründen Sie ein Bürger-Expertengremium
2. Finden Sie die richtigen Mitglieder dieses Gremiums
3. Umfassende energiepolitische Strategie für die Kommune
4. Transparenz und Frühzeitigkeit
a. Ein Forum schaffen
b. Geeignete Veranstaltungsformen
c. Alternativen zu Veranstaltungen
d. Unparteilichkeit ermöglichen
e. Gesprächsbereit bleiben
f. Frühzeitigkeit
II. Die Kommune als Eigentümerin windhöffiger Flächen
1. Kommunale Grundstücksflächen in der Flächennutzungsplanung
a. Kommunale Grundstücksflächen auf der zivilrechtlichen Ebene
b. Besteht eine Pflicht zur Windenergienutzung kommunaler Grundstücke?
c. Vergaberechtliche Anforderungen an die Verpachtung kommunaler Grundstücke an Dritte
aa. Anwendungsbereich des Vergaberechts
bb. Ablauf des Verfahrens
cc. Wichtige Aspekte aus kommunaler Sicht
dd. Auswahl geeigneter Unternehmen für die Verhandlungsphase: Kriterien und Ablauf
Kapitel 4 Typische Aspekte und Argumente der Windenergiediskussion vor OrtMichael Frey
I. Lärmemissionen von Windenergieanlagen und Mindestabstände
II. Optisch bedrängende Wirkung von Windenergieanlagen
III. Windenergieanlagen, Infraschall und Gesundheitsgefahren
IV. Auswirkungen von Windenergieanlagen auf den Tourismus
V. Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen – lohnt sich das?
VI. Warum gibt es unterschiedliche Vorsorgeabstände für verschiedene Wohnbereiche und verschiedene Tierarten?
VII. Was heißt das: „substanziell Raum für die Windenergie“?
VIII. Windenergieanlagen und der Wertverlust der eigenen Wohnimmobilie
IX. Was passiert, wenn eine Windenergieanlage brennt?
Kapitel 5 Zwei Beispiele für gut umgesetzte Windenergievorhaben auf Waldstandorten in Baden-WürttembergFranziska Tucci
I. Einleitung
II. Windpark Lauterstein
1. Flächeneinsparung von Anfang an als Ziel
2. Planung von Natur- und Artenschutzmaßnahmen mit Naturschutzvertretern vor Ort
3. Projekt-Website schafft Transparenz
III. Windpark Rauhkasten/Steinfirst
1. Windenergie wird in der Region als Chance begriffen
2. Umfangreiche Beteiligung kommt Dorf- und Nachbarschaftsfrieden zugute
Stichwortverzeichnis
Autoren- und Schriftleiterverzeichnis
Dr. Ulrich Derpa
Erster Landesbeamter im Main-Tauber-Kreis und für den Landkreistag Baden-Württemberg Mitglied im Arbeitskreis Windenergie beim Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg.
Dr. Derpa studierte nach Abitur in Arnsberg und Wehrdienst in Celle, Unna und Sonthofen Rechtswissenschaften mit fachspezifischer Fremdsprachenausbildung in Passau, Tours und Mannheim.
Nach den juristischen Examina und der Tätigkeit als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Deutsches und Ausländisches Öffentliches Recht, Völkerrecht und Europarecht an der Universität Mannheim wurde er mit einem europarechtlichen Thema bei Prof. Dr. Eibe Riedel promoviert. Danach Tätigkeit im Landratsamt Main-Tauber-Kreis und im Staatsministerium Baden-Württemberg. Mitglied im Führungskreis Europa und Internationales.
Prof. Dr. Michael Frey, Mag. rer. publ.
Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl.
Prof. Dr. Frey wurde in Offenburg geboren. Nach Abitur und Wehrdienst im Eurokorps studierte er von 1996–2001 Rechtswissenschaften an der Universität Freiburg und Verwaltungswissenschaften an der Deutschen Hochschule für Verwaltungswissenschaften in Speyer. Rechtswissenschaftliche Promotion an der Universität Freiburg 2009. Nach der Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Wirtschaftsrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht an der Universität Freiburg verschiedene Tätigkeiten im Regierungspräsidium Freiburg in der Stabstelle für Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europäische Angelegenheiten, sowie als Koordinierungsreferent und zuletzt Leiter des Kompetenzzentrums Energie. Seit 2013 Tätigkeit als Professor für Öffentliches Recht an der Hochschule für öffentliche Verwaltung Kehl mit den Forschungsschwerpunkten Rechtsfragen der Erneuerbaren Energien und Grenzüberschreitende Zusammenarbeit und Europa. Zahlreiche Veröffentlichungen zu energieverwaltungsrechtlichen Fragestellungen.
Prof. Dr. Gerd Hager
Geb. 1955, studierte Rechts- und Verwaltungswissenschaften an den Universitäten Heidelberg, Speyer und Konstanz. Er ist Vater von zwei Töchtern. Nach seiner Assistentenzeit und der Promotion mit einem verfassungsrechtlichen Thema bei Professor Dr. Hartmut Maurer in Konstanz arbeitete er im Dienste des Landes Baden-Württemberg bei verschiedenen Landratsämtern, dem Regierungspräsidium Karlsruhe und dem Innenministerium Baden-Württemberg. Er absolvierte den 4. Kurs der Führungsakademie des Landes Baden-Württemberg (1989/90). Auslandsprojekte führten ihn in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Indonesien, Weißrussland und Aserbaidschan. Bis 1997 arbeitete er als Erster Landesbeamter im Enzkreis, danach war er stellvertretender Leiter der Bauabteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe. Im Jahre 2001 wurde Gerd Hager zum Direktor des Regionalverbandes Mittlerer Oberrhein gewählt und 2009 sowie 2017 in seinem Amt bestätigt. Gleichzeitig ist er Geschäftsführer der grenzüberschreitenden Touristik-Gemeinschaft Baden-Elsass-Pfalz, des Initiativkreises Metropolitaner Grenzregionen (IMeG) und der Arbeitsgemeinschaft der Regionalverbände in Baden-Württemberg. Gerd Hager lehrt als Honorarprofessor am Karlsruher Institut für Technologie und hat zahlreiche Beiträge zum Gemeinderecht, Baurecht und Raumordnungsrecht veröffentlicht. Er ist u. a. Herausgeber eines Kommentars zum Landesplanungsrecht Baden-Württemberg, Mitherausgeber einer sechsbändigen Baurechtssammlung und Autor von Kommentaren zur Landesbauordnung, zum Raumordnungsgesetz und zum Denkmalrecht Baden-Württemberg.
Dr. Till Jenssen
Till Jenssen ist seit 2018 Referent für Regional- und Bauleitplanung, Landschaftsplanung beim Verband Region Stuttgart. Zuvor war er in der Umweltverwaltung des Landes Baden-Württemberg (2012 bis 2018), der Energieforschung (2006 bis 2012), der GIS-Analyse (2004 bis 2006) und der Umweltkommunikation (2002 bis 2004) tätig.
Herr Jenssen hat das Studium der Raumplanung absolviert und wurde 2009 promoviert. Er hat an der Universität Stuttgart, der Technischen Universität Dortmund und der Technischen Universität München Lehraufgaben in den Themenfeldern Umweltschutz, Umwelt- und Infrastrukturplanung, Erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit übernommen.
Andreas Rettenmeier
Andreas Rettenmeier ist seit Oktober 2016 Teamleiter Windenergie im Fachgebiet Systemanalyse des Zentrums für Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW).
Von 2001 bis 2003 arbeitete er im Bereich Messtechnik/Neue Technologien beim Anlagenhersteller Enercon. Von 2004 bis 2013 war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent und Projektleiter am Stuttgarter Lehrstuhl für Windenergie der Universität Stuttgart beschäftigt, den er während der Vakanz ab 2010 eineinhalb Jahre kommissarisch leitete. In dieser Zeit initiierte er das süddeutsche Forschungsnetzwerk WindForS, das er von Beginn bis Mitte 2017 als Geschäftsführer koordinierte und dem inzwischen mehr als 20 Institute von sieben Institutionen aus Bayern und Baden-Württemberg angehören. Von 2012 bis 2015 leitete er den Subtask III „Procedures for turbine assessment“ des Task 32 „Wind Lidar Systems for Wind Energy Deployment“ der Internationalen Energieagentur.
Andreas Rettenmeier hat 2001 das Fachhochschulstudium des Allgemeinen Maschinenbaus in Aalen absolviert. Von 2006 bis 2010 studierte er in Teilzeit Luft-und Raumfahrttechnik an der Universität Stuttgart.
Franziska Tucci
Franziska Tucci ist seit Anfang 2014 bei der Fachagentur Windenergie an Land (FA Wind) tätig und betreut dort hauptsächlich die Themen Natur- und Artenschutz und Windenergie im Wald. Sie studierte „International Forest Ecosystem Management“ (B. Sc.) an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde (HNEE) und absolvierte dort ebenso den interdisziplinären Masterstudiengang „Global Change Management“. Im Rahmen ihrer Masterarbeit beschäftigte sie sich mit dem Thema Erneuerbare Energien und Naturschutz, womit ihr der Einstieg in den Windenergiesektor gelang. Bevor sie zur FA Wind kam, war Frau Tucci in der internationalen Entwicklungszusammenarbeit, bei einem Politikberatungsinstitut und in der Klimafolgenforschung beschäftigt.
Abkürzungsverzeichnis
aaO
am angegebenen Ort
AAVO
Ausgleichsabgabeverordnung
AllMBl.
Allgemeines Ministerialblatt
BauNVO
Baunutzungsverordnung
Bay
Bayern, bayerisch
BayVBl.
Bayerische Verwaltungsblätter (Zeitschrift)
BeckOK
Beck’scher Online-Kommentar
BGBl.
Bundesgesetzblatt
BHKW
Blockheizkraftwerk
BImSchG
Bundes-Immissionsschutzgesetz
BNatSchG
Bundesnaturschutzgesetz
BT-Drs.
Bundestagsdrucksache
BUND
Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e. V.
BVerwGE
Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
BW
Baden-Württemberg
CEF
continuous ecological functionality-measures
CH4
Methan
dBA
Schalldruckpegel
DIN
Deutsches Institut für Normung
DSchG
Denkmalschutzgesetz
DVO-BauGB
Durchführungsverordnung zum Baugesetzbuch
DVW
Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanagement e. V.
DWDG
Gesetz über den Deutschen Wetterdienst
EAG
Europarechtsanpassungsgesetz
FCS
favourable conservation status
FFH
Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
GABl.
Gemeinsames Amtsblatt
GBl.
Gesetzblatt
GbR
Gesellschaft bürgerlichen Rechts
GDG
Guidelines Development Group
GE
Gewerbegebiete
GemHVO
Gemeindehaushaltsverordnung
GemO
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
GI
Industriegebiete
GMBl.
Gemeinsames Ministerialblatt
GVBl.
Gesetz- und Verordnungsblatt
GVV
Gemeindeverwaltungsverband
GWB
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWB-E
GWB-Entwurf zur Neuregelung des deutschen Vergaberechts
H2
Wasserstoff (gasförmig)
ISO
International Organisation for Standardization
i. S. v.
im Sinne von
i. V. m.
in Verbindung mit
ImSchZuVO
Immissionsschutz-Zuständigkeitsverordnung
KomHVO
Kommunalhaushaltsverordnung
KSG
Klimaschutzgesetz
LAI
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
LBO
Landesbauordnung
LDAY
Tag-Lärmindex
Lden
Tag-Abend-Nacht-Lärmindex
LEVENING
Abend-Lärmindex
LNIGHT
Nacht-Lärmindex
LEP
Landesentwicklungsprogramm
LGA
Landesgesundheitsamt
LGebG
Landesgebührengesetz
LHO
Landeshaushaltsordnung
LT-Drs.
Landtagsdrucksache
LUBW
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg
LV
Landesverfassung
LVG BW
Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg
LVwVG
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz
MD
Dorfgebiete
MI
Mischgebiete
MLR
Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz
NABU
Naturschutzbund
NJOZ
Neue Juristische Online-Zeitschrift
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
N.N.
Normal-Null
NuR
Natur und Recht (Zeitschrift)
NVerbG
Nachbarschaftsverbandsgesetz
NVwZ
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NVwZ-RR
Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (Rechtsprechungs-Report)
PlanZV
Planzeichenverordnung
PS
Plansatz
RiL
Richtlinie
ROG
Raumordnungsgesetz
SchlHGVOBl.
Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein
SektVO
Sektorenverordnung
TA-Lärm
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm
TÖB
Träger öffentlicher Belange
UM
Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft
UmwRG
Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UVPG
Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung
UVwG
Umweltverwaltungsgesetz
ü.NN
über Normal Null (Höhe über dem Meeresspiegel)
VBlBW
Verwaltungsblätter für Baden-Württemberg
VgV
Vergabeverordnung
VR
Verwaltungsrundschau (Zeitschrift)
VRG
Verwaltungsstruktur-Reformgesetz
VwV
Verwaltungsvorschrift
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
WA
Allgemeine Wohngebiete
WEE
Windenergie-Erlass
WG
Wohngesetz
WHG
Wasserhaushaltsgesetz
WR
Reine Wohngebiete
ZfBR
Zeitschrift für deutsches und internationales Bau- und Vergaberecht
Literaturverzeichnis
Battis/Krautzberger/Löhr, BauGB, Kommentar, 13. Auflage, München, 2016
Boewe/Meckert (Hrsg.), Leitfaden Windenergie, 2013
Decker, Rechtsschutz gegen Flächennutzungspläne nach dem UmwRG, VBl. Baden-Württemberg 2018, 441
Ernst/Zinkahn/Bielenberger/Krautzberger (Hrsg.), BauGB, Loseblattwerk, München, fortlaufend, 131. Lieferung 10/2018
Fachagentur Windenergie an Land, Nachträgliche Anpassung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungen aufgrund artenschutzrechtlicher Belange, bearbeitet von Fellenberg, 2016
Fachagentur Windenergie an Land, Klagemöglichkeiten nach dem Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) 2017, bearbeitet von Philipp-Gerlach/Teßmer, 2017
Fachagentur Windenergie an Land, 20 Jahre Erfahrungen mit der privilegierten Zulässigkeit von Windenergieanlagen im Außenbereich, bearbeitet von Söfker, 2018
Franco/Frey, Möglichkeiten zur Zulassung von Windenergieanlagen trotz entgegenstehender Darstellungen in der Flächennutzungsplanung, BauR 2014, 1088
Frenz, Energiewende zwischen Beihilfenverbot und Artenschutz, NVwZ 2017, 1579
Gatz, Windenergieanlagen in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis, 3. Auflage, Bonn, 2019
Hager/Hammer/Morlock/Zimdars/Davydov, DSchG BW, Kommentar, 2. Auflage, Wiesbaden, 2016
Hoppenberg/de Witt (Hrsg.), Handbuch des öffentlichen Baurechts, Loseblattwerk, 51. Auflage, München, 2018
Jäde/Dirnberger (Hrsg.), BauGB, Kommentar, 8. Auflage, Stuttgart, 2017
Jarass/Kment, BauGB, Kommentar, 2. Auflage, München, 2018
Jarass/Pieroth, Grundgesetz, Kommentar, 15. Auflage, München, 2018
Kment, Rechtsbehelfe von Umweltvereinigungen, NVwZ 2018, 921
König/Röser/Stock, BauNVO, Kommentar, 3. Auflage, München, 2014
Martin/Krautzberger (Hrsg.), Handbuch Denkmalschutz und Denkmalpflege, 4. Auflage, München, 2016
Maslaton (Hrsg.), Windenergieanlagen, 2. Auflage, München, 2018
Schmidt/Kahl/Gärditz, Umweltrecht, 10. Auflage, 2017
Schrödter (Hrsg.), BauGB, Kommentar, 9. Auflage, München, 2019
Schulz (Hrsg.), Handbuch Windenergie, 2015
Simon/Busse (Hrsg.), BayBO, Kommentar, Loseblattwerk, München, fortlaufend, 132. Ergänzungslieferung 12/2018
Spannowsky/Uechtritz, BauGB, Kommentar, 3. Auflage, München, 2018
Spitz, Planungen für Standorte von Windkraftanlagen, 2016
Strobl/Sieche/Kemper/Rothemund, DSchG BW Kommentar, 4. Auflage, Stuttgart, 2019
Kapitel 1Rahmenbedingungen der Windenergienutzung an Land – eine technische und energiewirtschaftliche Einordnung
Till Jenssen / Andreas Rettenmeier
I. Grundlagen der Windenergienutzung
Kinetische und elektrische Energie
Windenergieanlagen machen sich die kinetische Energie des Windes, die durch die solare Einstrahlung und daraus resultierende Temperatur- und Druckunterschiede hervorgerufen wird, zu Nutze und konvertieren sie in mechanische und elektrische Energie. Die Bereitstellung von Strom aus Windenergie hängt damit in einem hohen Maße von den jeweiligen naturräumlichen Gegebenheiten ab und gehört entsprechend des jeweiligen Angebotes an Wind zu den volatilen erneuerbaren Energiequellen. In Deutschland werden Windenergieanlagen mit Ausnahme weniger Sonderanwendungen im stromnetzgekoppelten Betrieb eingesetzt. Grundsätzlich können sie an Land (onshore) und im Meer (offshore) eingesetzt werden, dieses Kapitel konzentriert sich auf die Windenergie an Land.
Windenergie als Teil der Konsistenzstrategie
Die handlungsleitende Idee hinter der Windenergienutzung ist es, zur Befriedigung des bestehenden Energiebedarfes nachhaltige(re) Ressourcen zu nutzen (Konsistenzstrategie) und tatsächlich sticht Windenergie im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energien durch geringe Stromgestehungskosten und sehr gute Möglichkeiten zur Treibhausgasminderung hervor. Beides ist in ähnlicher Weise ansonsten nur bei der Wasserkraft vorzufinden, die jedoch über deutlich geringere Ausbaupotenziale als die Windenergie verfügt.
II. Zielsetzungen zur Windenergie
Energiepolitische Ziele des Bundes
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
Vor diesem Hintergrund spielt der Ausbau der Windenergie bei den Zielsetzungen von Bund und Ländern eine bedeutende Rolle. Mit der aktuellen Fassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)1 wird das Ziel verfolgt, den Anteil der regenerativen Stromerzeugung bis 2035 auf 55 bis 60 Prozent anzuheben. Der Koalitionsvertrag auf Bundesebene vom März 2018 strebt darüber hinausgehend einen Anteil von etwa 65 Prozent bis 2030 an.2 Bislang ist im EEG ein jährliches Ausschreibungsvolumen für die Windenergie in Höhe von 2.800 Megawatt (2017 bis 2019) bzw. 2.900 Megawatt (ab 2020) festgeschrieben. Letzteres wird in Anbetracht der Altersstruktur und des Herausfallens bestehender Windenergieanlagen aus der Förderung ab 2021 absehbar nicht ausreichen, um die genannten Zielsetzungen zu erreichen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) geht davon aus, dass bis 2035 durchschnittlich 1.900 Megawatt an Windleistung jährlich vom Netz gehen werden.3 Die Ambition der Aufgabenstellung wird ersichtlich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass allein die 3.000 Megawatt-Marke seit Einführung des EEG bisher nur in fünf Kalenderjahren (2002 und 2014 bis 2017) erreicht wurde. Im langfristigen Mittelwert der Jahre 2000 bis 2017 lag der Zubau unter 2.600 Megawatt.4
III. Anlagentechnik und deren Entwicklung
Von der historischen zur modernen Windenergienutzung
Die Windenergie wird in Form des Antriebs von Mühlen oder beim Segeln bereits seit Jahrtausenden genutzt, die prototypenbasierte Nutzung elektrischer Windenergieanlagen begann jedoch erst zum Ende des 19. Jahrhunderts in Dänemark. Bis zur industriellen Anwendung bedurfte es vielzähliger technischer Entwicklungen und (Grundlagen-)Forschungen, um die sich bietenden Möglichkeiten technisch zuverlässig und kostengünstig nutzen zu können.5 In Deutschland hat die Windenergie seit Einführung des EEG im Jahr 2000 eine energiewirtschaftliche Bedeutung erlangt (Windenergie an Land und im Meer) und trägt mittlerweile in einem Umfang von mehr als 18 % zur Bruttostromerzeugung bei. Damit stellt sie im Bereich der Stromerzeugung den größten Beitrag unter den erneuerbaren Energien.
1. Standardisierung der Anlagentechnik
Standardisierung im Zuge der industriellen Nutzung
In den ersten Jahren der industriellen Windstromerzeugung hat sich eine Fokussierung auf das Auftriebsprinzip6 (anstatt des Widerstandsprinzips) sowie eine Standardbauform für Windenergieanlagen herausgebildet.
Zunahme der Anlagengröße
Alle gängigen, im industriellen Maßstab genutzten Windenergieanlagen verfügen demnach über die in Abb. 1 (Seite 26) skizzierten Dreiblattrotoren, eine horizontale Rotorachse, Luvläufer (ansonsten käme es durch den Windschatten des Turmes zu periodischen, mechanischen Belastungen und zu Leistungseinbußen) sowie ein Azimutsystem zur Ausrichtung des Maschinenhauses (aktive Windnachführung).7 Die Gründe für diese Standardbauform liegen in der höheren Effizienz und der geringen Materialbelastung, aber auch in der Generierung von Skaleneffekten durch eine standardisierte Produktion. Gleichzeitig wurde die gesamte Anlagentechnik (Materialeinsatz, Getriebetechnik, Regelungstechnik und Aerodynamik) weiterentwickelt. Im Rahmen dieses Prozesses hat eine erhebliche Steigerung des Stromertrags Einzug gehalten.
2. Aufskalierung der Windenergie
Aufskalierung der Windenergie
Wahrnehmbarkeit der Windenergie
Markteinführung der 4 MW-Anlagen
Sichtbar werden die dynamischen Entwicklungen im Bereich der Windenergie vor allem, wenn man sich die Größen der heutigen Anlagen vor Augen führt. Hier hat eine rasante Aufskalierung bei Generatorleistung, Nabenhöhe und Rotordurchmesser stattgefunden (siehe beigefügte Tabelle), die einerseits zu erheblichen Steigerungen bei Stromerträgen und Beiträgen zur Treibhausgasminderung geführt hat, andererseits aber auch die Wahrnehmbarkeit in der Landschaft vergrößert hat. Für ein konstantes energiepolitisches Ziel muss nun aber eine geringere Anzahl an Windkraftanlagen installiert werden, als dies in der Vergangenheit erforderlich gewesen wäre. Während die heutige Generation an Windenergieanlagen in Deutschland über Leistungen über 3,0 Megawatt, durchschnittliche Nabenhöhen von ca. 140 Metern sowie durchschnittliche Rotordurchmesser von über 120 Metern verfügt, sind kleine und mittlere Windenergieanlagen der Kilowatt-Klasse nicht mehr marktrelevant. Gleichzeitig hat auch eine stärkere Differenzierung zwischen Starkwind- und Binnenlandanlagen stattgefunden. Aktuell steht die 4 Megawattklasse am Beginn einer breiten Markteinführung.8
Abb. 1: Konstruktive Merkmale standardisierter Großwindanlagen
Binnenlandanlagen werden typischerweise mit eher großen Rotoren und eher kleinen Generatoren (großes Rotor-Generator-Verhältnis) ausgestattet.9 Eine Kennzahl in diesem Zusammenhang stellt die Flächenleistung [W/m²] dar, bei der die erzeugte elektrische Leistung ins Verhältnis zur überstrichenen Rotorkreisfläche gesetzt wird. Bei Windenergieanlagen an Schwachwindstandorten erzielt man durch die Senkung der Flächenleistung eine Erhöhung der Volllaststunden sowie eine verstetigtere Stromeinspeisung.
Technischer Parameter
Einheit
1998
2008
2018
Installierte Leistung
kW
750
1.750
3.000
Rotordurchmesser
m
48
79
120
Nabenhöhe
m
63
93
145
Windgeschwindigkeit in 100 m ü. G.
m/s
6,0
6,0
6,0
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
m/s
5,3
5,9
6,4
Volllaststunden
h/a
1.200
1.900
2.400
Jährlicher Bruttostromertrag
MWh
900
3.325
7.200
Jährliche Treibhausgasminderung
t
600
2.250
4.900
Vergleich der Anlagentechnik verschiedener Generationen an Windenergieanlagen10
IV. Potenziale und Standorte zur Windenergienutzung
1. Flächenpotenzial der Windenergie
Technisches Potenzial der Windenergie
Regionale Verteilung
Das Umweltbundesamt (UBA) hat auf Grundlage einer umfangreichen Studie11 attestiert, dass für die Windenergienutzung deutschlandweit ein Flächenpotenzial von fast 50.000 Quadratkilometern besteht und auf diesen Flächen eine Windleistung von nahezu 1.200 Gigawatt möglich ist. Das technische Potenzial liegt damit um den Faktor 24 über dem derzeitigen Anlagenbestand von 51 Gigawatt. Ferner übertrifft das ermittelte technische Potenzial auch die für die Erreichung des im Koalitionsvertrag genannten 65 Prozent-Zieles in 2030 notwendigen Windenergiekapazitäten grosso modo um den Faktor 13. Während sich rund 44 Prozent des ermittelten Leistungspotenzials auf die nördlichen Bundesländer verteilen und 24 Prozent in den mittleren Bundesländern (Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen) liegen, schlagen für den Süden (Baden-Württemberg, Bayern, Saarland) fast 32 Prozent zu Buche.
Siedlungsabstände
Unterscheidet man die Potenziale hinsichtlich der Standortgüte, befindet sich mit ca. 20 Prozent nur ein vergleichsweise geringer Anteil auf besonders windstarken Standorten (mit Referenzerträgen12 zwischen 90 und 150 Prozent). Demgegenüber liegen 70 Prozent des Gesamtpotenzials bei geringen oder mittleren Standortgüten mit Referenzerträgen zwischen 60 und 90 Prozent. Eine dominante Rolle bei den Potenzialermittlungen spielen die zu Grunde gelegten Siedlungsabstände. Werden die Abstände von 600 Metern auf 1.200 oder 1.800 Meter vergrößert, verbleiben lediglich 26,0 bzw. 5,4 Prozent des genannten Potenzials.13
Methodik der Potenzialermittlung
Bei der Ermittlung der Potenzialflächen des UBA wurde ein umfangreicher Kriterienkatalog mit einem Geoinformationssystem (GIS) auf die Fläche angewendet, der viele – aber freilich nicht sämtliche – Faktoren einbezieht. Die Gründe hierfür liegen bei der begrenzten Datenverfügbarkeit und Quantifizierbarkeit sowie der Notwendigkeit für Einzelfallprüfungen (bspw. zum besonderen Artenschutzrecht). Insofern kann die Potenzialstudie des Umweltbundesamtes eine strategische Übersicht über die grundsätzlichen Nutzungsmöglichkeiten der Windenergie an Land geben, die tatsächlich realisierbare Windleistung (im Sinne eines erschließbaren Potenzials) liegt jedoch unter dem ermittelten technischen Potenzial. Ähnliche Ansätze verfolgen die Potenzial- bzw. Energieatlanten der Bundesländer.14
Verschiedene Potenzialstudien
Gegenüber den Ergebnissen des UBA kommt eine Untersuchung im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) mit einer alternativen Berücksichtigung raum- und fachplanerischer Belange und zwei unterschiedlichen Ermittlungsverfahren auf ein Flächenpotenzial in der Bandbreite von rund 9.000 bis 39.000 Quadratkilometern,15 während in einer Studie für den Bundesverband WindEnergie (BWE) sogar ein maximales Flächenpotenzial von fast 80.000 Quadratkilometern (davon 28.000 Quadratkilometer gänzlich ohne Restriktionen) bzw. ein Leistungspotenzial von 1.600 Gigawatt (davon 722 Gigawatt auf Flächen ohne Restriktionen) ermittelt werden.16
2. Bedeutung der Windhöffigkeit
Windhöffigkeit
Abhängigkeit von der Höhe über Grund
Regionale Verteilung
Die zentrale Größe für die erzielbaren Stromerträge aus der Windenergie – und damit indirekt auch für die Wirtschaftlichkeit – stellt die Windgeschwindigkeit dar, denn die aerodynamische Leistung des Windes hängt von der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit ab. Nimmt die Windgeschwindigkeit bspw. um 10 Prozent zu (z. B. von 6,0 auf 6,6 m/s), so wird die Leistung um 33 Prozent größer. Da die Windgeschwindigkeit in größeren Höhen über dem Grund zunimmt und sich der Wind stetiger verhält, bieten sich aus energiewirtschaftlicher Sicht Windenergieanlagen mit großen Nabenhöhen an. Die Agentur für Erneuerbare Energien gibt als Faustregel an, dass der Ertrag pro Meter Nabenhöhe um bis zu 1 Prozent ansteigt.17 Dabei ist das Vorkommen an windreichen Windenergiestandorten über Deutschland nicht gleichverteilt. Die Karte zum Anlagenbestand in Deutschland (Seite 31) veranschaulicht, dass im Norden Deutschlands sowohl sehr gute Standorte als auch z. B. 70-Prozent-Referenzertragsstandorte vorkommen. Demgegenüber ist das Dargebot in weiten Teilen Mittel- und Süddeutschlands auf die mittleren und unteren Güteklassen beschränkt.
3. Größe der Windparks
Abstände zwischen Windenergieanlagen
Aufgrund der siedlungsstrukturellen und topografischen Besonderheiten ist der Anlagenbestand in Deutschland relativ kleinteilig ausgestaltet. So gehören 60 Prozent der Windenergieanlagen zu Windparks mit maximal 6 Anlagen und 35 Prozent zu Windparks mit maximal 3 Anlagen.18 Bei der Planung von Windparks werden aus Gründen der Standsicherheit und zur Vermeidung von Abschattungsverlusten zwischen den Windenergieanlagen üblicherweise Abstände von drei bis sechs Rotordurchmessern eingeplant.19
Abb. 2: Mittlerer Referenzertrag für den Anlagenbestand in Deutschland bis 201320
V. Ökonomische Entwicklung und Perspektiven
1. Langfristige Kostenentwicklung
Kostendegression
Haupt- und Nebeninvestitionskosten
Die spezifischen Investitionskosten (€/kW) für Windenergieanlagen sind in den letzten 25 Jahren auf weniger als die Hälfte zurückgegangen. Der größte Teil der Kostendegressionen wurde dabei aber – wie bei vielen anderen Technologien auch – in den Anfangsjahren der Markteinführung erreicht. In den vergangenen zehn Jahren ist bei den spezifischen Investitionskosten eher eine Seitwärtsentwicklung mit zum Teil maßvollen Reduktionen eingetreten.21 Die Investitionskosten können in Hauptinvestitionskosten (für die Anlage) sowie die Nebeninvestitionskosten (für Planung und Nebenanlagen) unterschieden werden. Bei den Hauptinvestitionskosten besteht eine starke Abhängigkeit von den – bspw. im Zuge der Finanzkrise um 2008 gesunkenen – Rohstoffpreisen für Stahl, Kupfer und Aluminium oder seltene Erden. Ein weiterer, wichtiger Kostenfaktor sind die in den vergangenen Jahren deutlich angestiegenen Nabenhöhen und Rotordurchmesser, die die Aufwendungen für Material und Logistik maßgeblich bestimmen.22 Die Deutsche WindGuard gibt für Anlagen der 3 bis 4 Megawattklasse pro installiertem Kilowatt Hauptinvestitionskosten je nach Nabenhöhe in einer Bandbreite von 900 Euro (< 90 Meter) bis 1.260 Euro (> 130 Meter) an.23
Weitere Kostenbestandteile
Darüber hinaus werden Nebeninvestitionskosten für die Anlagenplanung (inkl. Genehmigungen), das Fundament, die Erschließung, die Netzanbindung und sonstige Aspekte wirksam, die in hohem Maße standortspezifisch ausfallen und über eine große Streuung verfügen. Sie liegen bei einer Bandbreite von 159 bis 525 Euro und durchschnittlich bei 326 Euro pro Kilowatt.24 Die Investitionskosten nehmen damit einen signifikanten Anteil an den Gesamtkosten ein.
Abb. 3: Spezifische Gesamtinvestitionskosten [EUR/kW] in Abhängigkeit vom Referenzertrag25
a. Investitionskosten
Standortabhängige Variation der Gesamtkosten
Wie die beigefügte Abbildung veranschaulicht, variieren die Gesamtinvestitionskosten relativ stark nach Projekten und Standortgüte (Referenzertrag). Ferner spiegelt sich in den dargestellten Kostenverläufen auch die Bandbreite an Kosten wider. Insgesamt ist bei der Einordnung der aufgeführten Gesamtinvestitionskosten zu berücksichtigen, dass die Windenergieanlagen der heutigen Generation deutlich mehr Strom als in der Vergangenheit erzeugen.
b. Betriebskosten
Kostenbestandteile
Vollwartungsverträge
Weiterhin werden während des Anlagenbetriebs Kosten fällig, dazu gehören bspw. Aufwendungen für Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, Pachtzahlungen, Versicherung sowie die kaufmännische Geschäftsführung. Der Kostenpunkt Wartung und Instandhaltung schlägt mit dem größten Anteil zu Buche und wird oft über sogenannte Vollwartungsverträge abgewickelt, es gibt jedoch auch einen relevanten Anteil fixer Betriebskosten (bspw. Büro- und Personalkosten). Pro Kilowattstunde liegen die Betriebskosten insgesamt üblicherweise in einer Größenordnung von 2,5 bis 3,0 Cent. Die Betriebskosten fallen jedoch projektspezifisch sowie in Abhängigkeit zur Betriebsdauer sehr unterschiedlich (1,5 bis 4,0 Cent pro Kilowattstunde) aus und verhalten sich mit zunehmender Standortgüte tendenziell rückläufig.26
2. Erfahrungen mit dem Ausschreibungsregime
Deutschlandweiter Wettbewerb um Vergütungen
Lange Projektrealisierungsdauern
Während im Bereich der erneuerbaren Energien seit Einführung des EEG im Jahre 2000 bislang staatlich festgesetzte Einspeisetarife bzw. -prämien für den erzeugten Strom garantiert wurden, werden die Förderungen für Projekte mit einer installierten Leistung ab 750 Kilowatt seit Januar 2017 grundsätzlich durch Ausschreibungen ermittelt. Der Vergütungsanspruch und die Vergütungshöhe werden – im Rahmen der jeweils ausgeschriebenen Menge – also nunmehr im deutschlandweiten Wettbewerb zwischen den einzelnen Projekten ermittelt. Für die Vorhabenträger von Windenergieprojekten, insbesondere für die kleinen Marktakteure, birgt dies neue bzw. verstärkte Risiken. Denn bis zur Genehmigungsfähigkeit der Projekte sind umfangreiche Prüfungen und mit rund fünf Jahren27 ein vergleichsweise langer Zeitraum erforderlich, in dem hohe Vorleistungen (inkl. der damit einhergehenden Kosten) erbracht werden müssen. Durch das neu hinzugekommene Zuschlagsrisiko (Nichtbezuschlagung) und das verstärkte Preisrisiko (Höhe der Vergütung) wächst wegen der Vorlaufkosten die sog. Sunk-Cost-Problematik (versunkene Kosten).
Bisherige Ausschreibungsergebnisse
Die bisherigen Ausschreibungsrunden haben bei der Verteilung der Zuschläge eine starke räumliche Konzentration im Norden Deutschlands gezeigt. So entfielen lediglich 11 Prozent der Zuschläge auf das Gebiet südlich des Mains, während hier seit 2010 im Durchschnitt noch jede fünfte Anlage errichtet wurde.28 Während die ersten sechs Ausschreibungsrunden zunächst überzeichnet waren, fiel die Teilnahme bei drei Ausschreibungen (Mai 2018, Oktober 2018 und Februar 2019) sehr gering aus und lag unter der Ausschreibungsmenge. Insgesamt lagen die maximalen Zuschlagswerte in einer Spanne von 3,82 bis 6,3 Cent pro Kilowattstunde.29 Ein Grund für die vergleichsweise niedrigen Zuschlagswerte in den ersten Ausschreibungsrunden lag in den Sonderregelungen für sog. Bürgerenergieanlagen nach § 36 g EEG 2017. Neben anderen Besonderheiten konnten diese ohne immissionsschutzrechtliche Genehmigung an den Ausschreibungen teilnehmen, für sie gilt eine um 24 Monate verlängerte Umsetzungsfrist und sie können daher auch auf eine neuere Anlagengeneration abstellen. Da in den ersten drei Ausschreibungsrunden 2017 über 90 Prozent der Zuschläge an Bürgerenergiegesellschaften vergeben wurden (in der dritten Ausschreibungsrunde bei einem maximalen Zuschlagswert von 3,82 Cent pro Kilowattstunde sogar 98 Prozent) hat der Bundesgesetzgeber die Regelungen vorerst für das Kalenderjahr 2018 ausgesetzt und diese Regelung nun bis zur Ausschreibungsrunde am 1. Juni 2020 verlängert.
3. Zielvorstellungen des Koalitionsvertrages
Die Ausführungen des Koalitionsvertrages zur laufenden Legislaturperiode des Bundestages vom Februar 2018 sind mit drei Seiten relativ knapp bemessen. Im Grunde haben sich die Regierungsparteien darauf verständigt, „die Energiewende sauber, sicher und bezahlbar fort[zuführen]“.30