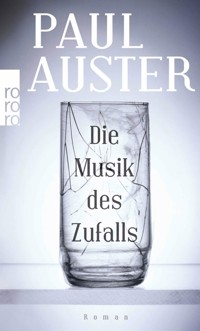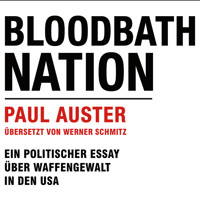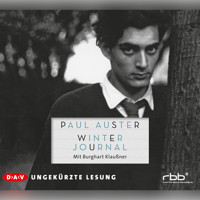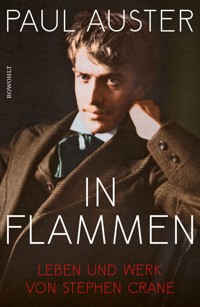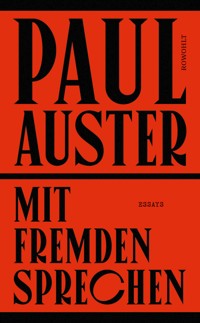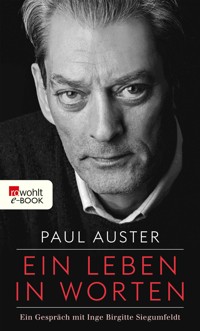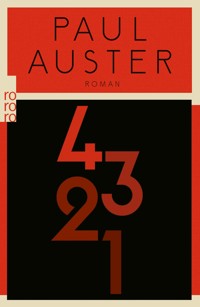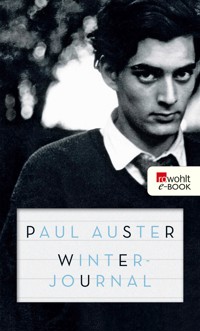
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Dies ist ein emotional mitreißendes, mit den ersten Zeilen packendes Buch: eine Lebensbeichte ganz aus der Warte des Körpers. Man kommt darin dem Schriftsteller Paul Auster sehr nahe, aber auch und vor allem dem Mann an der Schwelle zum Alter. Paul Auster spricht aus, was seine Hand, seine Füße, seine Glieder im Verlauf eines langen Lebens getan haben. Er lässt seine Liebesbeziehungen Revue passieren: viele zunächst und dann – dreißig Jahre lang – nur noch die eine, große Liebe! Die Kinder, die Abtreibungen, die Krankheiten. Er spricht über die Begegnungen mit dem Tod: ein Sturz als Junge, eine Herzattacke, ein Autounfall. Über die Körperlichkeit auch, die unendliche Empfindlichkeit jenes physischen Systems, das uns am Leben erhält und über das wir so wenig nachdenken, solange es funktioniert. Alkohol, Zigarillos, Süchte – all die Versuchungen, dieses System auszutricksen, sich dem Verfall, dem Alltag zu entziehen. «Winterjournal» ist eine Art Autobiographie, aber keine konventionelle, sondern höchste literarische Kunst: voll philosophischer Betrachtungen, poetischer Impressionen, intimer Einsichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 308
Ähnliche
Paul Auster
Winterjournal
Aus dem Englischen von Werner Schmitz
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Dies ist ein emotional mitreißendes, mit den ersten Zeilen packendes Buch: eine Lebensbeichte ganz aus der Warte des Körpers. Man kommt darin dem Schriftsteller Paul Auster sehr nahe, aber auch und vor allem dem Mann an der Schwelle zum Alter.
Paul Auster spricht aus, was seine Hand, seine Füße, seine Glieder im Verlauf eines langen Lebens getan haben. Er lässt seine Liebesbeziehungen Revue passieren: viele zunächst und dann – dreißig Jahre lang – nur noch die eine, große Liebe! Die Kinder, die Abtreibungen, die Krankheiten. Er spricht über die Begegnungen mit dem Tod: ein Sturz als Junge, eine Herzattacke, ein Autounfall. Über die Körperlichkeit auch, die unendliche Empfindlichkeit jenes physischen Systems, das uns am Leben erhält und über das wir so wenig nachdenken, solange es funktioniert. Alkohol, Zigarillos, Süchte – all die Versuchungen, dieses System auszutricksen, sich dem Verfall, dem Alltag zu entziehen.
«Winterjournal» ist eine Art Autobiographie, aber keine konventionelle, sondern höchste literarische Kunst: voll philosophischer Betrachtungen, poetischer Impressionen, intimer Einsichten.
Über Paul Auster
Paul Auster wurde 1947 in Newark, New Jersey, geboren. Er studierte Anglistik und Vergleichende Literaturwissenschaften an der Columbia University und verbrachte danach einige Jahre in Frankreich. Heute lebt er in Brooklyn. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sein umfangreiches, vielfach preisgekröntes Werk umfasst neben 16 Romanen auch Essayistik und Lyrik.
Inhaltsübersicht
Du denkst, das wird dir niemals passieren, das kann dir niemals passieren, du seist der einzige Mensch auf der Welt, dem nichts von alldem jemals passieren wird, und dann geht es los, und eins nach dem anderen passiert dir all das genau so, wie es jedem anderen passiert.
Deine nackten Füße auf dem kalten Boden, wenn du aus dem Bett steigst und zum Fenster gehst. Du bist sechs Jahre alt. Draußen fällt Schnee, und die Zweige der Bäume im Garten werden weiß.
Sprich jetzt, bevor es zu spät ist, und hoffentlich kannst du so lange sprechen, bis nichts mehr zu sagen ist. Schließlich verrinnt die Zeit. Vielleicht solltest du deine Geschichten fürs Erste einmal beiseitelegen und zu ergründen versuchen, wie das für dich war, in diesem Körper zu leben – vom ersten Tag, an den du dich erinnern kannst, bis heute. Ein Katalog von Sinnesdaten. Was man eine Phänomenologie des Atmens nennen könnte.
Du bist zehn Jahre alt, und die Hochsommerluft ist warm, drückend warm, so furchtbar schwül, dass dir, während du nur im Schatten der Bäume im Garten sitzt, der Schweiß auf die Stirn tritt.
Es ist eine unbestreitbare Tatsache, dass du nicht mehr jung bist. Heute in einem Monat wirst du vierundsechzig, und wenngleich das nicht übermäßig alt ist, nicht das, was irgendjemand als fortgeschrittenes Alter bezeichnen würde, kannst du dich nicht der Gedanken an all die anderen erwehren, die es nicht geschafft haben, so weit zu kommen wie du. Dies ist ein Beispiel für die verschiedenen Dinge, die niemals passieren konnten, die aber tatsächlich passiert sind.
Der Wind in deinem Gesicht bei dem Schneesturm letzte Woche. Die schneidende Kälte, und während du da draußen in den leeren Straßen dich fragtest, welcher Teufel dich ritt, bei einem so heftigen Sturm das Haus zu verlassen, kaum dass du dich auf den Beinen halten konntest, weckte dieser Wind zugleich Begeisterung in dir, das Vergnügen, die vertrauten Straßen in dem weißen Gestöber verschwinden zu sehen.
Physische Freuden und physische Schmerzen. In erster Linie sexuelle Lust, aber auch die Lust am Essen und Trinken, der Genuss, nackt in einem warmen Bad zu liegen, sich das juckende Fell zu kratzen, zu niesen und zu furzen, eine weitere Stunde im Bett zu verbringen, an einem lauen Nachmittag im Spätfrühling oder Frühsommer dein Gesicht in die Sonne zu halten und die Wärme auf deiner Haut zu spüren. Unzählige Beispiele, kein Tag, der nicht den einen oder anderen physischen Genuss bescherte, und doch sind Schmerzen zweifellos beharrlicher und hartnäckiger, und im Lauf deines Lebens ist nahezu jeder Teil deines Körpers schon einmal Ziel einer Attacke gewesen. Augen und Ohren, Kopf und Hals, Schultern und Rücken, Arme und Beine, Rachen und Magen, Knöchel und Füße, zu schweigen von der riesigen Geschwulst, die einst auf deiner linken Arschbacke spross und die der Arzt als Furunkel bezeichnete, was sich in deinen Ohren wie eine mittelalterliche Krankheit anhörte und dir eine Woche lang das Sitzen unmöglich machte.
Die Nähe deines kleinen Körpers zum Erdboden, des Körpers, der dir gehörte, als du drei oder vier Jahre alt warst, soll heißen, die kurze Entfernung zwischen deinen Füßen und deinem Kopf, und wie die Dinge, die du jetzt nicht mehr bemerkst, dir früher stets gegenwärtig und wichtig waren: die kleine Welt krabbelnder Ameisen und verlorener Münzen, abgebrochener Zweige und zerknickter Kronkorken, die Welt der Pusteblumen und Kleeblätter. Vor allem aber die Ameisen. An die erinnerst du dich am besten. Das Hin und Her der Ameisenheere um ihre sandigen Hügel.
Du bist fünf Jahre alt, hockst vor einem Ameisenhaufen im Garten und studierst das Kommen und Gehen deiner winzigen sechsbeinigen Freunde. Ungesehen und ungehört schleicht dein dreijähriger Nachbar von hinten heran und schlägt dir mit einem Spielzeugrechen auf den Kopf. Die Zinken durchbohren deine Kopfhaut, Blut strömt dir ins Haar und in den Nacken, und du rennst kreischend ins Haus, wo deine Großmutter deine Wunden versorgt.
Wie sagte deine Großmutter zu deiner Mutter: «Dein Vater wäre so ein wunderbarer Mann – wenn er nur anders wäre.»
Heute früh, beim Aufwachen im Halbdunkel eines weiteren Januarmorgens, in dem grauen Dämmerlicht, das in dein Schlafzimmer dringt, erblickst du das Gesicht deiner Frau, dem deinen zugewandt, die Augen geschlossen, noch im Tiefschlaf, die Decke bis zum Hals hochgezogen, sichtbar allein ihr Kopf, und du staunst, wie schön sie aussieht, wie jung sie aussieht, noch jetzt, dreißig Jahre nachdem du zum ersten Mal mit ihr geschlafen hast, nach dreißig Jahren unter einem Dach und in einem Bett.
Wieder schneit es, und während du aus dem Bett steigst und zum Fenster gehst, werden die Zweige der Bäume im Garten weiß. Du bist dreiundsechzig Jahre alt. Dir kommt der Gedanke, dass es auf der langen Reise von der Kindheit nach heute kaum einen Augenblick gegeben hat, an dem du nicht verliebt gewesen bist. Dreißig Jahre verheiratet, ja, aber in den dreißig Jahren davor: wie oft verknallt und verschossen, wie oft Feuer und Flamme, wie oft in fiebrigem Wahn und rasender Verzückung? Vom Anbeginn deines bewussten Lebens bist du ein williger Sklave des Eros gewesen. Die Mädchen, die du als Junge geliebt hast, die Frauen, die du als Mann geliebt hast, jede anders als die anderen, Mollige und Schlanke, Kleine und Große, Intellektuelle und Sportliche, Launische und Gesellige, Weiße, Schwarze und Asiatische: Nichts Oberflächliches hat dir je etwas bedeutet, immer ging es um das innere Licht, das du in ihr entdecktest, den Funken der Einzigartigkeit, das Auflodern von Individualität, und dieses Licht machte sie in deinen Augen schön, und während andere blind sein mochten für die Schönheit, die du in ihr sahst, entbranntest du vor Sehnsucht nach ihr, nach ihrer Nähe, denn weibliche Schönheit ist etwas, dem du nie hast widerstehen können. Das war schon in deinen ersten Schultagen so, im Kindergarten, wo es dir das Mädchen mit dem langen blonden Pferdeschwanz angetan hatte, und wie oft wurdest du von Miss Sandquist bestraft, weil ihr zwei, du und die Kleine, euch in irgendeinem Winkel versteckt und ungezogene Dinge getan hattet, aber diese Strafen bedeuteten dir nichts, denn du warst verliebt, du warst schon damals verrückt nach Liebe, so wie du noch heute verrückt nach Liebe bist.
Das Inventar deiner Narben, insbesondere der in deinem Gesicht, die du jeden Morgen, wenn du dich rasierst oder dir die Haare kämmst, im Badezimmerspiegel sehen kannst. Du denkst selten daran, aber wenn du es tust, begreifst du, es sind Zeichen des Lebens, die verschiedenen in dein Gesicht geschnittenen zerklüfteten Linien sind Buchstaben aus dem geheimen Alphabet, das die Geschichte dessen erzählt, der du bist, denn jede einzelne Narbe ist die Spur einer verheilten Wunde, und jede einzelne Wunde war das Ergebnis einer unerwarteten Kollision mit der Welt – soll heißen, eines Unfalls, also einer Sache, die nicht hätte zu passieren brauchen, denn ein Unfall ist per definitionem etwas, das nicht zu passieren braucht. Zufälle im Gegensatz zu Notwendigkeiten, und heute früh beim Blick in den Spiegel die Erkenntnis, dass alles Leben zufällig ist, ausgenommen die einzige Notwendigkeit, dass es früher oder später zu Ende gehen wird.
Du bist dreieinhalb, und deine fünfundzwanzig Jahre alte schwangere Mutter hat dich zum Einkaufen in ein Warenhaus in Newark mitgenommen. Sie wird von einer Freundin begleitet, der Mutter eines Jungen, der ebenfalls dreieinhalb Jahre alt ist. Irgendwann macht du und dein kleiner Gefährte euch von euren Müttern los und beginnt in dem Laden herumzulaufen. Es ist ein ungeheures offenes Gelände, zweifellos der größte Raum, in dem du jemals gewesen bist, und was für ein Nervenkitzel, durch diese gewaltige Arena toben zu können. Du und der Junge kommt auf die Idee, euch bäuchlings auf den Boden zu werfen und über die glatte Fläche zu gleiten, Schlitten zu fahren ohne Schlitten, könnte man sagen, ein Spiel, an dem ihr solchen Gefallen findet und das euch mit solcher Begeisterung erfüllt, dass ihr immer leichtsinniger werdet, immer waghalsiger in dem, was ihr zu erreichen versucht. Ihr gelangt in einen Teil des Ladens, der gerade umgebaut oder renoviert wird, und ohne auf mögliche Hindernisse zu achten, wirfst du dich abermals auf den Boden und rutschst über die glasglatte Fläche, bis du erkennst, dass du schnurstracks auf eine Werkbank zusegelst. Du glaubst, dem vor dir auftauchenden Holzbein mit einer leichten Drehung ausweichen zu können, übersiehst aber in dem Sekundenbruchteil, der dir zum Kurswechsel bleibt, einen langen Nagel, einen Nagel, der in Höhe deines Kopfs aus dem Holz ragt, und bevor du bremsen kannst, hat sich der Nagel in deine linke Wange gebohrt. Dein halbes Gesicht wird aufgerissen. Sechzig Jahre später hast du an den Unfall keine Erinnerung mehr. Du erinnerst dich an das Toben und Hinwerfen, nicht jedoch an den Schmerz, nicht an das Blut und nicht an die hektische Fahrt zum Krankenhaus oder an den Arzt, der deine Wange genäht hat. Er habe das glänzend gemacht, hat deine Mutter immer gesagt, und da der traumatische Anblick ihres Erstgeborenen mit halb abgerissenem Gesicht sie zeitlebens verfolgte, hat sie es oft gesagt: Es ging wohl um eine raffinierte Doppelnaht, die den Schaden auf ein Minimum begrenzte und so verhinderte, dass du fürs ganze Leben entstellt geblieben bist. Du hättest ein Auge verlieren können, sagte sie – oder noch dramatischer: Du hättest sterben können. Zweifellos hatte sie recht. Die Narbe ist mit den Jahren blasser und blasser geworden, aber sie ist immer noch da, wenn du nach ihr suchst, und du wirst dieses Glückssymbol (Auge unversehrt! Nicht tot!) mit ins Grab nehmen.
Narben von aufgeplatzten Augenbrauen, eine links und eine rechts, nahezu perfekt symmetrisch, die erste, nachdem du beim Völkerball im Turnunterricht der Grundschule mit Karacho gegen eine Mauer gerannt warst (das mächtig geschwollene Auge, das du tagelang stolz zur Schau trugst und das dich an ein Foto des Boxers Gene Fullmer erinnerte, der damals bei einem Meisterschaftskampf von Sugar Ray Robinson geschlagen worden war), die zweite mit Anfang zwanzig, als du beim Basketball Anlauf zu einem Korbleger nahmst und ein Foul von hinten dich gegen den metallenen Korbpfosten fliegen ließ. Eine weitere Narbe an deinem Kinn, Ursprung unbekannt. Sehr wahrscheinlich in früher Kindheit zugezogen, bei einem Sturz, beim harten Aufprall auf einen Bürgersteig, auf einen Stein, bleibendes Zeichen einer Wunde, das morgens beim Rasieren immer noch sichtbar ist. Keine Geschichte begleitet diese Narbe, deine Mutter hat nie darüber gesprochen (zumindest kannst du dich nicht daran erinnern), und du findest es merkwürdig, wenn nicht regelrecht verwirrend, dass etwas, das man nur eine unsichtbare Hand nennen kann, dir diesen Strich auf die Haut gezeichnet hat, dass dein Körper der Schauplatz von Ereignissen ist, die aus der Geschichte ausgelöscht worden sind.
Juni 1959. Du bist zwölf Jahre alt, und in einer Woche wirst du zusammen mit deinen Klassenkameraden die Grundschule, auf die du seit dem fünften Lebensjahr gegangen bist, nach der sechsten Klasse abschließen. Es ist ein prächtiger Tag, der Inbegriff eines schönen Spätfrühlingstags, die Sonne scheint vom wolkenlosen blauen Himmel, es ist warm, aber nicht zu warm, die Luft nur mäßig feucht, ein leichter Wind regt sich und streicht dir über Gesicht, Hals und nackte Arme. Nach der Schule gehst du mit deinen Freunden zum Baseball in den Grove Park. Der Grove Park ist eigentlich kein Park, eher so etwas wie eine Dorfwiese, ein großes, mit gepflegtem Rasen bedecktes Rechteck, das auf allen vier Seiten von Häusern flankiert wird, ein hübsches Fleckchen, eine der schönsten Stellen in deiner kleinen Stadt in New Jersey, und ihr spielt oft dort, denn ihr liebt Baseball über alles und könnt stundenlang spielen, ohne es jemals satt zu werden. Keine Erwachsenen sind dabei. Ihr stellt eure eigenen Regeln auf und schlichtet eure Streitigkeiten selbst – meist mit Worten, gelegentlich mit Fäusten. Nach über fünfzig Jahren kannst du dich an keine Einzelheiten des Spiels an jenem Nachmittag erinnern, aber eins weißt du noch: Das Spiel ist aus, du stehst allein in der Mitte des Infields und spielst Fangen mit dir selbst, das heißt, du wirfst einen Ball hoch in die Luft und verfolgst seinen Auf- und Abstieg, bis er in deinem Handschuh landet, worauf du den Ball sofort wieder hochwirfst, und jedes Mal fliegt er höher als zuvor, und nach einigen Würfen erreichst du nie da gewesene Höhen, der Ball schwebt jetzt mehrere Sekunden lang in der Luft, der weiße Ball steigt in den klaren blauen Himmel, der weiße Ball fällt in deinen Handschuh, deine gesamte Existenz verliert sich in diesem einfältigen Tun, du bist vollkommen konzentriert, es gibt für dich nichts mehr als den Ball und den Himmel und deinen Handschuh, mit anderen Worten, dein Gesicht ist nach oben gewandt, du schaust hinauf, verfolgst die Flugbahn des Balls und bekommst daher nicht mit, was sich auf dem Boden abspielt, und es spielt sich, während du in den Himmel starrst, auf dem Boden etwas ab, etwas oder jemand kracht unversehens mit dir zusammen, und der Aufprall kommt so plötzlich und mit so enormer Wucht, dass du wie vom Blitz getroffen zu Boden stürzt. Der Stoß hat im Wesentlichen deinen Kopf getroffen, deine Stirn, aber auch dein Oberkörper hat etwas abbekommen, und während du betäubt und halb ohnmächtig nach Luft schnappend auf dem Rasen liegst, siehst du Blut von deiner Stirn rinnen, nein, nicht rinnen, strömen, und du ziehst dein weißes T-Shirt aus und drückst es auf die stark blutende Stelle, und binnen Sekunden ist das ganze weiße T-Shirt rot. Die anderen Jungen sehen es mit Schrecken. Sie kommen angerannt, sie wollen dir helfen, und jetzt erst verstehst du, was passiert ist. Offenbar war einer von ihnen, ein schlaksiger, gutmütiger Tollpatsch namens B. T. (du erinnerst dich an seinen Namen, wirst ihn hier aber nicht nennen, weil du ihn nicht in Verlegenheit bringen möchtest – falls er noch lebt), von deinen ungeheuer hohen Würfen so beeindruckt, dass er es sich in den Kopf setzte, bei deinem Spiel mitzumachen, und, ohne dir zu sagen, dass er auch einmal einen deiner Würfe fangen wolle, in Richtung des herabfallenden Balls losrannte, natürlich den Blick nach oben gerichtet und mit offenem Mund (was muss man für ein Trottel sein, um mit weit offenem Mund zu laufen?), Sekunden später in vollem Galopp mit dir zusammenstieß und seine Zähne geradewegs in deinen Kopf rammte. Daher das Blut, das jetzt aus dir strömt, daher die tiefe Wunde über deinem linken Auge. Zum Glück ist es zur Praxis deines Hausarztes nicht weit, sie befindet sich in einem der Häuser am Rand des Parks. Die Jungen beschließen, dich dort hinzubringen, und so gehst du über den Rasen, das blutige T-Shirt an die Stirn gepresst, umringt von deinen Freunden, es mögen vier gewesen sein, vielleicht auch sechs, du weißt es nicht mehr, und dann fallt ihr alle Mann hoch in Dr. Kohns Praxis ein. (Du hast seinen Namen nicht vergessen, sowenig wie du den Namen deiner Kindergärtnerin vergessen hast, Miss Sandquist, oder die Namen aller Lehrer, die du als Junge hattest.) Die Sprechstundenhilfe erklärt dir und deinen Freunden, Dr. Kohn sei mit einem Patienten beschäftigt, und bevor sie aufstehen und dem Arzt sagen kann, es sei ein Notfall eingetroffen, marschierst du mitsamt deinen Freunden, ohne anzuklopfen, ins Sprechzimmer. Dort spricht Dr. Kohn gerade mit einer dicken Frau, die nur mit BH und Slip bekleidet auf dem Untersuchungstisch sitzt. Die Frau stößt einen spitzen Schrei aus, doch kaum sieht Dr. Kohn das Blut aus deiner Stirn quellen, bittet er die Frau, sich anzuziehen und den Raum zu verlassen, schickt auch deine Freunde hinaus und macht sich eilig ans Werk, die Wunde zu nähen. Das ist eine schmerzhafte Sache, denn für eine Betäubungsspritze bleibt keine Zeit, aber du gibst dir alle Mühe, nicht zu schreien, während er mit Nadel und Faden an deiner Stirn hantiert. Ihm gelingt das vielleicht nicht so glänzend wie dem Arzt, der 1950 deine Wange genäht hat, aber letztlich zählt nur der Erfolg: Du verblutest nicht, das Loch in deinem Kopf ist geschlossen. Ein paar Tage später nimmst du an der Abschlussfeier deiner Klasse teil. Man hat dich zum Fahnenträger bestimmt, das heißt, du musst die amerikanische Flagge durch den Mittelgang der Aula tragen und in den Fahnenständer auf der Bühne stellen. Dein Kopf ist mit einer weißen Mullbinde umwickelt, und da manchmal noch Blut aus der genähten Wunde sickert, prangt auf der weißen Binde ein roter Fleck. Nach der Feier sagt deine Mutter, bei deinem Marsch mit der Flagge habe sie an ein Gemälde eines verwundeten Helden aus dem Unabhängigkeitskrieg denken müssen. Du weißt schon, sagt sie, genau wie The Spirit of ’76.
Was auf dich eindringt, was immer auf dich eingedrungen ist: das Äußere, soll heißen die Luft – oder genauer, dein Körper in der dich umgebenden Luft. Die Sohlen deiner Füße fest auf dem Boden verankert, alles andere aber der Luft ausgesetzt, und genau da fängt die Geschichte an, in deinem Körper, und in diesem Körper wird es auch enden, alles. Fürs Erste denkst du an den Wind. Später, wenn es die Zeit erlaubt, wirst du an Hitze und Kälte denken, an die unzähligen Arten von Regen, die Nebel, durch die du gestolpert bist wie ein Mann ohne Augen, an das wahnsinnige Trommelfeuer des Hagels auf den Dachziegeln des Hauses im Var. Jetzt aber ist es der Wind, der deine Aufmerksamkeit beansprucht, denn die Luft steht selten still, und außer dem kaum wahrnehmbaren Hauch des Nichts, der dich manchmal umstreicht, gibt es die Brisen und leichten Lüftchen, die jähen Böen und Stöße, den drei Tage währenden Mistral, den du mehrmals in diesem Haus mit dem Ziegeldach durchlebtest, die alles durchnässenden Nordostwinde der Atlantikküste, die Orkane und Wirbelstürme. Und da bist du vor einundzwanzig Jahren, du gehst durch die Straßen von Amsterdam zu einer Veranstaltung, die ohne dein Wissen längst abgesagt wurde, du kämpfst dich, getreulich die eingegangene Verpflichtung zu erfüllen, durch ein Wetter, das man später den Sturm des Jahrhunderts nennen wird, einen Orkan von so wütender Intensität, dass binnen einer Stunde nach deinem starrsinnigen, unbedachten Entschluss, dich ins Freie zu wagen, überall in der Stadt entwurzelte Bäume die Wege versperren, Schornsteine von den Dächern stürzen und parkende Autos durch die Luft geschleudert werden. Du hältst dein Gesicht in den Wind, versuchst auf dem Bürgersteig voranzukommen, aber sosehr du dich mühst, dein Ziel zu erreichen, du kannst dich nicht bewegen. Der Wind donnert dir entgegen, und anderthalb Minuten lang steckst du fest.
Deine Hände auf der Ha’Penny Bridge in Dublin, vor dreizehn Jahren, am Abend nach einem weiteren Orkan mit Windgeschwindigkeiten von über hundertfünfzig Stundenkilometern, am letzten Abend der Arbeiten an dem Film, bei dem du in den vergangenen zwei Monaten Regie geführt hast, es ist die letzte Szene, die letzte Einstellung, die Kamera muss bloß auf die behandschuhte Hand der Hauptdarstellerin gerichtet bleiben, während sie die Hand umdreht und einen kleinen Stein loslässt, der ins Wasser des Liffey fällt. Nichts Besonderes, keine Szene des ganzen Films hat weniger Mühe und Kreativität verlangt, du aber stehst da in der nasskalten Finsternis dieses windigen Abends, ziemlich erschöpft nach neun Wochen aufreibender Arbeit an einer mit zahllosen Problemen beladenen Produktion (Probleme mit dem Budget, den Gewerkschaften, den Drehorten, dem Wetter), acht Kilo leichter als zu Beginn, und nachdem du stundenlang mit deiner Crew auf der Brücke gestanden hast, ist die klamme, eisige irische Luft dir bis in die Knochen gekrochen, und unmittelbar vor dem Dreh der letzten Szene musst du feststellen, dass deine Hände erfroren sind, dass du deine Finger nicht bewegen kannst, dass deine Hände sich in zwei Eisblöcke verwandelt haben. Warum trägst du keine Handschuhe?, fragst du dich, kannst aber die Frage nicht beantworten, denn beim Verlassen des Hotels hast du an Handschuhe keinen Gedanken verschwendet. Du drehst die letzte Szene noch einmal, und dann geht ihr, du und dein Produzent, die Schauspielerin und ihr Freund und mehrere Mitglieder der Crew, in den nächstbesten Pub, um aufzutauen und den Abschluss der Dreharbeiten zu feiern. Das Lokal ist voll, rappelvoll, eine Echokammer voller lärmender Gestalten, die in einem Zustand apokalyptischer Heiterkeit hin und her wogen, aber für dich und deine Freunde ist ein Tisch reserviert, an dem ihr euch niederlasst, und kaum hat dein Körper den Stuhl berührt, begreifst du, wie erschöpft du bist, vollkommen fix und fertig, wie du es niemals für möglich gehalten hättest, so kaputt, dass du glaubst, jeden Augenblick in Tränen auszubrechen. Du bestellst einen Whisky, und als du das Glas an deine Lippen hebst, registrierst du erleichtert, dass deine Finger sich wieder bewegen können. Du bestellst einen zweiten Whisky, dann einen dritten Whisky, dann einen vierten Whisky, und plötzlich schläfst du ein. Dem ganzen Radau um dich herum zum Trotz bringst du es fertig, so lange zu schlafen, bis dein Produzent, der gute Mensch, dir auf die Füße hilft und dich zum Hotel zurückbefördert.
Ja, du trinkst zu viel und rauchst zu viel, du hast Zähne verloren und niemals ersetzen lassen, dein Speiseplan hält sich nicht an die Vorgaben aktueller Ernährungsprinzipien, aber wenn du Gemüse aus dem Weg gehst, dann nur, weil es dir nicht schmeckt und du es schwierig, beinahe unmöglich findest, etwas zu essen, das du nicht magst. Du weißt, deine Frau macht sich Sorgen um dich, besonders um dein Rauchen und Trinken, aber noch hat zum Glück kein Röntgenbild irgendwelche Beeinträchtigungen deiner Lunge und kein Bluttest Verheerungen an deiner Leber enthüllt, und so hältst du im vollen Bewusstsein, dass sie dir am Ende schweren Schaden zufügen werden, an deinen schlimmen Lastern fest, aber je älter du wirst, desto unwahrscheinlicher kommt es dir vor, dass du jemals die Willenskraft oder den Mut aufbringen wirst, deine geliebten Zigarillos und zahlreichen Gläser Wein dranzugeben, die dir in all den Jahren so viel Vergnügen bereitet haben, und manchmal denkst du, wenn du das alles zu diesem späten Zeitpunkt aus deinem Leben streichen solltest, würde dein Körper auseinanderfallen, würde dein Organismus einfach aufhören zu funktionieren. Zweifellos bist du ein beschädigter, ein verwundeter Mensch, ein Mann, der von Anfang an eine Wunde in sich herumgetragen hat (warum sonst hättest du dein ganzes Erwachsenenleben damit verbringen sollen, Worte auf Papier zu bluten?), und der Gewinn, den du aus Alkohol und Tabak ziehst, dient dir als Krücke, dein verkrüppeltes Ich aufrecht zu halten und durch die Welt zu tragen. Selbstmedikation, wie deine Frau das nennt. Anders als die Mutter deiner Mutter möchte sie dich nicht anders haben. Deine Frau toleriert deine Schwächen, sie schimpft nicht und zetert nicht, und wenn sie sich Sorgen macht, dann nur, weil sie dir ewiges Leben wünscht. Du zählst die Gründe, warum du sie so viele Jahre lang an deiner Seite behalten hast, und das ist sicher einer davon, einer der hellen Sterne in dem ungeheuer großen Sternbild nie nachlassender Liebe.
Natürlich hustest du, besonders nachts, wenn dein Körper sich in der Horizontalen befindet, und in solchen Nächten, in denen die Bronchien noch verschleimter sind als sonst, steigst du aus dem Bett, gehst in ein anderes Zimmer und hustest wie ein Irrer, bis du den ganzen Rotz losgeworden bist. Dein Freund Spiegelmann (der leidenschaftlichste Raucher, den du kennst) pflegt auf die Frage, warum er rauche, regelmäßig zu antworten: «Weil ich gern huste.»
1952. Fünf Jahre alt, nackt in der Wanne, allein, groß genug jetzt, dich selbst zu waschen, und während du im warmen Wasser auf dem Rücken liegst, macht plötzlich dein Penis auf sich aufmerksam, indem er aus der Wasserfläche taucht. Bis zu diesem Moment hast du deinen Penis stets nur von oben gesehen, wenn du im Stehen auf ihn hinabgeblickt hast, aber aus diesem neuen Blickwinkel, mehr oder weniger auf Augenhöhe, scheint es dir, als habe die Spitze deines beschnittenen Gliedes verblüffende Ähnlichkeit mit einem Helm. Mit einem altmodischen Helm, ähnlich denen, die von Feuerwehrleuten Ende des neunzehnten Jahrhunderts getragen wurden. Die Entdeckung behagt dir sehr, denn in dieser Phase deines Lebens wünschst du nichts sehnlicher, als später einmal Feuerwehrmann zu werden, ein Job, der dir den größten Heldenmut zu erfordern scheint (und das tut er zweifellos), und wie gut passt es da, am eigenen Leib mit einem Minifeuerwehrhelm ausgestattet zu sein, an jenem zentralen Körperteil, der obendrein nicht nur aussieht, sondern auch arbeitet wie ein Schlauch.
Die zahllosen Verlegenheiten, in denen du im Lauf deines Lebens gesteckt hast, die verzweifelten Augenblicke, wo du das dringende, überwältigende Bedürfnis hattest, deine Blase zu leeren, und nirgends ist eine Toilette in Sicht, in einem Verkehrsstau, zum Beispiel, oder in einer U-Bahn, die zwischen zwei Stationen steckengeblieben ist, die Tortur, unbedingt einhalten zu müssen. Das ist ein universales Dilemma, von dem nie jemand spricht, aber jeder hat es schon erlebt, jeder hat das durchgemacht, und obwohl es kaum ein komischeres Beispiel für menschliches Leiden gibt als das der platzenden Blase, kannst du darüber nicht lachen oder erst, nachdem du es geschafft hast, dich zu erleichtern – denn welcher über Dreijährige würde sich vor aller Welt in die Hose machen wollen? Deshalb wirst du diese Worte nie vergessen, die letzten Worte, die einer deiner Freunde von seinem sterbenden Vater zu hören bekam: «Merk dir das, Charlie», sagte er, «lass keine Gelegenheit zum Pinkeln aus.» So werden uralte Weisheiten von einer Generation zur nächsten weitergereicht.
Wieder 1952, du sitzt hinten im Familienauto, dem blauen 1950er De Soto, den dein Vater am Tag der Geburt deiner Schwester angeschafft hat. Deine Mutter fährt, und ihr seid schon eine Weile unterwegs, von wo nach wo hast du längst vergessen, jedenfalls seid ihr auf dem Rückweg, höchstens noch zehn oder fünfzehn Minuten von zu Hause, und du spürst einen Druck auf der Blase, seit einiger Zeit schon, und er nimmt immer mehr zu, und inzwischen windest du dich auf dem Sitz, die Beine verklemmt, die Hände in den Schoß gepresst, und weißt nicht, wie lange du das noch aushalten wirst. Du sagst deiner Mutter, was los ist, und sie fragt, ob du noch zehn Minuten durchhalten kannst. Nein, antwortest du, ich glaube nicht. Von hier bis nach Hause, sagt sie, kann ich nirgendwo ranfahren, also mach einfach in die Hose. Was für ein radikaler Gedanke, was für ein Verrat an deiner hart erarbeiteten männlichen Unabhängigkeit – du kannst kaum glauben, dass sie das gesagt hat. Ich soll in die Hose machen?, fragst du. Ja, mach in die Hose, sagt sie. Ist doch egal. Sobald wir nach Hause kommen, kommen deine Sachen in die Wäsche. Und so geschieht es, dass du dir mit ausdrücklicher Erlaubnis deiner Mutter zum letzten Mal in die Hose machst.
Fünfzig Jahre später, ein anderes Auto, ein nagelneuer Toyota Corolla, ein Mietwagen, da du kein eigenes besitzt. Du bist seit drei Stunden auf dem Heimweg von Connecticut zu deinem Haus in Brooklyn. August 2002. Du bist fünfundfünfzig Jahre alt und fährst seit deinem siebzehnten Lebensjahr, souverän und umsichtig, jeder, der je mit dir gefahren ist, kennt dich als guten Fahrer, fast vierzig Jahre lang unfallfrei hinterm Steuer, von einem einzigen Kratzer am Kotflügel einmal abgesehen. Deine Frau sitzt rechts neben dir, auf der Rückbank schläft eure fünfzehn Jahre alte Tochter (die gerade einen Sommerschauspielkurs an einer Schule in Connecticut beendet hat) auf den Decken und Kissen, die ihr im vergangenen Monat als Bettzeug gedient haben. Hinten schläft auch euer Hund, der struppige Köter, den du und deine Tochter vor acht Jahren von der Straße aufgelesen habt, genannt Jack (nach Jack Wilton, dem Protagonisten von Nashes Der glücklose Reisende), und seither ebenso heißgeliebtes wie durchgeknalltes Mitglied der Familie. Deine Frau, die sich über vieles Sorgen macht, hat sich wegen deines Fahrstils niemals Sorgen gemacht, tatsächlich hat sie dich oft dazu beglückwünscht, wie gut du mit den verschiedensten Verkehrssituationen zurechtkommst: andere Autos auf mehrspurigen Highways überholen, zum Beispiel, durch städtische Labyrinthe manövrieren, problemlos die kurvenreichsten Landstraßen meistern. Heute jedoch spürt sie, dass etwas nicht stimmt, dass du dich nicht richtig konzentrierst, dass dein Timing nicht ganz passt, und mehr als einmal hat sie dir schon gesagt, dass du besser aufpassen sollst. Inzwischen solltest du gelernt haben, die Klugheit deiner Frau nicht in Zweifel zu ziehen, denn sie besitzt eine unheimliche Fähigkeit, die Gedanken anderer zu lesen, in die Seelen anderer zu blicken, die verborgenen Unterströmungen jeder menschlichen Situation zu wittern, und immer wieder hast du über ihren treffsicheren Instinkt nur staunen können, aber an diesem Tag äußert sie ihre Unruhe so nachdrücklich, dass sie dir langsam auf die Nerven geht. Ob du nicht ein bekanntermaßen guter Fahrer seist?, sagst du. Ob du jemals einen Unfall hattest? Ob du jemals das Leben der Menschen, die dir alles bedeuten, in Gefahr bringen würdest? Nein, sagt sie, natürlich nicht, sie wisse auch nicht, was mit ihr los sei, und als ihr die Mautstation an der Triborough Bridge erreicht, sagst du: Bitte, da sind wir, New York City, fast schon zu Hause, und jetzt verspricht sie, von nun an kein Wort mehr über deine Fahrerei zu sagen. Aber etwas stimmt nicht, auch wenn du nicht bereit bist, das zuzugeben, denn es ist 2002, und in diesem Jahr hast du so viele böse Überraschungen erlebt, warum also sollten dir nicht auch deine Fahrkünste plötzlich und unerwartet abhandengekommen sein? Am schlimmsten war Mitte Mai der Tod deiner Mutter (Herzinfarkt), ein Schock für dich, nicht weil du nicht weißt, dass Siebenundsiebzigjährige ohne Vorwarnung tot umfallen können, sondern weil sie scheinbar bei guter Gesundheit war und du noch am Tag vor dem letzten Tag ihres Lebens am Telefon mit ihr gesprochen hast, und da war sie guter Dinge, machte Witze und erzählte so komische Geschichten, dass du hinterher zu deiner Frau sagtest: «So glücklich hat sie sich seit Jahren nicht mehr angehört.» Der Tod deiner Mutter war das Schlimmste, aber dann war da auch das Blutgerinnsel, das sich Anfang Februar während eines neunstündigen Flugs nach Kopenhagen in deinem linken Bein bildete, worauf du erst wochenlang flach auf dem Rücken liegen musstest und dann monatelang nur am Stock gehen konntest, zu schweigen von den Scherereien, die du mit deinen Augen hattest, erst der Riss in der Hornhaut deines linken Auges, dann ein paar Wochen später der Riss in der Hornhaut des rechten, gefolgt von weiteren, völlig wahllos auftretenden Zwischenfällen dieser Art im einen oder anderen Auge in den vergangenen Monaten, und jedes Mal geschieht es im Schlaf, was bedeutet, dass du nichts vorbeugend dagegen unternehmen kannst (da die vom Augenarzt verschriebene Salbe keinerlei Wirkung hatte), und wenn du an solchen Morgen wieder einmal mit einem Riss in der Hornhaut aufwachst, leidest du grausame Schmerzen, denn das Auge ist fraglos der empfindlichste und verletzlichste Teil des ganzen Körpers, und nachdem du die schmerzstillenden Tropfen genommen hast, die der Arzt dir für solche Notfälle verschrieben hat, dauert es gewöhnlich zwei bis vier Stunden, ehe der Schmerz sich zu legen beginnt, und in diesen Stunden kannst du nichts tun, nur reglos herumsitzen, mit einem kalten Waschlappen auf dem betroffenen Auge, das du zuhalten musst, weil jeder Versuch, es zu öffnen, sich anfühlt, als würde dir eine Nadel hineingestochen. Also: erst sechs zermürbende Monate nach einer Thrombose, dann ein chronisches trockenes Auge, und dann, nur zwei Tage nach dem Tod deiner Mutter, die erste ausgewachsene Panikattacke deines Lebens, gefolgt von etlichen weiteren an den Tagen unmittelbar darauf, und seit einiger Zeit hast du das Gefühl, dass du dich auflöst, dass du, einst ein unverwüstlicher Kraftprotz, der sämtliche Attacken von innen und von außen abzuwehren vermochte, immun gegen die physischen und psychischen Nöte, die den Rest der Menschheit bedrängen, überhaupt nicht mehr stark bist und rapide zu einem kraftlosen Wrack zerfällst. Dein Hausarzt hat dir Medikamente gegen die Panikattacken verschrieben, und vielleicht beeinträchtigen die an diesem Nachmittag dein Fahrvermögen, auch wenn dir das unwahrscheinlich vorkommt, da du schon öfter mit diesen Pillen im Blut Auto gefahren bist und weder du noch deine Frau jemals einen Unterschied bemerkt habt. Beeinträchtigt oder nicht, du hast die Mautstation an der Triborough Bridge hinter dir und hast die letzte Etappe deines Heimwegs angetreten, und während der Fahrt durch die Stadt denkst du weder an deine Mutter noch an deine Augen, weder an dein Bein noch an die Pillen, die du schluckst, um deine Panikattacken in Schach zu halten. Du denkst ausschließlich an das Auto und die vierzig oder fünfzig Minuten, die du noch bis zu eurem Haus in Brooklyn brauchst, und jetzt, wo deine Frau sich beruhigt hat und sich wegen deiner Fahrerei keine Sorgen mehr zu machen scheint, bist auch du ruhig, und nichts Ungewöhnliches geschieht, während du die Meilen von der Brücke zu den Außenbezirken deines Viertels hinter dich bringst. Es stimmt, du musst pinkeln, deine Blase signalisiert dir das schon seit zwanzig Minuten und mit zunehmender Verzweiflung, und daher fährst du ein wenig schneller, als du vielleicht solltest, denn jetzt hast du es doppelt eilig, dein Zuhause zu erreichen, zum einen natürlich, weil es dein Zuhause ist und du endlich aus dem stickigen Auto herauskommen wirst, zum anderen aber auch, weil du dann die Treppe zum Bad hinaufrennen und dich erleichtern kannst, aber obwohl du ein wenig hektischer fährst als nötig, geht alles gut, und inzwischen bist du nur noch zweieinhalb Minuten von der Straße entfernt, in der du wohnst. Das Auto rollt die Fourth Avenue entlang, eine hässliche Zeile baufälliger Wohnhäuser und leerstehender Lagerhallen, und da Fußgänger sich in dieser Gegend nur selten blickenlassen, brauchen Autofahrer kaum damit zu rechnen, dass jemand die Straße überquert, zumal die Ampeln hier länger grün bleiben als an den meisten anderen Straßen, was dazu verführt, schnell zu fahren, zu schnell, oft weit über dem Tempolimit. Solange man geradeaus fährt, ist das kein Problem (deswegen hast du schließlich diese Route gewählt: weil sie dich schneller nach Hause bringt als alle anderen), aber wenn man links abbiegen will, kann der Gegenverkehr gefährlich werden, da man bei Grün abbiegen muss, und wenn die Ampel für dich grün ist, ist sie es auch für die Autos, die dir entgegenkommen. Jetzt, an der Kreuzung Fourth Avenue und Third Street, wo du nach links abbiegen musst, um dein Haus zu erreichen, hältst du an und wartest auf eine Lücke, und plötzlich vergisst du, was du von deinem Vater gelernt hast, als er dir vor fast vierzig Jahren das Autofahren beigebracht hat. Er selbst war ein schlechter, ein miserabler Fahrer, ein unaufmerksamer Träumer, der jedes Mal das Schicksal herausforderte, wenn er den Schlüssel in die Zündung steckte, aber bei all seiner Unzulänglichkeit hinterm Steuer besaß er ausgezeichnete pädagogische Fähigkeiten, und der beste Rat, den er dir je gegeben hat, war der: Fahr defensiv; geh davon aus, dass alle anderen auf der Straße dumm und verrückt sind; fühl dich niemals sicher. An diese Worte hast du dich immer gehalten, sie haben dir in all den Jahren gute Dienste geleistet, jetzt aber, entweder weil du es kaum noch erwarten kannst, deine Blase zu leeren, oder weil ein Medikament dein Urteilsvermögen trübt oder weil du müde bist und nicht genug aufpasst oder weil du zu einem kraftlosen Wrack geworden bist, entscheidest du dich impulsiv, etwas zu riskieren, oder anders gesagt, offensiv zu werden. Ein brauner Lieferwagen kommt auf dich zu. Er fährt schnell, ja, aber nicht schneller als siebzig Stundenkilometer, denkst du, höchstens achtzig, und nachdem du die Entfernung zwischen dir und dem Lieferwagen in Bezug auf seine Geschwindigkeit abgeschätzt hast, bist du dir sicher, problemlos nach links abbiegen und die Kreuzung hinter dich bringen zu können – freilich nur, wenn du entschlossen handelst und jetzt Gas gibst. Deine Berechnungen fußen auf der Annahme, dass der Lieferwagen siebzig oder achtzig Stundenkilometer draufhat, was jedoch nicht den Tatsachen entspricht. Er fährt schneller, mindestens neunzig, vielleicht sogar hundert, und daher ist er, kaum dass du das Steuer nach links gerissen und über die Kreuzung zu jagen begonnen hast, plötzlich und unerwartet ganz nah, und da dein Blick nach vorn und nicht nach rechts gerichtet ist, siehst du den Lieferwagen nicht auf dich zurasen