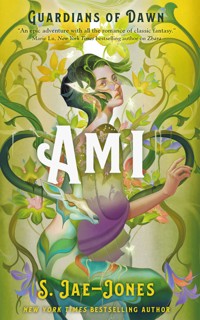9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die 19-jährige Liesl ist mit der Sage um den faszinierenden wie schrecklichen Erlkönig aufgewachsen. Ihre Großmutter hat sie immer ermahnt, die längste Nacht des Winters zu fürchten, in der der König ein hübsches Mädchen in die Unterwelt entführt. Als ein unheimlicher, gut aussehender Fremder auftaucht und Liesls Schwester mit sich nimmt, wird Liesls schlimmste Befürchtung wahr. Nur sie kann ihre Schwester noch aus den Fängen des Erlkönigs retten, indem sie ihm in sein Reich folgt und ihn anstelle ihrer Schwester selbst heiratet. Doch wer ist dieser mysteriöse Mann? Gegen ihren Willen fühlt Liesl sich zu ihm hingezogen. Während sie noch versucht, ihre Gefühle zu verstehen, arbeitet das Schicksal bereits gegen sie – denn in der Unterwelt stirbt Liesls Körper. Können Liesl und ihr Erlkönig die alten Gesetze brechen und ihrer Liebe eine Chance geben?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Lesen was ich will!www.lesen-was-ich-will.deÜbersetzung aus dem Amerikanischen von Diana BürgelISBN 978-3-492-97850-7© S. Jae-Jones 2017Titel der amerikanischen Originalausgabe:»Wintersong« bei Thomas Dunne Books, New York 2017Deutschsprachige Ausgabe:© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2017Covergestaltung: zero-media.net, MünchenCovermotiv: FinePic®, MünchenDatenkonvertierung: Fotosatz Amann GmbH & Co. KGSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Danksagung
Ouvertüre
Teil 1 – Der Markt der Kobolde
Hüte dich vor den Kobolden
Kommt und kauft, kommt und kauft
Sie gehört nun dem Koboldkönig
Virtuose
Das Vorspielen
Der große, elegante Fremde
Intermezzo
Das vollkommene Trugbild
Eine schöne Lüge
Die hässliche Wahrheit
Opfer
Teil 2 – Der Ball der Kobolde
Feenlichter
Offene Augen
Die Spiele, die wir gespielt haben
Die Braut
Die alten Gesetze
Fremd, süß
Teuer erkaufter Sieg
Wiederauferstehung
Teil 3 – Die Koboldkönigin
Weihe
Die Hochzeit
Hochzeitsnacht
Ein blutender Stich
Jene, die vorher waren
Komm und spiel mit mir
Wechselbalg
Erbarmen
Romanze in c-Dur
Teil 4 – Der Koboldkönig
Der Tod und die Jungfrau
Vielleicht auch träumen
Unvollendete Symphonie
Die Schwelle
Zugzwang
Gerechtigkeit
Bist du bei mir
Die Geschichte der tapferen Maid
Die Mysterien-Sonaten
Die Rückkehr
Unsterblicher Geliebter
Gedicht
Brief
Glossar der musikalischen Begriffe
Für
die beste Märchenoma aller Zeiten
DANKSAGUNG
Als meine Lektorin mich fragte, ob ich eine Danksagung in mein Buch integrieren wolle, antwortete ich sofort »Klar! Unbedingt!«, ohne mir zuvor Gedanken darüber zu machen, was für eine unmögliche Aufgabe dies werden würde. In vielerlei Hinsicht war das Verfassen einer Danksagung viel schwieriger, als das ganze restliche Manuskript zu schreiben. Wen sollte ich erwähnen? Was, wenn ich jemanden vergaß? Was, wenn ich versehentlich jemanden beleidigte, der die Macht besaß, mein Buch toppen oder floppen zu lassen? Um also niemanden außen vor zu lassen, möchte ich mich hiermit bei all jenen bedanken, die mein Werk gelesen, daran mitgearbeitet, es berührt oder auch nur angesehen haben. Vielen, vielen Dank. Eure Hilfe und Unterstützung bedeutet mir mehr, als ich jemals sagen könnte.
Was Dankesworte betrifft, war ich noch nie sonderlich talentiert, ob ich sie nun verteile oder empfange, trotzdem möchte ich nicht versäumen, meine treuesten und unerschütterlichsten Helden einzeln aufzuführen, beginnend mit der Person, die mich überhaupt erst gefragt hat, ob ich diese Danksagung schreiben möchte.
Vielen Dank an meine Lektorin Jennifer Latwack, meine liebste hauseigene Heldin, die als erste Potenzial in diesem merkwürdigen Zwischenmanuskript gesehen hat und dabei geblieben ist, trotz Genrewechseln und anderer unerwarteter Wendungen während jener verrückten Achterbahnfahrt, die wir Buchveröffentlichung nennen. Danke, dass du nicht in Panik ausgebrochen bist (oder es dir wenigstens nie hast anmerken lassen), wenn ich mit einem Entwurf bei dir aufgetaucht bin, der plötzlich ein ganz anderes Ende oder einen neuen Prolog beinhaltet hat oder wenn ich mit »Aber wie wäre es, wenn …?« gekommen bin. Vielen Dank auch an Karen Masnica und Brittani Hilles dafür, dass ihr schon so frühe Fans von »Wintersong« wart (und »Labyrinth« genauso verehrt habt wie ich); an Danielle Fiorella für das fantastische Cover (und für den Input!), an Anna Gorovoy für das schöne Design (und dafür, dass ich meine eigenen Illustrationen beitragen durfte!) und an Melanie Sanders, die dieses Buch sicher durch den Herstellungsprozess gelotst hat.*
An Katelyn Detweiler, meine Agentin und Mitstreiterin, meine unermüdliche Fürsprecherin und Ratgeberin, die selbst eine unheimlich talentierte Schriftstellerin ist. Du warst die Erste, die mir eine Chance gegeben hat, und du hast nie gezögert oder in deinem Glauben an »Wintersong« gewankt, selbst dann nicht, als die Bücherindustrie keine Ahnung hatte, was sie mit uns anfangen sollte. Auf viele weitere Bücher! Danke vielmals für die Unterstützung auch an Jill Grinberg, Cheryl Pientka, Denise St. Pierre und an alle bei Jill Grinberg Literary Management.
An meine Schriftstellerfreunde Marie Lu, Renee Ahdieh und Roshani Chokshi, vielen Dank für euren Rat, die Cocktails und euer Mitgefühl. Danke, dass ihr mich nörgeln und zetern gelassen habt – ob nun per Mail oder in persona – und dass ihr während dieser ganzen Reise meine Felsen in der Brandung wart. Ein weiterer Dank geht an Kate Elliott und Charlie N. Holmberg für eure freundlichen Worte über »Wintersong«: Ihr wart die Ersten, die dieses Werk gelobt haben – abgesehen von meinen Freunden, meiner Familie und denen, die ich dafür bezahlt habe (ist nur Spaß) – und dafür bin ich euch sehr dankbar.
Jeder Schriftsteller braucht ein unterstützendes Netzwerk, um nicht verrückt zu werden, also geht ein großer Dank an Sarah Lemon, Beth Revis, Carrie Ryan und alle Mitwirkenden bei Pub(lishing) Crawl und an meine Mit-Swankys. Ein besonderer Applaus gebührt Kelly Van Sant und Vicki Lame, dafür, dass ihr täglich auf Google Hangouts für mich da wart und mich von jedem Abgrund zurückgeholt habt, an den ich mich wieder manövriert hatte. Danke an alle meine Freunde in New York, L.A. und North Carolina, an all jenen Orten, die ich einmal mein Zuhause genannt habe. Danke, danke, danke.
Schließlich und endlich gilt meine ganze Liebe und all mein Dank meiner Familie. Sue Mi, Michael und Taylor Jones, danke, dass ihr mir den Rücken gestärkt und an das schwarze Schaf des südkalifornischen Jones-Clans geglaubt habt. Danke an Halmeoni für ihre bedingungslose Liebe und ihre Gebete. Und natürlich an Bear. Wer weiß, vielleicht kannst du das Versprechen, das du deinen Kollegen gegeben hast, ja eines Tages erfüllen, falls »Wintersong« ein Erfolg wird. Vielleicht kündigst du dann wirklich und wirst ein pokerspielender Gigolo. Träumen kann man ja mal.
* Betrifft die amerikanische Ausgabe.
Es war einmal ein kleines Mädchen, das seine Musik für einen kleinen Jungen in den Wäldern spielte. Sie war klein und dunkelhaarig, er hingegen groß und blond, und die beiden gaben ein schönes Paar ab, wenn sie miteinander tanzten. Wenn sie zu der Musik tanzten, die das Mädchen in seinem Kopf hörte.
Ihre Großmutter hatte es vor den Wölfen gewarnt, die diese Wälder durchstreiften. Doch das kleine Mädchen wusste, dass ihm von dem kleinen Jungen keine Gefahr drohte, obwohl er der König der Kobolde war.
Willst du mich heiraten, Elisabeth?, fragte der kleine Junge, und das kleine Mädchen wunderte sich nicht darüber, dass er ihren Namen kannte.
Oh, antwortete sie. Aber ich bin noch zu jung zum Heiraten.
Dann werde ich warten, sagte der kleine Junge. Solange du dich erinnerst, werde ich warten.
Und das kleine Mädchen lachte und tanzte mit dem Koboldkönig. Mit dem kleinen Jungen, der immer nur ein wenig älter war als sie, immer ein kleines Stück außerhalb ihrer Reichweite.
Während sich die Jahreszeiten wandelten und die Jahre verstrichen, wuchs das kleine Mädchen heran, doch der Koboldkönig blieb derselbe. Sie wusch die Teller, wischte den Boden, kämmte das Haar ihrer Schwester und lief noch immer in den Wald, um ihren alten Freund im Hain zu treffen. Ihre Spiele hatten sich verändert. Jetzt waren es Wahrheit oder Pflicht, Herausforderungen und Mutproben.
Willst du mich heiraten, Elisabeth?, fragte der kleine Junge, aber das kleine Mädchen verstand noch nicht, dass seine Frage nicht zum Spiel gehörte.
Oh, antwortete sie. Aber du hast meine Hand noch nicht gewonnen.
Dann werde ich sie gewinnen, sagte der kleine Junge. Ich werde gewinnen, bis du einwilligst.
Das kleine Mädchen lachte und spielte gegen den Koboldkönig, wobei sie jede Runde und jedes Spiel verlor.
Der Winter wurde zum Frühling, der Frühling zum Sommer, der Sommer zum Herbst und der Herbst wieder zum Winter, doch jeder Wechsel der Jahreszeiten wurde schwieriger, während das kleine Mädchen heranwuchs und der Koboldkönig immer derselbe blieb. Sie wusch die Teller, wischte den Boden, kämmte das Haar ihrer Schwester, tröstete ihren Bruder, wenn er Angst hatte, versteckte den Geldbeutel ihres Vaters, zählte die Münzen und lief nicht mehr in den Wald, um ihren alten Freund zu treffen.
Willst du mich heiraten, Elisabeth?, fragte der Koboldkönig.
Doch das kleine Mädchen antwortete nicht.
Sieh die Kobolde nicht an,Kauf ihre Früchte nicht:Denn wer weiß, in welche ErdeSich die darbende Wurzel flicht?
Christina Rossetti, Markt der Kobolde
»Hüte dich vor den Kobolden«, sagte Constanze. »Und vor den Waren, die sie feilbieten.«
Ich zuckte zusammen als der Schatten meiner Großmutter über meine Notizen huschte und sowohl meine Gedanken als auch die Papiere vor mir durcheinanderbrachte. Rasch versuchte ich, meine Musik mit zitternden Händen zu verdecken, aber Constanze hatte nicht mich gemeint. Mit finsterer Miene stand sie in der Tür und sah meine Schwester Käthe an, die sich vor dem Spiegel in unserem Schlafzimmer herausputzte.
»Pass gut auf, Katharina.« Mit einem knotigen Finger deutete Constanze auf das Spiegelbild meiner Schwester. »Eitelkeit lässt einen leicht in Versuchung geraten, und sie ist ein Zeichen für einen schwachen Willen.«
Käthe achtete nicht auf sie, kniff sich in die Wangen und schüttelte ihre Locken. »Liesl«, sagte sie und griff nach einem Hut auf der Frisierkommode. »Könntest du mir damit mal helfen?«
Ich legte meine Notizen in ihr kleines abschließbares Kästchen. »Es ist nur ein Markt, Käthe, kein Ball. Wir holen lediglich Josefs Geigenbögen von Herrn Kassl ab.«
»Liesl«, bettelte Käthe. »Bitte.«
Constanze schnaubte abfällig und klopfte mit ihrem Krückstock auf den Boden, aber meine Schwester nahm sie noch immer nicht zur Kenntnis. Wir waren an die mürrischen und unheilschwangeren Äußerungen gewöhnt.
»Na gut«, seufzte ich, versteckte das Kästchen unter unserem Bett und stand auf, um den Hut auf Käthes Haar festzustecken.
Er sah aus wie Zuckerwerk aus Seide und Federn, eine alberne Heuchelei, besonders in unserem kleinen Provinznest. Aber immerhin war meine Schwester genauso albern, also passten sie und der Hut gut zusammen.
»Autsch!«, rief Käthe, als ich sie versehentlich mit einer der Nadeln pikte. »Pass auf, wohin du damit stichst.«
»Dann lern endlich, dich selbst anzuziehen.« Ich strich die Locken meiner Schwester glatt und zupfte ihr Tuch zurecht, damit es ihre nackten Schultern bedeckte. Ihr Kleid war unter den Brüsten gerafft und die schlichten Linien brachten jede Kurve ihres Körpers voll zur Geltung. Käthe zufolge war dies ganz nach der neuesten Mode in Paris, aber in meinen Augen wirkte meine Schwester schockierend unbekleidet.
»Ach was.« Käthe warf ihrem Spiegelbild einen zufriedenen Blick zu. »Du bist ja nur neidisch.«
Ich zuckte innerlich zusammen. Käthe war die Schönheit unserer Familie mit ihrem sonnenscheinhellen Haar, den sommerblauen Augen, den Apfelbäckchen und ihrer vollbusigen Figur. Mit siebzehn sah sie schon aus wie eine erwachsene Frau. Ihre Taille war schmal und die Hüften breit, was ihr neues Kleid äußerst vorteilhaft betonte. Ich dagegen war fast zwei Jahre älter, wirkte aber immer noch wie ein Kind: klein, dünn und blass. Kleiner Kobold hatte Papa mich immer genannt. Fee war Constanzes Wort der Wahl. Nur Josef behauptete, ich sei schön. Nicht hübsch, betonte mein Bruder immer. Schön.
»Ja, ich bin neidisch«, gab ich zu. »Gehen wir jetzt zum Markt oder nicht?«
»Gleich.« Käthe kramte in ihrem Schmuckkästchen herum. »Was meinst du, Liesl?«, fragte sie und hielt eine Handvoll Bänder hoch. »Rot oder blau?«
»Spielt das eine Rolle?«
Sie seufzte. »Wahrscheinlich nicht. Keiner der Jungen im Dorf achtet jetzt noch darauf, wo ich doch bald heirate.« Finster dreinblickend zupfte sie am Saum ihres Kleides herum. »Hans macht sich nicht viel aus Vergnügen und schönen Kleidern.«
Ich presste die Lippen zusammen. »Hans ist ein guter Mann.«
»Ein guter Mann und langweilig«, erwiderte Käthe. »Hast du ihn neulich abends beim Tanz gesehen? Er hat mich nicht ein einziges Mal aufgefordert. Er hat nur in der Ecke gestanden und vorwurfsvoll geschaut.«
Weil Käthe schamlos mit ein paar österreichischen Soldaten geflirtet hatte, die unterwegs nach München waren, um die Franzosen zu vertreiben. Hübsches Mädel, hatten sie in ihrem komischen österreichischen Akzent gerufen. Komm und gib uns einen Kuss!
»Eine lasterhafte Frau ist wie eine reife Frucht«, stimmte Constanze ein. »Sie bettelt geradezu darum, vom Koboldkönig gepflückt zu werden.«
Ein unbehaglicher Schauer lief mir über den Rücken. Unsere Großmutter erschreckte uns gerne mit Erzählungen über Kobolde und andere Wesen, die in den Wäldern jenseits unseres Dorfes lebten, aber Käthe, Josef und ich glaubten seit unseren Kindertagen nicht mehr an ihre Geschichten. Mit achtzehn war ich zu alt für die Märchen meiner Großmutter, doch der leicht schuldbewusste Nervenkitzel, der mich überkam, wenn der Koboldkönig erwähnt wurde, war mir kostbar. Trotz allem glaubte ich noch immer an ihn. Ich wollte noch immer an ihn glauben.
»Ach, geh und meckere jemand anderen an, du alte Krähe. Warum musst du immer auf mir herumhacken?« Käthe schmollte.
»Denk an meine Worte.« Constanze funkelte meine Schwester an. Der Blick ihrer dunkelbraunen Augen war das Einzige, was in ihrem runzligen Gesicht noch scharf wirkte. »Gib auf dich acht, Katharina, sonst kommen dich die Kobolde holen wegen deiner zügellosen Art.«
»Das ist genug, Constanze«, fiel ich ihr ins Wort. »Lass Käthe in Frieden, damit wir loskommen. Wir müssen zurück sein, bevor Meister Antonius hier ist.«
»Ja, nicht, dass wir das Vorspielen unseres lieben kleinen Josefs für den berühmten Maestro der Violine verpassen«, murmelte meine Schwester.
»Käthe!«
»Schon gut, schon gut.« Sie seufzte. »Hör auf, dir Sorgen zu machen, Liesl. Er wird das schon schaffen. Du bist schlimmer als eine Glucke.«
»Er wird es nicht schaffen, wenn er keinen Geigenbogen hat, mit dem er spielen kann.« Ich wandte mich zum Gehen. »Komm jetzt, oder ich gehe ohne dich.«
»Warte.« Käthe hielt mich an der Hand fest. »Würdest du mich etwas mit deinen Haaren machen lassen? Du hast so wunderschöne Locken. Es ist eine Schande, dass du immer nur diesen geflochtenen Zopf trägst. Ich könnte …«
»Ein Zaunkönig ist immer noch ein Zaunkönig, auch wenn er sich mit Pfauenfedern schmückt.« Ich schüttelte sie ab. »Verschwende nicht deine Zeit. Es ist ja nicht so, als ob Hans – oder sonst irgendjemand – es bemerken würde.«
Bei der Erwähnung ihres Verlobten zuckte meine Schwester zurück. »Schön«, zischte sie und stolzierte ohne ein weiteres Wort an mir vorbei.
»Kä…«, setzte ich an, aber Constanze hielt mich auf, bevor ich ihr nachlaufen konnte.
»Pass gut auf deine Schwester auf, Mädchen«, warnte sie. »Du musst sie beschützen.«
»Tue ich das nicht immer?«, fauchte ich. Stets war es meine Aufgabe gewesen – und die meiner Mutter –, die Familie zusammenzuhalten. Mutter kümmerte sich um das Gasthaus, in dem wir lebten und arbeiteten. Ich kümmerte mich um die Menschen, die es zu unserem Zuhause machten.
»Tust du das wirklich?« Meine Großmutter richtete den Blick ihrer dunklen Augen auf mich. »Josef ist nicht der Einzige, um den man sich kümmern muss, weißt du.«
Ich runzelte die Stirn. »Wie meinst du das?«
»Du vergisst, welcher Tag heute ist.«
Manchmal war es leichter, Constanze ihren Willen zu lassen, als sie zu ignorieren. Ich seufzte. »Welcher Tag ist denn heute?«
»Der Tag, an dem das alte Jahr stirbt.«
Ein weiterer Schauer lief mir über den Rücken. Meine Großmutter hielt sich noch an die alte Ordnung und an den alten Kalender, nach dem diese letzte Nacht des Herbstes den Tod des alten Jahres bedeutete. In dieser Nacht war die Grenze zwischen den Welten dünn. Während der Wintertage wandelten die Bewohner der Unterwelt auf der Erde, bevor das Jahr im Frühling von Neuem begann.
»Die letzte Nacht des Jahres«, wiederholte Constanze. »Nun beginnen die Tage des Winters und der Koboldkönig zieht aus, um sich seine Braut zu suchen.«
Ich wandte das Gesicht ab. Früher einmal hätte ich nicht erst daran erinnert werden müssen. Früher hätte ich meiner Großmutter dabei geholfen, jedes Fenstersims, jede Türschwelle und jeden Eingang mit Salz zu bestreuen, um die Wildlinge in diesen Nächten fernzuhalten. Früher. Aber ich konnte mir den Luxus einer ausschweifenden Fantasie nicht mehr leisten. Es war an der Zeit, dieses kindische Verhalten abzulegen.
»Ich habe keine Zeit für so etwas.« Ich schob Constanze beiseite. »Lass mich vorbei.«
Trauer stand im faltigen Gesicht meiner Großmutter. Trauer und Einsamkeit. Ihre gebeugten Schultern neigten sich noch tiefer unter der Last ihres Glaubens. Nun trug sie diesen Glauben allein. Niemand von uns hielt dem Erlkönig noch die Treue. Niemand außer Josef.
»Liesl!«, rief Käthe von unten. »Kann ich mir deinen roten Mantel ausleihen?«
»Wähle weise, Mädchen«, fuhr Constanze eindringlich fort. »Josef ist nicht Teil des Spiels. Wenn der Erlkönig spielt, dann nimmt er es ernst.«
Abrupt hielt ich inne. »Wovon redest du? Welches Spiel?«
»Sag du es mir.« Constanzes Miene war finster. »Es hat Folgen, welche Wünsche wir in der Dunkelheit fassen, und der Herr des Unheils fordert ihren Preis ein.«
Ihre Worte waren wie Stacheln in meinen Gedanken. Ich dachte daran, wie Mutter uns vor Constanzes vom Alter matt gewordenem Verstand gewarnt hatte, aber meine Großmutter war mir nie klarer und ernsthafter vorgekommen als in diesem Augenblick, und obwohl ich es nicht wollte, wand sich langsam ein Strang der Angst um meinen Hals.
»Ist das ein Ja?«, rief Käthe. »Dann nehme ich ihn mir jetzt!«
Ich gab einen unwilligen Laut von mir. »Nein, kannst du nicht!«, antwortete ich und lehnte mich über das Treppengeländer. »Ich bin gleich da, versprochen!«
»Versprochen, wie?« Constanze lachte gackernd. »Du gibst eine Menge Versprechen, aber wie viele davon hältst du auch?«
»Was …«, begann ich, doch als ich mich umdrehte, war meine Großmutter verschwunden.
Unten hatte Käthe meinen roten Mantel von seinem Haken genommen, aber ich schnappte ihn ihr aus den Händen und legte ihn mir selbst um die Schultern. Als Hans uns letztes Mal Geschenke aus dem Stoffgeschäft seines Vaters mitgebracht hatte – noch bevor er um Käthes Hand angehalten und sich zwischen uns alles verändert hatte –, war auch ein schöner Ballen mit schwerer Wolle dabei gewesen. Für die Familie, hatte er gesagt, aber alle hatten gewusst, dass es ein Geschenk an mich war. Die Wolle war in einem tiefen Blutrot gefärbt, das gut zu meinem dunklen Haar passte und meinen blassen Teint belebte. Mutter und Constanze hatten mir aus dem Stoff einen Wintermantel geschneidert und Käthe hatte aus ihrem Neid keinen Hehl gemacht.
Wir gingen an unserem Vater vorbei, der im Wirtsraum verträumte Lieder auf seiner Geige spielte. Ich sah mich nach Gästen um, doch der Raum war leer, der Kamin kalt und die Kohlen erloschen. Papa trug noch immer dieselben Kleider wie am Vorabend und der Geruch nach abgestandenem Bier umwaberte ihn.
»Wo ist Mutter?«, fragte Käthe.
Sie war nirgends zu sehen, was vermutlich auch der Grund war, warum Papa so verwegen war, im Schankraum zu spielen, wo ihn jeder hören konnte. Die Geige war ein wunder Punkt zwischen meinen Eltern. Das Geld war knapp, und Mutter wäre es lieber, wenn Papa gegen Lohn statt zum Vergnügen spielte. Aber vielleicht hatte Meister Antonius’ nahende Ankunft nicht nur Mutters Geldbeutel, sondern auch ihr Herz ein wenig geöffnet. Der berühmte Virtuose würde unserem Gasthaus auf seinem Weg von Wien nach München einen kurzen Besuch abstatten, um meinen kleinen Bruder vorspielen zu lassen.
»Wahrscheinlich hat sie sich kurz hingelegt«, vermutete ich. »Wir sind vor dem Morgengrauen aufgestanden und haben die Zimmer für Meister Antonius geputzt.«
Mein Vater war ein unvergleichlicher Violinist, der einst mit den besten Hofmusikanten in Salzburg gespielt hatte. Er prahlte gerne damit, dass er dort auch die Ehre gehabt hatte, mit Mozart zu arbeiten, einem der größten Konzertkomponisten seiner Zeit. Ein solches Genie gibt es nur einmal in der Lebensspanne eines Menschen, sagte Papa immer. Vielleicht auch nur einmal in zwei Lebensspannen. Dann warf er Josef für gewöhnlich einen schelmischen Blick zu. Aber manchmal schlägt der Blitz auch zweimal ein.
Josef war nirgendwo zu sehen. Mein kleiner Bruder war Fremden gegenüber schüchtern. Wahrscheinlich versteckte er sich im Koboldhain und übte, bis seine Finger bluteten. Wie ich mich doch danach sehnte, mich ihm anzuschließen.
»Gut, dann wird mich niemand vermissen«, sagte Käthe fröhlich. Meine Schwester fand ständig Ausreden, um ihren Pflichten zu entgehen. »Lass uns gehen.«
Die Luft draußen war kühl. Selbst für den Spätherbst war es ein ungewöhnlich kalter Tag und das Licht wirkte fahl und unbeständig. Feiner Nebel hüllte die Bäume entlang des Weges ein und verwandelte ihre dürren Äste in gespenstische Gliedmaßen. Die letzte Nacht des Jahres. An einem solchen Tag fiel es mir tatsächlich nicht schwer, daran zu glauben, dass die Grenzen zwischen den Welten dünn waren.
Der Weg in die Stadt war von Räderspuren zerfurcht und übersät mit Pferdeäpfeln. Käthe und ich gingen ganz am Rand, wo das kurze, tote Gras verhinderte, dass die Feuchtigkeit durch unsere Stiefel sickerte.
»Igitt.« Käthe umging eine weitere schmutzige Pfütze. »Ich wünschte, wir könnten uns eine Kutsche leisten.«
»Wenn Wünsche nur Macht besäßen«, antwortete ich.
»Dann wäre ich die mächtigste Person der Welt. Ich habe nämlich eine Menge Wünsche. Ich wünschte, wir wären reich. Ich wünschte, wir könnten uns alles leisten, was wir wollen. Stell dir das nur mal vor, Liesl: Was wenn, was wenn, was wenn.«
Ich lächelte. Als Mädchen hatten Käthe und ich oft das Was-wenn-Spiel gespielt. Obwohl meine Schwester keinen Blick für das Unheimliche hatte wie Josef und ich, so war sie doch außergewöhnlich fantasiebegabt.
»Ja, was wenn?«, murmelte ich leise.
»Lass uns spielen. Wie sähe eine perfekte Traumwelt aus? Du fängst an, Liesl.«
»In Ordnung.« Ich dachte an Hans, schob diesen Gedanken dann jedoch beiseite. »In einer perfekten Traumwelt wäre Josef ein berühmter Musiker.«
Käthe verzog das Gesicht. »Bei dir geht es immer nur um Josef. Hast du denn keine eigenen Träume?«
Hatte ich. Sie befanden sich eingeschlossen in einem Kästchen, sicher versteckt unter dem Bett, das wir uns teilten. Sie sollten niemals gesehen, niemals gehört werden.
»Gut«, sagte ich. »Dann bist du jetzt dran, Käthe. Wie sieht deine perfekte Traumwelt aus?«
Sie lachte. Es war ein glockenheller Klang, der einzige musikalische Laut, den meine Schwester jemals von sich gab. »Ich bin eine Prinzessin.«
»Natürlich.«
Sie warf mir einen scharfen Blick zu. »Ich bin eine Prinzessin und du bist eine Königin, zufrieden?«
Ich winkte ab.
»Ich bin also eine Prinzessin«, fuhr sie fort. »Papa ist der Kapellmeister des Fürstbischofs und wir leben in Salzburg.«
Käthe und ich waren in Salzburg geboren worden, als Papa noch einer der Hofmusikanten gewesen war und Mama bei einer Truppe gesungen hatte. Bevor uns die Armut in die Hinterwälder Bayerns getrieben hatte.
»Mutter ist der Stolz der Stadt wegen ihrer Schönheit und ihrer Stimme, und Josef ist Meister Antonius’ Meisterschüler.«
»Er studiert also in Salzburg?«, fragte ich. »Nicht in Wien?«
»Dann eben in Wien«, verbesserte sich Käthe. »Oh ja, Wien.« Ihre blauen Augen funkelten, während sie unsere Fantasiewelt weiter ausschmückte. »Natürlich würden wir oft dorthin reisen, um ihn zu besuchen. Vielleicht würden wir auch seine Vorstellungen in Paris, Mannheim und München sehen oder sogar in London! Wir hätten in jeder dieser Städte ein großes Haus aus Gold, Marmor und Mahagoniholz. Wir würden Kleider aus bester Seide und Brokat tragen, an jedem Tag der Woche eines in einer anderen Farbe. Und jeden Morgen würden wir mit Einladungen zu den fantastischsten Bällen, Festen, Opernaufführungen und Theaterstücken überschwemmt werden. Eine ganze Schar junger Burschen würde um unsere Gunst buhlen, und die größten Künstler und Musiker würden uns als vertraute Freunde bezeichnen. Und wir würden jede Nacht durchtanzen und nur Kuchen und Pastete und Schnitzel essen und …«
»Schokoladentorte«, fügte ich hinzu. Nichts aß ich lieber.
»Schokoladentorte«, stimmte Käthe zu. »Wir hätten die feinsten Kutschen und die schönsten Pferde, und …« – sie rutschte in einer Pfütze aus und kreischte auf – »… und wir müssten niemals zu Fuß auf unbefestigten Straßen zum Markt laufen.«
Lachend half ich ihr wieder auf. »Feste, Bälle, glitzernde Gesellschaften. Ist es das, was Prinzessinnen tun? Was ist mit Königinnen? Was ist mit mir?«
»Mit dir?« Käthe schwieg einen Augenblick. »Nein. Königinnen sind zu etwas Höherem bestimmt.«
»Zu etwas Höherem?«, wiederholte ich nachdenklich. »Ein armes, unscheinbares kleines Ding wie ich?«
»Du hast etwas, das beständiger ist als Schönheit«, sagte sie ernst.
»Und was wäre das?«
»Anmut«, antwortete sie schlicht. »Anmut und Talent.«
Ich lachte. »Was ist also mein Schicksal?«
Sie warf mir einen Seitenblick zu. »Du wirst eine ruhmreiche Komponistin.«
Ein eisiger Windhauch erfasste mich und die Kälte drang mir bis auf die Knochen. Es war, als hätte mir meine Schwester in die Brust gegriffen und das noch immer schlagende Herz herausgerissen. Ich hatte ab und zu kleine Melodien aufgeschrieben. Nur kurze Liedchen, keine Hymnen, auf die Ränder meines Gesangbüchleins. Ich hatte vorgehabt, sie irgendwann zu Sonaten und Concerti zusammenzufügen, zu Romanzen und Sinfonien. Meine zarten Hoffnungen und Träume waren schon so lange durch meine Heimlichkeit geschützt, dass ich es nicht ertragen konnte, sie entblößt zu sehen.
»Liesl?« Käthe zupfte an meinem Ärmel. »Liesl, ist alles in Ordnung?«
»Wie …« Meine Stimme klang heiser. »Woher weißt du …«
Sie wand sich. »Ich habe das Kästchen mit deinen Kompositionen unter unserem Bett gefunden«, sagte sie. »Ich wollte nichts Böses, wirklich nicht«, fügte sie rasch hinzu. »Aber ich habe nach einem Knopf gesucht, denn ich fallen gelassen hatte, und …« Sie verstummte, als sie mein Gesicht sah.
Meine Hände zitterten. Wie konnte sie es wagen, meine geheimen Gedanken vor ihren neugierigen Augen auszubreiten?
»Liesl?« Käthe wirkte besorgt. »Was ist los?«
Ich konnte nicht antworten. Nicht, solange meine Schwester nicht einmal begriff, wie schlimm dieser Übergriff für mich war. Käthe besaß keinen Funken musikalisches Talent, was in einer Familie wie der unseren fast als Todsünde galt. Ich wandte mich ab und marschierte weiter in Richtung Markt.
»Was habe ich denn gesagt?« Sie eilte mir nach. »Ich dachte, du würdest dich freuen. Jetzt, wo Josef fortgeht, dachte ich, Papa würde vielleicht … Ich meine, wir wissen alle, dass du genauso viel Talent hast wie …«
»Hör auf.« Die Worte knisterten in der Herbstluft, brachen unter der Kälte meiner Stimme. »Hör auf, Käthe.«
Ihre Wangen wurden rot, als hätte ich sie geschlagen. »Ich verstehe dich nicht.«
»Was verstehst du nicht?«
»Warum du dich hinter Josef versteckst.«
»Was hat Sepperl damit zu tun?«
Käthe verengte die Augen zu Schlitzen. »Für dich hat alles mit unserem kleinen Bruder zu tun. Ich wette, vor ihm hast du deine Musik nicht geheim gehalten.«
Ich zögerte. »Er ist anders.«
»Natürlich ist er anders.« Entnervt warf sie die Hände in die Luft. »Der kostbare Josef, der sensible Josef, der talentierter Josef. Er hat Musik und Wahnsinn und Zauber im Blut – etwas, das die arme, gewöhnliche, unmusikalische Katharina nicht versteht und niemals verstehen kann.«
Ich öffnete den Mund, um zu protestieren, doch dann schloss ich ihn wieder. »Sepperl braucht mich«, sagte ich leise. Es stimmte. Unser Bruder war zerbrechlich, nicht nur in körperlicher Hinsicht.
»Ich brauche dich«, sagte sie ruhig. Verletzt.
Constanzes Worte fielen mir wieder ein. Josef ist nicht der Einzige, um den man sich kümmern muss.
»Du brauchst mich nicht.« Ich schüttelte den Kopf. »Du hast jetzt Hans.«
Käthe versteifte sich. Ihre Lippen wurden schmal und ihre Nasenflügel bebten. »Glaubst du das wirklich?«, fragte sie tonlos. »Dann bist du sogar noch grausamer, als ich dachte.«
Grausam? Was wusste meine Schwester schon von Grausamkeit? Die Welt war wesentlich freundlicher mit ihr umgesprungen als mit mir. Ihre Aussichten waren glücklich, ihre Zukunft gesichert. Sie würde den gefragtesten Mann des Dorfes heiraten, während ich die ungewollte Schwester war, die Verschmähte. Und ich … ich hatte Josef, aber nicht mehr lange. Wenn mein kleiner Bruder fortging, dann würde er meine Kindheit mit sich nehmen: unsere Feiern im Wald, unsere Geschichten über Gnomen und Hödeken, die im Mondlicht tanzten, unsere Spiele, die Musik und die Fantasien. Wenn er fort war, würde mir nur noch die Musik bleiben – die Musik und der Koboldkönig.
»Sei dankbar für das, was du hast«, fauchte ich. »Jugend, Schönheit und, schon sehr bald, einen Ehemann, der dich glücklich machen wird.«
»Glücklich?« Ihre Augen blitzten. »Glaubst du wirklich, Hans könnte mich glücklich machen? Der stumpfsinnige, langweilige Hans, der nicht über die Grenzen dieses dummen, provinziellen Dorfes, in dem er aufgewachsen ist, hinausdenken kann? Der schwerfällige, verlässliche Hans, der mich mit einer Heiratsurkunde in der Hand und einem Baby auf dem Schoß im Gasthaus festhalten wird?«
Ich war zutiefst erschrocken. Hans war ein alter Freund der Familie, und obwohl Käthe und er sich als Kinder nicht nahegestanden hatten – wie Hans und ich –, war mir bis zu diesem Augenblick nicht klar gewesen, wie wenig sie ihn liebte. »Käthe«, sagte ich. »Warum …«
»Warum ich dann eingewilligt habe, ihn zu heiraten? Warum ich bis jetzt nichts gesagt habe?«
Ich nickte.
»Das habe ich.« Tränen stiegen ihr in die Augen. »Immer wieder. Aber du hast nie zugehört. Als ich heute Morgen ausgesprochen habe, wie langweilig er ist, hast du mir nur erklärt, was für ein guter Mann er ist.« Sie wandte sich ab. »Du hörst kein Wort von dem, was ich sage, Liesl. Du bist zu beschäftigt damit, stattdessen Josef zuzuhören.«
Wähle weise. Schuldgefühle machten mir die Kehle eng.
»Ach, Käthe«, flüsterte ich. »Du hättest doch nein sagen können.«
»Wirklich?« Sie schnaubte. »Und Mutter und du hättet das zugelassen? Welche Wahl hatte ich denn, außer seinen Antrag anzunehmen?«
Ihre Anschuldigungen zogen mir den Boden unter den Füßen weg und machten mich mitschuldig an meinem eigenen Groll. Ich war so sicher gewesen und hatte deshalb nie infrage gestellt, dass die Welt nun einmal so war. Der gut aussehende Hans und die schöne Käthe – natürlich gehörten sie zusammen.
»Du hast wenigstens Wahlmöglichkeiten.« Es klang unsicher. »Das ist mehr, als ich jemals haben werde.«
»Wahlmöglichkeiten, ha!« Ihr Lachen klang schroff. »Tja, Liesl, du hast deine Wahl wegen Josef jedenfalls schon vor langer Zeit getroffen. Du kannst mir meine Wahl wegen Hans nicht vorwerfen.«
Den Rest des Weges zum Markt gingen wir schweigend.
Kommt und kauft, kommt und kauft!
Auf dem großen Platz im Dorf reihten sich übervolle Stände aneinander. Die Verkäufer priesen ihre Waren lautstark an. Frisches Brot! Frische Milch! Ziegenkäse! Warme Wolle, die weichste Wolle, die ihr jemals fühlen werdet! Einige von ihnen läuteten Glöckchen, andere schlugen hölzerne Klappern und wieder andere stimmten einen unsteten Rhythmus auf selbst gebauten Trommeln an, um die Käufer anzulocken. Während wir näher kamen, hellte sich Käthes Miene auf.
Ich hatte nie verstanden, warum man zum Vergnügen Geld ausgeben sollte, aber meine Schwester liebte es einzukaufen. Liebevoll strich sie über die feilgebotenen Stoffe: Seide, Samt und Satin aus England, Italien und sogar Fernost. Sie steckte die Nase in Sträuße aus getrocknetem Lavendel und Rosmarin und schloss genießerisch die Augen beim Geschmack des herben Senfs auf der Brezel, die sie sich gekauft hatte. Was für ein sinnliches Vergnügen.
Ich folgte ihr langsamer und blieb bei einem Stand mit Kränzen aus getrockneten Blumen und Bändern stehen. Vielleicht konnte ich hier etwas als Hochzeitsgeschenk für meine Schwester kaufen – oder als eine Art Entschuldigung. Käthe liebte schöne Dinge. Sie war eine richtige Genießerin. Mir fiel auf, dass die schmallippigen Matronen und engstirnigen alten Männer des Dorfes Käthe finster musterten, als hielten sie ihre Freude über diese kleinen Genüsse für anstößig oder schmutzig. Besonders ein Mann, ein großer, blasser, eleganter Herr, betrachtete sie mit einer Intensität, die mich aufgeschreckt hätte, wenn er auch nur einen Blick in meine Richtung geworfen hätte.
Kommt und kauft, kommt und kauft!
Am Rand des Marktes hatte sich eine Gruppe Obstverkäufer gesammelt, deren helle, klare Stimmen sich über den Lärm der Menge erhoben. Der musikalische Klang schwebte durch die Luft und lockte mich fast gegen meinen Willen an. Es war spät im Jahr für frische Früchte, und mir fielen die ungewöhnlichen Farben und Formen ihrer dargebotenen Waren auf: rund, köstlich und verführerisch.
»Oooh, Liesl!« Käthe deutete auf die Händler. Unser Streit war vergessen. »Pfirsiche!«
Die Obstverkäufer winkten uns mit fließenden Bewegungen heran und streckten uns ihre Gaben entgegen. Der verlockende Duft der reifen Früchte wehte heran. Mir lief das Wasser im Mund zusammen, aber ich wandte mich ab und zog Käthe mit mir. Ich hatte kein Geld zu verschwenden.
Vor ein paar Wochen hatte ich einige von Josefs Geigenbögen zu einem Bogenmacher geschickt, damit sie für das Vorspielen bei Meister Antonius repariert und neu bespannt wurden. Ich hatte gehortet, geknausert und gespart, was ich konnte, denn solche Arbeiten waren kostspielig.
Doch die Händler hatten uns und unsere sehnsüchtigen Blicke bemerkt. »Kommt, schöne Damen!«, sangen sie. »Kommt, süße Mädchen. Kommt und kauft, kommt und kauft!« Einer von ihnen klopfte einen Rhythmus auf die Holzplanken, die ihm als Tisch dienten. Andere nahmen die Melodie auf. »Pflaumen und Aprikosen, Pfirsiche und Brombeeren, kommt und kostet sie!«
Ohne nachzudenken, fiel ich in ihren Gesang ein. Ein wortloses Ooh-ooh, das nach einer Harmonie und einem Kontrapunkt in ihrer Musik suchte. Terzen, Quinten und verminderte Septimen. Leise spielte ich mit den Akkorden. Gemeinsam woben die Obsthändler und ich ein schimmerndes Netz aus Klängen, eindringlich, fremdartig und ein bisschen wild.
Plötzlich sahen die Händler mich an, ihre Gesichtszüge wurden schärfer, ihr Grinsen breiter. Eine Gänsehaut überkam mich und rasch ließ ich die Melodie fallen. Ihre Blicke strichen über meine Haut, und ich spürte, dass hinter mir noch jemand stand und mich betrachtete. Ich spürte es so deutlich, als streichelte mir jemand über den Nacken. Rasch sah ich mich um.
Der große, blasse, elegante Fremde.
Seine Züge wurden von einer Kapuze verborgen, doch die Kleider unter seinem Mantel waren fein. Mein Blick erhaschte das Glänzen von Gold- und Silberfäden auf grünem Samtbrokat. Als er meinen neugierigen Blick bemerkte, regte sich der Fremde und zog den Mantel enger um sich, doch nicht bevor ich seine rehbraune Lederhose gesehen hatte, die sich um seine schlanke Hüfte schmiegte. Rasch wandte ich das Gesicht ab, und die Röte und Hitze, die mir in die Wangen stieg, schien die Luft um mich zu erwärmen. Irgendwie kam er mir bekannt vor.
»Bravo, bravo!«, riefen die Obsthändler, nachdem sie ihr Lied beendet hatten. »Kluges Mädchen in Rot, komm, und hol dir deine Belohnung!«
Mit langen, schlanken Fingern strichen sie über die Früchte vor ihnen. Ganz kurz schien es, als hätten ihre Hände zu viele Gelenke, und ich verspürte den Hauch von etwas Unheimlichem. Doch schon war dieser Moment vergangen und einer der Händler griff nach einem Pfirsich und hielt ihn mir in der offenen Hand hin.
Der Duft der Frucht hing schwer in der kühlen Herbstluft, aber unter dem süßlichen Geruch lag noch etwas anderes, ein Anflug von etwas Fauligem, Verwesenden. Ich zuckte zurück und plötzlich kamen mir die Obsthändler verändert vor. Ihre Haut hatte eine grünliche Färbung angenommen, die Zähne liefen spitz zu und anstelle der Fingernägel besaßen sie Klauen.
Hüte dich vor den Kobolden und vor den Waren, die sie feilbieten.
Käthe streckte beide Hände nach dem Pfirsich aus. »Oh ja, bitte!«
Ich packte das Schultertuch meiner Schwester und riss sie zurück.
»Die Jungfrau weiß, was sie will«, sagte einer der Händler. Er lächelte Käthe an, doch es wurde zu einem anzüglichen Grinsen. Seine Lippen schienen sich etwas zu weit zu dehnen und seine gelben Zähne wirkten scharf. »Voller Leidenschaft, voller Sehnsucht. Leicht verbraucht, leicht gesättigt.«
Verängstigt wandte ich mich Käthe zu. »Lass uns gehen. Wir sollten nicht trödeln. Wir müssen noch zu Herrn Kassl, bevor wir wieder nach Hause können.«
Ihr Blick verharrte auf den vor ihr ausgebreiteten Früchten. Sie wirkte krank, ihre Stirn war gefurcht, ihre Brust hob sich unter schweren Atemzügen, ihre Wangen waren gerötet und ihre Augen glänzten. Sie erschien fiebrig oder … begeistert. Das Gefühl, dass hier irgendetwas ganz und gar nicht stimmte, senkte sich auf mich herab. Das hier war falsch und ich hatte Angst, doch gleichzeitig spürte ich, wie ein Funke ihrer Begeisterung auch mich ergriff.
»Lass uns gehen«, wiederholte ich. Ihr Blick wirkte stumpf und glasig. »Anna Katharina Magdalena Ingeborg Vogler!«, fauchte ich. »Wir gehen.«
»Dann vielleicht ein anderes Mal, Schätzchen«, feixte der Obsthändler. Schützend legte ich meiner Schwester einen Arm um die Schultern und drückte sie an mich. »Sie kommt zurück«, sagte er. »Mädchen wie sie können einer Verlockung nie lange widerstehen. Beide sind … bereit, gepflückt zu werden.«
Ich ging fort und schob Käthe vor mir her. Aus dem Augenwinkel erhaschte ich wieder einen Blick auf den großen, eleganten Fremden. Ich spürte, dass er uns unter der Kapuze hervor beobachtete. Wie er uns musterte. Überlegte. Abwog. Einer der Obsthändler zupfte den Fremden am Mantel und der Mann beugte den Kopf, um ihm zu lauschen, doch noch immer ruhte sein Blick auf uns. Auf mir.
»Hüte dich.«
Wie angewurzelt blieb ich stehen. Vor uns stand ein weiterer Obsthändler, ein kleiner Mann mit krausem Haar wie Distelwolle und einem verkniffenen Gesicht. Er war nicht größer als ein Kind, doch seine Züge wirkten alt. Noch älter als Constanzes. Sogar älter als der Wald.
»Die da.« Er deutete auf Käthe, deren Kopf auf meine Schulter gesunken war. »Sie brennt wie Zunder. Ein Blitz, aber keine echte Wärme. Jedoch Ihr, Herrin, Ihr glüht. Eine glimmende Hitze, die nur darauf wartet, dass jemandes Atem sie entfacht. Wie sonderbar.« Ein Grinsen breitete sich auf seinem Gesicht aus. »In der Tat, sehr sonderbar.«
Dann verschwand der Händler. Ich blinzelte, doch er war fort, und ich fragte mich, ob ich mir diese Begegnung vielleicht nur eingebildet hatte. Ich schüttelte den Kopf, umfasste Käthes Arm noch fester und marschierte in Richtung von Herrn Kassls Laden, entschlossen, diese merkwürdigen Kobolde und ihre Früchte zu vergessen. So verführerisch, so süß und so unerreichbar.
Ich streckte Käthe eine kleine Geldbörse hin. »Geh und such Johannes den Brauer. Sag ihm …«
»Ich weiß, was ich zu tun habe, Liesl«, fauchte sie und schnappte sich den Geldbeutel aus meiner Hand. »Ich bin nicht völlig hilflos.«
Mit diesen Worten stolzierte sie davon und verschwand im Gewirr der Menge.
Besorgt wandte ich mich ab und suchte mir meinen Weg zu Herrn Kassls Laden. In unserem kleinen Dorf gab es keinen Bogenmacher und auch keinen Geigenbauer, aber Herr Kassl kannte die besten Handwerker in München. Während seiner langen Bekanntschaft mit unserer Familie waren viele kostbare Instrumente durch seine Hände gewandert, und er hatte es sich zur Angewohnheit gemacht, Kontakt zu jenen Leuten zu halten, die mit diesem Handelszweig zu tun hatten. Er war ein alter Freund von Papa, insofern ein Pfandleiher denn ein Freund sein konnte.
Sobald ich mein Geschäft bei Herrn Kassl abgewickelt hatte, machte ich mich wieder auf die Suche nach meiner Schwester. Selbst in dem Meer aus Gesichtern auf dem Marktplatz war sie leicht auszumachen. Ihr Lächeln war das strahlendste, ihre blauen Augen waren die hellsten, ihre Wangen die rosigsten. Ihr Haar unter diesem lächerlichen Hut schimmerte wie das Goldgefieder eines Vogels. Ich musste nichts weiter tun, als dem Weg zu folgen, den mir sämtliche Augenpaare des Dorfes wiesen. Bewundernde und anerkennende Blicke, die mich direkt zu meiner Schwester führten.
Kurz sah ich ihr zu, wie sie mit den Verkäufern handelte und feilschte. Käthe war wie eine Schauspielerin auf der Bühne, ganz übersteigert und leidenschaftlich. Ihre Gesten wirkten gekünstelt, ihr Lächeln war berechnend. Sie flirtete hemmungslos und achtete sorgsam darauf, die Blicke nicht zu beachten, die sie anzog wie das Licht die Motten. Sowohl Männer als auch Frauen musterten die Linien ihres Körpers, ihre runden Wangen und vollen Lippen.
Wenn man Käthe ansah, konnte man schwerlich vergessen, wie sündig unsere Körper und wie anfällig wir für Verruchtheit waren. Sondern der Mensch ist zur Mühsal geboren, wie Feuerfunken, die hochfliegen. So oder so ähnlich hatte es Hiob ausgedrückt. Alles an Käthe strahlte Sinnlichkeit aus: Der Stoff schmiegte sich so eng um ihren Körper, dass man jede Wölbung wahrnahm, jedes genüssliche Luftholen.
Erschrocken begriff ich, dass ich da eine Frau vor mir sah – kein Kind mehr. Käthe wusste, welche Macht ihr Körper hatte, und dieses Wissen stand nun an Stelle ihrer Unschuld. Meine Schwester hatte die Schwelle zum Frausein ohne mich überschritten, und ich fühlte mich verlassen. Betrogen. Ich sah zu, wie ein junger Mann um sie herumscharwenzelte, während sie die Waren an seinem Stand begutachtete. Eifersucht schnürte mir die Luft ab.
Was hätte ich nicht dafür gegeben, selbst auch einmal begehrt zu werden, und sei es nur für einen Augenblick. Was hätte ich nicht für das süße und berauschende Gefühl gegeben, gewollt zu werden. Ich wollte. Ich wollte das, was für Käthe so selbstverständlich war. Ich wollte diese verruchte Sinnlichkeit.
»Kann ich die junge Dame in Rot für ein paar kleine Merkwürdigkeiten interessieren?«
So plötzlich aus meinen Gedanken gerissen, starrte ich den großen, eleganten Fremden vor mir einfach nur an.
»Nein, danke, mein Herr.« Ich schüttelte den Kopf. »Ich habe kein Geld übrig.«
Der Fremde trat näher. In seiner behandschuhten Hand hielt er eine Flöte, die mit schönen Schnitzereien verziert und glänzend poliert war. Aus dieser Nähe konnte ich das Schimmern seiner Augen unter der Kapuze erkennen.
»Nein? Nun, wenn Ihr meine Waren nicht kaufen wollt, würdet Ihr sie dann als Geschenk annehmen?«
»Als … als Geschenk?« Unter seinem prüfenden Blick wurde mir heiß und ich fühlte mich unwohl. Er sah mich an wie noch niemand zuvor, so, als wäre ich mehr als nur die Summe meiner Augen, meiner Nase, meiner Lippen, meines Haars und meiner verfluchten Unscheinbarkeit. Er betrachtete mich, als sähe er das ganze Bild, als kenne er mich. Aber ich kannte ihn nicht, oder doch? Seine Gegenwart kitzelte meine Gedanken wie ein halb vergessenes Lied. »Weshalb?«
»Brauche ich denn einen Grund?« Seine Stimme war weder tief noch hoch, doch sie klang dunkel und trocken. »Vielleicht möchte ich nur den Tag einer jungen Dame ein wenig aufhellen. Immerhin werden die Nächte länger und kälter.«
»Oh nein, mein Herr«, sagte ich noch einmal. »Meine Großmutter hat mich vor den Wölfen gewarnt, die durch die Wälder streifen.«
Der Fremde lachte und ich erhaschte einen Blick auf scharfe, weiße Zähne. Ich zitterte.
»Eure Großmutter ist eine weise Frau«, antwortete er. »Sicherlich hat sie Euch auch vor den Kobolden gewarnt. Oder vielleicht hat sie Euch sogar erzählt, dass beides ein und dasselbe ist.«
Ich erwiderte nichts.
»Ihr seid klug. Ich biete Euch dieses Geschenk nicht aus reiner Herzensgüte an, sondern aus dem selbstsüchtigen Verlangen heraus, zu sehen, was Ihr damit tut.«
»Wie meint Ihr das?«
»Da ist Musik in Eurer Seele. Eine wilde, ungezähmte Musik, die von mir erzählt. Sie trotzt allen Regeln und Gesetzen, die ihr Menschen ihr auferlegt. Sie wächst aus Eurem Innern heraus und ich möchte diese Musik befreien.«
Er musste gehört haben, wie ich mit den Obsthändlern gesungen hatte. Eine wilde, ungezähmte Musik. Diese Worte hatte ich schon einmal gehört. Von Papa. Damals waren sie mir wie eine Beleidigung erschienen. Meine musikalische Erziehung war bestenfalls rudimentär. Papa hatte seine Zeit und Sorgfalt vor allem Josef gewidmet. Er hatte dafür gesorgt, dass mein Bruder Theorie und Geschichte der Musik kannte, dass er sich auf ihre Bausteine und ihr Gerüst verstand. Ich hatte diese Unterrichtsstunden am Rande mitverfolgt, aufgeschrieben, was immer ich konnte, und diesen unvollständigen Einblick auf meine Kompositionen angewandt.
Aber dieser elegante Fremde verurteilte meinen Mangel an Struktur nicht, meine fehlende Bildung. Ich nahm seine Worte und pflanzte sie tief in meine Seele.
»Für Euch, Elisabeth.« Wieder bot er mir die Flöte an. Dieses Mal nahm ich sie. Trotz der kalten Luft war das Instrument warm und fühlte sich unter meinen Fingern fast menschlich an.
Erst nachdem der Fremde verschwunden war, begriff ich, dass er mich bei meinem Namen genannt hatte.
Elisabeth.
Aber woher hätte er ihn kennen sollen?
Ich hielt die Flöte in den Händen, bewunderte ihre Form, strich über die prächtige Holzmaserung und die glatte Oberfläche. In meinem Hinterkopf nagte das Gefühl an mir, etwas verloren oder vergessen zu haben, doch es blieb am äußeren Rand meiner Erinnerung, wie ein Wort, das einem auf der Zunge lag.
Käthe.
Ein plötzlicher Stich der Angst durchdrang meine trägen Gedanken. Wo war Käthe? Im Tumult war keine Spur ihres albernen Hutes zu sehen, und ihr klingendes Lachen drang nicht an meine Ohren. Tiefe Furcht packte mich, begleitet von dem beunruhigenden Gefühl, hereingelegt worden zu sein.
Warum hatte mir der große, elegante Fremde ein Geschenk gemacht? War es wirklich aus selbstsüchtiger Neugierde meinetwegen geschehen? Oder hatte er mich nur ablenken wollen, während mir die Kobolde meine Schwester stahlen?
Ich steckte die Flöte in meine Tasche, raffte die Röcke und achtete dabei weder auf die empörten Blicke der Umstandskrämer des Dorfes noch auf die johlenden Rufe der Taugenichtse. Voll blinder Panik rannte ich über den Marktplatz und rief nach meiner Schwester.
Vernunft rang mit Glauben. Ich war zu alt, um noch an die Geschichten meiner Kindheit zu glauben, aber ich konnte die merkwürdige Begegnung mit den Obsthändlern nicht leugnen. Oder mit dem großen, eleganten Fremden.
Sie waren Kobolde.
Es gab keine Kobolde.
Kommt und kauft, kommt und kauft!
Die geisterhaften Stimmen der Händler schwebten schwach und dünn im Wind, mehr Erinnerung als Klang. Ich folgte diesem Gespinst von Musik, doch ich nahm die Melodie nicht mit meinen Ohren wahr, sondern mit einem anderen, unsichtbaren und unbeachteten Teil meiner selbst. Die Musik drang an mein Herz und zupfte daran, zog mich zu sich, als wäre ich eine Marionette.
Ich wusste, wohin meine Schwester gegangen war. Grauen erfasste mich, begleitet von dem Gefühl, dass etwas Schlimmes geschehen würde, wenn ich sie nicht rechtzeitig erreichte. Ich hatte versprochen, sie zu beschützen.
Kommt und kauft, kommt und kauft!
Die Stimmen waren nun leiser, ferner und hohl. Sie verklangen in der Stille wie ein Geisterflüstern. Als ich den Rand des Marktes erreichte, waren die Obsthändler fort. Keine Stände, keine Tische, keine Zelte, keine Früchte, keine Spur von ihnen. Nur Käthes einsame Gestalt im Nebel. Ihr hauchdünnes Kleid umwehte sie und sie sah aus wie eine der Weißen Frauen von Frau Perchta. Wie eine Figur aus Großmutters Märchen. Vielleicht war ich noch rechtzeitig gekommen. Vielleicht gab es nichts zu fürchten.
»Käthe!«, schluchzte ich und rannte zu ihr, um sie zu umarmen.
Sie drehte sich um. Ihre Lippen glänzten – rot, klebrig und süß. Ihr Mund war geschwollen, als hätte sie jemand ausgiebig geküsst.
In ihren Händen lag ein halb gegessener Pfirsich. Der Saft rann ihr über die Finger wie Blut.
Auf dem Heimweg sprach Käthe nicht mit mir. Ich war selbst finsterer Stimmung: Der Ärger über meine Schwester, die verstörende Begegnung mit den Obsthändlern, das bebende Verlangen, das der große, elegante Fremde in mir wachgerufen hatte – all das verband sich zu einem Strudel der Verwirrung. Meine Erinnerungen an den Markt waren wie in Nebel gehüllt, und ich konnte nicht mit Sicherheit sagen, dass nicht alles nur ein Traum gewesen war.
Doch geschützt in meiner Tasche ruhte das Geschenk des Fremden. Die Flöte schlug bei jedem Schritt gegen mein Bein, so echt wie Josefs Bögen in meiner Hand. Ich fragte mich, warum der Fremde sie mir geschenkt hatte. Ich war bestenfalls eine mittelmäßige Flötistin. Die dünnen, körperlosen Töne, die ich auf diesem Instrument hervorbrachte, waren eher merkwürdig als süß. Ich fragte mich, wie ich meiner Mutter erklären sollte, woher ich die Flöte hatte. Ich fragte mich, wie ich es mir selbst erklären sollte.
»Liesl.«
Zu meiner Überraschung war es Josef, der uns an der Tür begrüßte. Er spähte hinter dem Türpfosten hervor und blieb unsicher auf der Schwelle stehen.
»Was ist los, Sepp?«, fragte ich sanft. Ich wusste, dass mein Bruder wegen des Vorspielens nervös war und was es ihn kosten würde, sich vor so vielen Fremden zu zeigen. Wie ich verbarg sich mein Bruder in den Schatten, aber im Gegensatz zu mir wollte er es so.
»Meister Antonius«, flüsterte er. »Er ist hier.«
»Was?« Ich ließ meine Tasche fallen. »So früh?« Wir hatten den Meister der Geige nicht vor dem Abend erwartet. Er nickte. Ein wachsamer Ausdruck erschien auf seinem Gesicht. Seine blassen Züge waren von Sorge gezeichnet. »Er hat es schnell über die Alpen geschafft. Er wollte nicht von einem frühen Schneesturm überrascht werden.«
»Da hätte er sich keine Sorgen machen müssen«, erklärte Käthe. Überrascht drehten wir uns zu ihr um. Unsere Schwester schien in die Ferne zu spähen, ihr Blick war glasig. »Der König schläft noch und wartet. Die Tage des Winters haben noch nicht begonnen.«
Mein Herz schlug schwer. »Wer schläft noch? Wer wartet?«
Doch sie schwieg und ging einfach an Josef vorbei in das Gasthaus.
Mein Bruder und ich tauschten einen Blick. »Geht es ihr gut?«, fragte er.
Ich biss mir auf die Lippe und sah wieder die Saftflecken der Koboldfrucht vor mir, die ihren Mund und ihr Kinn bedeckt hatten wie Blut. Dann schüttelte ich den Kopf. »Alles in Ordnung. Wo ist Meister Antonius jetzt?«
»Oben. Er hat sich kurz hingelegt. Mutter hat uns ermahnt, ihn nicht zu stören.«
»Und Papa?«
Er wich meinem Blick aus. »Ich weiß es nicht.«
Ich schloss die Augen. Warum musste Papa ausgerechnet jetzt verschwinden? Der alte Violinenmeister und mein Vater waren am Hof des Fürstbischofs Freunde gewesen. Beide Männer hatten diese Zeit hinter sich gelassen, doch der eine hatte seither eine weitere Reise zurückgelegt als der andere. Einer kehrte gerade von einem langen Aufenthalt am Hof des österreichischen Kaisers zurück, während der andere Abend für Abend Trost am Grund eines Bierfasses suchte.
»Tja.« Ich öffnete die Augen und zwang mich zu einem Lächeln. Dann reichte ich Josef seine frisch reparierten Bögen und legte ihm einen Arm um die Schultern. »Dann machen wir uns mal bereit für die Vorstellung, einverstanden?«
In der Küche herrschte rege Geschäftigkeit. Es wurde gebacken, gekocht und gebraten. »Gut, dass du wieder da bist«, sagte Mutter knapp. Sie nickte zu einer Schale auf der Arbeitsfläche hinüber. »Du kannst gleich anfangen, die Würste abzutrennen.« Sie stand vor einem großen Bottich mit siedendem Wasser und rührte eine Portion Würste.
Ich band mir eine Schürze um und machte mich daran, den gefüllten Wurstdarm abzumessen und in einzelne Würste zu unterteilen. Käthe war nirgends zu sehen gewesen, also hatte ich Josef losgeschickt, um sie zu suchen.
»Hast du deinen Vater gesehen?«, fragte Mutter.
Ich wagte nicht, ihr ins Gesicht zu sehen. Mutter war eine außergewöhnlich liebliche Frau. Ihre Gestalt war noch immer schlank und jugendlich, ihr Haar noch immer strahlend hell, ihre Haut leuchtend. Im Zwielicht des Morgen- oder Abendrots oder im goldenen Kerzenschein sah man, warum sie in ganz Salzburg gerühmt worden war. Nicht nur wegen ihrer wundervollen Stimme, sondern auch wegen ihrer Schönheit. Doch die Zeit hatte Falten um die Winkel ihres vollen Mundes und zwischen ihre Brauen gegraben. Die Zeit, harte Arbeit und Papa.
»Liesl.«
Ich schüttelte den Kopf.
Sie stieß ein Seufzen aus, in dem so vieles lag: Ärger, Frustration, Hoffnungslosigkeit, Resignation. Mutter besaß noch immer die Gabe, jeder Schattierung ihrer Gefühle einzig und allein durch ihre Stimme Ausdruck zu verleihen.
»Tja«, sagte sie. »Dann lass uns beten, dass Meister Antonius seine Abwesenheit nicht als Beleidigung empfindet.«
»Ich bin sicher, dass Papa rechtzeitig wieder hier sein wird.« Um die Lüge zu verbergen, griff ich nach einem Messer. Abschneiden, eindrehen, verknoten. Abschneiden, eindrehen, verknoten. »Wir müssen Vertrauen haben.«
»Vertrauen.« Mutter lachte, aber es klang bitter. »Von Vertrauen allein kann man nicht leben, Liesl. Damit kann man keine Familie ernähren.«
Abschneiden, eindrehen, verknoten. »Du weißt doch, wie charmant Papa sein kann«, sagte ich. »Er könnte die Bäume dazu bringen, im Winter Früchte zu tragen. Man verzeiht ihm einfach jeden Fehltritt.«
»Ja, ich weiß ganz zweifellos, wie charmant dein Vater sein kann«, erwiderte meine Mutter trocken.
Ich wurde rot. Nur fünf Monate nachdem sich meine Eltern das Jawort gegeben hatten, war ich zur Welt gekommen.
»Charme ist gut und schön«, fuhr sie fort, holte die Würste aus dem Bottich und legte sie auf ein Küchentuch. »Aber sein Charme allein deckt keinen Tisch. Sein Charme geht abends mit seinen Freunden aus, anstatt seinen Sohn persönlich all den großen Meistern vorzustellen.«
Ich antwortete nicht. Früher war es einmal der Traum unserer Familie gewesen, Josef in die Großstädte dieser Welt zu bringen, damit er sein Talent besser entfalten und einem besser betuchten Publikum präsentieren konnte. Aber wir hatten es nie getan, und nun, mit vierzehn, war mein Bruder zu alt, um noch als Wunderkind angepriesen zu werden wie Mozart oder Linley damals. Zugleich war er jedoch noch zu jung für eine Daueranstellung als Berufsmusiker. Trotz seiner Fähigkeiten lagen noch viele Jahre vor ihm, in denen er lernen und seine Kunst vervollkommnen musste. Wenn Meister Antonius ihn nicht als Schüler annahm, dann wäre dies das Ende von Josefs Karriere.
Es ging also um viel bei diesem Vorspielen, nicht nur für Josef, sondern für uns alle. Es war die Gelegenheit für meinen Bruder, über seine bescheidene Herkunft hinauszuwachsen und der Welt zu zeigen, was für ein Talent er war. Aber es war auch für meinen Vater die letzte Chance, durch seinen Sohn doch noch in den großen Häusern Europas zu spielen. Für meine Mutter war es die Gelegenheit für ihr jüngstes Kind, einem Leben, bestehend aus Schinderei und Mühsal, zu entfliehen, das die Gastwirtschaft nun einmal mit sich brachte. Und für Käthe ging es um die Möglichkeit, ihren berühmten Bruder in sämtlichen großen Städten zu besuchen: Mannheim, München, Wien und vielleicht sogar London, Paris oder Rom.
Für mich … für mich war es der Weg, wie meine Musik auch an andere Ohren dringen könnte als nur an Josefs und meine. Käthe mochte zwar meine geheimen Notizen in dem Kästchen unter unserem Bett gesehen haben, doch bisher hatte einzig und allein Josef gehört, was sie bedeuteten.
»Hans!«, rief Mutter plötzlich. »Ich hatte nicht erwartet, dich schon so früh hier zu sehen.«
Mir rutschte das Messer ab und leise fluchend steckte ich den blutenden Finger in den Mund.
»Ich würde Josefs großen Tag doch nicht verpassen, Frau Vogler«, antwortete Hans. »Ich wollte fragen, ob ich helfen kann.«
»Gott segne dich, Hans«, sagte Mutter voller Zuneigung. »Dich schickt der Himmel.«
Ich riss einen Stoffstreifen von meiner Schürze ab, wickelte ihn um meinen Finger und arbeitete weiter, wobei ich mein Bestes gab, möglichst unauffällig zu bleiben. Er ist der Verlobte deiner Schwester, rief ich mir in Erinnerung. Trotzdem konnte ich nicht anders, als ihm unter gesenkten Lidern hervor heimliche Blicke zuzuwerfen.
Als er einen davon auffing, wich alle Wärme aus dem Raum. Er räusperte sich. »Guten Morgen, Fräulein«, sagte er.
Seine sorgsam gewahrte Distanz schmerzte mehr als der Schnitt an meinem Finger. Wir waren einmal so vertraut miteinander gewesen. Damals waren wir Hans und Liesl gewesen. Damals waren wir Freunde gewesen oder vielleicht sogar mehr. Doch das war, bevor wir erwachsen geworden waren.
»Ach, Hans.« Ich lachte gekünstelt auf. »Wir sind doch fast schon eine Familie. Du kannst mich immer noch Liesl nennen, weißt du.«
Er nickte steif. »Schön, dich zu sehen, Elisabeth.«
Elisabeth. Näher würden wir einander wohl nie wieder stehen. Ich zwang mich zu einem Lächeln. »Wie geht es dir?«
»Mir geht es gut, danke.« Vorsicht lag in seinen braunen Augen. »Und dir?«
»Bestens. Ein bisschen nervös. Wegen dem Vorspielen, meine ich.«
Hans’ Miene wurde weicher. Er trat näher, nahm sich ebenfalls ein Messer und half mir bei der Arbeit mit den Würsten. »Du musst dir keine Sorgen machen«, versicherte er mir. »Josef spielt wie ein Engel.«
Er lächelte und das Eis zwischen uns begann zu schmelzen. Wir fanden in den Rhythmus der Arbeit – abschneiden, eindrehen, verknoten, abschneiden, eindrehen, verknoten –, und für den Augenblick konnte ich so tun, als wäre alles wieder so wie früher. Papa hatte uns gemeinsam Klavier- und Geigenunterricht erteilt. Wir hatten auf derselben Bank gesessen und dieselben Tonleitern gelernt. Obwohl Hans nie weit über die Grundkenntnisse hinausgekommen war, hatten wir Stunden gemeinsam am Klavier verbracht, Schulter an Schulter. Doch unsere Hände hatten sich niemals berührt.
»Wo ist Josef überhaupt?«, fragte er. »Spielt er wieder draußen im Koboldhain?«
Wie wir alle hatte Hans früher zu Constanzes Füßen gesessen und ihren Geschichten über Gnomen und Hödeken gelauscht. Über Kobolde, die Lorelei und den Erlkönig, den Herrn des Unheils. Wärme wie von glühenden Kohlen breitete sich zwischen uns aus.
»Vielleicht«, sagte ich leise. »Es ist die letzte Nacht des Jahres.«
Er schnaubte. »Ist er nicht langsam zu alt, um noch Feen und Kobolde zu spielen?«
Seine Verachtung war wie ein Schwall kaltes Wasser, der alles, was von unserer gemeinsamen Kindheit noch übrig war, wegspülte.
»Liesl, kannst du auf den Bottich aufpassen?«, fragte Mutter und wischte sich über die Stirn. »Die Brauer müssten jeden Augenblick kommen.«
»Das übernehme ich, Frau Vogler«, bot Hans an.
»Danke, mein Lieber«, antwortete sie. Sie überreichte ihm den Holzlöffel und verließ die Küche, wobei sie sich die Hände an der Schürze abwischte. Wir waren allein.
Wir sprachen nicht.
»Elisabeth«, begann er schließlich zaghaft.
Abschneiden, eindrehen, verknoten. Abschneiden, eindrehen, verknoten.
»Liesl.«
Meine Hände hielten kurz inne, dann nahm ich die Arbeit wieder auf. »Ja, Hans?«
»Ich …« Er räusperte sich. »Ich hatte gehofft, dich allein zu treffen.«