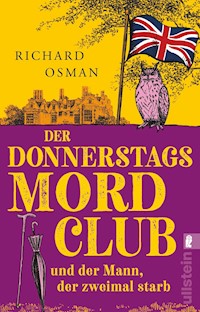14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Primetime-Crime aus dem Mutterland des Kriminalromans. Father-in-law, daughter-in-crime: Die Wheelers mischen das internationale Verbrechen auf und gehen auf die abenteuerlichste Verbrecherjagd seit James Bond. Very british, very funny, very good, indeed. Wer anderer Leute Leben schützt, ist selbst schnell tot. Amy Wheeler ist es als Bodyguard gewohnt, ihr Leben zu riskieren. Aber dass sie selbst ins Visier gerät, ist auch für Amy neu. Zumal sie nicht weiß, warum da plötzlich jemand wie verrückt auf sie schießt, während sie in South Carolina auf eine unfassbar reiche und erfolgreiche Thrillerautorin aufpasst. Ob es mit den Morden an Influencern zusammenhängt, die allesamt von ihrer Agentur betreut wurden? Schwiegertochter und Schwiegervater ermitteln gemeinsam. Ob das gutgeht? Zu Hause in England genießt ihr Schwiegervater, der Ex-Kriminalkommissar Steve Wheeler, derweil die Freuden der Pensionierung: ein Pub, ein Pint, ein Quiz – und die Ruhe des Waldes. Mit der jedoch ist's vorbei, als seine Schwiegertochter anruft und ihn zu sich zitiert. Um mit ihm die Morde aufzuklären. Und so die Hintermänner zu finden, die ihr nach dem Leben trachten. Für alle, die cosy im Sessel sitzen und trotzdem um die halbe Welt jetten wollen. Richard Osman, Autor der Erfolgsserie rund um den Donnerstagsmordclub, ist zurück mit einer neuen Serie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Wir finden Mörder
Richard Osman ist Autor, Produzent und Fernsehmoderator. Seine sämtliche Rekorde brechende Serie über die vier scharfsinnigen und liebenswerten Ermittlerinnen und Ermittler des Donnerstagsmordclubs hat ihn über Nacht zum Aushängeschild des britischen Krimis und Humors gemacht. Mit Wir finden Mörder betritt er neues Terrain, bleibt dabei aber ganz der Alte. Er lebt mit Frau und Katze in London.
Seit die erfolgreiche Thrillerautorin Rosie D’Antonio es sich mit einem Oligarchen verscherzt hat, lebt sie gefährlich. So kommt Amy Wheeler, Bodyguard bei Maximal Impact Solutions und für den Schutz der Autorin zuständig, auf eine kleine, private Insel vor der amerikanischen Küste. Zur selben Zeit, nur wenige Meilen entfernt, wird ein Influencer sehr medienwirksam auf einem Boot ermordet. Was bereits der dritte Mord in einer Reihe von Morden ist, bei dem Amy das Pech hatte, in der Nähe zu sein. Da will ihr offensichtlich jemand etwas anhängen. Auf der anderen Seite des Atlantiks wird Amys Schwiegervater Steve Wheeler auf den Fall aufmerksam. Wider Willen muss man beinahe sagen, denn der pensionierte Ermittler will eigentlich nichts mehr mit dem großen Verbrechen zu tun haben. Seine kleine Detektei in dem kleinen Örtchen, in das er sich zurückgezogen hat, ist ihm genug. Spaziergänge im New Forest, ab und an ein Bierchen und einen Shepard’s Pie im Pub, das ist es, was er sich von seinem Lebensabend erwartet. Aber sicher nicht diesen halsbrecherischen Wettlauf um den halben Globus, in den ihn seine Schwiegertochter mit hineinzieht, nachdem auf sie geschossen wurde.
Richard Osman
Wir finden Mörder
Sie haben den Fall. Wir haben die Lösung.
Aus dem Englischen von Sabine Roth
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein.de
Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel We Solve Murders bei Viking, PRH UK
© 2024 by Richard Osman© der deutschsprachigen Ausgabe 2024 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinAlle Rechte vorbehaltenWir behalten uns die Nutzung unserer Inhalte für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG ausdrücklich vor.Covergestaltung: Sabine Kwauka nach einer Vorlage von Richard BraveryAutorenfoto: © Conor O'LearyE-Book powerded by pepyrusISBN 978-3-8437-3286-4
Emojis werden bereitgestellt von openmoji.org unter der Lizenz CC BY-SA 4.0.
Auf einigen Lesegeräten erzeugt das Öffnen dieses E-Books in der aktuellen Formatversion EPUB3 einen Warnhinweis, der auf ein nicht unterstütztes Dateiformat hinweist und vor Darstellungs- und Systemfehlern warnt. Das Öffnen dieses E-Books stellt demgegenüber auf sämtlichen Lesegeräten keine Gefahr dar und ist unbedenklich. Bitte ignorieren Sie etwaige Warnhinweise und wenden sich bei Fragen vertrauensvoll an unseren Verlag! Wir wünschen viel Lesevergnügen.
Hinweis zu UrheberrechtenSämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Titelei
Das Buch
Titelseite
Impressum
Prolog
ERSTER TEILVom New Forest nach South Carolina
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ZWEITER TEILVon South Carolina nach Dubai(über St Lucia und Cork, Irland, mit einem kurzen Zwischenstopp im New Forest)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
DRITTER TEILVon Dubai zu einer kleinen Bank an einem stillen Teich
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
Danksagung
Anhang
Social Media
Vorablesen.de
Cover
Titelseite
Inhalt
Prolog
Keine Spur darf zu ihm führen. Das ist das oberste Gebot.
Ganz ohne Kommunikation geht es nicht. Anweisungen müssen erteilt, Lieferungen müssen organisiert, Leute umgebracht werden und und und. Der Mensch lebt nun mal nicht in einem Vakuum.
Jemand muss François Loubet telefonisch sprechen? In einem absoluten Notfall? Dann gerät er an ein Telefon mit integriertem Stimmverzerrer. Sollte sich der Notfall übrigens als doch nicht so absolut erweisen, wird es dem Anrufer sehr bald leidtun.
Aber das meiste läuft über Textnachricht oder E-Mail. In der Hinsicht unterscheiden sich High-End-Kriminelle nicht groß von Millennials.
Alle Nachrichten sind selbstredend verschlüsselt. Aber was ist, wenn die Behörden den Code knacken? Zu viele erstklassige Verbrecher sitzen hinter Gittern, nur weil einem Nerd mit einem Laptop langweilig war. Darum muss man sich absichern, so gut es geht.
Man kann seine IP-Adresse verschleiern – nichts leichter als das. Die E-Mails von François Loubet haben eine halbe Weltreise hinter sich, bevor sie schließlich verschickt werden. Selbst ein Nerd mit einem Laptop käme niemals dahinter, wo der wahre Absender sitzt.
Aber jedermanns Sprache hat ihre unverwechselbare Kennung. Ihren charakteristischen Wortgebrauch, ihren Rhythmus, ihre Persönlichkeit. Jemand könnte eine deiner Mails mit einer Postkarte von dir aus dem Jahr 2009 abgleichen und unwiderlegbar nachweisen, dass der Verfasser derselbe ist. Wissenschaft eben – so oft der Feind des ehrbaren Kriminellen.
Deshalb ist ChatGPT so ein Segen.
Du schreibst eine E-Mail, eine Textnachricht, egal was, und jagst sie einfach durch ChatGPT, dann ist deine Persönlichkeit im Nu ausgelöscht. ChatGPT macht sie platt, glättet alle Ecken und Kanten, spült sie weg, Eigenheit für Eigenheit, bis nichts mehr von dir übrig ist.
»ChatGPT, formuliere diese Mail bitte neu im Stil eines freundlichen englischen Gentlemans.« Das ist immer Loubets Prompt.
Praktisch, denn wären diese Nachrichten in François Loubets eigener Sprache geschrieben, dann wäre der Bezug gleich viel klarer. Zu klar.
So dagegen könnte man tausend E-Mails auswerten und hätte immer noch keine Ahnung, wo François Loubet sitzt, und erst recht keine Ahnung, wer François Loubet ist.
Was François Loubet macht, wüsste man natürlich trotzdem, aber es gäbe verdammt wenig, was man dagegen tun könnte.
ERSTER TEILVom New Forest nach South Carolina
1
Er hat den Durchbruch geschafft, endlich.
Andrew Fairbanks hat immer gewusst, dass er eines Tages berühmt sein wird. Und nun ist dieser Tag, ein ruhiger, sonniger Dienstag Anfang August, wirklich gekommen.
Die jahrelangen Fitness-Videos auf Insta haben ihm etliche Follower beschert, aber kein Vergleich zu dem, was jetzt abgeht. Das jetzt ist der Wahnsinn.
Eine On-off-Beziehung mit einem Pop-Sternchen gab es, die sein Bild ab und an in die Zeitungen gebracht hat. Aber nicht auf die Titelblätter wie heute.
Die Bekanntheit, nach der sich Andrew Fairbanks so lange gesehnt hat – hier ist sie nun. Sein Name weltweit in aller Munde. Der Social-Media-Hype. Dieses Selfie auf der Jacht ist viral gegangen: Andrew mit nacktem, gebräuntem Oberkörper, wie er in die Kamera lacht, um die Wette mit der Sonne über seiner Schulter, in der Hand, zu einem fröhlichen Toast erhoben, die Flasche Krusher Energy Drink.
Und die Kommentare unter dem Foto! Die Herz-Emojis, die Flammen-Emojis, die Begierde. Alles, wovon Andrew immer geträumt hat.
Einzelne Kommentare allerdings killen die Stimmung ein bisschen. »Andrew! Warum so früh?« »So fit – RIP« »Fast gruselig, dieses Bild, wenn man weiß, was als Nächstes kommt« – aber wer wäre so kleinlich, sich darüber zu beschweren. Die Klickzahlen sind überwältigend. In den Büros des Love-Island-Produktionsteams wird sein Foto herumgereicht, und man fachsimpelt darüber, wie perfekt er gepasst hätte, wenn er nur nicht, na ja …
Ja, endlich kennt jeder Andrew Fairbanks. Oder, wie es jetzt allgemein von ihm heißt, den »tragischen Instagram-Influencer Andrew Fairbanks«.
Der Glanz hat also auch seine dunkle Seite. Einmal abge-sehen davon, dass er schon zu verblassen beginnt. Mittlerweile ist es Mittwochnachmittag, und Andrews Stern sinkt bereits wieder. Neue Dramen spielen sich ab. Ein Baseballstar ist mit seinem Pick-up in den Swimmingpool seiner Ex gefahren. Eine Beauty-Vloggerin hat sich ungehörig über Taylor Swift geäußert. Das Interesse, wie die Gezeiten, wendet sich.
Andrew Fairbanks wurde tot aufgefunden: mit Kopfschuss an einem Seil festgebunden und über die Reling einer Jacht geworfen, die auf dem Atlantik schaukelte. Auf der Jacht war sonst niemand, und nichts deutete darauf hin, dass jemals jemand dort gewesen war, bis auf eine Ledertasche mit einer knappen Million Dollar darin.
Doch nichts davon sichert einem länger als einen Tag weltweite Aufmerksamkeit. Irgendwann wird es vielleicht einen Podcast über den Fall geben oder, besser noch, eine True-Crime-Doku auf Netflix, aber für den Augenblick trübt sich Andrews Rampenlicht rasant.
Schon bald wird Andrew Fairbanks nichts weiter sein als eine Gestalt auf einem Foto, die vor blauer See mit einem lila Energy Drink prostet, ein Leichnam in einer Leichenkammer in South Carolina oder ein gelegentliches: »Erinnert ihr euch an den Typen, der mit diesem ganzen Geld auf der Jacht ermordet wurde?«
Wer hat ihn getötet? Tja. Irgendjemand muss es gewesen sein, auf Social Media gibt es dazu Thesen aller Art. Warum musste er sterben? Keine Ahnung – irgendeinen Grund wird es schon geben. Eifersüchtige Ex? Ein Instagram-Fitness-Rivale? Tausend Erklärungen wären denkbar. Aber echt krass, was diese Vloggerin über Taylor Swift gesagt hat, oder?
Für diesen einen Tag jedoch: welch ein Höhenflug! Wenn Andrew noch am Leben gewesen wäre, hätte er sich nach einem Vollzeit-Agenten umgesehen, der für ihn ein paar mehr Deals klarmacht: Eiweiß-Riegel, Zahnbleaching-Praxen, oder vielleicht einen eigenen Wodka, wie wäre das?
Ja, genau vierundzwanzig Stunden lang rissen sich alle um Andrew Fairbanks. An dem freilich, nachdem die Haie mit ihm fertig waren, nicht mehr allzu viel dran war.
Showbusiness as usual.
2
»Was mögen Sie nicht an sich?«, fragt Rosie D’Antonio. Sie treibt auf einem Schwimmsessel in Form eines Thrones in einem Pool in der Form eines Schwans. »Das frage ich alle als Erstes.«
Amy Wheeler sitzt bolzengerade auf einem Liegestuhl am Beckenrand, Sonne im Gesicht, ihre Waffe in Reichweite. Nett ist das hier in South Carolina. Zumindest auf diesem verborgenen Ableger von South Carolina. Temperaturen in den Mittzwanzigern schon früh am Morgen, eine leichte Atlantikbrise und zur Abwechslung mal niemand, der sie umzubringen versucht. Sie durfte zwar schon länger auf niemanden mehr schießen, aber gut, man kann nicht alles haben.
»Meine Nase, denke ich mal«, sagt Amy.
»Was stimmt nicht mit Ihrer Nase?« Rosie lässt die freie Hand ins Wasser hängen, im Mund einen nicht recyclebaren Strohhalm, durch den sie eine giftgrüne Flüssigkeit schlürft.
»Weiß nicht«, sagt Amy. Sie staunt, wie perfekt Rosie selbst im Pool geschminkt ist. Wie alt mag sie sein? Sechzig? Achtzig? Ein Rätsel. In ihrer Akte steht bei »Alter«: Angabe verweigert. »Sie sieht einfach falsch aus, wenn ich mich anschaue. Verkehrt.«
»Operieren lassen«, urteilt Rosie. »Größer, kleiner, was immer Sie sich einbilden. Das Leben ist zu kurz, um unter seiner Nase zu leiden. Hunger und Armut sind Probleme oder kein WLAN, aber doch nicht Nasen. Was noch?«
»Meine Haare«, sagt Amy. Sie ist gefährlich nahe dran, sich zu entspannen. Spürt schon die ersten warnenden Anzeichen. Entspannung ist nichts für Amy. Zu viel Zeit zum Nachdenken. Amy ist mehr eine Macherin. »Die fallen nie so, wie sie sollen.«
»Sieht man«, sagt Rosie. »Aber das kriegen wir hin. Ich habe diese Haartechnikerin, die ich einfliegen lasse – wo kommt sie gleich her? Chile, glaube ich. Fünftausend Dollar, und Ihr Problem ist gelöst. Keine Angst, das geht auf mich.«
»Und meine Ohren sind nicht symmetrisch«, legt Amy nach.
Rosie legt den Kopf schief und paddelt ein Stück näher, um Amy genauer zu betrachten. »Seh ich nicht. Sie haben einwandfreie Ohren. Wie Goldie Hawn.«
»Ich hab sie mit dem Lineal nachgemessen«, sagt Amy, »als ich noch in der Schule war. Es ist nur ein Millimeter, aber mich stört es nun mal. Und meine Beine sind zu kurz für meinen Oberkörper.«
Rosie nickt und planscht zurück in die Poolmitte, wo die Sonne am stärksten scheint. »Dann mal andersrum, Amy: Was mögen Sie an sich?«
»Ich bin britisch«, sagt Amy. »Ich mag überhaupt nichts an mir.«
»Gähn«, sagt Rosie. »Ich war auch mal britisch, aber das lässt sich abschütteln. Los, sagen Sie was.«
»Ich glaube, dass ich loyal bin«, sagt Amy.
»Das ist eine gute Eigenschaft«, befindet Rosie. »Für eine Leibwächterin.«
»Und durch meine kurzen Beine habe ich einen niedrigen Schwerpunkt«, sagt Amy. »Dadurch kann ich sehr gut kämpfen.«
»Wenn das nichts ist.« Rosie nickt. »Loyal und sehr gut im Kämpfen.«
Sie hält ihr Gesicht in die Sonne.
»Sollte mich diese Woche wirklich jemand zu erschießen versuchen, müssten Sie dann in die Schusslinie hechten?«
»Theoretisch schon«, sagt Amy ohne rechte Überzeugung. »Aber das passiert hauptsächlich in Filmen.«
Nach Amys Erfahrung ist es nicht leicht, rechtzeitig in die Schusslinie zu hechten. Kugeln sind einfach irrsinnig schnell.
»Oder in Büchern«, sagt Rosie. »Möchten Sie einen Joint? Ich dreh mir jetzt einen.«
»Besser nicht«, sagt Amy. »Maximum Impact verordnet uns vierteljährliche Blutuntersuchungen. Firmenpolitik. Der kleinste Hinweis auf Drogen, und ich bin gefeuert.«
Rosie stößt ein einsichtiges Schnauben aus.
Das hier ist nicht der aufregendste Job, den Amy je hatte, aber die Sonne scheint, und sie mag die Klientin: Rosie D’Antonio, die weltweit meistgelesene Autorin, »wenn man Lee Child mal weglässt«, in ihrer maurischen Villa auf ihrer Privatinsel direkt vor der Küste South Carolinas. Mit eigenem Koch sogar.
Aus diversen operativen Gründen musste Amy einmal einen knappen Monat in einer aufgelassenen syrischen Ölpipeline ausharren, da ist das hier entschieden ein Aufstieg. Der Koch bringt ihr einen Teller mit Räucherlachsblinis. Er ist eigentlich gar kein Koch, sondern ein ehemaliger Navy SEAL namens Kevin, aber er lernt schnell. Sein Bœuf Bourguignon gestern Abend war zum Niederknien. Rosies richtiger Koch hat zwei Wochen Urlaub. Amy, Rosie und Kevin, der Ex-Navy SEAL, sind die einzigen Menschen auf der Insel, und so soll es fürs Erste auch bleiben.
»Niemand darf also Hand an mich legen«, resümiert Rosie. Sie hat sich an den Beckenrand gepaddelt und dreht sich eine Zigarette. »Außer natürlich ich selbst.«
»Nicht, solange ich hier bin«, sagt Amy.
»Aber jemand könnte versuchen, mich zu erschießen«, fährt Rosie fort. »So, wie die heutige Welt nun mal ist, und so weiter, blabla. Wenn es also jemand versucht, werfen Sie sich bitte nicht in die Schusslinie, verstanden? Nicht wegen mir. Lassen Sie die Alte ruhig draufgehen.«
Amys Arbeitgeber, Maximum Impact Solutions, ist die weltgrößte Personenschutz-Agentur, vielleicht die zweitgrößte, seit Henk van Veen gegangen ist und den halben Kundenstamm mitgenommen hat. Wenn jemand Sie bestiehlt oder Sie umbringen will oder wenn es Unruhen in Ihrer Privatarmee gibt, ist das die Adresse Ihrer Wahl. Maximum Impact Solutions hat viele Devisen, aber »Lass die Alte ruhig draufgehen« gehört nicht dazu.
»Verlassen Sie sich drauf, dass ich das nicht tun werde«, sagt Amy.
Sie erinnert sich gut an Rosies Fernsehauftritte, als sie selbst noch ein Kind war. Diese Schulterpolster, dieses Flair. Es hat Amy viel bedeutet zu sehen, wie stark man als Frau sein kann – in einer Zeit, als sie sich Nacht für Nacht zum Schlafen unter ihrem Bett zusammenkauerte und um bessere Zeiten betete. Solange Amy Wache hält, wird Rosie nicht sterben.
»Was ist das für ein Akzent?« Rosie zieht an ihrem Joint. »Süß klingt das. Manchester?«
»Watford«, sagt Amy.
»Ups«, sagt Rosie. »Ich bin schon zu lange weg. Erzählen Sie mir was über Watford.«
»Es ist eine Stadt«, sagt Amy. »In England.«
»Das weiß ich auch, Amy. Ist es hübsch da?«
»Das wäre jetzt nicht das Wort, das mir als Erstes einfällt«, sagt Amy. Sie freut sich schon darauf, später bei Steve anzurufen, ihrem Schwiegervater. Es ist Freitag, da sollte er zu Hause sein. Von Rosie zu hören wird ihm Spaß machen. Starke Frauen waren immer sein Fall. Vielleicht werden sie es eines Tages ja wieder sein.
Bei starken Frauen muss Amy an Bella Sanchez denken. Und bei Bella Sanchez muss sie an Mark Gooch denken. Und bei Mark Gooch …
Und da beginnt das Problem auch schon, Amy, nicht wahr? Sobald du dich entspannst, fängst du zu denken an. Als ob irgendetwas davon deine Angelegenheit wäre. Hör auf zu denken, das tut dir nicht gut. Hau um dich, tritt Gaspedale durch, entschärfe Sprengkörper, aber lass um Gottes willen das Denken sein. Du bist nicht mehr in der Schule!
»Die Engländer sind schon ein komisches Volk«, sagt Rosie. »In den Achtzigern haben sie mich geliebt, in den Neunzigern dann gehasst, in den Nullerjahren hatten sie mich vergessen, in den Zehnerjahren haben sie mich neu entdeckt, und jetzt lieben sie mich wieder. Und ich hab mich die ganze Zeit kein bisschen verändert. Haben Sie mal ein Buch von mir gelesen, Miss Bodyguard?«
»Nein«, lügt Amy. Den Menschen, der nichts von Rosie D’Antonio kennt, gibt es nicht. Amy liest ihre Bücher, seit sie ein Teenager war. Eine Sozialarbeiterin hat ihr damals das erste zugesteckt, mit einem Finger an den Lippen, der klarstellte: Das hier war heiße Ware, ihr kleines Geheimnis. Und was für ein Geheimnis! Gewalt und Glamour, superschicke Kleider, Ströme von Blut. Schulterpolster und Gift. Aber bei einer Kundin darf man sich nicht als Fangirl outen. Kugeln scheren sich nicht darum, wie berühmt jemand ist. Und das ist eine Devise von Maximum Impact Solutions.
Auf dem Flug gestern hat Amy Der Tod spielt am Abzug wiedergelesen. Es ist auch verfilmt worden, mit Angelina Jolie, aber das Buch ist besser. Knarren, Sex mit Millionären. Themen, mit denen Amy etwas anfangen kann.
»Sind Sie verheiratet?«, fragt Rosie sie. »Kinder?«
»Verheiratet ja, Kinder nein«, sagt Amy.
»Und ist er nett? Ihr Mann?«
»Doch, schon.« Amy denkt an Adam. »So nett, wie es für mich eben passt. Ich mag ihn.«
Rosie nickt. »Das ist eine gute Antwort. Macht er sich Sorgen um Sie?«
»Er mag es nicht, wenn auf mich geschossen wird«, sagt Amy. »Und in Marokko ging mal einer mit dem Schwert auf mich los, da hat er geweint.«
»Und Sie? Haben Sie auch geweint?«
»Ich habe mir das Weinen abgewöhnt, als ich zwölf war«, sagt Amy.
»Das klingt sehr gesund«, sagt Rosie. »Darf ich Sie in ein Buch einbauen? Blondine, eins siebenundsechzig groß, blaue Augen, weint nie und legt Schurken um?«
»Nein«, sagt Amy. »Ich mag keine Publicity.«
»Ich verspreche, dass Ihre Ohren nicht vorkommen werden.«
Amy und ihr Schwiegervater telefonieren nach Möglichkeit täglich. Sie haben das nie so ausgemacht; es ist einfach zu einer Gewohnheit geworden, die beiden wichtig ist. Zumindest Amy ist sie wichtig, und sie hofft, dass es Steve auch so geht. Ab und zu müssen sie einen Tag auslassen. Zum Beispiel durfte Amy in dieser Ölpipeline einmal zwölf Stunden lang keinen Mucks von sich geben, weil ein Killerkommando nach ihr suchte, also musste sie sich an diesem Tag mit Textnachrichten behelfen. Steve hat Verständnis für so etwas. Der Job geht vor.
»Dürfen Sie Ihre Kleider selbst aussuchen?«, will Rosie jetzt wissen, »oder ist das eine Uniform?«
Amy schaut hinunter auf ihre Tarnhose und das ausgebleichte Under-Armour-T-Shirt. »Die suche ich selbst aus.«
Rosie zieht skeptisch die Brauen hoch. »Na gut, niemand ist vollkommen.«
Amy lässt nicht gern zu viel Zeit zwischen den Anrufen verstreichen, weil man bei Steve nie weiß, was er isst, ob er achtgibt auf sich. Aus Amys Sicht ist es einfach widersinnig, sich ungesund zu ernähren.
Ihren Mann sollte sie vermutlich auch anrufen, aber um Adam sorgt sie sich nicht so. Außerdem lässt sich mit ihm nicht so gut schwatzen.
»Als Sie angekommen sind«, sagt Rosie, »habe ich aus Ihrer Tasche Der Tod spielt am Abzug rausspitzen sehen. Etwa zur Hälfte gelesen.«
Amy nickt. Erwischt.
»Also kennen Sie doch was von mir. Obwohl Sie doch sagten, nein.«
»Kundenrecherche.«
»Blödsinn«, sagt Rosie. »Und, gefällt es Ihnen?«
»Ich hatte nichts anderes zu lesen.«
»Natürlich gefällt es Ihnen, das sehe ich doch. Sind Sie schon da, wo sie den Typen im Flugzeug abknallt?«
»Das ist ziemlich gut, ja«, sagt Amy.
»Finde ich auch«, sagt Rosie und nickt. »Dieser Pilot, mit dem ich was hatte, hat mich dafür in seinem Flugzeug eine Pistole abfeuern lassen, zur Recherche. Haben Sie das schon mal gemacht?«
»Im Flugzeug eine Pistole abgefeuert? Nein«, lügt Amy.
»Passiert nicht viel«, sagt Rosie. »Sie mussten eins von den Kalbsledersofas neu beziehen, aber das war schon alles.«
»Wenn die Kugel in den Rumpf eingeschlagen wäre, hätte es in der Kabine zu einem Druckabfall kommen können, und Sie wären alle gestorben«, sagt Amy. Sie musste sich einmal nach exakt so einem Vorfall mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug retten. In den darauffolgenden fünf Tagen hat sie sich durch die Wüste Burkina Fasos geschlagen. Letzten Endes alles ein großer Spaß. Adrenalin, so Amys Erfahrung, tut der Seele gut und der Haut noch besser. Sie hat sich schon manchmal Hautpflege-Tutorials auf Instagram angeschaut, aber keine Pflege macht den Teint auch nur annähernd so frisch, wie knapp einer Kugel zu entgehen und anschließend aus einem Flugzeug zu springen. Ob sie vielleicht mal ein eigenes Video posten sollte? Wieder ertappt sie sich beim Denken, also hört sie auf damit.
»Na, dann war das ja Glück«, sagt Rosie und kippt den dubios aussehenden Bodensatz in ihrem Glas hinunter. »Ich werde langsam wepsig, Amy. Können wir nicht kurz rüber aufs Festland fahren? Einen Drink nehmen? Ein bisschen einen draufmachen?«
Rosies derzeitige Probleme resultieren aus der Tatsache, dass eine der Figuren in ihrem jüngsten Roman Denkzettel de luxe sehr unverhüllt einem russischen Chemie-Oligarchen nachempfunden ist, Wassili Karpin. Wassili, so scheint es, ließ den Humor vermissen, den man gemeinhin mit Chemie-Magnaten verbindet, und nach einer Gewehrkugel in der Post und einem missglückten Entführungsversuch bei einer Signierstunde in Nashville hat Rosie die Profis eingeschaltet und nun bis auf Weiteres Hausarrest.
Man kennt sich untereinander. Jeff Nolan, Amys Chef, hat Kontakt zu ein paar Londoner Kollegen von Wassili aufgenommen. Die Gespräche sind bereits im Gange. Wassili wird in Bälde dazu gebracht werden, von diesem speziellen Rachefeldzug abzulassen. Maximum Impact Solutions hat Klienten, die ihm den einen oder anderen Gefallen erweisen könnten. Eine Regelung wird getroffen werden, Wassilis Zorn wird verrauchen, und Rosie wird wieder ihren Geschäften nachgehen können. Und falls nicht, ist Amy zur Stelle.
Bis dahin sitzen Amy und Rosie auf dieser idyllischen Insel fest, mit ihrem eilig angelernten provisorischen Küchenchef. Amy könnte definitiv einige Tage hier gebrauchen, etwas Ruhe vertragen, wenn sie ehrlich ist, aber zu lange darf sie nicht auf der faulen Haut liegen. Niemand wird Rosie D’Antonio umbringen, das heißt, Amy ist im Grunde nur ein sündteurer Babysitter. Und davon haben sie beide nichts.
»Wir fahren fürs Erste gar nirgends hin«, sagt Amy. »Nicht dass Sie doch noch ermordet werden.«
Rosie verdreht die Augen und baut den nächsten Joint. »Ach, Amy, besser ermordet als angeödet, sag ich immer.«
Und in diesem Punkt muss ihr Amy Wheeler, die so weite Teile ihrer Kindheit damit verbracht hat, sich so klein und unsichtbar wie möglich zu machen, leider recht geben.
3
»Katze, rot, unnahbar. Hochmütiges kleines Biest. Mason’s Lane. Kontaktaufnahme versucht, aber abgewiesen. 3:58 Uhr.«
Steve steckt das Diktiergerät in seine Tasche zurück. Er hört die rote Katze ungelenk über einen Gartenzaun klettern. Es kommt nicht oft vor, dass er auf seinen Gängen eine fremde Katze sieht. Höchstwahrscheinlich ist es nichts, aber fast alles ist ja höchstwahrscheinlich nichts, oder? Und trotzdem gibt es immer wieder Dinge, die eben doch nicht nichts sind. Einmal hat eine Twix-Verpackung in einem Hochofen zur Ergreifung eines bewaffneten Räubers geführt. Die Tragweite einer Sache lässt sich fast nie gleich ermessen, und ein paar Notizen kosten nichts.
Steve wendet sich nach links, wo die High Street ihren Anfang nimmt, und sieht sie vor sich ausgerollt wie ein graues Band, schwach beleuchtet von der trüben Funzel des Mondes.
Wenn Sie Axley besuchen – und das sollten Sie unbedingt –, werden Sie glauben, das Urbild des perfekten englischen Dorfs vor sich zu sehen. Die sanft abfallende High Street schwingt in einem kleinen Bogen am Ufer des Dorfteichs aus. Es gibt zwei Pubs, The Brass Monkey und The Olde Pitcher, für Touristen mehr oder weniger identisch, aber für die Einheimischen durch eine Fülle kleiner und doch hochwichtiger Merkmale unterschieden. So flattert etwa vor dem einen ein Union Jack und vor dem anderen die ukrainische Flagge. Es gibt eine Metzgerei, eine Bäckerei und sogar einen kleinen Souvenirladen, der Duftkerzen und Lesezeichen verkauft. Gestreifte Markisen beschatten die Schaufenster, an denen Fahrräder lehnen, Schiefertafeln verheißen Cream Tea, Kartenlegen oder Leckereien für Hunde. Am höchsten Punkt des Dorfs ist die Kirche, am niedrigsten ein kleines Wettbüro, suchen Sie sich’s aus. Steve hat früher beide besucht und meidet jetzt beide.
Und ringsum breitet sich der New Forest. Ohne den Wald gäbe es das Dorf nicht. Es hat sich einfach eine kleine Lichtung gesucht und sich dort eingeschmiegt. Vor der Tür Spazierwege und Naturpfade, Insektensummen, Vogelzwitschern und die Rucksäcke und Regenmäntel der Touristen. Zuweilen streifen versprengte Wildponys durch die Straßen und werden gebührend hofiert. Es war ihr Wald, schon lange bevor er der unsere wurde, und er wird es auch lange danach noch sein. Axley duckt sich nur in seinen Schutz, geborgen in seinem kleinen Kokon aus Bäumen.
Als Steve hierhergezogen ist – vor zwölf Jahren, kann das sein? Debbie wüsste es genau, wahrscheinlich vor fünfzehn, so wie die Zeit rast –, ist er dieser Idylle keine Sekunde lang auf den Leim gegangen. Er hat sich nicht täuschen lassen von den Stockrosen und den selbst gebackenen Cupcakes und dem launigen »Guten Morgen«, mit dem man sich hier begrüßt. Steve sah hinter jeder pastellfarbenen Haustür Geheimnisse, sah Leichen in jeder Seitengasse, und sooft die Kirchturmuhr die Stunde schlug, hörte Steve die Totenglocke.
Eine Chipstüte hat sich in der Hecke verfangen. Steve holt sie heraus und wirft sie in einen Mülleimer. Monster Munch. Der Dorfladen führt Monster Munch nicht, es muss also ein Tourist gewesen sein.
Nein, Steve hat sich von Axley nicht hinters Licht führen lassen. Fünfundzwanzig Jahre Polizeidienst hatten ihn gelehrt, von allem und jedem das Schlechteste zu erwarten. Rechne stets mit dem Schlimmsten, dann bist du für alles gewappnet. Lass dich durch nichts und niemanden überrumpeln.
Schon ironisch, wenn man bedenkt, wie es danach weiterging.
Steve bleibt vor dem Fenster des Immobilienmaklers stehen und späht durch die Scheibe. Wenn er jetzt hierherziehen wollte, könnte er es sich nicht mehr leisten. Der einzige Weg, sich hier ein Haus leisten zu können, ist, es vor fünfzehn Jahren gekauft zu haben.
Steve hat Axley unrecht getan – er selbst wäre der Erste, der das zugibt. Hinter den Türen hier lauerten keine Mörder, in den Seitengassen lagen keine verstümmelten Leichname in ihrem Blut. Und so hat er sich nach und nach immer mehr entspannt.
Steve war schon als Kind permanent angespannt; dafür sorgte sein Vater. In der Schule zu helle, um sich einzufügen, aber nicht helle genug, um den Absprung zu schaffen, ging er mit achtzehn zur Metropolitan Police, wo er Tag für Tag das Schlimmste sah, was London zu bieten hatte. Zum Teil schloss das seine Kollegen mit ein. Jeder Tag war ein Kampf.
Steve zückt wieder sein Diktiergerät. »Hellblauer VW Passat auf dem Parkplatz vor dem Brass Monkey, Kennzeichen PN17 DFQ.« Er umrundet den Wagen. »Uralte Steuerplakette.« Im Fußraum eine leere Bäckertüte von Greggs. Wo ist der nächste Greggs? In Southampton? An der Raststätte an der M27?
Er setzt seinen Spaziergang fort. Er wird bis hinunter zum Teich gehen, dort eine kurze Rast einlegen und sich dann auf den Rückweg machen. Das macht er jede Nacht so.
Axley hat Steve verwandelt. Nicht auf einen Schlag, nein, Lächeln für Lächeln, Freundlichkeit für Freundlichkeit, Scone für Scone haben das Dorf und seine Bewohner die Mauer zum Bröckeln gebracht, die er über die Jahre um sich errichtet hatte. Debbie hatte ihm prophezeit, dass es so sein würde, aber er hatte ihr nicht geglaubt. Sie war hier geboren, und als Steve bei der Met ausgeschieden war, hatte sie ihn zu dem Umzug überredet. Sie wusste, wie es kommen würde.
Steve hatte Angst gehabt, ihm würde die Aufregung fehlen, das Adrenalin, aber Debbie hatte ihn beruhigt. »Wenn du dich langweilst, sind es nur zwanzig Meilen bis nach Southampton, da wird andauernd gemordet.«
Aber Steve vermisste die Aufregung und das Adrenalin kein bisschen.
Steve genoss es, daheim zu sein, er kochte für Debbie, er hörte den Vögeln zu, er fand ein brauchbares Pub-Quiz-Team. Gut, aber verbesserungsfähig.
Ein streunender Kater, Veteran vieler Schlachten, kam zu Besuch und weigerte sich, wieder zu gehen. Nach einer Woche des Gefauches und des Imponiergehabes, seitens des Hausherrn wie auch der Katze, legten sie jeweils ihren Panzer ab. Und jetzt trifft man Steve zeitunglesend in seinem alten Lehnstuhl an, auf seinem Schoß zusammengerollt Trouble, der im Schlaf schnurrt. Zwei alte Gauner haben sich gefunden.
Die Sache mit der Agentur war Debbies Idee. Ihm ging die Arbeit nicht ab – Debbies Bilder brachten genug ein –, aber sie hatte natürlich recht. Es war gut, etwas zu tun zu haben, und es war gut, der Gemeinschaft etwas zurückzugeben. Der Name seiner Agentur, »Steve ermittelt«, war wiederum seine Idee. Er weiß noch diesen Sonntag, an dem sein Sohn, Adam, und Amy, Adams Frau, zum Mittagessen da waren. Amy ist Personenschützerin, sie arbeitet für Milliardäre und Oligarchen und ist ständig in der Welt unterwegs. Adam macht irgendwas mit Finanzen. Steve spricht öfter mit Amy als mit Adam. Sie ist es, die anruft, sie sorgt dafür, dass sie und Adam zu Besuch kommen, wenn der Job sie einmal nach England führt.
Amy wollte, dass er seine Firma »Maverick Steel International Investigations« nennt. Die Markenbildung sei das A und O in der Welt der Privatermittler, sagte sie, aber Steve konterte, sein Name sei nun mal Steve und seine Tätigkeit das Ermitteln, und wenn das keine Marke sei, was dann?
Amy ist zurzeit irgendwo in Amerika, wo sie Rosie D’Antonio beschützt, die berühmte Schriftstellerin. Steve wird sich nichts anmerken lassen bei ihrem nächsten Gespräch, aber er brennt darauf, all den Klatsch zu hören. Sie kann immer viel erzählen, wenn sie prominente Klienten hat. Einmal war sie Leibwächterin bei dem Sänger einer Boy-Band, und er hat sich auf einem Elefanten Heroin gespritzt.
»Zeitunterschied zu Amerika googeln«, sagt Steve in sein Diktiergerät.
»Steve ermittelt« ist eine willkommene Beschäftigung und ein nettes kleines Zubrot. Er hat einige Kontaktleute bei Versicherungsgesellschaften. Falls Sie im Großraum New Forest je wegen Bandscheibenproblemen ein Jahr Verdienstausfall geltend gemacht haben, dann hat höchstwahrscheinlich irgendwann Steve vor Ihrem Haus gewartet und ist Ihnen zur Rückenschule gefolgt. Es macht ihn froh, feststellen zu können, dass die Leute bei diesen Dingen fast immer die Wahrheit sagen. Wenn man ihn sehr, sehr bittet, nimmt er sich auch fremdgehender Partner an. Hauptsache, er muss dabei keine weiten Strecken zurücklegen. Steve will nicht zu weit von Axley fort. Er fährt bis Brockenhurst, wenn es sein muss; da gibt es ein paar schöne Pubs. Zur Not fährt er auch rüber nach Ringwood oder runter in Richtung Lymington, aber Southampton oder Portsmouth sind nicht drin, das lehnt er höflich, aber bestimmt ab.
Nur mal angenommen, er ließe sich einen Mordfall aufdrücken. Da wäre er doch gleich nicht mehr Herr über seine Zeit. Steve verpasst nie das Mittwochabend-Quiz im Brass Monkey. Ein Mordfall käme ihm da mit Sicherheit irgendwann in die Quere, also nein danke.
Steve hat den Teich erreicht und setzt sich auf seinen Stammplatz dort. Debbies Lieblingsbank. Die Enten lieben diese Bank, aber jetzt schlafen sie, schlummern sanft wie das ganze restliche Dorf. Steve wacht über sie alle. Das ist das Mindeste, was er tun kann, nach allem, was Axley für ihn getan hat.
Er spürt es noch wie heute, dieses Gefühl des Loslassens, die Gewissheit, dass das Leben endlich auch für ihn zur Ruhe kommt. Dass die Menschen ihm wohlwollen und dass jeder Tag Gutes bringt. Dass ihm nichts zustoßen kann. So konnte es natürlich nicht bleiben. Wann kann es das je?
In gewisser Hinsicht hat Debbies Tod ihn nicht überrascht. Er hat sich innerlich darauf vorbereitet, immer wieder neu seit dem Tag, an dem sie sich ineinander verliebt haben. Darauf, dass irgendetwas kommt und sie ihm wegnimmt. Krebs, Hirnschlag, ein Fahrradunfall auf der Landstraße, Herzschwäche, Einbrecher. Denn es war ja undenkbar, dass nichts ihm dieses unfassbare Glück rauben würde, sie zu lieben und von ihr geliebt zu werden.
Und dann war es ein Eisenbahnwaggon, der beim Einfahren in eine ländliche Bahnstation entgleiste. Drei Menschen hatten auf dem Bahnsteig gewartet, Debbie und zwei weitere arme Seelen, die an diesem verregneten Januartag ihr Leben ließen.
Und trotz aller gewissenhaften Vorbereitung traf es ihn doch ungewappnet. Man kann sich etwas vorstellen, sooft man will, nichts rüstet einen dafür, dass das Herz in Stücke zerspringt.
Nach Debbies Tod hat das Dorf einen Schutzwall um ihn gebildet, ihm über das Schlimmste hinweggeholfen. Wenn er nun durch die Straßen geht, wo er jeden kennt und jeder ihn kennt, ist Steve dankbar dafür, dass er sich wenigstens daheim fühlen darf. Denn ohne dieses Gefühl ist es schwierig, überhaupt etwas zu fühlen.
Ein einsames Pony wandert mit wippendem Kopf am Teich vorbei. Steve betrachtet es argwöhnisch. Nein, eigentlich betrachtet er es nur. Steves Blick wirkt von Natur aus argwöhnisch. Im Pub eckt er damit auch ständig an.
»Du solltest schlafen«, sagt er zu dem Pony.
Das Tier wendet ihm den Kopf zu, als wollte es sagen: Du aber auch. Steve sieht ein, dass es da nicht ganz unrecht hat. Das Pony setzt seinen gemächlichen Weg fort, quer über die High Street und weiter durch das Gässchen neben dem Schreibwarenladen, nachdem es noch kurz in einer Mülltonne geschnobert hat. Dann hat er Axley wieder für sich.
Er reibt mit den Fingern über die Messingplakette an der Lehne. Debbies Name, ihr Geburtsdatum, ihr Todesdatum. Er drückt bei seinem Diktiergerät auf »Aufnahme«, denn andernfalls wäre er einfach ein Mann auf einer Bank, der Selbstgespräche führt.
»Hallo, Debs. Gestern beim Quiz sind wir nur Zweiter geworden. Norman aus dem Laden hatte seinen Schwager zu Besuch, der schon mal bei ›Der Schwächste fliegt‹ war, da waren wir natürlich chancenlos. Die Gang wollte eigentlich Beschwerde einlegen, weil es ja schon irgendwie verdächtig war, aber ich hab hinterher noch mal recherchiert, und er ist wirklich Normans Schwager, da ließ sich also nichts machen. Trouble hat eine Wühlmaus erlegt, die erste seit Langem; schon schön, dass sein Jagdtrieb noch da ist. Und er hat sie zu Margaret gebracht, nicht zu uns, was ja auch gut ist. Ich hab grad eine neue Katze gesehen, auf der Mason’s Lane, eine rote, so ein sprödes Vieh, du kennst den Typ. Hmm … Amy arbeitet zurzeit für Rosie D’Antonio, du weißt schon, die Schriftstellerin. Die soll so eine Schönheit sein, sagen alle, aber mein Typ ist sie nicht. Ich bestell ihr Grüße von dir – Amy, meine ich, nicht Rosie D’Antonio. Mal schauen, was sie so alles von ihr erzählt. Im Laden haben sie jetzt eine neue Pastete, Hühnchen und noch irgendwas. Die muss man nur in die Mikrowelle stecken, glaube ich. Vielleicht trau ich mich da ja mal ran, dann berichte ich dir. So, mehr weiß ich erst mal nicht. Lieb dich, Debs.«
Steve schaltet das Diktiergerät aus und steckt es in die Tasche zurück. Er tätschelt das Holz.
»Also dann, Liebes. Jetzt schau ich, ob diese Katze noch da ist.«
Steve geht die High Street wieder hoch. Morgen muss er einen Hund suchen, der auf einem der hiesigen Campingplätze entlaufen ist; die Besitzer, Sommergäste aus London, sind wie zu erwarten außer sich vor Sorge. Steve weiß, wie Hunde ticken – er wird ihn im Nu gefunden haben. Fünfhundert Pfund haben sie ihm gezahlt, gleich bar auf die Hand. Steve hätte es auch für einen Fünfziger gemacht. Den Londonern sitzen ihre Pfundnoten locker. Und im Souvenirladen fehlt Geld in der Kasse. Steve hat letzte Woche eine Überwachungskamera installiert, und nachher wird er die Aufnahmen sichten. Es ist die Tochter der Besitzerin, das war ihm sofort klar. Steve weiß auch, wie Menschen ticken: unterm Strich erstaunlich ähnlich wie Hunde. Aber die Besitzerin wird nicht glauben, dass es ihre Tochter war, ehe sie nicht den Beweis sieht.
Axley ist ruhig und friedlich, und Steve ist dankbar dafür. Viele seiner früheren Kollegen, alle Ende fünfzig inzwischen, hetzen sich bis heute mit ihren kaputten Knien für zwielichtige Bosse ab, trinkend und rauchend und immer im Stress. Aber Steve weiß, wie schnell das Spiel aus sein kann, und er hat nicht die Absicht, sich dagegen aufzulehnen.
Keine Höhenflüge im Leben ohne den Preis des Schmerzes, deshalb hat Steve die Höhenflüge für sich gestrichen. Er sieht fern, er geht zum Quizabend, er hilft anderen, wenn er kann, aber am Ende warten immer sein Lehnstuhl und ein Kater namens Trouble.
Bei einer Festnahme kann man grob zwei Arten der Reaktion unterscheiden. Manche Leute randalieren den ganzen Weg bis in die Zelle, während andere sich geschlagen geben und ruhig mitgehen.
Wer weiß schon vorher, wann das Spiel für ihn aus sein wird? Wann er selbst am Bahnsteig steht, wenn der Zug entgleist?
Wann immer es so weit ist, Steve gedenkt ruhig abzutreten.
4
Jeff Nolan, Geschäftsführer von Maximum Impact Solutions, denkt über Andrew Fairbanks nach.
Dass hier und da jemand aus dem Weg geräumt werden muss, gehört zum Geschäft, wer wüsste das besser als Jeff? Aber den Haien vorgeworfen? Das ist schon eine Ansage, und vermutlich auch als solche gemeint. Als Bella Sanchez ermordet wurde, hat das die Gemüter nicht groß bewegt. Bei Mark Gooch wurden schon einige stutzig, aber dieser neue Fall ist der erste, der echte Aufmerksamkeit erregt. Der erste, bei dem die Leute Fragen stellen. Die Polizei beispielsweise. Jeff mag es nicht, wenn ihn die Polizei bei der Arbeit besucht. Er war so kooperativ, wie er kann – immerhin ist ein junger Mann umgekommen –, aber es gibt schließlich noch so etwas wie die Verschwiegenheitspflicht.
Jeff kennt die Verbindung zwischen den drei Todesfällen. Und er weiß, wer hinter allen dreien steht.
François Loubet.
Jeff muss aktiv werden. Er kann sich von drei Morden nicht sein Geschäft kaputt machen lassen, das wäre ja noch schöner.
Die Polizei ist nicht das Hauptproblem, das ist sie sehr selten. Das Hauptproblem sind die Kunden. Seit heute früh haben schon ein Premier-League-Spieler und ein holländischer Cannabis-Importeur ihre Verträge gekündigt. Sie fühlen sich bei Maximum Impact Solutions nicht mehr gut aufgehoben. Wer will es ihnen verdenken? Es wird noch mehr Stornierungen geben, je weiter sich die Nachricht herumspricht. Zweifellos werden sie zu Henk abwandern, Jeffs einstigem Partner und noch einstigerem besten Freund.
Und nun sitzt auch noch Max Highfield bei ihm im Büro. Man sollte meinen, Max Highfield müsste Besseres zu tun haben, aber nein, hier sitzt er, Schuhe ausgezogen, Füße auf Jeffs Besprechungstisch geknallt, und macht Wind um sich.
»Es lässt mich schlecht dastehen, Jeff.« Max fährt sich durchs Haar mit einer Geste, als wäre er ein angegrauter alter Kämpe, der zu viel Blutvergießen gesehen hat, und nicht ein Mann, der geradewegs vom Brunch im Ivy kommt.
»Das kann ich verstehen, Max«, sagt Jeff. »Das kann ich verstehen.«
Er hat es geahnt. Sowie er von Andrew Fairbanks gehört hat, war ihm klar, dass andere Kunden eins und eins zusammenzählen werden. Die Menschen googeln. Erst recht die Promis – sie tun fast nichts anderes.
»Wie viele Kunden schleppe ich dir an?«, fragt Max.
»Oh, viele, viele«, sagt Jeff. »Deshalb zahlen wir dir ja auch eine Dreiviertelmillion Pfund im Jahr, Max.«
Das ist Max Highfields »Berater«-Honorar. Plus eine zehnprozentige Provision für jeden Neukunden – all die anderen Promis, die er an Jeff vermittelt. Schauspieler in erster Linie, aber bei Max’ Aussehen gibt es kaum jemanden, den er nicht kennt.
»Eine Dreiviertelmillion?« Max lacht. »Weißt du, was die mir bei meinem letzten Marvel-Film gezahlt haben?«
»Nein«, sagt Jeff. »Und du musst es mir auch nicht verraten. Es ist ja sicher vertrau–«
»Achteinhalb Millionen«, sagt Max. »Achteinhalb Millionen, Jeff. Und zwar Pfund, nicht Dollar. Hast du schon mal bei irgendwas achteinhalb Millionen verdient?«
»Habe ich, ja«, sagt Jeff. »Mehrmals sogar – aber das hier ist ja kein Wettbewerb. Ich kann bestens verstehen, dass du Angst um deinen Ruf hast.«
»Drei Klienten tot«, sagt Max, der jetzt rhythmisch auf seinen Superhelden-Schenkeln herumtrommelt. »Das sind ganz schön viele tote Klienten.«
»Aber«, sagt Jeff, »wenn ich kurz mal den Advocatus Diaboli spielen darf, keine bedeutenden Klienten. Kleine Lichter, bei allem Respekt. Ich meine, Andrew Fairbanks war jetzt nicht direkt oscarverdächtig. Er hat Fitness-Videos gedreht.«
Max wird schlagartig todernst. Er nimmt sogar die Füße vom Tisch. »Also die Oscars sind total überbewertet, Jeff. Da wird ausschließlich politisch entschieden.«
»Sicher, sicher«, sagt Jeff. »So, wenn …«
»Viele große Schauspieler haben nie einen Oscar bekommen«, sagt Max.
»Du hast ja recht. Also, mein Plan wäre folgender.«
»Samuel L. Jackson hat nie einen bekommen. Wusstest du das?« Max Highfield schüttelt langsam und bekümmert den Kopf.
»Wusste ich nicht, ich geb’s zu«, sagt Jeff. »Ich habe eine Mitarbeiterin vor Ort in South Carolina, unweit von dem Ort, wo Andrew Fairbanks ermordet wurde. Sie ist …«
»Travolta hat nie einen bekommen«, fährt Max fort. »Johnny Depp. Jason Statham. Reine Politik. Wenn denen dein Gesicht nicht passt …«
»Ich werde mit ihr sprechen«, sagt Jeff. »Diskrete Erkundigungen einziehen.«
»Sorry, mit wem willst du sprechen?«, sagt Max. »Wir waren bei den Oscars, Bro.«
»Ich habe gesagt, ich habe eine Mitarbeiterin in South Carolina«, wiederholt Jeff. »Amy Wheeler – war vor Jahren mal kurz als Bodyguard bei dir.«
»An die erinnere ich mich.« Max starrt Jeff eine Weile intensiv an. Offenbar hat ihm irgendwer gesagt, dass dieses intensive Starren sehr wirksam ist. »Tom Cruise, der hat auch noch keinen. Jeff, hat dir schon mal jemand gesagt, dass du wie ein schwarzer Jason Statham aussiehst?«
Jeff beschließt, sich nicht ablenken zu lassen.
»Es ist alles sehr diffizil, Max, das verstehst du sicher«, sagt er. »Du kennst unsere Branche. Aber glaub mir, wir nehmen die Sache sehr, sehr ernst.«
»Ich denk ja drüber nach, zu Henk zu gehen.« Max legt die Füße wieder auf den Tisch. »Ich dachte, das solltest du wissen. Der zahlt wahrscheinlich auch besser als du.«
»Ehrlich gesagt wäre ich etwas in Sorge, wenn du nicht darüber nachdächtest«, sagt Jeff. Max wäre Henks hochkarätigster Diebstahl bis dato. »Und übers Geld lässt sich natürlich reden.«
»Amy Wheeler war die, die mich dran gehindert hat, mit meinem Motorrad von dieser Brücke zu fahren«, sagt Max.
»Genau die«, bestätigt Jeff. »Du hattest deine Schmerzmittel überdosiert, kann das sein?«
»Sagt einem ja auch keiner, dass man die nicht mit Whisky nehmen darf.«
»Wirklich?«, fragt Jeff. »Ich dachte, ich hätte da schon mal was läuten hören.«
»Und meine Jeansjacke hat sie auch vollgeblutet.«
»Nachdem sie bei einer Rauferei dazwischengehen musste, die du in einer Bar angefangen hattest, und da mit einem zerbrochenen Glas attackiert wurde.«
»Die Jacke hat mir Harry Styles geschenkt«, sagt Max.
»Max«, Jeff nimmt einen nächsten Anlauf, um ihn zum Thema zurückzubringen, »vertraust du mir noch mal die nächsten paar Wochen? Bis wir herausfinden konnten, was da läuft?«
»Klar doch«, sagt Max. »Zwei Wochen.«
Er steigt wieder in seine Schuhe, ein erstes Aufbruchssignal. Jeff erhebt sich.
»Klasse Film übrigens, fand ich. Rampage 7.«
»Danke, Bro«, sagt Max. »Auf Rampage 6 bin ich ja nicht so abgefahren, aber mit dem neuen sind wir wieder in der Spur. Und Drillinge zu spielen ist einfach geil.«
Jeff nickt zustimmend. Als einer der Drillinge trägt Max einen Schnurrbart, als ein anderer hat er eine Augenklappe und einen französischen oder möglicherweise niederländischen Akzent. »Henk meinte zwar, jemand muss dir noch zeigen, wie man einen Revolver richtig hält, aber ich fand’s super. Ich halte meinen auch manchmal ein bisschen seitlich.«
»Henk hat das gesagt?« Max richtet sich zu seiner vollen Größe auf. Den vollen eins dreiundneunzig, dank deren er den billigen britischen Soaps so schnell entwachsen ist.
»Ja«, sagt Jeff mitfühlend.
»Hmm.« Diese Information muss Max erst einmal verarbeiten.
»Kino versteht nicht jeder«, tröstet Jeff.
»Ich werde missverstanden, als Mann«, sagt Max. »Und als Künstler. Und das ist so typisch englisch.«
»Grässliches Land, hast recht«, sagt Jeff, während seine ausgestreckte Hand in der von Max verschwindet. »Ich klär das alles auf.«
Als Max zur Tür geht, eine Schleppe von Testosteron und Tom Ford hinter sich herziehend, kommt Susan Knox in Jeffs Büro. Max gibt ihr im Vorbeigehen einen festen Klaps auf den Hintern.
»Da ist sie ja«, sagt er. »Mein scharfer kleiner Puma.«
»Sie leitet hier die HR-Abteilung, Max«, sagt Jeff.
»Sie steht auf so was«, sagt Max über die Schulter. »Sie nimmt es als Kompliment.« Und weg ist er.
»Ich geh mal davon aus, dass du nicht unbedingt drauf stehst.« Jeff bietet Susan einen Stuhl an. »Auf diese Art von Komplimenten.«
»Auf diese Art von Komplimenten? Nein«, sagt Susan gleichmütig, »auf die steh ich nicht unbedingt.«
»Soll ich was dagegen unternehmen?«, fragt Jeff.
»Das Patriarchat stürzen?«, schlägt Susan vor.
»Ich kann’s versuchen«, sagt Jeff. »Die sehen es zwar nicht gern, wenn Schwarze sich einmischen, aber ich schaue, was ich ausrichten kann. Ist das die Akte von François Loubet?«
Susan nickt und legt sie auf Jeffs Schreibtisch. »Wozu brauchst du die, wenn ich fragen darf?«
Vor etwa zwei Jahren haben sie für Loubet einen Auftrag ausgeführt. Nicht dass sie den Mann selbst getroffen hätten; niemand trifft François Loubet. Er ist der größte Geldschmuggler der Welt und mischt sich darum nicht gern unters Volk. Eine Mitarbeiterin von ihm brauchte Personenschutz. Henk war dagegen; er war immer etwas wählerischer als Jeff, was die Kundschaft betraf. Aber, wie Jeff seinerzeit argumentierte, wenn du keine Verbrecher beschützt, gehen dir sehr schnell die Kunden aus. Diese Erfahrung wird Henk mit seiner neuen Firma auch machen. Vielleicht war der Streit damals der Anfang vom Ende ihrer Beziehung?
Jeff schlägt die Akte auf und sieht Susan an. »Hast du sie gelesen?«
»Sie gelesen?«, wiederholt Susan. »Natürlich nicht, sie ist ja vertraulich.«
Jeff nickt. Selbstverständlich hat Susan sie gelesen; das darf sie auch. Susan liest alles, aber Susan kann schweigen.
Zuoberst ist ein Ausdruck der E-Mail abgeheftet, die Jeff vor einigen Monaten an François Loubet geschickt hat, vor dem ersten Mord noch. Ein Beweisstück, falls er es je brauchen sollte.
Sehr geehrter Mssr Loubet,
ich hoffe, es geht Ihnen gut. Wie Sie sich erinnern werden, durften wir vor zwei Jahren einen Auftrag für Sie ausführen. Für Ihre prompte Zahlung nochmals vielen Dank. Der Anlass für meine heutige Mail ist jedoch ein beunruhigender.
Wenn ich unumwunden sprechen darf: Zwei meiner Klienten wurden kürzlich mit großen Geldsummen vom Zoll aufgegriffen.
Das bringt mich zu der Vermutung, dass meine Firma von einem professionellen Geldschmuggel-Syndikat missbraucht wird, und der einzige Geldschmuggler, mit dem Maximum Impact Solutions zu tun hatte, sind Sie. Ich bitte Sie dringend um Auskünfte in dieser Sache, die mir weiterhelfen könnten. Können wir sprechen?
Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Bedrohung meiner Firma nicht hinnehmen kann und alle nötigen Schritte in die Wege leiten werde, um meine Klienten und mein Unternehmen zu schützen. Wenn also Sie selbst, François, hinter der Sache stecken, wovon ich ausgehe, werde ich Ihnen das Handwerk legen.
Hochachtungsvoll,Jeff Nolan
Jeff sieht von dem Ausdruck auf.
»Weißt du, womit François Loubet sein Geld verdient, Susan?«
Susan schüttelt den Kopf. »Ohne seine Akte gelesen zu haben, kann ich das schlecht wissen.«
»Vielleicht hast du ja zufällig mal einen Blick reingeworfen, dachte ich? Beim Kopieren oder so?«
»Wenn ich einen Blick reingeworfen hätte«, sagt Susan, »und so was kommt schon mal vor, dann würde ich sagen, er ist der weltweit führende Geldschmuggler, der erste Name auf der Fahndungsliste des FBI, und stand letztens in E-Mail-Kontakt mit dir.«
»Das muss ja ein Mordsblick gewesen sein«, sagt Jeff.
»Ich kopiere sehr viel«, erwidert Susan. »Wenn ich das richtig sehe, weiß niemand, wer er ist?«
Jeff nickt. »Und kannst du dir denken, warum ich seine Akte haben wollte?«
»Andrew Fairbanks und dieses ganze Geld, das bei ihm gefunden wurde?«, mutmaßt Susan.
»Zusätzlich zu allem anderen, was du zufällig in der Akte gesehen haben könntest«, sagt Jeff.
»Schon eine heikle Situation«, sagt Susan. »Aber du warst schon öfter in heiklen Situationen, und du hast dich immer irgendwie rausgewunden, also hoffe ich, du schaffst es diesmal auch. Es wäre nützlich rauszukriegen, wer er ist – wenn ich also irgendwie helfen kann?«
»Ist Amy Wheeler allein, oder ist noch wer drüben?«, fragt Jeff. »Bei Rosie D’Antonio?«
»Ein Ex-Navy SEAL, Kevin heißt er«, sagt Susan. Wie immer weiß sie die Antwort aus dem Effeff. Auch so ein Grund, warum Jeff nichts dagegen hat, wenn sie die Dokumente liest. Nicht alle Dokumente natürlich.
»Der kommt aber nicht über uns, oder?«, sagt er.
»Nein, über eine lokale Niederlassung«, sagt Susan. »Sehr brauchbar, nach allem, was man hört, und mit einem einwandfreien Gesundheitszeugnis vom Polizeikommissariat Lowesport.«
»Amys Auftragsliste der letzten Zeit liest sich sehr interessant«, sagt Jeff, »angesichts der Morde. Was ist da deine Einschätzung als Personalchefin?«
»Als Personalchefin würde ich sagen, dass du sie dringend sprechen musst«, sagt Susan. »Ich würde sie auf dem schnellsten Weg heimholen.«
Susan arbeitet seit seinen ersten Tagen in London für ihn. Jeff würde gern sagen, sie ist mit ihm durch dick und dünn gegangen, aber wenn er ehrlich ist, gab es deutlich mehr dick als dünn.
Was muss jetzt sein nächster Schritt sein? Amy wird selbst schon darauf gekommen sein, dass die drei Morde nichts Gutes für sie bedeuten. Alles weist auf sie hin. Er beschließt, ihr eine Nachricht zu schicken. Sie zurück nach London zu holen und zu schauen, wie sie reagiert.
Er nimmt ein anderes Blatt Papier von seinem Schreibtisch. »Danke übrigens für die Inhaltsangabe von Rampage 7.«
Er konnte sie gerade noch überfliegen, bevor Max Highfield hereingerauscht kam.
»War mir ein Vergnügen«, sagt Susan. »Wenn auch offen gestanden ein zweifelhaftes, aber was tut man nicht alles.«
Jeff sieht Susan an. Er wäre verloren ohne sie. Seine Augen und Ohren. Seine weise Ratgeberin. Er verdankt ihr sehr viel.
»Ich rede noch mal mit Max Highfield«, sagt er. »Sein Benehmen ist inakzeptabel.«
Susan steht auf. »Ich will einfach nur ungestört arbeiten können, Jeff. Jetzt hol Amy Wheeler heim, sie könnte in Gefahr sein.«
»Hmm«, macht Jeff.
Sie beugt sich zu ihm und legt ihre Hand auf seine. »Ich liebe dich von ganzem Herzen, Jeff, aber du musst mich nicht vor Max Highfield retten. Mit dem werde ich schon selbst fertig, verstehst du?«
Jeff versteht, und er ist ihr sehr dankbar. Max bringt ihm eine Menge Geld ein. Er würde auch Henk eine Menge Geld einbringen.
Henk van Veen. Er und sein alter Freund haben die Firma gemeinsam aufgebaut. Butch und Sundance, Cagney und Lacey. Dann, vor drei Monaten, der Bruch. Steckt dahinter Loubet? Oder etwas völlig anderes? Bei Henk weiß man nie.
Jeff schaut hinüber zu dem breiten Spiegel an der Rückwand des Besprechungszimmers. Dahinter ist Henks Geheimraum. Da saß er immer in seinem Sessel, Brandy in der Hand, stumm und lauernd, und sah durch den Einwegspiegel den Team-Meetings zu. Angeblich, um die Sicherheit zu erhöhen, aber in Wahrheit wollte er nur wissen, ob jemand hinter seinem Rücken über ihn sprach. So war Henk. Argwöhnisch, paranoid. An sich sehr nützliche Eigenschaften in ihrem Metier, aber ärgerlich bei einem Geschäftspartner.
Das mit dem Geheimraum sprach sich allerdings sehr schnell herum, hauptsächlich, weil Jeff die anderen warnte, und ab da gingen sie, wenn sie über Henk reden wollten, einfach ins Pub.
Jeff sieht Susan an. »Darf ich dich noch was fragen?«
»Schieß los«, sagt Susan.
Jeff greift wieder nach Loubets Akte.
»Hat Henk irgendwann mal in diese Akte reingeschaut, meinst du?«
»Oh, Henk hat in alles reingeschaut«, sagt Susan.