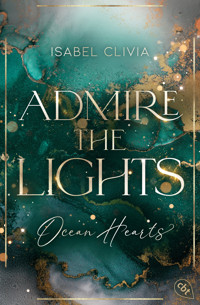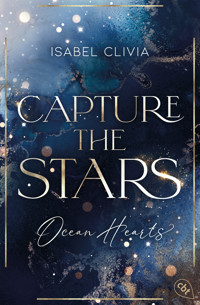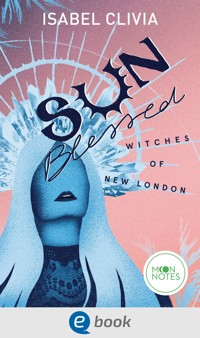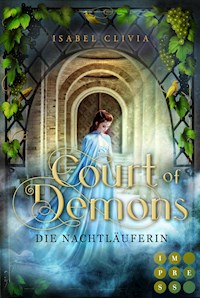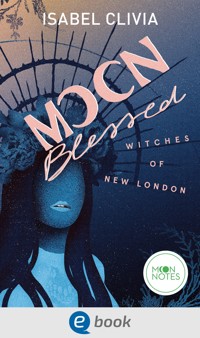
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In einem Netz aus Lügen … Obwohl Reva einer Verschwörung innerhalb der Elite von New London auf die Spur gekommen ist, konnte sie den wahren Verantwortlichen für die Mordserie in der Menschenwelt nicht finden. Weil die Unruhen in der Hexengesellschaft immer größer werden, kehrt sie auf der Suche nach Antworten in ihre magische Heimat zurück. Inmitten rauschender Feste muss sie erkennen, wer Freund und wer Feind ist. Dabei sind ihre heimlichen Gefühle für Gabriel alles andere als hilfreich. Insbesondere, da er fest davon überzeugt ist, seine Pflichten als Frühlingserbe erfüllen zu müssen. Doch nicht nur ihre verbotene Sehnsucht erschwert die Ermittlungen, sondern auch die wachsende Dunkelheit in ihr selbst. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem sie alles verlieren könnte … Moonblessed: Eine New-Adult-Romantasy mit einer Prise Crime - Einzigartig: Eine fesselnde Kombination aus Urban Romantasy und Crime, die Leser*innen ab 16 Jahren in ihren Bann zieht. - Spannend und magisch: Band 2 der erfolgreichen "Witches of New London"-Reihe von Bestsellerautorin Isabel Clivia. - Gegen alle Widerstände: Die junge Hexe Reva kämpft in dieser einzigartigen Second Chance-Liebesgeschichte gegen alle Regeln und für ihre Liebe zu Gabriel. - Voll im Trend: Moonblessed vereint meisterhaft die faszinierenden Themen Hexen, Crime und Liebe in einer packenden Geschichte, die ihre Leser*innen nicht mehr loslassen wird.Band 2 der "Witches of New London"-Reihe von Bestsellerautorin Isabel Clivia ist eine Urban Romantasy, die die Trendthemen Hexen und Crime vereint. Eine mitreißende Second-Chance-Liebesgeschichte für New-Adult-Leser*innen ab 16 Jahren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
FINDE DIE WAHRHEIT IN EINEM NETZ AUS LÜGEN
Obwohl Reva einer Verschwörung innerhalb der Elite von New London auf die Spur gekommen ist, konnte sie den wahren Verantwortlichen für die Mordserie in der Menschenwelt nicht finden. Weil die Unruhen in der Hexengesellschaft immer größer werden, kehrt sie auf der Suche nach Antworten in ihre magische Heimat zurück. Inmitten rauschender Feste muss sie erkennen, wer Freund und wer Feind ist. Dabei sind ihre heimlichen Gefühle für Gabriel alles andere als hilfreich. Insbesondere, da er fest davon überzeugt ist, seine Pflichten als Frühlingserbe erfüllen zu müssen. Doch nicht nur ihre verbotene Sehnsucht erschwert die Ermittlungen, sondern auch die wachsende Dunkelheit in ihr selbst. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, bei dem sie alles verlieren könnte …
Für Papa.
Weil du wie der Mond über mich wachst.
Kapitel 1
Schmerz pocht in jedem Winkel meines Körpers. Er breitet sich von meinem Rücken bis in meine Fingerspitzen aus, raubt mir die Luft zum Atmen und hindert mich daran zu schreien. Panik frisst sich wie ein zerstörerisches, unkontrollierbares Feuer durch mein Innerstes. Ich muss aufstehen und weglaufen, sonst wird die Person, die mich gerade hinterrücks auf dem Friedhof niedergestochen hat, mich eiskalt töten.
Verzweifelt versuche ich, den Arm zu heben, um nach meinem Handy zu tasten, aber mir fehlt die Kraft. Ein dumpfes Rauschen dröhnt in meinen Ohren.
Im nächsten Moment legt sich ein ungeheurer Druck auf mich. Jemand hat seinen Schuh auf meinem Rücken platziert, direkt über der pochenden Stichwunde, und presst mich in den Kies. Mir entfährt ein Keuchen.
»Mach schon!«, ruft die männliche Stimme gehetzt.
Die Frau schnaubt. »Bin dabei.«
Meine Gedanken rasen, während ich gegen Schmerz und die Ohnmacht ankämpfe.
Es sind zwei Personen. Ein Mann und eine Frau. Sie haben die zuletzt ermordeten Hexen gemeinschaftlich auf dem Gewissen, und wenn ich ihnen nicht entkomme, werde ich ihr nächstes Opfer sein.
Mit aller Macht stemme ich mich gegen den ungeheuren Druck auf meinem Rücken, doch es gelingt mir nicht, mich umzudrehen oder zu befreien.
Verdammter Mist, ich muss weg von hier!
Schwer atmend horche ich in meinen Körper hinein und strecke meinen Geist nach meiner Wintermagie aus. Seit ich den Blutzauber genutzt habe, ist sie mächtiger geworden, aber der Mond und meine schrecklichen Schmerzen schneiden mich fast vollständig von ihr ab. Es ist, als würde mich ein bodenloser Abgrund von ihr trennen.
Immer hektischer ringe ich nach Luft, doch mein Brustkorb kann sich kaum ausdehnen, weil ich so fest auf den Boden gedrückt werde. Meine Atemmuskulatur verkrampft sich, und mir treten Tränen in die Augen. Während die Wunde mit jeder Sekunde stärker schmerzt, rinnt mir ein eiskaltes Prickeln den Rücken hinab. Ein dunkles, unangenehm vertrautes Verlangen. Verheißungsvoll flüstert es mir zu, dass ich mehr Macht besitze, als ich glaube. Dass der Mond mich nicht unterwerfen kann. Heißes Blut quillt aus meiner Wunde hervor. Ich könnte es mit meiner Magie verbinden, bräuchte nur ein bisschen davon, um diese Macht zu entfesseln …
Gleißendes, silbriges Licht erhellt den Friedhof, und kurz darauf zerrt eine unsichtbare Kraft an mir. Es fühlt sich an, als bohrte sich ein Skalpell in meinen Kopf, das etwas aus mir herausschneiden will. Ich stöhne auf, spanne meine Muskeln an und winde mich verbissen, doch der Kerl über mir lässt mir keine Chance.
»Hast du es?«, ruft er.
Seine Komplizin stößt einen Fluch aus. »Gleich.«
Das Licht wird greller, das Reißen an meinem Körper noch heftiger. Ich weiß nicht, was schmerzhafter ist – die tiefe Verletzung in meinem Rücken oder dieses furchtbare Zerren, das mir die Lebensenergie aussaugt.
Schweiß rinnt mir die Schläfe hinab. Mein Herz schlägt so hart gegen meinen Brustkorb, dass ich fürchte, es könnte jeden Augenblick aus seinem Käfig aus Knochen und Muskeln ausbrechen.
Aufhören. Bitte.
Ich will diese Worte schreien, aber ich schaffe es nicht.
Das penetrante Piepsen in meinen Ohren drängt alle anderen Geräusche in den Hintergrund. Meine Finger zittern unkontrolliert. Mit letzter Kraft wehre ich mich gegen die Bewusstlosigkeit, die ihre kalten Klauen nach mir ausstreckt, während das Reißen an meinem Körper schlimmer wird. Es will mir etwas wegnehmen. Etwas Wichtiges, das ich nicht zu geben bereit bin.
Das silbrige Licht wird schwächer und gewährt der Dunkelheit mehr Raum.
»Es funktioniert nicht«, stellt die Frau frustriert fest.
»Was?«, ruft der Typ nervös. »Ist das Ding kaputt?«
»Nein, es wird bloß heißer. Als ob …« Ein Geräusch ertönt, das wie splitterndes Glas klingt. »Scheiße!«
Das Leuchten erlischt augenblicklich, und der Friedhof ist wieder komplett in Finsternis gehüllt. Sofort verschwindet das Zerren an meinem Körper, woraufhin Schwäche und Schmerz wieder in den Vordergrund treten.
»Was ist passiert?«, will der Mann wissen.
Die Frau flucht. »Der Stein ist kaputtgegangen. So ein Mist, das hätte nicht passieren dürfen!«
»Aber wie kann das sein? Sie ist doch eine –«
»Ja. Aber ihre Magie muss falsch sein. Sonst wäre er nicht zerborsten. Ich muss die Teile einsammeln, und dann verschwinden wir.«
»Und was sollen wir mit ihr tun? Sie töten?« Für jemanden, der wahrscheinlich schon ein paar Hexen auf dem Gewissen hat, klingt der Kerl absurd entsetzt.
»Lassen wir sie einfach hier liegen«, meint die Frau. »Sie wird sowieso sterben, wenn niemand sie findet.«
Ihr sachlicher Tonfall lässt mir das Blut in den Adern gefrieren.
»Muss das wirklich sein?«, fragt der Mann. »Wir tun, was nötig ist. Aber wenn sie keinen Nutzen für uns hat, müssen wir sie auch nicht sterben lassen. Sie hat unsere Gesichter nicht gesehen.«
»Und was willst du stattdessen tun?«, herrscht seine Komplizin ihn an. »Sie ins Krankenhaus bringen? Zu einem Heiler? Dann kannst du auch gleich ein Geständnis ablegen. Los, lass uns abhauen!«
Einige Sekunden lang ist es gespenstisch still. Dann hebt der unbekannte Kerl endlich seinen Fuß von meinem Rücken. Kies knirscht hinter mir, und die beiden entfernen sich, sodass ich allein mit dem Schmerz zurückbleibe.
Erschöpft krieche ich über den Boden, wo ich nach meinem Handy suche. Mein Rücken brennt wie Feuer und mein Körper ist so schwer, dass ich ihn kaum bewegen kann. Das Einzige, das mich überhaupt noch funktionieren lässt, ist mein Überlebensinstinkt. Ich habe vollständig die Orientierung verloren.
Als ich die Hoffnung beinahe aufgegeben habe, finde ich endlich mein Smartphone. Mit letzter Kraft entsperre ich das Gerät und öffne meine Anrufliste. Ich wähle die erste Nummer, die dort ganz oben auftaucht.
Es klingelt einmal. Zweimal. Dreimal.
»Komm schon«, flüstere ich schwer atmend.
Hier in der Menschenwelt ist bereits später Abend und Wochenende, was mir gerade nicht hilft. Aber er muss rangehen. Er muss einfach.
»Miss Graham?«, meldet sich eine tiefe Stimme nach dem vierten Klingeln. »Was ist los?«
Noch nie war ich so dankbar, Jonathan am anderen Ende einer Leitung zu hören.
»Jemand hat mich niedergestochen«, keuche ich. »Auf dem Friedhof. In der Nähe des Schleiertors. Ich brauche …«
Einen Heiler, will ich sagen, doch da fällt mir bereits das Telefon aus der Hand, und ich breche endgültig zusammen.
Auf einmal ist der Boden schrecklich kalt, obwohl mir so unerträglich heiß ist, dass ich schwitze. Meine Kraft hat mich verlassen, und ich kann nicht mehr klar denken.
»Miss Graham, können Sie mich hören?«, ruft Jonathan so laut, dass ich ihn sogar verstehe, ohne mir das Handy ans Ohr zu halten.
Die Ohnmacht überkommt mich wie ein gewaltsamer Schlaf, und das Letzte, woran ich denke, sind sanfte grüne Augen, die zu noch zärtlicheren Händen gehören. Hände, die mich heilen könnten, wären sie jetzt nur bei mir.
Kapitel 2
Ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich in den Garten hinter der Bernsteinvilla gekommen bin. Es muss mitten in der Nacht sein, denn die Sonne taucht die bunte Blumenwiese, auf der ich stehe, in goldenes Licht. Die Weide über mir spendet Schatten, und ihre Blätter wiegen sich in der leichten Brise. Ich blicke an mir hinab, auf meine nackten Füße und das hauchzarte weiße Kleid an meinem Körper.
Verwirrt sehe ich mich um. Alles an diesem Ort scheint friedlich. Bisher dachte ich immer, meine ganzen Regelbrüche würden mir einen Platz in der Hölle sichern, aber falls ich tot sein sollte, ist das definitiv das Paradies.
Wachsam wandere ich durch den farbenfrohen Garten und betrete das Heckenlabyrinth, wo ich mich in den schmalen, verwinkelten Korridoren verliere. Früher kannte ich mich hier drin mal gut aus, aber jetzt muss ich an jeder Weggabelung instinktiv entscheiden.
Sanfte Streichmusik und aufgeregtes Stimmengewirr dringen an meine Ohren. Ich folge den Geräuschen, bis ich den Ausgang des Labyrinths erreiche, wo überraschenderweise mein Bruder auf mich wartet. Ich mustere ihn verwirrt. Er trägt ein feines nachtblaues Gewand und farblich passenden Kajal. Die silbernen Perlmuttknöpfe seiner Kleidung schimmern im Sonnenlicht.
»Da bist du ja«, ruft er breit grinsend. »Ich warte schon eine Ewigkeit auf dich.«
»Auf mich? Wieso?«
»Wir kommen zu spät zum großen Ereignis.«
Er eilt an meine Seite und bietet mir seinen Arm an, den ich zögerlich ergreife. Mir ist absolut nicht klar, was eigentlich los ist, aber vielleicht wird Rami es mir ja gleich zeigen.
Gemeinsam lassen wir das Labyrinth hinter uns und gelangen zu dem versteckten Bereich dahinter, der durch Bäume und Sträucher vor Blicken von außen geschützt ist. Im Zentrum der kleinen Oase gibt es einen Teich, auf dem gelbe Seerosen schwimmen. Hinter ihm hat sich eine Gruppe von etwa fünfzig Hexen und Hexern versammelt, die auf sorgfältig aufgestellten Stühlen mit dem Rücken zu uns sitzen. In der zweiten von insgesamt fünf Reihen sind noch zwei Plätze frei. Wenn ich mich nicht täusche, sitzen Dad und Daisy bereits daneben.
Zwischen den Stuhlreihen befindet sich ein Korridor, an dessen Ende ich Gabriel entdecke. Er steht direkt vor dem Strauch, an dem die blauen Winterrosen wachsen, und trägt neben einem smaragdgrünen Gewand auch das Diadem seiner Familie, dessen goldene Blätter mit seinem braunen Haar zu verschmelzen scheinen. Er sieht atemberaubend aus und strahlt richtig, als wäre er wirklich glücklich. Seine Freude gilt jedoch nicht mir, sondern der Frau vor ihm, deren Hände er in diesem Moment festhält.
Lous jadegrüne Robe passt perfekt zu Gabriels Kleidung, und ihr Schmuck, in den einige Smaragde eingearbeitet sind, wirkt wie eine Liebeserklärung an sein Diadem. Ein Kranz aus Gänseblümchen ziert ihren blonden Lockenkopf. Sie hält den Blick gesenkt, starrt ihre Hände an, während Gabriel einen Ring an ihren Finger steckt und sich dann zu ihr hinunterbeugt. Als ihre Lippen aufeinandertreffen, ertönen einige Seufzer, und die übrigen Gäste applaudieren.
Scheint, als wäre ich doch in der Hölle gelandet.
Obwohl ich wegsehen will, schaffe ich es nicht, meinen Blick abzuwenden. Gabriel küsst Lou, wie er mich zuletzt geküsst hat, mit geschlossenen Augen und entspannter, zufriedener Miene, die man beinahe als Lächeln interpretieren könnte. Um ihre Handgelenke ist ein mit Blüten dekoriertes Stoffband gewickelt, das die Verbindung des Frühlingserben mit seiner Auserwählten symbolisieren soll.
Mir wird schlecht.
Ich lege die Hand auf meinen Bauch, und plötzlich ist da Blut, das aus einer unsichtbaren Wunde tritt. Wie ein dunkelrotes Lauffeuer breitet es sich aus und tränkt mein Kleid. Voller Entsetzen schreie ich auf.
»Was ist los?«, fragt Rami verwundert, wobei er gar nicht zu bemerken scheint, was mit mir passiert.
Mein Puls wird schneller und mein Atem flacher. Wo kommt all das Blut her? Es breitet sich unaufhaltsam auf meinem Kleid aus, aber niemand interessiert sich dafür. Die Gäste ignorieren mich. Sie haben den Blick auf das Brautpaar gerichtet, das sich weiter leidenschaftlich küsst.
»Mach, dass es aufhört!«, rufe ich panisch und kralle die Finger in Ramis Oberarm.
Mit weit aufgerissenen Augen starre ich nach vorn zu Gabriel und Lou, die eng umschlungen beieinanderstehen.
»Gabe!«, schreie ich verzweifelt. »Gabe, hilf mir!«
Immer wieder kreische ich seinen Namen, doch er nimmt mich überhaupt nicht wahr.
Tränen brennen in meinen Augen, und ich kann nicht mehr atmen. Mein Blut hat bereits einen Großteil meines Kleides durchdrungen, sodass der Stoff nicht länger weiß, sondern rot ist. Warum ist da bloß so viel davon? Wieso hilft mir denn niemand?
Gabriel zieht Lou an sich, während er sie stürmisch küsst. Ihre Hände ruhen auf seiner Brust, ihre Finger sind in seinem Hemd vergraben. Jeder kann sehen, wie sehr sie sich wollen, und es macht ihnen nichts aus, dass wir ihre Leidenschaft miterleben.
»Nein«, wispere ich unter Tränen. »Aufhören. Bitte.«
Ein Ruck geht durch meinen Körper, und ich schlage die Augen auf.
Heftig atmend starre ich an eine sterile, weiße Decke. Mein Herz rast in meiner Brust, und ich bin so außer Atem, dass es mir vorkommt, als wäre ich gerade einen Marathon gelaufen. Die Muskeln in meinem Rücken schmerzen höllisch.
»Du bist wach!«
Ich drehe meinen Kopf in die Richtung, aus der die vertraute, erleichterte Stimme gekommen ist, und entdecke Naomi. Sie sitzt auf einem Stuhl direkt neben der Pritsche, auf der ich liege. Das bisschen Tageslicht, das zwischen den heruntergelassenen Jalousien hindurchscheint, zaubert einen beneidenswerten Glanz auf ihr schwarzes Haar.
»Ich hab mir solche Sorgen gemacht!«, ruft sie, bevor sie meine Hand berührt.
Ich atme tief durch und versuche, meinen Herzschlag zu beruhigen. »Was ist denn passiert?«
Kummer huscht über ihr Gesicht. »Jonathan hat mich gestern angerufen und gesagt, du wurdest auf dem Friedhof verletzt. Er hat sofort eine Frühlingshexe mit Heilfähigkeiten hingeschickt. Du warst wohl schon total bleich, und es sah echt übel aus, aber sie hat dich zum Glück wieder hinbekommen.«
Ich blicke an mir hinab und muss geschockt feststellen, dass ich noch immer die Kleidung von gestern Abend trage. Das Blut darauf ist inzwischen getrocknet.
»Wo bin ich überhaupt?«, frage ich erschöpft.
»Auf der Krankenstation der magischen Abteilung. Sie wollten dich heute Nacht noch hierbehalten.«
Bevor ich eine weitere Frage stellen kann, wird die Tür aufgerissen und Jonathan stürmt wie eine riesige, brodelnde Gewitterwolke ins Zimmer. Am Fußende der Pritsche bleibt er stehen.
»Sie sind endlich wach«, sagt er ernst.
Falls ihn diese Tatsache erleichtert, spricht er es nicht aus. Natürlich nicht, denn dann könnte man ja auf die Idee kommen, dass der knallharte Chef der magischen Abteilung vielleicht doch ein weiches Herz in seiner harten Brust versteckt.
Ich richte mich auf und lehne mich mit dem Rücken gegen die Wand. Obwohl er noch schmerzt, scheint die Wunde vollständig geheilt worden zu sein, denn ich spüre keinen Verband oder ein Pflaster.
»Dass ich noch lebe, ist wohl Ihr Verdienst«, erwidere ich. »Danke für die Rettung.«
»Unsere Heilerin MsSpencer hat Sie gerettet«, weist er das Lob von sich. »Ich habe nur meinen Job gemacht und sie zu Ihnen geschickt.«
Mir entfährt ein Seufzer. Dem Mann könnte man eine Heldenmedaille um den Stiernacken hängen und er würde trotzdem darauf bestehen, sie nicht zu verdienen.
»Was ist auf dem Friedhof passiert?«, will er von mir wissen.
Ich kneife die Augen zusammen. Die Erinnerungen daran sind blass, als wären sie hinter einem Nebelschleier verborgen, aber ich versuche dennoch, sie zu erreichen.
»Kurz nachdem ich dort angekommen war, konnte ich nicht mehr atmen«, erzähle ich. »Irgendwer muss Herbstmagie auf mich angewandt haben. Ich bin zusammengebrochen, und man hat mir eine Klinge in den Rücken gestoßen.«
Beim Gedanken an den Schmerz bekomme ich eine Gänsehaut. Hätte ich merken müssen, dass ich nicht allein dort gewesen bin? Haben diese Leute mir aufgelauert? Oder nur irgendwem?
»Ich wurde zu Boden gedrückt und konnte nichts sehen«, fahre ich fort. »Aber ich weiß noch, dass es zwei Personen waren. Ein Mann und eine Frau. Ich bin mir absolut sicher, dass sie die Mörder sind, die wir suchen.«
Jonathan verschränkt die Arme vor der Brust. »Warum denken Sie das?«
»Na ja, es war Vollmond«, antworte ich. »Und der Kerl meinte so was wie: Wir müssen sie nicht töten, wenn sie uns nichts nützt. Es klang, als hätten sie das schon öfter gemacht.«
Naomi drückt meine Hand und sieht mich besorgt an.
»Warum haben sie Sie dann am Leben gelassen?«, fragt Jonathan sachlich. »Nach all den Opfern kann ich mir kaum vorstellen, dass sie auf einmal Schuldgefühle entwickeln.«
In Gedanken lasse ich die Geschehnisse auf dem Friedhof Revue passieren und krame in meinen Erinnerungen nach Details. Der unbekannte Typ hat gewirkt, als hätte er zumindest einen Funken Moral übrig. Und die Frau … sie hat etwas Seltsames gesagt.
»Ich glaube, sie haben von mir nicht das bekommen, was sie wollten«, mutmaße ich.
Jonathan hebt seine dichten Brauen. »Warum denken Sie das?«
Ich massiere mir mit Daumen und Zeigefinger die Nasenwurzel. »Weil die Frau meinte, etwas an mir wäre nicht richtig. Es klang, als wäre meine Magie das Problem. Als ob sie was Bestimmtes suchen würden, das ich ihnen nicht geben konnte. Und etwas ist zu Bruch gegangen, aber ich weiß nicht, was es war. Hat man irgendwas in meiner Nähe gefunden?«
Naomi schüttelt den Kopf. »Nein, nichts.«
Verdammt. Mir ist nicht ganz klar, wonach diese Personen gesucht haben könnten. Ich bin eine Sonnengeborene, so wie alle anderen Opfer es auch mal waren. War ihnen das bewusst? Ich kann mir keinen Reim auf die ganze Sache machen. Woher wussten sie, dass ich falsch bin, ohne mein Gesicht oder mein Hexenzeichen zu sehen? Und was hatte es mit diesem Splittern auf sich?
»Sonst noch etwas?«, fragt Jonathan ernst.
Ich starre das Fenster an und beobachte die Sonnenstrahlen zwischen den Jalousien. »Da war ein Licht. Könnte zu einem Leuchtkristall gehört haben. Aber als es aufgetaucht ist, hatte ich das Gefühl, als würde eine seltsame Kraft versuchen, mir etwas aus meiner Brust zu reißen. Und dann ist beides ganz plötzlich wieder verschwunden.«
Als ich an dieses gewaltsame Zerren zurückdenke, erschaudere ich. Es war beinahe schwerer zu ertragen als der Schmerz meiner Verletzung, weil es mehr als Blut aus mir herausholen wollte. Einen wichtigen Teil von mir, mit dem ich eng verbunden bin.
»Konnten Sie die Gesichter der beiden Personen erkennen?«, hakt Jonathan nach.
Ich schüttele den Kopf. »Bevor ich mich umdrehen konnte, hat der Kerl mich schon zu Boden gedrückt. Und dann waren sie ganz schnell weg. Sind wahrscheinlich durch den Schleier abgehauen.«
Mein Chef kratzt sich an der Stirn. »Wissen Sie noch, zu welcher Uhrzeit das ungefähr passiert ist? Vielleicht hat jemand auf der New Londoner Seite etwas Verdächtiges beobachtet.«
»Wollen Sie damit an die Öffentlichkeit?«, ruft Naomi überrascht.
»Die Öffentlichkeit weiß bereits von den Vorfällen«, erwidert er. »Wir sind uns nicht sicher, wie das passieren konnte. Möglicherweise sind die Täter selbst dafür verantwortlich. Bisher glaubt man allerdings, dass die Opfer Mondgeborene waren.«
Das Gleiche hat auch Lydia Silverstein behauptet. Sie hat die Morde instrumentalisiert, um gegen Sonnengeborene und ihre Proteste zu wettern. Bisher dachte ich bloß, dass sie von den Morden wusste, weil sie daran beteiligt war.
»Wir sollten das richtigstellen«, sage ich.
»Dafür ist es noch zu früh«, meint Jonathan. »Es würde die aktuellen Unruhen in der New Londoner Bevölkerung nur weiter verstärken. Die Stimmung dort ist auch so schon angespannt.«
Ich presse die Lippen aufeinander. Angespannt ist gar kein Ausdruck für das, was ich vor ein paar Tagen bei der Demonstration erlebt habe. Ein eigentlich friedlicher Protest hat mit Gewalt und Kämpfen zwischen den beiden Lagern geendet, und zu dem Zeitpunkt wussten die Beteiligten nicht einmal von der Mordserie.
»Aber Sie können die Leute doch nicht im falschen Glauben lassen!«, rufe ich entsetzt.
Jonathan bleibt ernst. »Es ist besser so. Niemand würde tatsächlich glauben, dass diese Morde gezielte Angriffe auf Mondgeborene waren. Dafür gibt es zu viele von ihnen. Vielleicht sind diese Unruhen ja sogar genau das, was die Täter mit ihren Verbrechen bezwecken wollen.«
Im ersten Moment kann ich mir das kaum vorstellen, schließlich sind die Morde in der Menschenwelt verübt worden und nicht in New London. Außerdem haben diese Personen sich gezielt Opfer gesucht, die früher einmal sonnengeboren waren, bevor ein Zauber sie zu Mondgeborenen gemacht hat. Aber was, wenn Jonathan doch recht hat? Wenn das alles geschickt eingefädelt war, um die politische Lage eskalieren zu lassen? Irgendwer hat die Gunst der Stunde genutzt und die Morde mit den Protesten in Verbindung gebracht, um beide Gruppen gegeneinander aufzuwiegeln. Kann das wirklich Zufall sein? Immerhin bin ich eine Sonnengeborene, also hätten die beiden Täter mich töten können, wenn es ihnen nur darum gegangen wäre, Leute wie mich umzubringen. Es wirkte jedoch vielmehr, als hätten sie sich etwas anderes von mir erhofft.
Aber ihre Magie muss falsch sein.
Was könnten sie damit gemeint haben? Suchen sie nach Opfern, die ein bestimmtes Element beherrschen, so wie Jack the Ripper damals? Josephine Hill war eine Herbsthexe und Mr Darwin ein Sommerhexer. Wie passe ich dort hinein? Und wenn ich nicht passe, warum nicht?
Mir schwirrt der Kopf. In den letzten Tagen war ich mir so sicher, dass wir den Grund für die Morde kennen und Lydia in die Sache verwickelt ist. Aber was, wenn bei ihrer Befragung mit dem Wahrheitskristall, die bald stattfindet, nichts herauskommt? Dann stünden wir wieder ganz am Anfang.
»Falls Lydia Silverstein nichts damit zu tun hat und die beiden nicht ihre Komplizen sind, müssen wir dringend was unternehmen!«, dränge ich.
»Wir?«, wiederholt Naomi unsicher.
»Sie werden nichts dergleichen tun, MsGraham«, herrscht Jonathan mich an. »Es reicht, dass Sie fast gestorben sind. Ich werde Sie von den Ermittlungen abziehen.«
»Was?«, rufe ich. »Aber das können Sie nicht!«
»Ich kann und ich werde.«
Sofort richte ich mich auf und lasse meine Füße von der Pritsche baumeln. Meine Magie ist unruhig, regt sich kalt in meinem Blut. Am liebsten würde ich dem Drang nachgeben, sie freizulassen.
»Keine Ahnung, was diese Personen vorhaben«, sage ich dann zu meinem Chef. »Aber wenn ich nicht das richtige Opfer für sie bin, dann bin ich die perfekte Ermittlerin. Außerdem kenne ich jetzt ihre Stimmen, was ein entscheidender Vorteil sein könnte. Sie haben selbst gesagt, dass das mein Fall ist. Lassen Sie mich ihn zu Ende bringen.«
Jonathan und Naomi starren mich an, ohne etwas zu sagen. Vielleicht sind sie überrascht von meiner Entscheidung, immerhin wollte ich ursprünglich nicht lange in New London bleiben. Selbst jetzt würde ich eine Rückkehr gern vermeiden, weil ich mich davor fürchte, was der Blutzauber, mit dem ich Gabriels Leben gerettet habe, mit mir gemacht hat. Dieses dunkle Verlangen nach mehr Macht und mehr Wissen verbirgt sich tief in mir, und ich weiß nicht, ob es je wieder verschwindet. Außerdem wäre da noch der Blutschwur, den ich gegenüber Diana geleistet habe. Sie könnte ihn jederzeit einfordern.
Aber diesen Fall muss ich trotzdem abschließen. Ich bin das einzige Opfer, das überlebt hat, und wenn ich mit jeder verdammten Person in New London reden muss, um die Täter aufzuspüren, werde ich das tun.
Jonathan atmet schwer ein und aus. »Also schön, Sie dürfen weiter ermitteln. Aber Sie müssen mir versprechen, dass Sie vorsichtig sind.«
Ich lächele ihn dankbar an und nicke.
Das Versprechen gebe ich ihm allerdings nicht, denn ich weiß, dass ich es wahrscheinlich brechen werde.
Kapitel 3
Wir bleiben in der Menschenwelt, bis ich mich ganz von den Folgen meiner Verletzung erholt habe. Obwohl die Wunde sofort geheilt worden ist, steckt mir der Schmerz noch einige Tage in den Knochen. Ich hatte schon wieder vergessen, dass nicht alle Frühlingshexen mit Heilfähigkeiten so begnadet sind wie Gabriel. Die meisten können zwar Wunden heilen, aber nicht den kompletten Schmerz nehmen. Manchmal wird man nach diesem Prozess sogar krank, weil der Körper von Nicht-Frühlingshexen nur schwer damit umgehen kann. Gabriel ist ein Ausnahmetalent. Wie bei so vielen Dingen. Es ist, als wollten die Sterne ihn um jeden Preis besonders machen. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen.
Pünktlich zu Lydias Verhandlung kehren Naomi und ich wieder nach New London zurück, um dem Prozess beizuwohnen.
Das Hohe Gericht befindet sich im Sommerbezirk, darum überrascht es kaum, dass es ein übertrieben herrschaftliches Gebäude ist, an dessen dunkler Fassade rote Flaggen mit einem Flammensymbol hängen. Die weißen Marmorsäulen und goldenen Feuerschalen vor dem Haupteingang erinnern mich an den Rubinpalast, bei dem keine Gelegenheit ausgelassen worden ist, den Reichtum der Campbells zu zeigen. Neben diesem beeindruckenden Bauwerk fühle ich mich klein und unbedeutend.
Auf unserem Weg durch die hohen, schmucklosen Hallen begegnen uns eine Menge Bedienstete. Sie tragen tiefrote, goldbestickte Roben, die sie furchtbar wichtig aussehen lassen. Außer ihnen sind heute kaum andere Leute da, weil die Befragung unter Ausschluss der breiten Öffentlichkeit stattfindet.
Das ist auch der Grund, warum die Ränge auf den beiden Emporen des kleinen Verhandlungssaals im Westflügel beinahe leer sind. Als wir oben ankommen, sitzt nur Gabriel auf der gepolsterten Holzbank in der ersten Reihe. Er starrt konzentriert in den Saal hinab, während einer der Verhandlungsführer bereits damit begonnen hat, das Vorgehen bei der Befragung zu erläutern.
Wir lassen uns still am anderen Ende der Bank nieder, woraufhin Gabriel seinen Kopf in meine Richtung dreht. Unsere Blicke begegnen sich kurz. Seiner ist fragend, meiner dagegen ausweichend, denn seine grünen Augen machen mich so nervös, dass ich mich schnell abwenden muss. Auf einmal ist mein Albtraum von seiner Hochzeit wieder sehr präsent in meinen Gedanken. Dieser schreckliche Traum, in dem ich verblutet bin, während er Lou an sich gezogen und geküsst hat.
Hör auf, daran zu denken, ermahne ich mich.
Ich muss mich dringend zusammenreißen. Schließlich bin ich nur wegen der Verhandlung hergekommen, also sollte ich mich auch auf sie konzentrieren, statt Gabriel anzuschmachten. Von jetzt an werde ich ihn wieder wie einen Freund behandeln. Einen Freund, den ich rein zufällig auf verbotene, schmerzhafte und zutiefst unfreundschaftliche Art liebe.
»Du könntest dich auf meine andere Seite setzen«, schlägt Naomi leise vor. »Dann hast du einen Puffer.«
Ich sehe sie entsetzt an. »Bin ich so offensichtlich?«
»Nur für mich«, versichert sie und lächelt aufmunternd. »Du brauchst dringend Ablenkung, Süße.«
»Dann haben wir ja Glück, dass die Verhandlung jetzt losgeht.«
Ich richte meinen Blick nach vorn und lausche den Worten des hochgewachsenen, langhaarigen Verhandlungsführers, der neben dem ehrenwerten Richter steht und das Verfahren erläutert.
Lydia befindet sich bereits im Saal und sitzt auf einem Stuhl, der wenige Meter vom Gerichtspersonal entfernt ist. Sie hält sich aufrecht und stolz, aber sogar von hier oben kann ich ihr zerzaustes Haar und ihr blasses Gesicht erkennen. Von der akkuraten Hochsteckfrisur ist nichts mehr übrig, und sie trägt ein schmuckloses schwarzes Outfit, das im Gegensatz zu ihren ansonsten edlen Roben steht. Man wird sie wegen ihres Standes zwar nicht in den Hochsicherheitstrakt gesteckt haben, aber das Gefängnis von New London soll für niemanden angenehm sein. Das sieht man ihr auch an.
Auf der Empore, die unserer gegenüberliegt, entdecke ich Lydias Ehemann, der mit ernster Miene auf seinem Platz sitzt und das Geschehen beobachtet. Immer wieder wirft er Gabriel finstere Blicke zu. Obwohl sie an ihm abzuprallen scheinen, entgeht mir nicht, dass er die Hände in seinem Schoß ballt. Er sieht blass aus.
»Beginnen wir mit der Befragung«, verkündet der Richter lautstark.
Ein Bediensteter eilt an Lydias Seite, löst ihre Fesseln und legt einen farblosen Wahrheitskristall in ihre Hand. Je nachdem, ob sie die Wahrheit sagt oder lügt, wird er sich bei ihren Aussagen grün oder rot färben.
Der Richter erhebt sich von seinem Platz und nimmt eine gerade Haltung ein. »Lydia Silverstein, Sie werden des Mordes an insgesamt fünf Hexen und Hexern beschuldigt. Josephine Hill, Milton Nicholls, Florence Parker, Emma Morris und Robert Darwin. Ich beginne mit der ersten Frage: Haben Sie sich in den vergangenen sechs Monaten zu irgendeiner Zeit in der Menschenwelt aufgehalten?«
Ich verdrehe die Augen. Warum kann er nicht einfach fragen, ob sie diese Leute getötet oder etwas mit ihrem Tod zu tun hat?
»Nein«, antwortet Lydia bissig, als hielte auch sie die Frage für reine Zeitverschwendung.
Unglaublich, wie überheblich jemand erscheinen kann, der bis eben noch wegen mehrerer Mordversuche am eigenen Neffen eingesessen hat und einer weiteren Mordserie beschuldigt wird.
Der Wahrheitskristall färbt sich grün und bestätigt ihre Aussage, was mich kaum überrascht. Lydia war noch nie der Typ dafür, sich die Hände schmutzig zu machen.
»Haben Sie eine, mehrere oder sogar alle der genannten Personen getötet?«, fragt der Richter dann endlich.
Jetzt spanne auch ich mich an, und mein Puls wird schneller. Das ist der Moment der Wahrheit.
»Nein«, erwidert Lydia. »Und um die nächste Frage vorwegzunehmen: Ich habe auch niemanden damit beauftragt, es zu tun.«
Die Farbe des Kristalls bleibt weiterhin grün, und ich sacke ein wenig in mir zusammen.
Es sollte mich beruhigen, dass Gabriels Tante nicht auch diese Verbrechen zu verantworten hat. Trotzdem macht sich Enttäuschung in mir breit. Weil es bedeutet, dass wir weiterhin im Dunkeln tappen. Die beiden Personen, die mich attackiert haben, handeln nicht in ihrem Auftrag, und sie wird uns deshalb nichts über sie verraten können.
Naomi seufzt. »Tja, das ist …«
»Ernüchternd«, murmele ich so leise, dass Gabriel es hoffentlich nicht mitbekommt.
Ich riskiere einen Seitenblick. Er starrt nach unten und beobachtet seine Tante. Ein Schatten huscht über sein Gesicht, und ich habe das Gefühl, dass er es jetzt schon bereut, sie ausgeliefert zu haben. Denkt er, dass er das, was sie ihm angetan hat, anders hätte lösen müssen, um den Rest seiner Familie zu schützen? Um Grace und Charlie nicht ihre Mutter zu nehmen? Ich würde gern meine Hand auf seine legen und ihm beruhigende Worte zuflüstern, aber er ist zu weit weg, und vielleicht ist das besser so.
»Wissen Sie etwas über die Gründe, warum diese Leute getötet wurden?«, fragt der Richter, woraufhin ich mich wieder dem Geschehen unten im Saal zuwende.
»Ich vermute, dass diese Protestierenden etwas damit zu tun haben«, meint Lydia abschätzig. »Erst die Verbrechen, dann die Auseinandersetzungen auf offener Straße … Ich kann Ihnen nicht sagen, was dazu geführt hat, aber das ist meine Vermutung.«
Nur mit Mühe kann ich mich davon abhalten, aufzuspringen und sie vor aller Augen eine hasserfüllte Schlange zu nennen. Selbst jetzt, in dieser Position, facht sie den politischen Konflikt noch weiter an. Und das Schlimmste daran ist, dass sie fest von ihren Worten überzeugt sein muss, sonst würde der Kristall inzwischen rot in ihrer Hand aufleuchten.
»Sie sind also nicht für diese Verbrechen verantwortlich?«, hakt der Richter noch einmal nach, als würde er sichergehen wollen.
Lydia stöhnt entnervt auf. »Nein. Wie ich bereits sagte.«
»Also haben Sie auch niemanden angestiftet, diese Taten zu begehen?«
»Natürlich nicht.«
»Hat es jemand in Ihrem Namen getan, ohne dass Sie darum bitten mussten?«
»Was für eine lächerliche Anschuldigung. Nein.«
»Das bedeutet, Sie waren nicht in der Nähe, als diese Personen getötet wurden?«
»War ich nicht«, bestätigt Lydia süffisant. »Die Ausnahme ist Robert Darwin. Ihn habe ich vor seinem Tod auf der Party gesehen. Da war er allerdings noch quicklebendig. Ich habe ihn den Turm hinaufgehen, aber nicht wieder herunterkommen sehen. Nicht auf normalem Weg, jedenfalls. Das habe ich der Polizei schon an jenem Abend gesagt.«
Die Erinnerungen an Robert Darwins Sturz kehren unerbittlich in mein Gedächtnis zurück. Ich muss an die Schreie der Gäste denken, als sein Körper auf dem Boden aufkam, und an das hemmungslose Schluchzen seiner Frau, als sie ihn trotz des entstellten Leichnams erkannt hat. Diese grässlichen Bilder würde ich gern verdrängen, aber es gelingt mir nicht.
»Ich habe keine weiteren Fragen mehr«, verkündet der Richter.
Kurz darauf nimmt der Bedienstete Lydia den Wahrheitskristall ab und legt ihr die Fesseln wieder an, bevor er auf seinen Platz zurückkehrt.
Das war es jetzt also. Damit stehen wir wieder nahezu am Anfang. Verdammter Mist. Es muss doch irgendwas geben, das uns auf die Spur der wahren Täter bringt. Nur was?
»Diese Befragung ist beendet.« Die dröhnende Stimme des Richters hallt von den hohen Wänden des Saals wider. »Aufgrund des Ergebnisses wird die Angeklagte bezüglich der jüngsten Mordserie in allen Punkten freigesprochen und darf in ihre Zelle zurückehren.«
Stühle werden gerückt, und Gemurmel dringt nach oben.
»Vorher will ich mit meinem Ehemann sprechen!«, ruft Lydia. »Das ist das Mindeste, das man mir zugestehen sollte, nachdem ich meine Zeit mit dieser sinnlosen Befragung verschwendet habe.«
Ich schürze die Lippen. Nicht zu fassen, dass diese Frau sogar noch Forderungen stellt!
Der Richter seufzt. »Meinetwegen. Man wird Sie in einen separaten Raum führen und Ihnen ein paar Minuten geben.«
Er sammelt die Unterlagen auf dem Pult vor sich ein, bevor er durch eine Hintertür aus dem Raum verschwindet. Daraufhin erhebt sich Lydias Mann auf der gegenüberliegenden Seite und verlässt die Empore, während sie unten von einem Bediensteten abgeführt wird.
»Wusste gar nicht, dass wir hier bei Wünsch-dir-was sind«, kommentiert Naomi fassungslos.
Kurz huscht mein Blick zur Hintertür, durch die der Richter gegangen ist. »Ich glaube, mir kommt gerade eine Idee.«
»Was?«, fragt meine Freundin. »Was ist los?«
Ich sehe sie an. »Bin gleich wieder da.«
Ohne eine Antwort abzuwarten, stehe ich auf, eile die Stufen der Empore hinunter und folge dem Richter. Mit großen Schritten durchquere ich das Gebäude, wobei ich einigen Mitarbeitenden aus dem Weg gehen muss.
In einem lang gezogenen Korridor, in dem einige Bilder von würdevollen, vermutlich sehr wichtigen Personen hängen, hole ich den Richter endlich ein. Sein roter Umhang weht wie das Cape von Superman, während er durch den Gang hastet, aber für Superman ist der Mann eindeutig zu schmächtig.
»Euer Ehren?«, rufe ich.
Er hält abrupt inne und wendet sich mir zu. Als ich vor ihm zum Stehen komme, blitzt Erkenntnis in seinen klugen grauen Augen auf, und ein feines Lächeln umspielt seine Lippen.
»Lady Reva Graham«, grüßt er mich. »Beim letzten Mal, als ich Sie gesehen habe, saßen Sie für unerlaubten Magiegebrauch in der Öffentlichkeit auf meiner Anklagebank. Wie man hört, ist das auch heute noch eine Ihrer Spezialitäten.«
Ich winde mich unter seinem tadelnden Blick und kann mir ein schuldbewusstes Grinsen nicht verkneifen. Er war damals derjenige, der mir nach meinem Magieausbruch in der Bernsteinvilla eine Geldstrafe aufgebrummt hat. Als ich letzte Woche für den Angriff auf Lydia eine weitere Strafe bekommen habe, war allerdings eine andere Richterin im Saal. Wer weiß, vielleicht sind die beiden ja befreundet und tauschen sich regelmäßig über ihre Fälle aus.
»Für das letzte Mal konnte ich nichts«, rede ich mich raus, obwohl das nur die halbe Wahrheit ist.
Die Nachwirkungen des Blutzaubers haben mich zwar stark beeinflusst, aber ich habe Lydia wissentlich angegriffen, und wenn die Richterin das geahnt hätte, wäre ich sicher nicht mit einer einfachen Geldstrafe davongekommen.
Über den goldenen Rand seiner viel zu kleinen Brille hinweg wirft der Richter mir einen strengen Blick zu. »Sie sind nicht hier, um mit mir über Ihre Fehltritte zu sprechen, nehme ich an.«
Ich lächele ertappt. »Nein, Euer Ehren. Ich habe der Verhandlung beigewohnt. Aber die ist nicht der Grund, weshalb ich mit Ihnen reden muss.«
Er neigt den Kopf. »Ich höre.«
Ich hole tief Luft. »Wie Sie wahrscheinlich in den Akten gesehen haben, ermittele ich für die magische Abteilung der Londoner Polizei. Wir wollen diese Mordserie unbedingt aufklären, und es gibt eine Person, die ich in der Sache gern befragen würde. Dafür brauche ich allerdings eine Genehmigung, die nicht viele Leute erteilen können.«
Sofort werden die grauen Augen des Richters schmal. »Soweit ich weiß, waren die Opfer alle Hexen. Und da mit Mr Darwin nun auch ein Opfer aus New London hinzugekommen ist, hat unsere Polizei die Ermittlungen übernommen. Es dürfte also nicht länger nötig sein, dass Ihre Abteilung sich damit befasst.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe. Prinzipiell hat er recht, aber unsere Abteilung hat die ersten Fälle untersucht, darum sind wir streng genommen noch immer für deren Aufklärung zuständig – mit Ausnahme des Mordes an Robert Darwin. Außerdem traut Jonathan der Arbeit der New Londoner Polizei nicht über den Weg. Wenn man Ergebnisse will, kümmert man sich lieber selbst, ist quasi sein Lebensmotto.
»Meiner Meinung nach ist es nötig«, entgegne ich forsch. »Deshalb will ich Sie um einen Gefallen bitten. Ich brauche die Erlaubnis dafür, den Hochsicherheitstrakt im Gefängnis zu besuchen. Sie sind einer der beiden obersten Richter, also könnten Sie mir eine Genehmigung erteilen.«
Er hebt die Augenbrauen so sehr, dass sie fast mit seiner Haarlinie verschmelzen. »Und wen genau wollen Sie dort befragen?«
Ich schlucke. »Jack Smythe.«
Der Name allein treibt ihm die Blässe ins Gesicht. »Warum sollten Sie den Ripper treffen wollen?«
Diese Frage habe ich mir auf dem Weg von der Empore bis hierher auch ein paarmal gestellt, und noch bin ich unsicher, ob die Antwort irgendwen überzeugen kann.
»Weil auch er mehrere Hexen ermordet hat«, erkläre ich. »Manchmal muss man die Perspektive eines Mörders einnehmen, um einen Mörder zu verstehen, auch wenn es makaber klingt. Diese Taten haben ein System. Wenn wir Glück haben, kann Smythe uns dabei helfen, es zu entschlüsseln.«
Der Richter rümpft empört die Nase. »Dieser Mann sitzt seit fast einhundertfünfzig Jahren im Gefängnis. Er hatte schon damals den Verstand verloren. Glauben Sie wirklich, er würde Ihnen helfen?«
»Ich weiß es nicht«, gebe ich zu. »Aber ich verschwende lieber meine Zeit, als es gar nicht erst zu versuchen.«
Er schüttelt den Kopf. »Für diese unerhörte Idee werde ich keine Ausnahmegenehmigung erteilen. Und meine Frau wird das sicher auch nicht tun. Wenn Sie Ihren Plan also unbedingt in die Tat umsetzen wollen, müssen Sie einen Antrag stellen und den Rat entscheiden lassen.«
Meine Miene gefriert zu Eis. Die andere oberste Richterin ist seine Frau? Dann habe ich wenig Zuversicht.
»Ein Antrag braucht Zeit«, beschwere ich mich, und allein das Wort Antrag sorgt dafür, dass ich am liebsten die Augen verdrehen würde.
Der Richter zuckt mit den Schultern. »Dann bleibt Ihnen nur die Möglichkeit, eine Ausnahmegenehmigung beim Ratsmitglied der Sommerhexen zu erwirken.«
Alexandra Campbell.
Das Gefängnis befindet sich in ihrem Bezirk, aber bei ihr brauche ich es gar nicht erst zu versuchen. Sie wird mir niemals eine solche Genehmigung erteilen, und während der Einbruch in die Archive des Frühlingsbezirks noch mal gut gegangen ist, werde ich mein Glück kein zweites Mal versuchen. In der Geschichte von New London hat es kein einziger Gefangener je geschafft, aus dem Gefängnis auszubrechen, geschweige denn aus dem Hochsicherheitstrakt. Ich muss mir also keine Hoffnungen machen, dass es mir gelingen könnte, dort ungesehen hineinzugelangen. Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, als einen Antrag einzureichen. Der wahrscheinlich scheitern wird, weil ich nur zwei von vier Stimmen sicher habe – die meiner Schwester und die von Gabriel. Wenn eine Abstimmung unentschieden ausgeht, entscheidet leider die Stimme desjenigen Ratsmitgliedes, das über die Hoheit des vom Antrag betroffenen Bezirks verfügt. Damit wäre ich wieder bei Alexandra.
»Danke für Ihre Hilfe«, sage ich eine Spur zu ironisch, bevor ich mich von dem Richter abwende und den Rückweg antrete.
Auf der Suche nach Naomi entdecke ich Gabriel im Flur vor dem Verhandlungssaal, der sich mit einem Gerichtsdiener unterhält. Bei seinem Anblick kommt mir eine Idee.
Ich bleibe auf Abstand und warte darauf, dass sie das Gespräch beenden. Sobald sie sich voneinander verabschiedet haben, gehe ich zu Gabriel und bleibe vor ihm stehen.
Er mustert mich intensiv. Meine Haut prickelt bei der Art und Weise, wie er das tut.
»Ich wollte dich schon fragen, warum du wieder zurück bist«, sagt er. »Aber nach allem, was da drin ans Licht gekommen ist, hat sich das wohl erübrigt.«
Er klingt fast enttäuscht, als hätte er gehofft, ich wäre aus einem anderen Grund hier.
Mir entfährt ein Seufzer. »Ich war mir so sicher, dass Lydia was mit den Morden zu tun hat … Jetzt fühlt es sich an, als müsste ich mich bei ihr entschuldigen.«
»Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben«, erwidert Gabriel. »Habt ihr noch eine andere Spur, die ihr verfolgen könnt?«
Kurz überlege ich, ob ich ihm von dem Angriff auf dem Friedhof erzählen soll. Am liebsten würde ich es tun, aber er würde sich dann bloß um mich sorgen oder sich Vorwürfe machen, weil er nicht dort war, um mir zu helfen. Ich glaube, das würde ihm gerade nicht guttun.
»Es gibt da was, das ich gern versuchen möchte«, antworte ich. »Dabei könnte ich deine Hilfe gebrauchen.«
Er kommt einen Schritt näher. »Natürlich. Ich helfe gern, wenn ich kann.«
Mir wird warm ums Herz, weil er nicht einmal fragt, worum es geht. Dabei sollte er das in diesem Fall wirklich tun, denn ich würde fast darauf wetten, dass er meinen Plan beschissen finden wird.
»Du bist gut darin, offizielle Anträge zu verfassen, oder?«, frage ich.
Ein schiefes Lächeln schleicht sich auf seine Lippen. »Wie kommst du bloß darauf?«
Ich erwidere sein Grinsen. »War nur so ein Gefühl.«
Er hebt seinen Arm, als wollte er mich berühren, doch als er sich dessen bewusst zu werden scheint, lässt er ihn wieder sinken. »Was brauchst du von mir?«
Dich, denke ich sehnsüchtig. Ich brauche deine Lippen auf meinen. Deinen Körper, der mich wärmt. Deine Seele, die mir Zuneigung schenkt.
Und Selbstbeherrschung. Die brauche ich bei diesen Gedanken auch ganz dringend.
»Das wird dir nicht gefallen«, warne ich ihn.
Er neigt den Kopf. »Illegal?«
»Nur unvernünftig.« Als er seine Brauen hebt, seufze ich. »Kannst du einen Antrag für mich verfassen, der so gut ist, dass der Rat mir einen Besuch im Hochsicherheitstrakt des Gefängnisses genehmigt und ich mich mit Jack Smythe unterhalten kann?«
Für ein paar Sekunden sagt Gabriel kein Wort, während er wahrscheinlich die eintausend Möglichkeiten durchgeht, auf welche Weise er das verneinen und gleichzeitig herausfinden kann, ob ich noch alle Tassen im Schrank habe.
»Ich bin gut, aber ich weiß nicht, ob ich so gut bin«, antwortet er schließlich. »Versuchen kann ich es. Der Antrag ließe sich so verfassen, dass er dich nicht persönlich erwähnt, sondern für ein beliebiges Mitglied der magischen Abteilung gelten kann.«
»Das geht?«, frage ich verwundert.
»Du klingst fast enttäuscht«, stellt er belustigt fest.
»Eigentlich hatte ich eine Moralpredigt von dir erwartet«, gestehe ich.
Seine Mundwinkel zucken. »Ich würde dir auch am liebsten eine halten. Aber zur Abwechslung werde ich darauf vertrauen, dass du weißt, was du tust.«
Ich betrachte ihn mit gerunzelter Stirn. »Wer bist du, und was hast du mit Gabriel Silverstein gemacht?«
Er lacht. »Wenn wir ehrlich sind, würdest du sowieso deine Schwester um Hilfe bitten, falls ich Nein sage.«
Da hat er recht, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihre Predigt zu dem Thema unangenehmer ausfallen würde als seine.
»Wie lange dauert es, bis ihr euch im Rat damit befassen könnt?«, frage ich.
Darüber denkt er einige Sekunden nach. »Kommt darauf an, wie dringend die Angelegenheit ist. Gibt es einen unmittelbaren Grund, warum du Smythe besuchen willst? Weist irgendetwas darauf hin, dass die Morde eine Nachahmung seiner Taten sein könnten?«
»Nicht wirklich«, gebe ich zu. »Ich erhoffe mir bloß einen neuen Blickwinkel auf die Sache. Vielleicht hat er eine Idee, was das Ziel dieser Mörder sein könnte. Wenn sich jemand mit grausamen Verbrechen auskennt, dann er.«
Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet oder ob er überhaupt mit mir reden wird. Aber ich hoffe, er kann mir etwas zu diesem seltsamen Licht und dem Reißen an meinem Körper sagen, das ich während des Angriffs gespürt habe.
»Verstehe«, meint Gabriel. »In dem Fall wird es etwas dauern. Aber ich kann versuchen, die Angelegenheit zu beschleunigen. Gib mir fünf Tage.«
Ich unterdrücke ein Aufstöhnen, weil ich weiß, dass er nichts für diese langwierigen Prozesse kann und sein Bestes tut. Trotzdem sind fünf Tage eine lange Zeit.
»Okay, dann müssen wir in der Zwischenzeit andere Spuren finden«, sage ich, bevor ich ihm ein Lächeln schenke. »Danke, Gabe.«
Als ich seinen Spitznamen ausspreche, tritt ein sehnsuchtsvoller Ausdruck in sein Gesicht. Er ist so schnell wieder verschwunden, dass ich ihn vielleicht nicht bemerkt hätte, wenn ich Gabriel nicht dauernd anstarren würde.
»Immer gern«, murmelt er.
Dieses Mal streckt er tatsächlich die Hand aus und berührt mich hauchzart am Oberarm wie eine Feder, die mich nur eine Ahnung lang streift. Es fühlt sich trotzdem unfassbar intensiv an, sodass mein ganzer Körper kribbelt.
Sogar nachdem er gegangen ist und seine Schritte verklungen sind, spüre ich noch das Echo seiner flüchtigen Berührung, und ich frage mich, ob dieses Gefühl, diese unfassbare Sehnsucht, je wieder verschwinden wird.
Kapitel 4
Als ich am nächsten Morgen aus meiner Kutsche steige, wünsche ich mir, dass ich im Bett geblieben wäre. Dunkelheit liegt über New London, und der Regen verwandelt die Pflastersteine der Hauptstraße in feucht glänzende Spiegel. Heute ist der Wind so stark, dass er mir die Kapuze meines schwarzen Umhangs vom Kopf weht und mein Haar durcheinanderwirbelt. Die anderen Hexen, die unterwegs sind, scheinen sich weniger an den Böen zu stören. Während ich mit einer angestrengten Grimasse durch die Gegend eile, gehen sie ganz entspannt ihrer Wege.
Das Kaffeehaus an der Straßenecke ist kaum zu verfehlen, weil man von dort aus einen perfekten Blick auf den Amethystturm hat, der in den Sternenhimmel aufragt. Schon im Eingangsbereich schlägt mir der Duft von gefühlt einhundert verschiedenen Aromen entgegen. Was die mannigfaltigen Geschmacksrichtungen der Getränke angeht, stehen die meisten Lokalitäten der anderen Bezirke denen im Frühlingsviertel in nichts nach. Typisch für das Herbstviertel sind allerdings die Hocker an den hohen Tischen, die unnötigerweise ein paar Zentimeter über dem Fußboden schweben. Auf denen wird mir immer viel zu schnell schwindelig.
Ich hänge meinen nassen Umhang an die Garderobe und bahne mir einen Weg durch das gut gefüllte Kaffeehaus. In einer der privateren Ecken im hinteren Bereich entdecke ich Alistair Kent.
Er verzieht seine Lippen zu einem schiefen Grinsen, als ich auf ihn zukomme. Während ich wie ein begossener Pudel aussehen muss, wirkt er, als hätte er sich für eine Feier herausgeputzt. Jede goldblonde Haarsträhne sitzt akkurat, sodass man meinen könnte, sie wären an seinem Kopf festgeklebt. Außerdem ist er frisch rasiert und sein dunkellila Hemd weist weder Flecken noch Falten auf. Er sitzt entspannt auf dem schwebenden Hocker, als wäre er sein persönlicher Thron. Mir entgeht nicht, dass die anderen Gäste uns neugierig beobachten.
»Hallo, Eisprinzessin«, grüßt er mich gut gelaunt. »Sind wir ein bisschen nass geworden?«
Seinen anzüglichen Tonfall vergelte ich mit einem verständnislosen Blick. »Ich kann auch gern wieder gehen.«
Er zuckt mit den Schultern. »Du hast mir eine Nachricht zukommen lassen, dass du mich heute treffen willst. Wenn du es dir anders überlegt hast, weißt du ja, wo die Tür ist.«
Mir entfährt ein entnervter Seufzer, weil er leider recht hat. Ich habe ihn um ein Treffen außerhalb seines Anwesens gebeten, damit seine Familie und vor allem sein Vater mich nicht dort sehen. Den genauen Ort hätte ich wohl lieber selbst wählen sollen.
Missmutig starre ich den schwebenden Hocker an, bevor ich schließlich auf ihn klettere. Er fühlt sich wacklig an, und ich muss meine Arme auf dem Tisch ablegen, um wenigstens etwas Halt zu haben. Wirklich geheuer ist mir das Ganze trotzdem nicht.
Als die Bedienung an unseren Tisch kommt, überfliege ich kurz die Karte und bestelle einen Kaffee mit Zimtaroma.
Während ich auf mein Getränk warte, nimmt Alistair einen Schluck aus seiner Tasse. »Was verschafft mir die Ehre? Ich dachte, du wärst schon wieder in der Menschenwelt.«
»Meine Pläne haben sich geändert.«
»Ach?«
»Ja«, bestätige ich. »Bevor ich herkam, wusste ich nicht, dass meine Schwester heiraten will.«
Er leckt sich ein wenig zu genüsslich den Milchschaum von der Oberlippe. »Komm schon, Graham. Wir wissen beide, dass deine Schwester keine Kupplerin braucht.«
Der Kaffee, den ich bestellt habe, schwebt an unseren Tisch und sinkt vor mir herab. Mit den Dampfschwaden steigt wohltuender Zimtduft aus der Tasse empor. Ich lege meine Hände an das Porzellan, um sie daran zu wärmen.
»Wissen wir das?«, frage ich unschuldig.
Alistair beobachtet mich dabei, wie ich einen vorsichtigen Schluck trinke. »Du bist wegen der Briefe an meine Cousine in Alexandras Haus eingebrochen und wolltest, dass ich dich wegen Darwins Tod auf dem Laufenden halte. Außerdem ist gerade bekannt geworden, dass diese Vorfälle zu einer Mordserie gehören. Interessanter Zeitpunkt, um nach New London zurückzukehren.«
Ich werfe ihm ein provokantes Lächeln zu. »Du glaubst nicht an Zufälle?«
»Nein. Und ich kann eins und eins zusammenzählen.«
Sein Tonfall ist selbstbewusst. Es sollte mich nicht wundern, dass er die richtigen Schlüsse aus der Sache gezogen hat. Das ist ärgerlich, macht es aber zumindest einfacher, ihn um Hilfe zu bitten.
»Ehrlich gesagt, hatte ich gehofft, du könntest mehr für mich tun, als nur zählen«, sage ich.
»Für dich könnte ich eine Menge tun«, erwidert er selbstgefällig.
Ich verdrehe die Augen. »Es gibt nur eine Sache, die ich von dir will. In den nächsten Tagen wird im Rat ein Antrag besprochen. Dabei soll entschieden werden, ob ein Mitglied der magischen Abteilung der Londoner Polizei Zugang zum Hochsicherheitsgefängnis erhält, um mit einem Gefangenen von dort zu sprechen. Jack Smythe. Ich will, dass dein Vater diesem Antrag zustimmt. Kannst du dafür sorgen?«
Bei der Erwähnung von Smythes Namen sind Alistairs Brauen in die Höhe gewandert. Für einige Sekunden mustert er mich schweigend, bevor er einen weiteren Schluck aus seiner Tasse nimmt und sie dann langsam auf dem Untersetzer abstellt.
»Ich fürchte, du überschätzt meinen Einfluss auf meinen Vater und seine politischen Entscheidungen«, sagt er. »Warum sollte er so einem Antrag zustimmen?«
»Weil es dabei helfen könnte, den Mord an deiner Cousine aufzuklären. Daran hat er als Familienoberhaupt bestimmt ein Interesse. Du musst ihm nur glaubhaft versichern, dass diese Befragung zur Ergreifung ihres Mörders führt.«
»Wäre das denn die Wahrheit?«, fragt Alistair, obwohl die Wahrheit ihm auch nicht besonders wichtig war, als ich die angebliche Taschenuhr seines Onkels für ihn stehlen sollte.
»Das wird sich zeigen«, antworte ich. »Aber nur, wenn er dem Antrag zustimmt.«
Mit einem neugierigen Funkeln in den Augen lehnt Alistair sich vor. »Du überraschst mich immer wieder, Eisprinzessin. Wie schade, dass dein Interesse bereits einem anderen Mann gilt, sonst hätte ich dich jetzt um ein Date gebeten.«
Fast hätte ich meine Tasse fallen lassen. Statt zu antworten, trinke ich einen Schluck und versuche, mich zu sammeln.
»Wie kommst du darauf?«, will ich wissen. »Nur, weil dein unwiderstehlicher Charme bei mir keine Wirkung zeigt, heißt das nicht zwangsläufig, dass es einen anderen geben muss.«
Er lehnt sich grinsend zurück, was mich nervöser macht, als es sollte. Bestimmt ist er bloß beleidigt, weil ich ihn abgewiesen habe, und zieht jetzt irgendwelche Psychospielchen mit mir ab.
»Angenommen, ich spreche mit meinem Vater«, sagt er und macht eine bedeutungsschwere Pause. »Was würde für mich dabei herausspringen?«
Ich sehe ihn verständnislos an. »Bei dir gibt es nichts umsonst, oder? Sogar aus dem Mord an deiner Cousine versuchst du noch Profit zu schlagen.«
Alistair wirkt ungerührt. »Meine Ehrenhaftigkeit wird sie auch nicht wieder lebendig machen.«
»Ein bisschen Anstand würde mir dabei helfen, dich weniger zu verachten.«
»Du verachtest mich nicht«, behauptet er. »Wir teilen nur nicht dieselben Moralvorstellungen.«
Im Moment bezweifele ich stark, dass der Kerl überhaupt so etwas wie Moral besitzt. Wahrscheinlich sollte ich gehen und mich nicht länger auf dieses Spiel einlassen. Wenn er sich weigert, mir dabei zu helfen, den Tod seiner Cousine aufzuklären, habe ich ihm nichts mehr zu sagen. Noch mal werde ich jedenfalls nicht das Gesetz für ihn brechen.
Als ich eine Silbermünze aus der Tasche ziehe und sie in die Schale für die Bezahlung lege, lehnt er sich zu mir vor. »Ich sorge dafür, dass Vater dem Antrag zustimmt. Unter einer Bedingung. Ich will, dass du deinen Bruder darum bittest, eine Eisskulptur von mir anzufertigen, die er bei eurer Familienfeier ausstellt.«
»Ich soll was tun?«
Meine Fassungslosigkeit prallt an ihm ab. »Seit Jahren besuche ich eure Partys und denke mir jedes Mal, dass ich eine verdammt gute Skulptur abgeben würde. Das ist doch Ramis Ding, oder? Ich würde sogar Modell stehen, wenn es nötig ist. Du wärest dann natürlich herzlich eingeladen, mich dabei zu bewundern.«
Ich starre ihn entgeistert an. Am liebsten würde ich ihn auf der Stelle sitzen lassen und ihm sagen, dass er mich mal gernhaben kann. Aber diese ganze Situation ist so absurd, dass ich gegen meinen Willen grinsen muss.
»Du bist unglaublich«, murmele ich.
»Unglaublich gut aussehend«, erwidert er.
»Nicht zu vergessen arrogant.«
»Selbstbewusst.«
»Selbstverliebt.«
»Und äußerst liebenswert. Definitiv einer eigenen Eisskulptur würdig.«
Mit einem Seufzer schnappe ich mir meine Tasse und trinke den Kaffee aus, obwohl er eigentlich noch viel zu heiß ist. »Die Entscheidung überlasse ich meinem Bruder.«
Bevor er noch weitere Forderungen stellen kann, klettere ich von dem schwebenden Hocker, nehme die Schale mit dem Geld und stelle sie auf dem Tresen ab. Als ich Alistair einen letzten Blick zuwerfe, winkt er mir lässig zu.
»War mir eine Ehre, Geschäfte mit dir zu machen«, ruft er heiter, woraufhin sich ein paar Leute zu ihm umdrehen.
Ich bleibe ihm eine Antwort schuldig, nehme meinen Umhang von der Garderobe und eile nach draußen in den Regen.
Schon als ich die Eingangshalle unseres Familienanwesens betrete, überkommt mich das vertraute Gefühl von dunkler Sehnsucht. Seitdem ich vor einigen Tagen den Blutzauber genutzt habe, macht es sich immer wieder in mir breit. Es ist wie ein klebriger Faden, der mich umspannt und zu dem Abstellraum zieht, in dem sich der Zugang zur Quelle des Wissens verbirgt. Manchmal bemerke ich nicht einmal, dass ich diesem Sehnen nachgebe. Erst als ich bereits vor der Wand stehe, die sich nicht für mich öffnen wird, wird mir bewusst, wo ich bin.
Mit angespannten Muskeln fahre ich über den rauen Stein. Presse meine Fingerspitzen dagegen, als könnte ich den magischen Durchgang dazu bringen, mich einzulassen. Aber das kann ich nicht, weil nur die Wintererbin dazu in der Lage ist.
Verlangen brennt in meiner Brust, in der ein finsteres Loch klafft, das sich nur schließen wird, wenn ich mit dem eisigen Wasser der Quelle vereint bin. Wenn ich ihre melodische Stimme endlich wieder in meinem Kopf höre. Mit den Fingernägeln kratze ich über die unebene Steinwand. Gestatte meiner Magie, an die Oberfläche zu strömen. Sie fühlt sich anders an als früher, ist unruhig und viel enger mit meinen Emotionen verwoben. Obwohl sie durch die Dunkelheit geschwächt ist, kommt es mir vor, als wäre sie wilder geworden.
»Lady Reva?«
Ich fühle mich wie etwas, das in Metall gehüllt ist und magnetisch von der Quelle unter diesem Anwesen angezogen wird. Sie könnte mir helfen. Mir sagen, wer mich auf dem Friedhof töten wollte und wo ich diese Personen finde. Alles, was mich seit Wochen beschäftigt, könnte schnell vorbei sein.
»Lady Reva, was tut Ihr da?«
Juliens besorgte Stimme reißt mich aus meinen Gedanken. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich mich gegen die verborgene Tür stemme. Meine Brust hebt und senkt sich hektisch, mein Herz rast, und unter meinen Fingern breitet sich eine hauchzarte Frostschicht aus. Die Kälte macht mir nichts aus, aber ich zittere dennoch am ganzen Körper.
Atemlos drehe ich mich um. Julien hält eine weiße Porzellanvase in der Hand, in der frische Blumen stecken. Er starrt mich mindestens so verwirrt an wie ich ihn.
»Reva«, hauche ich. »Nur Reva, bitte.«
»Reva«, wiederholt er entschuldigend und fährt sich mit der freien Hand über seinen vollen grauen Bart. »Stimmt etwas nicht?«
Es dürfte offensichtlich sein, dass etwas ganz und gar nicht stimmt, sonst würde ich nicht panisch in dieser Abstellkammer stehen. Aber er ist zu höflich, um es auszusprechen.
»Alles gut«, lüge ich. »Machen Sie sich keine Sorgen.«
Als ich zur Tür gehe und mich eilig an ihm vorbeischiebe, ist da sehr wohl Sorge in seiner Miene. Diese Art von Blick hat Daisy mir auch zugeworfen, nachdem sie beobachtet hat, wie ich gestern aus diesem Raum gekommen bin. Ich will nicht so angesehen werden. So, als müsste man Angst um mich haben. Weil ich dann auch Angst habe.
Ich stürme die Marmorstufen hinauf, die ins erste Stockwerk führen. Oben lehne ich mich gegen die Wand, um nach Luft zu schnappen. Mein Herz will sich kaum beruhigen. Ich schließe die Augen, zähle bis zehn und atme ganz langsam.
Das hier muss aufhören. Wann lässt dieser unbändige Drang, die Quelle aufsuchen zu wollen, endlich nach? Manchmal stehe ich dort unten und will mir in die Hand schneiden, damit ich mein adliges Blut auf dem Stein verteilen kann, in der Hoffnung, dass es den Durchgang öffnet. Ich will es mit meiner Magie verbinden. Dieses Verlangen ist falsch.
Kopfschüttelnd stoße ich mich von der Wand ab und suche Rami in seinem Atelier auf. In den letzten Wochen sind es täglich mehr Eisskulpturen geworden, sodass es kaum noch einen freien Platz in diesem kalten Raum gibt. Sie glitzern wunderschön im Mondlicht, das durch die großen blauen Mosaikfenster hereinfällt, und sehen unglaublich echt aus.
Ich beobachte meinen Bruder dabei, wie er mithilfe seiner Magie die Konturen der Figur vor sich glättet.
»Nimmst du zufällig noch Aufträge an?«, frage ich.
Er hält inne und wendet sich mir zu. »Wieso? Willst du eine von dir?«
Das bringt mich zum Lachen. »Nein. Ich fürchte, ich brauche eine von Alistair Kent.«
Seine dunklen Augen werden schmal. »Und ich brauche definitiv mehr Hintergrundinfos.«
Hätte ich mir denken können.
Mit einem Seufzer setze ich mich in Bewegung und flaniere zwischen den vielen Skulpturen hindurch. Sofort fällt mir eine auf, die Daisy nachempfunden ist. Rami hat ihre feinen, majestätischen Gesichtszüge und ihre erhabene Ausstrahlung perfekt eingefangen. Sogar das Diadem unserer Familie sitzt detailgetreu auf ihrem Kopf.
»Du weißt doch, dass ich immer noch an diesen Mordfällen dran bin«, sage ich. »Alistair Kent könnte was für mich tun, das mir weiterhilft. Aber er will eine Gegenleistung. Eine Skulptur von sich, die du bei unserer Familienfeier ausstellst.«
Mein Bruder unterbricht seine Arbeit abrupt.
»Wie kommt er denn darauf?«, fragt er verwundert.
»Es scheint, als wäre er ein großer Fan deiner Arbeit.«
Und wahrscheinlich liebt er es, sich selbst anzusehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er morgens sehr lange vor dem Spiegel steht und sich ausgiebig bewundert.
»Tja, meine Fans kann ich wohl kaum enttäuschen«, meint Rami. »Und meine Schwester auch nicht. Natürlich helfe ich dir.«
»Du bist der Beste!« Ich blicke von Daisys eisigem Antlitz zu meinem Bruder. »Muss er dafür eigentlich Modell stehen?«
»Wäre besser. Sonst sieht seine Skulptur am Ende aus wie ein entfernter Verwandter.«
»Dann meide ich dein Atelier, solange du an seinem Ebenbild arbeitest. Er ist unerträglich.«
Rami grinst wissend. »Die Skulptur von einem anderen Adligen würde dir besser gefallen, was?«
Meine Wangen werden heiß, woraufhin das Grinsen meines Bruders breiter wird. Verdammt, ich hätte ihm nie davon erzählen dürfen. Das wird er mich bis ans Ende meines Lebens nicht vergessen lassen.
»Gabriel und ich sind nur Freunde«, behaupte ich. »Wir haben das geklärt.«
»Warum wirst du dann rot?«
»Weil etwas klären und darüber hinweg sein zwei verschiedene Dinge sind.« Dieses Eingeständnis tut ziemlich weh. »Es reicht mir schon, dass der echte Gabriel auf der Party sein wird. Da braucht es nicht noch eine Kopie aus Eis.«
Mein Bruder schaut mich mitleidig an. »Ich sollte dich mal auf eine richtige Party mitnehmen. Eine, bei der du deinen Liebeskummer schnell vergisst.«
»Nach der letzten richtigen Party, zu der du mich geschleppt hast, bist du halb nackt im Ratsgebäude aufgewacht und hast auf einen sehr teuren Stuhl gekotzt«, erinnere ich ihn.
Er lacht, als wäre er stolz auf diese Eskapade. »Das hat Daisy mir immer noch nicht verziehen.«
»Du hast ja auch ihren Schlüssel geklaut.«
»Geliehen«, korrigiert er.
Ich seufze.