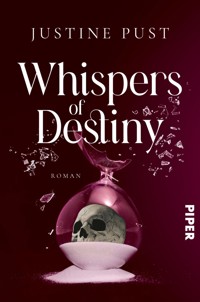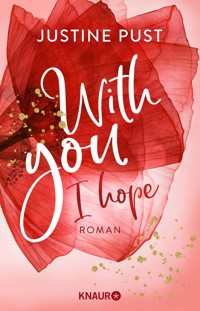9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Skyline-Reihe
- Sprache: Deutsch
Adas Leben gleicht einem Gewittersturm. Als sie auf Diez trifft, will sie alles, nur keine Liebe. Doch dann entbrennt inmitten des Gewitters zwischen beiden ein Feuer … Der zweite und abschließende New-Adult-Roman in Justine Pusts berührender Skyline-Dilogie, auch unabhängig lesbar. Nachdem ihr Vater an der seltenen, vererbbaren Huntington-Krankheit gestorben ist, will die Studentin Ada einfach nur ihre Trauer und ihre Angst, vielleicht selbst zu erkranken, vergessen. Als sie den charismatischen Diez kennenlernt, bietet er für sie vor allem eine ungezwungene Ablenkung von all den Gedanken und Gefühlen, vor denen sie fliehen will. Doch für Diez ist die Zeit mit Ada bald sehr viel mehr als eine rein körperliche Beziehung. Immer wieder kommt es deshalb zwischen ihnen zum Streit, immer wieder stößt Ada Diez von sich. Bis sich auch in Diez' Leben ein Sturm zusammenbraut und nicht mehr nur Ada mit ihren Ängsten und Gefühlen konfrontiert wird … Justine Pusts New-Adult-Liebesromane zeichnet eine wunderschöne Mischung aus großen Emotionen, schlagfertigen Figuren und Themen, die ihr wichtig sind, aus. In ihrer Skyline-Dilogie spielen Mental und Physical Health eine große Rolle, ebenso wie Freundschaft, Mut und Liebe, mit der man manchmal gar nicht rechnet, die aber dann doch genau zur richtigen Zeit kommt. Entdecke auch den ersten New-Adult-Roman der romantischen und emotionalen Skyline-Dilogie von Justine Pust: »Wo die Sterne uns sehen«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 438
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Justine Pust
Wo der Regen uns berührt
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Nachdem ihr Vater an der seltenen, vererbbaren Huntington-Krankheit gestorben ist, will die Studentin Ada einfach nur ihre Trauer und ihre Angst, vielleicht selbst daran zu erkranken, vergessen. Als sie den charismatischen Diez kennenlernt, bietet er für sie vor allem eine ungezwungene Ablenkung von all den Gedanken und Gefühlen, vor denen sie fliehen will. Doch für Diez, dessen Leben ebenfalls kopfsteht, ist die Zeit mit Ada bald sehr viel mehr als eine rein körperliche Beziehung. Immer wieder kommt es deshalb zwischen ihnen zum Streit, und Ada stößt Diez von sich. Doch manche Menschen lassen sich auch von den finstersten Stürmen nicht vertreiben ...
Der zweite New-Adult-Roman in Justine Pusts berührender Skyline-Reihe, auch unabhängig lesbar.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Notes – Hinweis
Widmung
Playlist
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Teil 2
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Teil 3
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Nachwort
Danksagung
Liste sensibler Inhalte / Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Dieses Buch ist für dich.
Für alle, die jemanden in einem Sturm verloren haben.
Oder sich selbst.
Und für Annika, damit du nicht vergisst, dass irgendwo hinter den Wolken noch immer die Sonne ist.
Playlist
Bausa x LEA – 1000 Mal
Andreas Bourani – Hey
Joris – Herz über Kopf
Sophia – Wenn es sich gut anfühlt
SIMONA – Tränen
Elif – Ein letztes Mal
Elif – Freunde
Maxim – Meine Soldaten
Wilhelmine – Eins sein
Berq – Einmal verliebt
Provinz feat. Nina Chuba – Zorn & Liebe
LEA x Dhurata Dora – Chaos
Madeline Juno – Gewissenlos
Lotte – Angst
Christoph Sakwerda – Herztausch
Soffie – Bevor du gehst
SDP feat. Adel Tawil – Ich will nur dass du weißt
Juju feat. Henning May – Vermissen
Bonus:
Taylor Swift – I Can Do It With a Broken Heart
Teil 1
Und wenn der Regen erst fällt, wird die Trauer zu unserer Welt.
Elias
Kapitel 1
Wenn die Uhren aufhören zu ticken und die Welt plötzlich still wird, fühlt es sich an, als würde man auf einer Schwelle stehen, in der die Realität mit der Traumwelt verschwimmt. Wobei … wer entscheidet überhaupt, was real ist?
»Du machst schon wieder dieses Gesicht«, bemerkt Danielle und legt seufzend ihr Buch aus der Hand, während sie mich betrachtet. Im hellen Sonnenschein muss sie die Augen zusammenkneifen, die dadurch von winzigen Fältchen eingerahmt werden. Sie wirkt anders als sonst, aber ich komme nicht darauf, was es ist.
»Welches Gesicht?«
»Na, genau dieses«, entgegnet sie und deutet auf mich. »Als würdest du zu viel nachdenken.«
Tue ich das?
Ich kann es nicht mal richtig beantworten, denn im warmen Licht der Sonne, die auf uns herabscheint, sollte doch eigentlich alles leicht und einfach sein. Wir sitzen auf einer Veranda, auf dem Tisch neben uns Gläser mit Limonade, und Danielles Sommerkleid weht sachte in einem Wind, den ich kaum spüren kann. Und irgendwie ist es genau das, was mich innehalten lässt.
»Wo sind wir eigentlich?«
Danielle dreht sich etwas zur Seite und lehnt sich mit geschlossenen Augen in ihrem Stuhl zurück. »Ist das wichtig?«
»Ja?«
»Bei all den Fragen, die du mir stellen könntest, soll es ausgerechnet diese sein?«
Und dann verstehe ich.
Das alles hier, diese Sonne, diese Veranda, Danielle. Das ist alles nicht echt. Nicht wahr. Nichts als Schall und Rauch und vielleicht noch weniger als das.
»Das hier ist ein Traum.«
»Hundert Punkte für Sherlock Holmes.«
»Aber …«
»Diez …«, unterbricht mich meine Schwester. »Können wir diesen Moment nicht einfach genießen?«
Es ist die Art, wie sie mich ansieht.
Nein, es sind ihre Augen.
Sie sind anders.
Nicht was die Farbe oder ihre Form betrifft. Es ist der Ausdruck in ihnen, der anders ist als beim letzten Mal, als ich in sie geblickt habe.
»Aber du bist nicht wirklich hier«, murmle ich, mehr zu mir selbst als zu ihr. Mehr zu den Tiefen meines Verstands als zu den Gefühlen, die mein Herz zum Zerbersten bringen wollen. Mehr zu den Zweifeln als zu der leisen Hoffnung.
»Wer entscheidet das?«
»Ob du real bist oder nicht?«
»Ich bin real, vielleicht nicht für dich, aber für mich selbst«, hält sie dagegen. »Und ich bin hier, ist das nicht alles, was zählt?«
Aber ich schaffe es nicht mehr, ihr zu antworten. Das rhythmische Piepen verschluckt jedes meiner Worte, scheint alles zu übertönen, sodass ich nichts anderes mehr hören kann. Und dann wache ich auf.
Kapitel 2
Jetzt
Wenn die Welt laut genug ist, kann ich die Schreie meiner Seele nicht mehr hören. Der Beat, der den Nachtclub zum Beben bringt, soll meinen Herzschlag ersetzen. Und Diez? Er soll dasselbe mit meinen Gefühlen tun.
Ich presse mich an ihn. Spüre, wie der Druck in meinem Inneren nachlässt, als er mich an sich zieht. Ich küsse ihn, ertränke all die Gedanken, die ich nicht denken, und all die Gefühle, die ich nicht fühlen will, in unserem Kuss. Bis Diez nach Luft schnappt und mich ansieht. Er legt eine Hand an mein Gesicht, streicht mit dem Daumen über meine Wange, verharrt an meinen Lippen, als wüsste er nicht, ob diese Berührung zu viel ist.
»Lass uns gehen.«
Ich bitte nicht darum.
Ich warte nicht auf eine Antwort.
Ich erwarte nur, dass er mir folgt. Dass er meine Hand nicht loslässt, während wir das Meer aus tanzenden Körpern verlassen und in die kalte Nachtluft treten.
Ein paar Tropfen aus den dunklen Wolken über uns vertreiben die Hitze auf meiner Haut, bevor ich mich mit Diez in das erstbeste Taxi setze.
»Kennst du dieses Gefühl, als seist du kurz davor zu fallen?«
Jetzt prasselt das Wasser gegen die Fensterscheibe des Wagens. Die Tropfen schimmern abwechselnd blau, lila und golden, während wir durch die nächtlichen Straßen Frankfurts fahren.
»Was meinst du?«
Ich lehne mich zurück und betrachte ihn von der Seite.
Diez’ fragender Blick trifft meinen. Grinsend beiße ich mir auf die Unterlippe. »Dieses Wissen, dass es nur noch einen Drink braucht, nur noch einen Schluck, um dich abstürzen zu lassen, aber du noch klar genug bist, um das zu erkennen und drauf zu scheißen.«
Im Rückspiegel kann ich sehen, wie die Augenbrauen des Taxifahrers nach oben wandern. Und auch meine heutige Eroberung scheint nicht so ganz zu wissen, was er mit dieser Information anfangen soll. »Ich habe keine Ahnung, was du mir sagen willst, Ada.«
Lachend ziehe ich ihn zu mir, drücke meine Lippen wieder auf seine. »Ich will dich, Diez«, raune ich ihm ins Ohr, leise genug, damit nur er es hören kann, und laut genug, damit es in meinem eigenen Kopf ankommt. »Ich will dich, weil ich nichts anderes mehr fühlen will.«
Alles, was ich brauche, ist die Stille in meinem Kopf, die er mir geben kann. Auch wenn ich weiß, dass das Danach uns beide verletzt.
»Aber …«
»Kein Aber, ich will fallen. Und heute Nacht falle ich mit dir«, unterbreche ich ihn. Er sieht mich aus dunklen Augen an. Aber ich kann die Hitze spüren. Die Funken zwischen uns haben längst etwas entzündet, das nicht einmal der Regen löschen kann.
Der Wagen hält vor meiner Haustür. Diez zahlt, während ich schon ausgestiegen bin.
Innerhalb von Sekunden bin ich vollkommen durchnässt. Unaufhaltsam klatschen die großen Tropfen auf die Erde, auf mich, auf einfach alles. Und auf Diez, als er endlich neben mir steht und mich mit sich in den Schutz des Wohnblocks ziehen will. Aber das lasse ich nicht zu.
Stattdessen schlinge ich die Arme um seinen Hals, küsse ihn erneut. Meine Lippen umspielen seine, bis er mich einlässt. Unsere Zungen vernichten den letzten Rest an Zweifeln, die letzten aufkeimenden Gedanken und das letzte bisschen Kontrolle, das wir uns bis eben bewahrt hatten.
Sein Keuchen an meinem Ohr geht im Rauschen des Gewitters fast unter. Mein Körper pulsiert, glüht, wehrt sich gegen die Kälte mit einer Hitze, die aus meinem Inneren strömt. Dann stoße ich ihn lachend von mir.
Denn all das ist ein bisschen zu gut, ein bisschen zu nah. Fühlt sich nach einem Mehr an, das ich nicht will.
Perplex sieht er mich an, stimmt aber in mein Lachen ein, als ihm klar wird, dass ich genug davon habe, im Schauer herumzuknutschen. Mit einer Hand krame ich den Schlüssel aus meiner Handtasche hervor und stoße mit der Schulter die Haustür auf.
Diez bleibt dicht hinter mir.
Die nasse Kleidung lässt mich zittern, aber ich genieße die kurze Pause. Genieße es, Diez’ Blick auf meinem Körper zu spüren. Sein Verlangen, das mindestens so stark ist wie mein eigenes. Ich weiß nicht, was er zu vergessen versucht – zumindest rede ich mir das ein –, aber es macht auch keinen Unterschied.
An meiner Wohnungstür drehe ich mich zu ihm um. »Meinst du, du kannst leise sein, damit wir niemanden wecken?«
Diez kommt näher. Ich kann den Geruch seines Parfums wahrnehmen, die Mischung aus Sandelholz und Bernstein. Er will sich an mich drücken, aber ich weiche aus, indem ich die Tür hinter mir aufstoße.
Die Wohnung liegt dunkel und still vor uns. Nur der Regen ist zu hören, als wollte er uns ein ganz eigenes Lied widmen.
Ich knipse das Flurlicht an und schlüpfe aus meinen hohen Schuhen. Diez steht nur da, wartet darauf, dass ich die nächste Runde unseres Spiels einläute. Und verdammt, ich bin gut darin.
Mit einem verführerischen Lächeln streife ich mir die Lederjacke von den Schultern. Mein helles Kleid klebt wie eine zweite Haut an meinem Körper und lässt überdeutlich erkennen, dass ich nur ein schwarzes Höschen darunter trage.
»Fuck«, entfährt es Diez.
Ohne den Blick von ihm zu nehmen, löse ich die Träger und ziehe das Kleid nach unten. Leider macht es mir die Feuchtigkeit nicht allzu leicht. Aber ich ignoriere meine kurze Unbeholfenheit.
»Wie wäre es, wenn du deinen Worten endlich Taten folgen lässt?«, hauche ich heiser.
Diez’ Nasenflügel beben, als er mich betrachtet. Ich kann sehen, wie er mit sich ringt, wie er versucht, sich an dem letzten Halt vor dem freien Fall festzuklammern, als habe er Angst vor dem, was dann kommen könnte. »Bist du sicher, dass …«
»Ich stehe halb nackt vor dir, wie viele Einladungen brauchst du noch? Weniger denken, mehr …«
Aber dieses Mal ist er es, der mich zum Schweigen bringt, indem er meine Worte mit einem Kuss erstickt. Der mich nimmt, wie ich gerade genommen werden will. Hart. Kompromisslos. Entlang einer Grenze, von der ich bis eben nicht wusste, ob ich sie wirklich überschreiten sollte. Aber ich will es.
Ich will alles, außer den Gefühlen in mir.
Ich will ihn, um zu vergessen, welcher Orkan in meinem Inneren tobt.
Er drückt mich gegen die Wand, raubt mir den Atem mit seinen Küssen und seinen Berührungen, als sich seine Hände unter den Bund meines Höschens schieben. Wassertropfen perlen von den Spitzen meiner Haare und hinterlassen blassviolette Punkte auf seinem weißen Shirt.
Seinen Körper an meinen gepresst, fährt seine eine Hand über meinen Hals. Meine Kehle.
Die schwarzen Linien seiner Tätowierung auf dem Unterarm wirken wie Schatten, die von seiner Haut auf meine wandern. Mich infizieren.
Alles in mir bereitet sich auf den Donner vor.
Auf den Ausbruch, der jede Faser meines Körpers unter seinem zum Erzittern bringen wird. Diez’ Kuss und sein Keuchen erobern meine Seele und bringen meinen Herzschlag aus dem Takt. Seine Finger streichen weiter über meinen Hals, verharren kurz auf meiner Kehle und gleiten weiter zu meinen Brüsten.
Ich stöhne, kralle meine Finger in seinen Rücken.
Er zuckt zurück.
Seine Lippen glänzen von dem Angriff auf meinen Mund, von unserem Kampf darum, wer von uns die Kontrolle behalten und wer sie verlieren darf.
»Ich dachte, wir wollten leise sein?«
Herausfordernd hebe ich das Kinn. »Nein, nur du.«
Sein heiseres Lachen lässt das Prickeln in mir noch stärker werden. Ich ergreife seine Hand und ziehe ihn hinter mir her in mein Zimmer. Dann starre ich ihn an.
In seinen dunklen Augen kann ich seine Gedanken nicht lesen, dafür jedoch nehme ich die Signale seines Körpers überdeutlich wahr. Binnen eines Herzschlags gehen wir wieder aufeinander zu. Ich zerre an seinem Shirt, an dem Bund seiner Jeans. Will endlich seinen Körper auf meinem spüren.
Diez packt mich und wirft mich überraschend heftig auf mein Bett, was mir ein nicht ganz so erotisches Quietschen entlockt. Dann streift er die Boxershorts von seinem Körper, während ich mich meines Höschens entledige.
Mir bleibt gerade noch Zeit, nach den Kondomen in meiner Nachttischschublade zu tasten, als Diez wieder neben mir ist.
Seine Finger gleiten erneut über meinen Körper, zwischen meine Beine und tauchen tief in mich ein. Ich drücke ihm mein Becken entgegen, unterdrücke ein Seufzen. Mein Körper schmilzt unter den Bewegungen seiner Finger.
Ich kann nicht mehr warten.
Diez raunt etwas, das ich nicht verstehen kann. Seine Worte sind gedämpft. Seine Härte drängt sich mir entgegen, bringt mich noch mehr dazu, ihn zu wollen.
Mit immer gröberen, ungehaltenen Berührungen reizt er mich, als wüsste er genau, wie kurz ich davorstehe zu explodieren. Ich wiege mich vor und zurück, flehe ihn mit meinem Körper an, mir endlich mehr zu geben. Das Verlangen pulsiert durch meine Adern, raubt mir jede Klarheit und legt den Fokus einzig und allein auf das Empfinden.
Dann endlich schiebt sich Diez auf mich. Ich stöhne, als er hart in mich stößt. Es ist mir egal, wer mich hört. Verdammt, von mir aus kann die ganze verdammte Welt mitbekommen, dass ich gevögelt werde, solange ich endlich komme.
Endlich vergessen kann.
Endlich den Dopamin-Push kriege, den mir sonst nichts verschaffen kann.
In meinem Bauch verdichten sich die Empfindungen, als würde er kurz vor dem Urknall stehen. Mit jeder seiner Bewegungen treibt Diez mich weiter. Meine Hände krallen sich in seinen Hintern, während ich die Beine nach oben nehme, um ihn noch tiefer in mir zu spüren.
Ich keuche heftig. Jede Zelle in meinem Körper scheint zu explodieren und gleichzeitig den gefährlichen Wunsch nach mehr herauszuschreien.
Ich kann spüren, wie Diez in mir zuckt.
Dann liegen wir Stirn an Stirn da.
»Fuck«, entfährt es ihm wieder, doch dieses Mal mit einem Lächeln auf den Lippen. Er haucht mir einen Kuss auf die Stirn und zieht mich in seine Arme. Wie ein Versprechen, mich heute Nacht nicht mehr loszulassen und all die Zweifel zu ersticken, nur durch seine Anwesenheit. Durch seine Nähe.
Und genau das will ich nicht.
Etwas gröber, als ich es beabsichtige, winde ich mich aus seiner Umarmung und erhebe mich. Mit zittrigen Schritten torkle ich ins Badezimmer.
Es fällt mir schwer, mein Spiegelbild anzusehen, während Hormone und Alkohol Besitz von meinem Körper ergriffen haben. Die innere Leere, nach der ich mich so gesehnt habe, ist nicht da.
Dafür aber die Stille.
Stille, die ich gerade noch gerufen habe, die nun aber unendlich laut erscheint und etwas ganz anderes zum Vorschein bringt: Angst.
Verdammt.
»Das war eine schlechte Idee«, raune ich meinem Spiegelbild zu, ohne mir in die Augen zu schauen. Schlechte Entscheidungen sind mein Ding. Jedes Mal. Und doch fühlt es sich heute Nacht anders an. Schlimmer.
Nachdem ich mich frisch gemacht und einen Bademantel übergeworfen habe, begebe ich mich zurück in mein Zimmer. Diez liegt noch immer in meinem Bett und sieht mich an. Meine Fingernägel haben Spuren auf seinem Körper hinterlassen. Rote Striemen, als hätte ich ihn gezeichnet. In seinem Blick liegt zu viel Wärme. Viel mehr, als ich gerade ertragen kann.
Viel mehr, als ich gerade verdiene.
Und gleichzeitig sehnt sich ein Teil von mir genau danach, auch wenn ich es nie zugeben würde. Danach, in seinen Armen einzuschlafen und auszublenden, was das bedeuten würde. Was es mir bedeuten würde.
Aber das kann ich nicht zulassen. Also räuspere ich mich. »Danke.«
»Du sagst nach dem Sex einfach Danke?«, fragt Diez perplex.
»Na ja, ich dachte, mit einem Danke würde die Verabschiedung netter wirken«, gebe ich zurück, was dafür sorgt, dass er sich aufrichtet.
»Du willst, dass ich gehe?«
»Ja.«
Er fährt zusammen, als hätte ich ihn geschlagen. Nicht im Spiel, sondern mit der Absicht, ihn zu verletzen. Vielleicht wollte ich das auch, so ganz kann ich das gerade nicht sagen.
»Okay, ich …« Er stutzt, fährt sich durch die Haare, bevor er erneut ansetzt. »Sehen wir uns wieder?«
»Schon möglich. Wir leben in der gleichen Stadt.«
Der nächste Schlag.
Mein Verteidigungsmodus ist an, ohne dass Diez die Chance hat zu verstehen, was ihn ausgelöst hat. Aber es ist besser so. Besser für ihn. Für uns.
Shit, ich sollte nicht mal an ein Uns denken.
»Ada, komm schon«, brummt er und greift gleichzeitig schon nach seiner Jeans.
»Bin ich ja gerade, und jetzt will ich schlafen.«
Er schluckt.
Ich verschränke die Arme vor der Brust. Meine Mauer ist zu hoch für ihn und eine einzige Nacht. Ich habe bekommen, was ich wollte, und nun will ich mit mir und meinem schlechten Gewissen allein sein.
»Wie du willst«, murmelt er und schiebt sich an mir vorbei.
Ich kann hören, wie er die Tür hinter sich zuknallt.
Verdenken kann ich es ihm nicht.
Manchmal kann ich mich selbst auch nicht leiden.
Kapitel 3
6 Monate zuvor
Nicht alle können verstehen, warum man in die Dunkelheit flieht. Wieso man sich in den Nächten sicherer fühlt als im Schein der Sonne. Aber ich glaube, in der Dunkelheit ist die eigene Seele sicherer als im Spotlicht aller anderen. Geschützter vor den Verurteilungen, den falschen Erwartungen, vielleicht auch sicherer vor sich selbst. Denn wenn Teile der Wahrheit in der Nacht verschwinden und vom Morgentau davongewischt werden, kann man sich selbst noch einreden, dass man sich nicht verändert hat.
Dass all die schlimmen Dinge im Leben einem nichts von der eigenen Seele geraubt haben.
Ich unterdrücke ein Husten.
Eigentlich rauche ich nicht.
Aber heute ist es mir im Club zu laut. Dabei wollte ich eigentlich genau das. Etwas, das mich übertönt und die Sorgen in den Hintergrund treten lässt. Trotzdem stehe ich jetzt draußen und rauche eine Zigarette, die mir nicht schmeckt, während ich auf mein Handy blicke.
Martha
Willa und ich wollen einen Leseabend machen, bist du dabei?
Ich habe nicht geantwortet.
Das tue ich oft nicht, denn wie soll ich meinen besten Freundinnen erklären, dass ihre Nähe mir zu guttut, mich zu sehr in einen warmen Kokon aus Liebe einhüllt, den ich gerade nicht ertragen kann? Trotzdem starre ich die Nachricht immer wieder an, während meine Finger über der Tastatur schweben und es nur Sekunden brauchen würde, um ihr zu antworten. Nur Sekunden, um ihnen zu sagen, wie es mir wirklich geht.
»Du bist Ada, oder?«
Verdutzt blicke ich auf und mache mich schon darauf gefasst, einem der Kerle aus den letzten Wochen eine saftige Abfuhr zu erteilen, doch mir bleibt für einen Moment die Luft weg.
Dunkelbraune Augen blicken mich. »Und du bist …?«
Dabei weiß ich, wer er ist.
Die letzte Partynacht, zu der ich Willa und Martha überredet habe, endete in einem emotionalen Ausbruch, von dem ich mich immer noch erholen muss. Und der Typ in der Lederjacke, der jetzt vor mir steht, ist derselbe, der in dieser Nacht neben Willa stand. Ich erinnere mich an ihn.
Vielleicht ein bisschen zu gut.
»Tut mir leid«, meint er lächelnd und fährt sich durch die nahezu schwarzen Haare. »Ich bin Diez.«
»Cooler Name«, kommt es aus meinem Mund, noch ehe ich es verhindern kann. »Ist das ein spanischer Name?«
Er lacht, als würde er diese Frage öfter hören. »Kommt drauf an, wen man fragt.«
»Ich habe doch gerade dich gefragt?«
»Mein Vater würde sagen, es ist eine Kurzform von Dietrich, meine Mutter würde sagen, es war die einfachste Art, einen Namen zu finden, mit dem auch meine Großeltern zufrieden sind.«
Grinsend nicke ich und trete die Zigarette aus, die ich ohnehin nicht wirklich geraucht habe. »Deine Mutter ist mir sympathisch. Und was bedeutet Diez? Auf Spanisch, meine ich.«
»So viel wie zehn oder der Zehnte?«
»Fragst du mich das gerade, oder antwortest du mir?«, will ich neckend wissen.
»Keine Ahnung, irgendwie ist es mir unangenehm, so lange über meinen Namen zu sprechen«, gibt er zu. »Willst du nach Hause?«
Ich werfe einen Blick über die Schulter und schüttle den Kopf, noch ehe ich mir selbst diese Frage wirklich beantworten kann. Dann deute ich auf den Motorradhelm in seiner Hand. »Und du?«
Diez folgt meinen Blick. »Ich wollte noch etwas durch die Stadt fahren«, sagt er und legt den Kopf schief, während er mich betrachtet. Fast schon wartend.
Mein Herz macht einen seltsamen Extraschlag, während sich in meinem Körper Wärme ausbreitet, dicht gefolgt von einem Prickeln, das von meinen Ohrläppchen bis in die Fingerspitzen reicht.
»Hast du noch Platz auf deinem Bike?«
Die Frage ist schneller ausgesprochen, als ich es verhindern kann, denn eigentlich stehe ich nicht besonders auf Motorräder. Oder auf Biker. Shit, selbst Lederjacken mag ich an mir selbst lieber als an Männern. Aber Diez sieht mich an auf eine Art, die ich seit Monaten nicht mehr erlebt habe.
Manchmal trifft man Menschen und spürt eine Verbindung, ohne dass man sagen kann, woher sie kommt. Es ist nicht mehr als eine lose Ahnung, gepaart mit einer Anziehung, die man weder versteht noch der man sich entziehen kann. Aber sie ist da, unaufhaltsam.
»Ich habe keinen zweiten Helm«, antwortet er.
»Und du lebst nicht gern gefährlich?«
»Warum habe ich das Gefühl, du bist ein schlechter Einfluss?«
Das bin ich vielleicht wirklich.
Weil ich es so satthabe, das Richtige zu tun.
Weil die richtigen Entscheidungen nicht dafür sorgen, dass einem das Universum, Karma oder ein Gott ein besseres Leben geben.
Weil richtig und falsch am Ende auch nur Wörter sind, deren Bedeutung wir am Ende selbst bestimmen.
Vielleicht bin ich ein schlechter Einfluss. Shit, vielleicht bin ich sogar ein schlechter Mensch. Aber jetzt gerade, mit Diez in dieser Oktobernacht, fühlt sich das richtiger an als die ganzen letzten Monate.
Ich mache einen Schritt auf ihn zu, nahe genug, damit ich das Leder riechen kann, aber nicht so nahe, dass wir uns berühren. »Kommt drauf an, wen man fragt«, murmle ich und hebe das Kinn.
Heute Nacht werde ich Diez’ falsche Entscheidung sein.
Kapitel 4
Jetzt
Frankfurt wacht gerade erst auf. Die Sonne kämpft sich zwischen den grauen Gebäuden hindurch und lässt die Tausenden von Fenstern schimmern, während ich weiterlaufe, ohne zu wissen, wo ich eigentlich hinwill. Der Kaffee in meiner Hand ist längst kalt geworden, aber meine Gedanken wollen sich immer noch nicht beruhigen.
Ada hat sich ziemlich klar ausgedrückt. Nur habe ich trotzdem nicht damit gerechnet, dass sie mich sofort wieder vor die Tür setzt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll.
Irgendwie war ich davon ausgegangen, dass wir durch die letzten Monate eine Art Verbindung zueinander aufgebaut hätten. Aber vielleicht war das reines Wunschdenken.
Das Klingeln meines Handys reißt mich aus meinen Gedanken. Es gibt nur eine Person, die mich um diese Uhrzeit anrufen würde. »Guten Morgen.«
Am anderen Ende der Leitung höre ich Elias’ Stimme. »Hey, Mann.«
»Was gibt’s?«
»Ich wollte eigentlich zu dir, aber du bist …«
»Bin gerade erst auf dem Weg nach Hause«, schneide ich ihm das Wort ab und haste über die Straße, weil die Ampel bereits rot ist. Den ganzen Weg bis zu mir werde ich nicht laufen, also muss ich mir langsam eine Haltestelle suchen.
»Um 6 Uhr morgens?«
»Ja, ich …« Wurde gerade nach einem Nicht-One-Night-Stand vor die Tür gesetzt.
Nur kann ich genau das Elias nicht sagen, immerhin komme ich aus der Wohnung, in der auch seine Freundin lebt. Verdammt, wann hat mein Leben eigentlich angefangen, so schrecklich kompliziert und verworren zu sein?
»Alles okay?«
»Sicher, ich nehm die nächste Bahn«, erkläre ich, ehe ich die Stufen zum Bahnsteig hinunterlaufe.
»Bro, ich kann auch …«
»Ich bin in ein paar Minuten da, du kannst warten, wenn du willst.«
Nachdem ich in die Bahn gesprungen bin, checke ich mein Handy. Es sind keine weiteren Nachrichten eingegangen, und auch wenn ich weiß, dass Ada wahrscheinlich schläft, regt sich Enttäuschung in mir.
Sie war es, die mich in den Club bestellt hat.
Sie hat mich geküsst.
Und es war ihre Idee, zu ihr zu fahren, um … na ja, eben das zu tun, was wir da getan haben.
Also was habe ich angestellt, das ihr offenbar so sehr missfallen hat, dass sie mich einfach rauswirft? Oder habe ich irgendwo zwischen Knutschen und Alkohol akzeptiert, dass sie mich für diese Nacht nur benutzt?
Wäre ja nicht zum ersten Mal so, flüstert eine heimtückische Stimme in meinem Kopf. Nur dass wir es sonst gar nicht erst in ihre Wohnung geschafft haben. Und sie mich bisher nicht rauswerfen musste.
Mein Kopf schmerzt zu sehr, um diesen Gedanken wirklich zu Ende zu führen. Und der Anblick meines besten Freundes vor meiner Haustür macht meine Lage nicht wesentlich besser.
»Du siehst scheiße aus«, begrüßt er mich.
Ich fummle den Schlüssel aus meiner Lederjacke. »Ungefähr so fühl ich mich auch.«
»Ich wusste gar nicht, dass du gestern noch wegwolltest«, meint Elias, als ich ihm die Tür aufhalte. Die Reifen seines Rollstuhls quietschen, als er sich vor dem Fahrstuhl umdreht und mich skeptisch anschaut.
Um Zeit zu schinden, drücke ich erst mal den Knopf. »War eher eine spontane Aktion.«
Elias kennt mich allerdings zu lange, um das einfach so hinzunehmen. »Und möchtest du mir dazu noch etwas sagen?«
»Nein, eigentlich wäre es mir lieber, wenn du es nicht weiter erwähnst«, brumme ich in mich hinein. Zum Glück ertönt das leise Ping, das uns verkündet, dass wir in meiner Etage angekommen sind. Schnell mache ich ein paar Schritte vor, um das Chaos aus Sportschuhen in meinem Flur zur Seite zu schieben, damit Elias genügend Platz hat.
»Dir ist schon klar, dass ich jetzt erst recht wissen will, was passiert ist, oder?«, murmelt er.
Da mir der billige To-go-Kaffee nicht ausgereicht hat, um meine Gedanken zu ordnen, begebe ich mich in die Küche. Elias folgt mir. Ich kann seinen Blick in meinem Nacken deutlich spüren. »Verrat du mir lieber, was du um 6 Uhr morgens von mir willst.«
»Eigentlich wollte ich dich abholen«, sagt er und legt seine Hände auf meinem Küchentisch ab.
»Und wozu?«
»Zum Training.«
Verwirrt drehe ich mich zu ihm um. »Was?«
Zu meinem Glück ist er nicht wütend, sondern eher belustigt. »Alter, wir haben das seit Wochen geplant.«
Irgendwo in meinem Hinterkopf regt sich die Erinnerung daran, dass wir uns vorgenommen haben, wieder öfter Sport zu treiben. »Shit, ich hab’s vergessen.«
»Ist mir aufgefallen«, sagt Elias lachend und deutet auf den Kaffee, der gerade durchläuft. »Bekomm ich auch einen?«
»Sicher, aber ich habe keine Milch da.«
»Passt schon.«
Ich fülle unsere Tassen und setze mich zu ihm, ehe ich den Kopf in eine Hand stütze. Mit einem Nicken deutet er auf meine Motorradkleidung, die mitten im Wohnzimmer verteilt liegt.
»Ich find’s gut, dass du wieder mehr fährst.«
Mit einer Hand wische ich mir über das Gesicht. »Ist ohne dich nicht dasselbe.«
Elias sieht mich ernst an.
Er weiß, dass es lange gedauert hat, bis ich den Unfall verkraften konnte. Was absurd ist, denn ich bin ohne einen Kratzer davongekommen. Doch das Bild meines besten Freunds, der blutend auf der Straße lag und es fast nicht überlebt hätte, hat sich tief in mein Unterbewusstsein gegraben.
»Gut, dass wir jetzt anfangen, wieder mehr Sport miteinander zu machen«, sagt Elias und zuckt mit den Schultern. »Wie wäre es, wenn wir heute auch wirklich damit anfangen?«
»Bro, ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, jetzt Sport zu machen.«
Elias’ schallendes Lachen fühlt sich an wie eine Ohrfeige, und ich muss mich daran erinnern, dass er ja nicht wissen kann, wie stark mein Ego heute Nacht beschädigt wurde. Schon wieder.
»Glaube ich auch nicht, aber wir sollten was essen«, entgegnet er. Lässig lehnt er sich zurück, während seine dunklen Augen mich mustern.
»Damit du mich weiter ausfragen kannst?«
»Ganz genau.«
»Kann ich mich vorher noch umziehen?«
Grinsend nickt er. »Sicher. Von dem Geruch nach Sex und Alkohol wird mir sonst noch ganz schwindelig.«
Sex, Alkohol und Herzschmerz, denke ich.
Aber ich sage nichts.
Es gibt diesen Augenblick, kurz bevor man wach wird, in dem man begreift, dass man schläft. Träumt. Und in dem man sich verzweifelt davon abzuhalten versucht, wirklich wach zu werden, weil man weiß, dass die Welt außerhalb des eigenen Kopfs viel zu dunkel ist, auch wenn der morgen versucht, einen mit dem Sonnenlicht zu locken.
»Shit.«
»Sie hat sich noch nicht mal darüber beschwert, dass wir das TikTok noch nicht gepostet haben.«
»Ist sie wach?«
»So würde ich ihren Zustand nicht beschreiben.«
»Ich kann euch hören«, stöhne ich und richte mich auf. Was ich ziemlich schnell bereue, weil mein Kopf dröhnt, als habe jemand ihn mit einem Hammer bearbeitet. Und obwohl ich dachte, mein Leben sei ohnehin schon die Hölle, wird alles noch schlimmer, als ich die Augen öffne.
Willa sieht mich mit diesem Blick an, der mir das Gefühl gibt, sie sei meine Mutter, die ich gerade bitterlich enttäuscht habe.
»Hier«, höre ich Martha und nehme die schmale Hand wahr, die sich in mein Gesichtsfeld schiebt und mir eine Aspirintablette und ein Glas Wasser reicht. Dicht gefolgt von einem großen Glas ihrer Anti-Kater-Spezialmischung. Meine Lebensrettung.
»Danke.«
Ich spüle die Tablette hinunter, wage es aber noch immer nicht, meine Augen weiter als nötig zu öffnen. Nach jedem Gewitter erscheint mir die Welt danach zu hell. Und es ist egal, ob das Gewitter den Himmel beherrscht oder meinen Kopf.
»Wie geht’s dir?«, vernehme ich Willa.
»Verkatert.«
Dass meine Freundinnen besorgte Blicke austauschen, muss ich nicht sehen, ich kann es förmlich fühlen. Manchmal kommt es mir so vor, als würden wir drei so oft aufeinanderhängen, dass wir schon eine telepathische Verbindung haben. Nur dass es cooler klingt, als es ist.
Dieses Mal ist es Martha, die als Erstes etwas sagt. »Kannst du dich an gestern noch erinnern?«
Die Frage irritiert mich fast so sehr wie die Tatsache, dass es unnatürlich hell in meinem Zimmer ist, obwohl die Vorhänge noch geschlossen sind. »Ja.«
»Gut, immerhin etwas.«
»Was soll das denn heißen?«, grummle ich und schiebe die Bettdecke von meinen Füßen. Die Luft im Zimmer ist stickig, was dafür sorgt, dass mir noch etwas übler wird.
Vielleicht auch, weil der Gedanke an Diez mich so sehr verkrampfen lässt, dass sich sämtliche meiner inneren Organe zusammenziehen.
»Du meinst, mal davon abgesehen, dass deine kleine Orgie uns geweckt hat?«, fragt Martha lächelnd. Aber es ist kein freundliches Lächeln, sondern eines, bei dem ich mich frage, ob sie mich liebt oder mich gern aus dem Fenster stoßen würde.
»Seit wann betreiben wir in dieser WG Sex-Shaming?«, gebe ich pampig zurück und will mich an ihr vorbeischieben, was allerdings nichts wird, weil mich ein Schwindelgefühl überkommt.
Willa springt an meine Seite, sodass ich ihren Arm ergreifen und mich auf sie stützen kann. »Das tun wir nicht«, antwortet sie schnell. »Wir machen uns nur Sorgen. Es war das dritte Mal in dieser Woche, dass du völlig betrunken nach Hause gekommen bist. Und nicht allein warst.«
Da sich der Schwindel endlich wieder gelegt hat, kann ich mich von ihr lösen. »Ich wusste gar nicht, dass wir jetzt über alle Aktivitäten außerhalb der WG Buch führen?«
»Ada, komm schon. Was sollte das gestern?«, meint Martha in ruhigem Ton.
Aber ich kenne sie zu gut. Offenbar habe ich gestern einmal zu oft eine Grenze überschritten, und auch wenn ich die Fassade meiner Coolness aufrechtzuerhalten versuche, tut es mir eigentlich leid. »Ich feiere nur etwas, dazu sind Feiertage doch da, oder?«
Willa und Martha sehen einander an. Es ist Erstere, die sich räuspert und den Kopf schief legt. »Also eigentlich sind unsere Vorlesungen bereits gestartet. Pfingsten ist fast eine Woche her.«
Damit hat sie mich eiskalt erwischt. »Oh.«
»Ja, oh«, ahmt Martha mich nach. »Und 66,66 Prozent dieser WG nehmen ihr Studium ziemlich ernst.«
»Autsch. Möchtest du noch etwas an mir kritisieren, während ich darauf warte, dass die Tablette wirkt?«
»Hör auf, um dich zu schlagen«, sagt Martha betont langsam. »Wir sind’s, nicht deine Eltern.«
»Du meinst meine Mutter«, zische ich zurück.
Damit habe nun ich sie eiskalt erwischt. Ich kann sehen, wie ihre ernste Miene bröckelt und darunter sichtbar wird, dass sie Mitleid hat. Ich hasse Mitleid.
»Tut mir leid, ich wollte nicht …«
»Hast du aber«, schnaube ich und marschiere aus meinem Zimmer in Richtung Bad. Ganz so einfach lassen meine Freundinnen mich allerdings nicht vom Haken.
»Wir verstehen, dass Trauer ein Prozess ist, Ada«, versucht Willa es noch einmal. »Und wir verstehen auch, dass jeder anders damit umgeht. Niemand hier verurteilt dich, aber wir brauchen unseren Schlaf und etwas mehr …«
»Ruhe«, ergänzt Martha.
»Schon verstanden, kommt nicht wieder vor«, sage ich in der Hoffnung, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen und gleichzeitig eine neue Regel für mich aufzustellen. Es war tatsächlich nicht meine beste Idee, ausgerechnet Diez anzurufen. Schon wieder. Und ihn mit nach Hause zu nehmen. Schon wieder. Verdammt, ich steh nicht mal auf Bikerboys, und trotzdem ...
»Und vielleicht sollten wir auch darüber reden, was da gestern passiert ist.«
Dieser Satz lässt mich innehalten, noch ehe ich die Badezimmertür aufgestoßen habe. »Was meinst du?«
Willa sucht offenbar noch nach den richtigen Worten, um es mir möglichst schonend beizubringen. Martha zuckt mit den Schultern. »Du warst ein Arschloch.«
»Bitte was?«
»Als du den armen Kerl rausgeschmissen hast, warst du ziemlich unsensibel«, erklärt Willa in versöhnlichem Ton. Offenbar haben sie beschlossen, Good Cop – Bad Cop zu spielen, und ich bin diejenige, die hier verhört wird. Scheiße, in den Thrillern mag ich das, aber gerade geht es mir auf die Nerven.
»Shit, konntet ihr denn alles hören?«, platzt es aus mir heraus.
»Ja«, entgegnen meine Freundinnen wie aus einem Mund. Und in mir regt sich so etwas Ähnliches wie Scham. »Tut mir leid, dass ich eure Nacht versaut habe. Kommt nicht wieder vor.«
Damit lasse ich die beiden stehen und betrete endlich das Badezimmer. Mein Spiegelbild ignoriere ich dabei. Das Letzte, was ich gebrauchen kann, ist zu wissen, dass ich genauso beschissen aussehe, wie ich mich fühle.
Unwirsch kratze ich über meine Arme und damit auch über die kleine Tätowierung der Ente, die durch das Weinglas schaut. Die Ente war meine Idee. So wie es offenbar zu meiner Funktion in dieser WG geworden ist, die schlechten Ideen zu haben, die sich nie wieder abwaschen lassen.
Nur liebe ich diese Ente. Nicht dafür, wie sie aussieht, sondern für das, wofür sie steht: dass ich mich für immer an diese WG erinnern werde, auf die eine oder andere Art.
Selbst dann, wenn meine Freundinnen mal wieder (zu Recht) wütend auf mich sind. Oder wenn mein Gehirn nicht mehr all die Erinnerungen abrufen kann, die ich so sorgfältig gesammelt habe.
Mit all den losen Gedanken im Kopf versuche ich, irgendwie damit klarzukommen, dass ich nun aufgewacht bin und der Traum vorbei ist. Hallo, Realität, hallo, Nachwirkungen von beschissenen Entscheidungen. Als wollte mein Körper mir auch gleich noch zeigen, dass er sich zusammen mit meinen Freundinnen gegen mich verschworen hat, sehe ich das frische Blut in meinem Slip und stöhne auf. Auch das noch.
Wie sehr kann mir die Welt eigentlich noch den Mittelfinger zeigen?
Als ich wieder aus dem Bad komme, werde ich abgefangen.
»Soll ich uns was zu essen machen?«, will Martha wissen, was aus ihrem Mund einer Entschuldigung gleichkommt.
»Ja, ich brauche was Fettiges. Mit viel Salz. Und Schokolade.«
»Aber als Erstes brauchst du eine Dusche«, kommentiert Willa.
Verdutzt blicke ich an mir hinunter. »So schlimm?«
»Um ehrlich zu sein, noch schlimmer. Ich kann den Alkohol aus jeder deiner Poren riechen.«
Genervt verdrehe ich die Augen. »Okay, gebt mir ein paar Minuten.«
»Wir warten in der Küche auf dich.«
Das tun sie, wie jedes Mal. Weil unsere Freundschaft irgendwie noch funktioniert, obwohl in meinem Leben gar nichts mehr funktioniert. Obwohl ich gar nicht mehr will, dass etwas in meinem Leben funktioniert.
Kapitel 5
6 Monate zuvor
Kaum etwas zeigt das Gefühl von Einsamkeit so gut wie ein leerer Krankenhausflur. Ich sitze vor dem Zimmer und warte darauf, dass meine Eltern sich verabschieden. Zumindest für heute, denn endgültig Abschied nehmen kann noch niemand von uns.
Ich reibe mir über die Arme. Obwohl es eigentlich warm ist, stellen sich mir die Härchen im Nacken auf.
Schließlich tritt mein Vater aus der Tür.
Jemand, der ihn nicht kennt, würde nicht bemerken, dass seine Augen gerötet sind. Oder die Flusen der Taschentücher auf seinem Sakko. »Deine Mutter braucht noch einen Moment.«
»Soll ich euch einen Kaffee holen?«, will ich wissen.
Er nickt, ohne wirklich zu antworten und ohne mich anzusehen. Manchmal frage ich mich, ob er mir nicht mehr in die Augen schauen kann, weil sie ihn zu sehr an die von Danielle erinnern oder weil er sich wünschte, dass nicht sie leblos in einem Krankenhausbett läge, sondern ich. Verdammt, es ist das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mir wünschte, hier zu sein und in einem Bett zu liegen. Erst bei Elias nach dem Motorradunfall und jetzt ...
Nur kann man einen Unfall nicht mit dem vergleichen, was Danielle passiert ist.
Resigniert stehe ich auf und schlurfe in Richtung Kaffeeautomat. Die Einsamkeit wird von Hektik abgelöst, von Stimmen, die sich beschweren, und vom Weinen der Menschen, die nicht wissen, was sie sonst tun können. Zielsicher steuere ich den Automaten an. Ich kenne den Weg inzwischen im Schlaf.
Fast fühlt es sich an, als sei ich in einer Zeitschleife gefangen. Der immer gleiche Ablauf, die immer gleiche Nachricht:
Deine Schwester wird vielleicht nicht wieder aufwachen.
Meine Gedanken werden abrupt unterbrochen, als ich gegen etwas stolpere und laut fluche. Brennende Hitze breitet sich auf meiner Brust aus. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, dass ich mit heißem Kaffee überschüttet wurde.
»Fuck.«
Blaue Augen starren mich an.
Eine junge Frau schiebt sich eine Strähne ihres pastelllila Haares hinters Ohr. »Was machst du denn hier?«
Ada.
Von allen Menschen auf der Welt habe ich mit ihr hier am wenigsten gerechnet. Das letzte Mal, dass wir uns getroffen haben, war im Roxy, und da haben wir kaum mehr als ein paar Worte gewechselt. Überhaupt bin ich eher der ruhige Typ, wenn mein bester Freund Elias mich mitnimmt und ich so irgendwie zu einem Teil des Freundeskreises von ihm und seiner Freundin Willa werde.
Grollend blicke ich auf den gigantischen Kaffeefleck auf meinem hellgrauen Hoodie. »Wie wäre es mit einer Entschuldigung?«
Ihr Blick wird etwas weicher, und sie beginnt in ihrer Handtasche nach Taschentüchern zu wühlen, die sie mir reicht. »Du bist in mich reingerannt«, meint sie, und die langen schwarz lackierten Nägel glänzen im künstlichen Licht. »Also, was machst du hier?«
»Das Gleiche könnte ich dich fragen«, brumme ich in mich hinein, während ich versuche, irgendwie den Fleck wegzutupfen. Meine Erfolgschancen sind zwar nicht sonderlich hoch, aber immerhin halte ich so meine Hände beschäftigt.
Verdammt, ausgerechnet sie. Ausgerechnet hier.
Ihre lila Haare durchbrechen das klinische Weiß des Krankenhauses.
Ada nimmt mich ein Stück zur Seite, damit noch andere Menschen an den Kaffeeautomaten kommen. »Ich besuche meinen Vater«, gibt sie zu. Ihr Blick flattert, als sie mich ansieht, als würde sie versuchen, die Mauer, hinter der sie sich versteckt hat, nicht einbrechen zu lassen.
»Und ich meine Schwester.«
»Ich wusste nicht, dass du eine Schwester hast.«
»Die Frage ist, ob ich noch immer eine habe.«
Ihre Augenbrauen wölben sich nach oben. »Was?«
»Vergiss es«, erwidere ich schnell, weil mir klar ist, dass ich ansonsten erklären müsste, was los ist. Und wie soll ich etwas erklären, das ich selbst noch immer nicht verstehe? »Hatte dein Vater einen Unfall oder so was?«
»Nein, nur Pech mit den Genen.«
Nun bin ich es, der verwirrt ist. Aber Ada winkt ab, als sei es nicht weiter wichtig. Nein, das stimmt nicht, als wollte sie das Thema möglichst schnell wieder vergessen. Und da ich mir nur zu gut vorstellen kann, wie sie sich fühlt, bohre ich auch nicht weiter nach.
»Eigentlich wollte ich nur schnell einen Kaffee für meine Eltern holen.«
»Im Kiosk um die Ecke ist er besser«, behauptet sie und wirft den leeren Plastikbecher in den Mülleimer neben uns.
»Und warum warst du dann nicht dort?«
Darauf geht Ada nicht ein, sondern bedeutet mir mit einer Handbewegung, ihr zu folgen. »Komm, wir besorgen uns einen anständigen Kaffee. Ich schulde dir was für das Desaster mit deinem Pulli.«
Eigentlich sollte ich Nein sagen, aber die Aussicht, dem Horror des Krankenhauses wenigstens kurz zu entkommen, ist zu verlockend. Genauso wie die Gesellschaft. Also nicke ich nur und folge Ada hinaus.
Das Wetter kann sich noch nicht so richtig entscheiden, ob es den Herbst zulassen will.
Schweigend laufen wir nebeneinanderher. Die Sonne blendet mich, während ich die Hände in die Hosentaschen schiebe und darüber nachdenke, wie ich die Stille zwischen uns füllen soll. Ich muss feststellen, dass ich besser meine Jacke geholt hätte, denn in den einfachen Hoodie kriecht die Kälte ebenso erbarmungslos hinein wie die Zweifel in meinen Kopf. Ada hingegen scheint das Schweigen nichts auszumachen. Sie steuert zielsicher den kleinen Kiosk an. Jede ihrer Bewegungen wirkt so sicher, so selbstbewusst, dass ich mir wünschte, etwas davon würde auch auf mich abstrahlen.
Erst nachdem Ada mir den frischen Kaffee gereicht hat, meint sie: »Huntington.«
Irritiert ziehe ich die Augenbrauen hoch. »Was?«
»Mein Dad.«
Mein Mund klappt auf. »Oh.«
»Es ist die dritte Lungenentzündung in diesem Jahr.«
»Das tut mir leid«, antworte ich, weil man mir beigebracht hat, dass man diesen Satz in solchen Momenten eben sagt. Selbst dann, wenn er nichts bringt und lediglich dafür sorgt, dass die Wunden nur noch stärker bluten.
Ada nippt an ihrem Kaffee, während wir uns langsam wieder in Richtung Krankenhaus bewegen. »Muss es nicht. Was ist mit deiner Schwester?«
Ich schlucke.
Danielle und ich sind nur ein Jahr auseinander, aber sie ist trotzdem meine kleine Schwester. Ich wollte sie immer beschützen und konnte es doch nie, weil sie viel öfter mich beschützt hat.
»Du musst es mir nicht sagen, ist schon okay.«
Nur liegt mein Schweigen nicht daran, dass ich es ihr nicht sagen will. »Ich habe irgendwie Angst davor, es laut auszusprechen«, gestehe ich so leise, dass ich erst nicht glaube, dass sie mich verstanden hat.
Ada bleibt stehen. Ihre blauen Augen durchdringen mich mit einer Klarheit, die sich anfühlt, als könnte sie direkt in mein Innerstes sehen. In all die Gedanken und Gefühle, die ich sorgfältig in einem der hintersten Winkel meines Kopfs versteckt habe. »Weil es dann real wird?«
Ich halte ihrem Blick kaum stand, kann aber dennoch nichts anderes tun, als ihn zu erwidern. »Damit kennst du dich wohl aus.«
»Besser, als mir lieb ist«, entgegnet sie.
Dann bricht der Blickkontakt zwischen uns ab, und ich erlaube mir, erleichtert aufzuatmen. Ich betrachte sie von der Seite, während wir weiterlaufen. »Danke.«
»Wofür?«, will sie mit einem kleinen Grinsen wissen. »Dafür, dass ich dich mit Kaffee verbrüht und dich dadurch vor der Plörre bewahrt habe?«
»Dass du mich nicht drängst, darüber zu reden.«
Sie wirft den Kopf in den Nacken und lacht auf. »Ich glaube, Reden wird überbewertet.«
»Tatsächlich? Und was sollte man sonst tun?«
Sie richtet den Blick wieder auf mich, der jetzt anders ist als zuvor. Herausfordernder. »Gib mir dein Handy.«
Keine Frage. Keine Bitte. Eine Aufforderung.
Für den Bruchteil einer Sekunde zögere ich, weil es sich anfühlt, als würde ich mich auf etwas einlassen, von dem ich nicht weiß, ob es mir gefallen wird. Doch je länger sie mich ansieht, desto deutlicher wird mir bewusst, dass ich mich schon entschieden habe. Ich fummle das Handy aus meiner Jeanstasche, entsperre es und reiche es ihr.
Ada tippt ihre Nummer ein und gibt es mir zurück. »Schreib mir, wenn du wieder mal nicht über die Scheiße in deinem Leben reden willst.«
Ich schlucke. »Mach ich.«
Lächelnd dreht sie mir den Rücken zu. »Bis dann, Diez.«
Und dann geht sie.
Wie der Sonnenschein, wenn die Wolken am Himmel wieder dichter werden.
Kapitel 6
Jetzt
Die Buch-WG, drei Girls aus Frankfurt und der Dackel Herr Fitzek.
Ich blicke auf unseren TikTok-Kanal, obwohl ich weiß, dass ich nur Zeit schinde. Es freut mich zwar, dass unser WG-Dackel Herr Fitzek auch mit dem aktuellen Video, in dem er sehr zu Willas Empörung auf Trusting Was the Hardest Part herumkaut, viral gegangen ist, aber gerade kann mich der Sog der App nur kurzzeitig aufheitern. Schnell beantworte ich ein paar der Kommentare, die sich unter dem Video gesammelt haben, dann lasse ich das Smartphone in meine Handtasche fallen.
Die echte Welt wartet nicht länger.
Jedes Mal, wenn ich vor der Wohnungstür meiner Mutter stehe, muss ich mich daran erinnern, dass der Ort hinter dem Holz nicht mehr mein Zuhause ist. Nur noch ein fragiles Abbild, wie eine Erinnerung, die immer rissiger wird und die man nicht mehr lange festhalten kann.
Und jedes Mal wieder ist es, als würde mein Herz erneut brechen und die Reste meiner Kindheit unter seinen Scherben begraben.
Noch einmal atme ich tief ein und aus, dann setze ich mein falsches Lächeln auf und öffne die Tür. »Ich war einkaufen«, rufe ich hinein und balanciere die zwei schweren Tüten durch den schmalen Flur.
Meine Mutter hebt den Kopf. »Das musst du doch nicht«, sagt sie sofort, steht aber nicht vom Sofa auf, als ich in die Küche gehe.
»Na ja, jemand muss es tun, und ich bin mir gerade nicht sicher, ob du das Sofa verlassen hast, seit ich gestern bei dir war«, erkläre ich und stemme die Hände in die Hüften, während ich sie eingehend betrachte.
In den letzten Wochen ist sie schmaler geworden. Manchmal kommt es mir vor, als würde sie versuchen zu verschwinden.
Müde steht sie auf und schlingt den fleckigen Bademantel enger um sich. »Ich war duschen«, sagt sie, weil sie weiß, dass ich verstehe, wie schwer schon dieser alltägliche Akt für sie gewesen sein muss.
»Das ist ein Anfang. Dann würde ich sagen, du ziehst dir etwas an, und dann gehen wir eine Runde spazieren«, schlage ich vor und räume die Fertiggerichte in den Kühlschrank. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn ich Martha bitten würde, etwas zu kochen, aber es ist schon schwer genug, meine Fassade vor einem Menschen aufrechtzuerhalten.
Mama kommt näher und greift nach meiner Schulter. »Ada, ich bin deine Mutter. Ich sollte mich um dich kümmern.«
»Also ich finde, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich mich um dich kümmern will oder nicht«, gebe ich trocken zurück.
»Ich komme zurecht.«
»Nein, das tust du nicht, und das ist auch in Ordnung.«
Ihre blauen Augen verdunkeln sich. »Du weißt, was ich meine.«
»Und du weißt, dass ich stur bin. Also zieh dir was an.«
Sie überlegt einen Moment, ob sie die Kraft hat, sich mit mir zu streiten, doch dann nickt sie. Ich warte, bis ich höre, wie die Tür des Schlafzimmers hinter ihr zufällt, dann fluche ich leise.
Papas Bild blickt mich in der Küche an.
Es zeigt uns bei meiner Einschulung. Lächelnd, glücklich.
Tränen brennen in meinen Augen.
Früher habe ich nicht verstanden, warum wir von allen wichtigen Dingen in unserem Leben Fotos machen. Aber inzwischen weiß ich, dass Erinnerungen in unserem Kopf nicht für immer gespeichert sind. Einen Moment halte ich inne.
So viele Fotos, die eine Familie zeigen, die nicht mehr vollständig ist.
Und das Chaos, das dieser Verlust hinterlassen hat, obwohl wir alle darauf vorbereitet waren.
Der Müll stapelt sich inzwischen nicht mehr nur in der Küche, sondern auch auf dem Balkon. Die Teller, die ich gestern abgespült habe, stehen noch immer auf der Spüle. Aber am schlimmsten sind die Kisten.
Kisten und Tüten voller Dinge, die jetzt niemand mehr in dieser Wohnung braucht. Weil mein Vater nicht mehr hier ist.
Ich habe versucht, zumindest einen Teil in den Keller zu räumen, aber meine Mama hat so sehr geweint, dass ich mich jetzt kaum noch traue, auch nur irgendwas zu verschieben. Selbst der Morgenmantel meines Vaters liegt noch auf seinem Sessel, als würde sie glauben, dass er ihn jeden Moment brauchen könnte.
»Jetzt nicht«, sage ich mir und wische mir über die Augen. Es nützt niemandem etwas, wenn ich jetzt zusammenbreche. Am wenigsten meiner Mutter.
»Nimmst du mich so mit?«, fragt diese und deutet auf ihre Jogginghose und das Oversize-Shirt, in dem sie noch kleiner wirkt. Die Haare hat sie zu einem unordentlichen Knoten hochgebunden, aus dem die grauen Strähnen abstehen.
»Du siehst gut aus.«
»Das schlechte Lügen hast du von mir«, murmelt sie ausweichend.
»Nur eine Runde um den Block, du wirst sehen, etwas Bewegung wird dir guttun«, sage ich so sanft ich kann, denn eigentlich würde ich gern schreien.
Sie sagt nichts, lässt aber zu, dass ich ihren Arm nehme und sie mit mir ziehe.
»Wie läuft die Uni?«, will sie wissen, als ich ihr die Sonnenbrille reiche, damit sie keine Kopfschmerzen bekommt. Der Sommer ist endlich da, doch keine von uns scheint die Wärme zu genießen. Meine Schritte auf dem rissigen Asphalt lenken meinen Blick weg von den grünen Bäumen und hin zu dem Grau, das mich so viel besser zu verstehen scheint.
Erst als meine Mutter sanft meinen Arm drückt, wird mir bewusst, dass ich ihr noch nicht geantwortet habe. »Ist ganz okay«, gebe ich ausweichend zurück.
»Deine Begeisterung ist ansteckend.«
»Ich weiß einfach nicht, ob es das Richtige ist, zu studieren«, gebe ich zu. Das Studium und ich haben eine Hassliebe, bei der ich noch nicht weiß, wie sie enden wird.
Verdutzt sieht meine Mutter mich von der Seite an, während wir über den Bürgersteig laufen. Zwischen den Wohnblöcken sind kastenförmige Rasenabschnitte, in denen Bäume stehen, die aussehen, als würden sie dem nächsten Sturm nicht mehr standhalten. Aber immerhin die Gänseblümchen bahnen sich ihren Weg und durchbrechen das Grün mit ihren Schattierungen von Rosa bis hin zu kräftigem Lila, das die sonst so weißen Blüten umrandet, als wollten die Blumen ihre Schönheit selbst unterstreichen. Meiner Mutter scheinen die Gänseblümchen nicht aufzufallen. »Aber du mochtest das doch immer?«
Was ich mag, sind gute Geschichten.
Spannung und Nervenkitzel und einen Thrill, der mir das Gefühl gibt, lebendig zu sein. Was ich mag, sind Bücher. Worte, die es schaffen, mich für ein paar Stunden aus meinem eigentlichen Leben zu reißen, um ein ganz anderes zu erleben. Und ich mag es nicht nur, sondern mehr noch: Ich brauche es. Allerdings ist mein Studium das Gegenteil eines spannenden Thrillers. Es ist eher einschläfernd.
Schulterzuckend schiebe ich mir die Sonnenbrille höher auf die Nase. »Ich mag es, ich frage mich nur, ob ich wirklich irgendwann in einem Verlag arbeiten will oder ob es nicht sinnvoller wäre, mir mein Hobby nicht durch den Beruf zu versauen.«
»Ich denke nicht, dass du dir etwas versauen kannst, das du so sehr liebst wie das Lesen.«
Schluckend zwinge ich mich, wieder zu lächeln. »Stimmt, und irgendwer muss ja den nächsten Fitzek finden.«
»Ich bin sicher, dass du es sein wirst«, sagt sie aufmunternd, und ihre Mundwinkel zucken sogar ganz kurz nach oben. Das ist mehr, als ich in den letzten Tagen geschafft habe.
»Na immerhin eine von uns beiden.«
»Dein Vater war auch sicher.«
»Ich weiß, Onkel Rupert erzählt jedes Mal davon, dass Pa gewettet hat, dass ich den nächsten Starautor oder die nächste große Starautorin finde«, murmle ich, ohne zu wissen, ob mich die Erinnerung freut oder unter Druck setzt.
»Ich bin sicher, ausnahmsweise wird er diese Wette gewinnen.«
Den Rest des Wegs laufen wir schweigend, aber ich rede mir ein, dass die frische Luft allein dafür sorgt, dass ihr fahles Gesicht mehr Farbe bekommt.
Wieder in der Wohnung, lässt sie sich schwerfällig aufs Sofa sinken. »Am Montag muss ich wieder arbeiten«, höre ich sie sagen.
»Es wird dir guttun, wieder unter Menschen zu sein«, antwortete ich und lächle aufmunternd. »Und das Sofa kann auch eine kleine Auszeit von dir gebrauchen.«