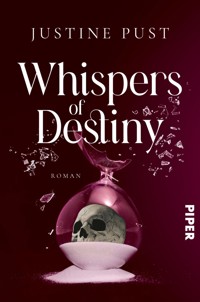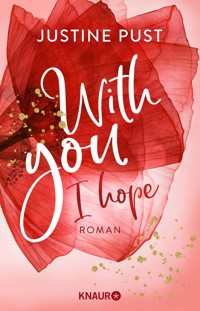9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Belmont Bay
- Sprache: Deutsch
Eine Liebe gegen alle Widerstände: In »With you I heal«, dem dritten Band der New-Adult-Reihe »Belmont Bay« von Justine Pust, treffen Arin und Sophia aufeinander, die beide bisher wenig Glück im Leben und in der Liebe hatten. Arin ist gerade clean geworden und steht vor den Scherben seines bisherigen Lebens. Sein schlechter Ruf in dem kleinen Städtchen Belmont Bay sorgt dafür, dass er keinen Job bekommt – bis er vom alten Bennett den Auftrag erhält, seinen Oldtimer wieder flottzumachen. Dabei trifft er auf Sophia, Bennetts Enkelin, die nach Belmont Bay zurückgekehrt ist, um für ihren Großvater da zu sein – zumindest ist das die offizielle Version. Aber Sophia scheint etwas zu verbergen. Eine Dunkelheit, die Arin nur zu gut kennt. Trotz aller Warnungen, Arin solle sich von Sophia fernhalten, fliegen zwischen den beiden bald die Funken … Justine Pust schreibt New-Adult-Liebesgeschichten, die unter die Haut gehen und ihre Leser*innen absolut in ihren Bann ziehen. Intensiv, romantisch, dramatisch und hoffnungsvoll. Dabei geht es in ihren Liebesromanen auch immer um Themen, die Justine Pust als Autorin am Herzen liegen. Die Liebesromane der Belmont-Bay-Reihe sind in folgender Reihenfolge erschienen: - With you I dream (Mia & Conner) - With you I hope (Megan & Leo) - With you I heal (Sophia & Arin)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 521
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Justine Pust
With you I heal
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Inhaltsübersicht
Triggerwarnung – Hinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
Nachwort
Danksagung
Quellenverzeichnis
Triggerwarnung
Triggerwarnung – Hinweis
Liebe Leser*innen,
bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen euch gute Unterhaltung mit With you I heal.
Justine und der Knaur Verlag
Dieses Buch ist für dich.
Manchmal brauchen wir zum Heilen nur eine zweite Chance.
Playlist
MOD SUN – Flames
Fall Out Boy – Thnks fr th Mmrs
Billie Eilish – Lost Cause
Rise Against – Ready To Fall
SIXX AM – Better Man
Machine Gun Kelly – maybe feat. Bring Me The Horizon
Worms – Viagra Boys
YUNGBLUD – The Funeral
Tom Odell – Heal
1
Es heißt, wer hoch fliegt, fällt länger.
Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es ist, nicht zu fallen.
Ich werde oft gefragt, wie es anfing. Was der Grund dafür war, dass ich mein Leben gegen die nächste Pille eingetauscht habe. Es gibt so viele tragische Geschichten über Liebe und Verlust. Über dunkle Schatten, die einen immer wieder einholen, und Herzen, die im Ozean des Lebens ertrunken sind. Ich habe keine solche Geschichte – ich war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort mit der falschen Familie und den falschen Freunden. Und zu willensschwach. Von Grund auf verdorben, wie meine Mutter zu sagen pflegt. Mein Weg war lange vorherbestimmt, ehe ich auch nur die Chance hatte, es zu begreifen. Und dann kamen die Pillen.
Es fing harmlos an. Schleichend. Ich hatte mich im Griff. Ich hatte die Medikamente im Griff. Zumindest so lange, bis sie mich im Griff hatten. Bis jeder Atemzug sinnlos war, wenn ich nicht high sein konnte.
Der Absturz hat mich gerammt wie ein Truck, im wörtlichen Sinne. Er war erbarmungslos und brutal, genau wie der folgende kalte Entzug. Ich will nicht lügen, damals dachte ich, mein Leben wäre vorbei. Nichts ergab mehr Sinn, nichts war so gut wie auf Drogen. Der erste Rückfall war naiv, der zweite fast tödlich.
Aber ich will das nicht mehr.
Kein Drama. Keine Höhen. Keine Tiefen.
Ich will einfach nur versuchen, ein besserer Mensch zu werden. Was nicht gerade schwer werden dürfte, wenn man bedenkt, was für ein unfassbares Arschloch ich auf Drogen war. Aber ich suche auch nicht nach Vergebung, denn die werde ich in dieser Stadt ohnehin nie bekommen. Alles, was ich will, ist Ruhe.
Schon während ich an diesem ersten schönen Frühlingstag auf das Haus der Kirchengemeinde zugehe, in dem das Treffen stattfinden soll, möchte ich am liebsten wieder umdrehen.
Alles in mir sträubt sich, während ich eintrete.
Im Inneren des Gebäudes ist bereits der Stuhlkreis aufgestellt. Der Geruch von Kaffee und Plätzchen liegt in der Luft. Caroline winkt mir lächelnd zu und schenkt sich ein, ehe sie das kleine Büfett aus Knabberkram und Donuts zufrieden betrachtet. Die Wochen, in denen sie für das Essen zuständig ist, sind mir am liebsten. Der alte Bennett setzt uns immer nur gekaufte Kekse vor, die schmecken, als hätte er sie seit Wochen in der Vorratskammer vergessen.
Jemand fragt, ob ich auch etwas möchte, aber ich lehne ab. Vor den Gruppentreffen bekomme ich selten etwas runter und bin noch weniger dazu in der Lage, mit den anderen zu tratschen. Vielleicht ändert sich das irgendwann, doch gerade ist es für mich schon ein Sieg, dass ich überhaupt aufgestanden und hergekommen bin.
Eigentlich wäre ich lieber wieder zu Hause in meinem Trailer und würde ignorieren, was ich bin und was ich war und wie verflucht tief ich in meinem Loch aus Selbstmitleid stecke.
Dabei folgt mir die flüsternde Stimme in meinem Kopf überallhin. Raunt immer wieder die Worte, die dafür sorgen, dass ich den Wunsch habe, eine Pille einzuwerfen. Junkie. Loser. Monster.
Mit einer Hand wische ich mir das dunkle Haar aus der Stirn und sehe mich um. Das gute Wetter ist sicher schuld daran, dass wir weniger sind als sonst, und das bedeutet auch, dass wir mehr Zeit für jeden Einzelnen haben. Ich spüre das unangenehme Prickeln auf meiner Haut und fühle mich fehl am Platz, was absurd ist, weil ich wahrscheinlich nirgendwohin so sehr gehöre wie hierher.
Die meisten Mitglieder kennen sich bereits, und da in dieser Stadt ohnehin niemand wirklich lange unbekannt bleibt, ist es unnötig, dass wir uns einander vorstellen. Stattdessen erhalte ich ein stilles Nicken von allen, an denen ich vorbeigehe.
Gesprächsfetzen der anderen dringen zu mir herüber. Der alte Bennett hat sich gerade einen der Neuen zur Brust genommen, der sich lautstark schnäuzt.
Jimmy.
Wir kennen uns besser, als gut für uns beide ist, denn Jimmy wohnt wie ich im Trailerpark. Und wie ich hat er die meiste Zeit seines Lebens mit Partys verbracht. Und mit dem Dealen. Ich habe keine Ahnung, was ich davon halten soll, dass er nun in der Selbsthilfegruppe für Süchtige aufschlägt. Aber vielleicht war es die gleiche Bedingung wie bei mir: Lass dir helfen oder geh in den Knast.
»Kannst du dir gleich mal merken, bei uns muss sich keiner erklären. Ist schon okay«, nuschelt der alte Bennett, und ich muss fast grinsen. Genau diesen Satz hat er mir schon oft gesagt. Erklärungen sind unnötig, wenn alle das gleiche Monster in sich tragen.
Ich hänge meine Jacke über einen der Stühle, ehe ich mich setze. Das Klischee einer Hollywood-Selbsthilfegruppe stimmt nur bedingt. In kleinen Gemeinden ist der Stuhlkreis zwar ein fester Bestandteil, doch die Zusammensetzung der Leute entspricht nicht unbedingt dem, was man aus Filmen und Serien kennt.
Unsere Süchte sind alle unterschiedlich und doch gleich, denn sie haben uns dazu gebracht, Dinge zu tun, die furchtbar sind. Der größte Teil der Leute hier ist älter als ich, und die wenigsten wirken so, als hätten sie keinerlei Perspektive in ihrem Leben. Doch wie bei allen guten Klischees gibt es einen Hauch Wahrheit. Mir gegenüber nimmt eine Frau Platz, die wie ein warnendes Beispiel wirkt. Das Lächeln mit gelben Zähnen, die ausgemergelte Gestalt. Mein Körper schüttelt sich leicht, noch ehe ich es verhindern kann. Es ist ihr vierter Rückfall gewesen. Crystal Meth ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Meine Mutter hat es auch eine Zeit lang genommen, und das war so ziemlich der Sargnagel für die Familie, die wir einmal waren.
»Hallo, Gorgina«, grüße ich die Frau halbherzig. Sie wohnt drei Trailer weiter. Noch eine, mit der ich wahrscheinlich mehr gemeinsam habe als die meisten anderen in diesem Raum. Und das ist wirklich kein gutes Gefühl. Gorgina, Jimmy und ich – wir, die Quoten-Loser. Vermutlich ist es ziemlich mies, dass ich so über sie, über uns denke. Aber es sind eben die Gedanken, die dir beigebracht werden, wenn der Großteil der Gesellschaft dich wie Dreck behandelt.
Ich schlucke einen Kloß aus Selbstekel hinunter und warte, dass sich auch die anderen setzen. Joline, die Leiterin dieses Spektakels, kommt zu mir und drückt mir einen Tee in die Hand. Der Pappbecher ist warm genug, damit meine tauben Finger wieder zum Leben erwachen. Der Frühling mag sich heute zum ersten Mal zeigen, doch die Sonne hat noch keine wärmende Kraft. Jolines Lächeln ist echt, aber es dringt nicht zu mir durch. »Schön, dass du da bist«, sagt sie und setzt sich mit einem Block in der Hand auf ihren Platz.
»Aus deinem Mund klingt das, als hätte ich eine Wahl«, gebe ich zurück, obwohl ich eigentlich nicht streiten will.
»Die hast du jeden Tag, Arin«, antwortet sie leichthin. »Steht unser Termin nächsten Mittwoch noch?«
Ich nicke. Joline leitet die Selbsthilfegruppe zwar ehrenamtlich, aber sie ist auch Sozialarbeiterin. Meine Sozialarbeiterin. Und damit eine der wenigen Personen in meinem Leben, die dafür gesorgt haben, dass ich nicht vollends vor die Hunde gehe oder wie der Rest meiner Familie im Gefängnis lande.
Bennett setzt sich ebenso wie Jimmy, der mir immer wieder Blicke zuwirft. Wahrscheinlich, weil wir früher so was wie Freunde waren und ich jetzt zusehe, dass ich ihm aus dem Weg gehe, so gut ich eben kann.
Geduldig wartet Joline, bis sich das Gemurmel legt und die Plätze sich füllen. »Schön, dass ihr alle heute hier seid, und wie ich sehe, hat unsere kleine Gruppe Zuwachs bekommen«, beginnt sie freundlich. »Alles, was in diesem Raum gesagt wird, bleibt auch in diesem Raum. Niemand braucht Angst vor Verurteilung oder Ablehnung zu haben, denn auf diesen Stühlen …«, sie zeigt auf den leeren Sitz neben sich, »… sind wir alle gleich.«
Niemand reagiert auf ihre Rede, doch das ist Joline wahrscheinlich schon gewohnt. »Jimmy, möchtest du der Gruppe ein bisschen was über dich erzählen?«
Jimmy sieht erst zu ihr, dann zu mir und schüttelt den Kopf. Da es sein erstes Mal ist, genießt er so etwas wie Welpenschutz. Ich habe die ersten Male in dieser Gruppe auch geschwiegen. Manchmal ist schon allein das Zuhören genug Herausforderung für einen Tag.
Jolines Blick wandert durch die Runde. »Wer möchte anfangen?«
Niemand von uns rührt sich, was ihr ein tiefes Seufzen entlockt. »Bitte denkt immer daran, dass euer Augenmerk mehr auf das Gelungene gerichtet sein sollte«, fährt sie mit ihrer Ansprache fort. »Die Zeiten der Abstinenz, egal, ob viele Jahre, ein paar Monate, ein paar Tage bis hin zu den letzten vierundzwanzig Stunden, sind ein Grund, stolz auf sich zu sein.«
Sie verstummt, als würde sie nur darauf warten, dass jemand frustriert genug ist, um ihr zu widersprechen. Sosehr mir diese Treffen auch immer an die Nieren gehen, sosehr bewundere ich doch die Bereitschaft der Leute, für andere da zu sein. Besonders Joline. Sie organisiert alles und verteilt Aufgaben an weitere Freiwillige. Dinge wie Tee kochen, den Stuhlkreis auf- und abbauen, neue Mitglieder begrüßen, den Büchertisch beaufsichtigen und Anschlusstreffen nach den Meetings veranstalten. Sie geht vollends in ihrer Position auf, und ich verstehe absolut nicht, wie sie sich für Menschen wie mich begeistern kann. Oder wieso sie ihre Freizeit auch noch mit uns verbringen möchte.
»Arin?«
Ich weiß bereits, dass ich mich ihrer Bitte nicht entziehen kann, und beginne, noch ehe sich in mir eine Blockade aufbaut. »Ich bin Arin, und ich bin abhängig von Schmerzmitteln«, rede ich drauflos und klinge dabei genauso genervt, wie ich bin. Nicht weil ich hier bin, sondern weil ich mich so schlecht dabei fühle, hier sein zu müssen.
»Hallo, Arin«, schallt mir der Chor entgegen.
Ich umfasse den Pappbecher in meiner Hand etwas fester und kratze mich unruhig hinterm Ohr. Mein plötzliches Schweigen bleibt nicht unbemerkt, und Joline sieht mich mit einem freundlichen Lächeln an, das vor Verständnis fast tropft. »Lass dir Zeit«, sagt sie und lehnt sich betont entspannt zurück. »Du weißt, du bist hier unter Menschen, die dich verstehen.«
Fast hätte ich zynisch aufgelacht. Verstehen? Vielleicht verstehen sie meine Sucht, aber mich versteht in dieser Stadt niemand. Ganz Belmont Bay hasst mich, und ich kann es ihnen nicht einmal verdenken. Keiner von ihnen verspürt so viel Hass mir gegenüber wie ich selbst. Aber ich will clean bleiben, und dafür brauche ich diese Treffen. Egal, wie sehr ich den anderen Menschen in diesem Raum zuwider bin.
»Morgen sind es sechs Monate, seit ich die letzte Pille genommen habe«, fange ich wieder an und versuche, die Blicke auf mir nicht als Bedrohung aufzufassen. »Ich schätze also, es läuft ganz gut.«
»Aber?«, fragt Joline nach, ohne ihr Lächeln abzulegen.
»Aber ich kann meine Miete nicht von meinem guten Willen bezahlen«, erkläre ich und rutsche etwas auf meinem Stuhl nach vorn. »Ist ja schön, dass ich clean bin und mich scheiße fühle, weil ich clean bin. Aber was nützt es mir, wenn ich keinen Job finde?«
»Um an das Geld für deine Pillen zu kommen, ist dir auch immer etwas eingefallen«, höre ich von Caroline.
Die Gruppe sieht sie tadelnd an, was dafür sorgt, dass sie sich entschuldigend räuspert. Dabei ist sie einer der wenigen Menschen hier, dem ich so etwas wie Respekt entgegenbringe. Sie verstellt sich zumindest nicht, behandelt mich drinnen genauso wie draußen. Ist ehrlich. Das kann man nicht von allen hier behaupten.
»Ich denke, was Caroline eigentlich sagen wollte, ist, dass du nicht aufgeben darfst«, setzt Joline ein. »Du wirst schon einen Job finden.«
»In dieser Stadt?«, schieße ich zynisch zurück. »Ganz sicher nicht.«
Natürlich ist diese Gruppe anonym, aber in Belmont Bay gibt es keine Geheimnisse. Jeder weiß, was ich getan habe. Alle wissen, dass ich abhängig von Medikamenten bin. Und alle wissen, dass ich nicht mehr wert bin als der Dreck unter ihren Schuhsohlen.
»Es wird immer schwere Phasen geben«, sagt Gorgina mir gegenüber, in einem übergroßen schwarzen Pulli voller kleiner Löcher. Ich will sie nicht verurteilen, weil gerade ich weiß, dass hinter all dem, was die Sucht mit ihr macht, ein guter Mensch steckt. Dennoch kann ich ihr kaum in die Augen sehen, weil ich in ihnen den Abgrund erkenne, in den auch ich fallen könnte. Und der ist viel tiefer, als ich wahrhaben will.
»Und Rückschläge«, setzt der alte Bennett nach.
»Und was kann ich tun, damit es nicht passiert?«, will ich grollend wissen und wische mir über die Nase.
»Das ist ebenso einfach wie schwer, Arin«, sagt Joline lächelnd. »Nimm auch weiterhin keine Drogen und beweis den Menschen, dass du dich geändert hast.«
»Großartig, damit kann ich richtig viel anfangen. Meine Probleme sind quasi schon gelöst …«
»Wir wissen alle, dass es nicht einfach ist«, versucht Joline es erneut. »Und wir hören dir gern zu.«
Mein Gesicht zieht sich zusammen, als hätte ich in ein Stück Zitrone gebissen. »Message angekommen: Bleib clean und such dir ’nen Job.«
»Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass du bald etwas finden wirst.«
Bennett fängt meinen Blick auf, aber er bleibt schweigsam. Natürlich. Selbst wenn jemand hier im Raum wüsste, wo ich Arbeit finden kann – es ist alles nur Show. Sie sind nett zu mir, weil ich in diesem Stuhlkreis sitze. Nicht, weil sie sich tatsächlich um mich sorgen. Na ja, Joline vielleicht. Aber das ist ja auch ihr Job.
»Deine Zuversicht hätte ich auch gern«, knurre ich finster, obwohl ich weiß, dass meine Wut mir nicht weiterhelfen wird.
»Warte ab, bis du sechs Jahre statt Monate geschafft hast«, meint Caroline, die offenbar versucht, etwas halbwegs Brauchbares zu sagen. »Mit jedem Monat mehr wird es leichter – aber im ersten Jahr ist noch alles hart, weil du dich deiner eigenen Verantwortung stellen musst. Ohne Möglichkeiten der Flucht.«
»Super«, stöhne ich und lasse den Kopf in die Hände sinken. »Das klingt ja nach jeder Menge Spaß.«
Wer seine Zunge hütet, bewahrt sein Leben.
Dieser Satz will mir einfach nicht mehr aus dem Kopf gehen.
Immer und immer wieder spiele ich die letzten Stunden durch, versuche zu verstehen, was eigentlich passiert ist – und warum ich jetzt auf der Straße sitze, ohne zu wissen, wohin ich gehen soll.
Und alles nur, weil ich nicht meinen Mund gehalten habe. Ich dachte, die Wahrheit zu sagen, würde mich befreien. Mir irgendwie dabei helfen, mit dieser Situation umzugehen, aber das Gegenteil ist passiert. Und jetzt … bin ich allein. Mit mir und der Finsternis meiner Gedanken.
Der eisige Frühlingswind fegt über die Straßen, während ich ziellos herumlaufe. Obwohl heute der erste Tag war, an dem es in Idaho etwas wärmer wurde, ist davon nun nichts mehr zu spüren. Mit der Sonne scheint auch der Frühling wieder untergegangen zu sein. Stehen zu bleiben würde nur bedeuten, noch stärker zu frieren, aber ich weiß, dass ich nicht ewig durch die nächtliche Stadt irren kann. Ich brauche einen Platz zum Schlafen, jemanden, der mich aufnimmt.
Etwas Trost wäre auch nicht schlecht, aber darauf kann ich wohl gerade eher nicht hoffen. Tränen steigen mir in die Augen, denn wo soll ich hin?
Meine eigene Mutter hat mich aus der Wohnung geworfen. Ich habe keine Freunde, nicht einmal mehr einen Freund. Niemanden, der sich dafür interessiert, wie es mir geht. Ich bin allein. Und die Nacht und der Wind haben kein Erbarmen, treiben mir nur noch mehr Tränen in die Augen, als würden sie mich zusätzlich bestrafen wollen.
Wieso nur musste ich etwas sagen? Warum habe ich nicht einfach ein Geheimnis daraus gemacht?
Ich lasse mich auf einer einsamen Parkbank nieder. Der Bahnhof ist in der Ferne zu sehen, aber ich wüsste nicht, wohin mich ein Zug bringen sollte. Obwohl … Mir kommt ein Gedanke, der eine vage Hoffnung in mir aufkeimen lässt und mir zugleich erneut Angst macht. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit meinem Großvater gesprochen. Hauptsächlich, weil Mom es verboten hat.
Trotzdem ziehe ich mit zitternden Händen mein Smartphone aus der Hosentasche. Ich kenne die Nummer noch immer auswendig. Obwohl es weit nach elf Uhr abends ist, klingelt es nur zweimal, ehe mein Grandpa abhebt.
»Bennett«, grunzt er in den Hörer, und vor Schreck wäre mir mein Handy fast auf den Boden gefallen.
»Ich …«
Er schnaubt wütend: »Himmel, wer ruft mich mitten in der Nacht an?«
Kurz sammle ich meinen Mut. »Ich bin’s, Grandpa. Sophia.«
Am anderen Ende der Leitung herrscht einen Moment Schweigen, und ich kann hören, wie ein Stuhl knarrend über den Boden gezogen wird. »Was ist passiert?«
Ich schluchze ein paarmal, versuche, Worte zu formen, doch da kommen nur undeutliche Laute aus meinem Mund.
Die Stimme meines Großvaters wird milder. »Sophia, wo bist du?«
»Ich, ich bin …« Der Satz will sich einfach nicht bilden. Immer wieder entwischen mir die Worte wie glitschige Fische, die ich versuche zu fangen.
»Okay, wenn du mir sagst, wo du bist, komm ich dich holen.«
»Ich bin in Elk City.«
Sein leises Fluchen lässt mich zusammenzucken. Elk City ist gute fünf Stunden Autofahrt von ihm entfernt, es ist mitten in der Nacht, und trotzdem ist das hier die beste Option, die ich habe. Auch wenn mein schlechtes Gewissen sich jetzt schon meldet, weil ich meinen Großvater nach Jahren der Funkstille derartig überfalle.
»Kannst du einen Bus in Richtung …«
»… Belmont Bay nehmen?«, unterbreche ich dieses Mal ihn. Mein Blick huscht zum Bahnhof. Die Verbindungen in die winzige Kleinstadt sind eher mau, aber ich kann zumindest schauen, ob etwas in die richtige Richtung fährt. »Ich denke schon.«
»Gut, kauf dir ein Ticket und ruf mich wieder an, ich setz mich ins Auto.«
Wieder höre ich ein Knarren, das Rascheln von etwas, das ich nicht identifizieren kann. Aber ich schaffe es nicht, mich zu bewegen, bin wie erstarrt. »Grandpa?«
»Ja?«
»Danke.«
Kurzes Schweigen, ich kann förmlich vor mir sehen, wie er sich über die Nase wischt. »Ich bin bald bei dir«, verspricht er und legt auf.
Ich schlucke meine Angst hinunter und versuche, die aufkeimende Hoffnung festzuhalten. Mein Leben lang wurde ich dazu gezwungen, immer wegzulaufen. Immer der Konfrontation aus dem Weg zu gehen – sodass es zu einem Teil von mir wurde. Das Weglaufen. Die Flucht vor der Realität.
Und nun ist der einzige Ort, an den ich gehen kann, ausgerechnet Belmont Bay. Ich will nicht mein Leben lang wegrennen und mich verstecken, und doch fällt mir jeder Schritt in Richtung Bahnhof schwerer. Mein Rucksack muss inzwischen drei Kilo mehr wiegen, während meine Boots bei jedem Schritt über den Schnee knirschen, der in den letzten Minuten gefallen ist.
Ich erstehe von meinem letzten Geld ein Ticket, steige in den nächsten Bus ein und lehne meinen Kopf an die Fensterscheibe.
Kann es mir das Herz brechen, an den Ort zurückzukehren, der früher mein Zuhause war?
2
Ich ziehe mir mein Shirt über den Kopf.
Die letzte halbe Stunde kam mir vor wie eine Ewigkeit, und gleichzeitig ist sie viel zu schnell vergangen, denn ich wünsche mir nichts mehr, als wieder in das große Bett zu kriechen und mich an den warmen Körper hinter mir zu schmiegen. Aber so einfach ist das nicht.
Nicht mit Arin.
»Du musst noch nicht gehen«, haucht er zwischen zwei Küssen in meinen Nacken, und das verräterische Kribbeln meines Körpers setzt wieder ein. Meine Haut ist noch immer erhitzt, und sein Duft steigt mir in die Nase. Aber ich zwinge mich, dem Verlangen nicht nachzugeben. Über die Schulter betrachte ich ihn. Seine dunklen Haare stehen nach allen Seiten ab, weil meine Hände sie zerwühlt haben. In seinen braunen Augen schimmert die Glut der letzten Minuten nach – und mir ist bewusst, dass ich dabei bin, mich noch einmal zu verbrennen.
»Wir sind in das Haus von Mrs Tantum eingebrochen«, flüstere ich zurück, obwohl ich weiß, dass niemand uns hören kann. Die Tantums sind im Urlaub, wie jedes Jahr um diese Zeit. Es gibt niemanden, der uns erwischen kann – und doch wird die Angst davor, gesehen zu werden, mit jeder Sekunde stärker, wären da nur nicht Arins Küsse auf meinem Hals.
Es wäre so einfach, die Welt noch eine Weile auszusperren, noch etwas länger nur auf das zu hören, was wir wollen, und nicht auf das, was richtig ist. Nur wir beide, nur unsere Körper, nur noch ein paar Minuten …
Aber die Realität hat sich bereits zu sehr in mein Bewusstsein geschoben. Das Ticken des kleinen Weckers auf dem Nachttisch erinnert mich schmerzlich daran, dass wir gehen sollten.
»Niemand kann uns hier stören«, versucht es Arin hartnäckig. »Und theoretisch sind wir nicht eingebrochen, wir haben einen Schlüssel benutzt.«
»Dir ist schon klar, dass das keinen großen Unterschied macht?«, gebe ich zurück und stehe auf.
»Du Spießerin«, schnaubt Arin und reckt sich, völlig nackt, in dem großen Ehebett der Tantums. Ihm scheint der Gedanke daran, erwischt zu werden, nichts auszumachen. Einen Moment erlaube ich mir, seinen Körper genauer zu betrachten. Das V seiner Brustmuskeln, den feinen Flaum, der auf seiner Brust beginnt und sich bis zu seinem Schambereich zieht. Kleine Tätowierungen sind scheinbar willkürlich auf seinem Körper verteilt. Ein flammendes Herz auf der linken Seite der Brust, ein Pin-up-Girl, so schlecht gestochen, dass ich das erste Mal dachte, sie sei ein tanzender Fisch, und nicht zu vergessen der kiffende Frosch neben seinem …
»Hast du dich sattgesehen?«
Ertappt zucke ich zusammen und hoffe, dass ich nicht rot werde. Ganz der Bad Boy lässt Arin sich alle Zeit der Welt, nach seiner Jeans zu greifen, während ich bereits vollständig angezogen bin. Er genießt die Wirkung, die er auf mich hat, das seltsame Spiel, das wir seit dem Sommer miteinander spielen, und wahrscheinlich auch die Gefahr, die darin mitschwingt. Dass wir es heimlich, im Verborgenen tun, sorgt dafür, dass es spannend bleibt, und vielleicht ist das einer der Gründe, warum ich solche Angst davor habe, dass wir auffliegen könnten. Denn was wird von diesen gestohlenen Momenten bleiben, wenn wir sie mit der Welt teilen müssen?
In meinem Kopf rattert es. Manchmal verfluche ich ihn dafür, dass er es nach all den Dingen, die wir schon miteinander gemacht haben, immer noch schafft, dass ich rot werde – und weil ich wirklich versuche, das Ganze irgendwie zu überspielen, sage ich das Erstbeste, was mir in den Sinn kommt. »Wir haben morgen den Mathetest, hast du dich vorbereitet?«
Das Abschlussjahr macht mir zu schaffen. Die ständigen Tests, der Druck, die Ängste vor all dem, was vielleicht kommt oder nicht kommt, wenn ich meine Noten jetzt versaue – und mittendrin auch noch Arin. Und dieses Etwas, das wir haben und von dem ich nicht weiß, was es eigentlich ist.
»Hatten wir nicht gesagt, das Thema Schule ist ein Tabu?«, brummt er und greift nach seinem schmuddeligen Hoodie, den er überzieht.
Kurz presse ich die Lippen aufeinander. »Schon, aber du warst schon lange nicht mehr da …«
Arin funkelt mich an. Es ist, als wäre der Vorhang der Zärtlichkeiten zwischen uns zu Boden gefallen, als sei dieser Teil des Stücks nun vorbei, und das echte Drama erwacht zum Leben. »Weil ich Wichtigeres zu tun habe«, meint er und richtet seine Haare.
»Und das wäre?«
Er hält inne, während er mich im Spiegel des Schminktisches von Caroline Tantum ansieht. »Fragst du mich jetzt aus?«
»Vielleicht ein bisschen«, gebe ich schulterzuckend zu. Wir tun das hier schon so lange, immer wieder – und doch weiß ich so wenig über ihn. Was wahrscheinlich daran liegt, dass er auf jede kleine Frage genauso reagiert.
Abweisend.
Kalt.
Als würde er die Wärme zwischen uns immer nur kurz ertragen und die Glut dann schnell austreten, ehe jemand anderes sie entdecken kann.
»Es geht dich einen Scheiß an, was ich mache, wenn ich nicht in der Schule bin.«
Diese Antwort hätte ich kommen sehen müssen, aber sie tut trotzdem weh. Nur will ich gerade jetzt auf keinen Fall zeigen, dass er es geschafft hat, mich zu verletzen, also recke ich das Kinn nach oben. »Wow, kannst du dich noch etwas mehr wie ein Arsch aufführen, nachdem wir gerade Sex hatten?«
Er rümpft die Nase. Langsam dreht er sich wieder zu mir um. »Die Schule ist was für Mädchen wie dich.«
Da er auf meine hochgezogene Augenbraue nicht reagiert, setze ich nach: »Was soll das denn jetzt heißen?«
»Du weißt verdammt genau, was ich meine«, knurrt er in sich hinein und zieht sich die Kapuze seines Hoodies über den Kopf. Schirmt sich wieder einmal ab, von mir und der Welt, und den Dingen, die er nicht hören will.
Nur hat er sich da bei mir geschnitten.
»Nein, aber erklär es mir doch mal – falls du das kannst, denn soweit ich weiß, ist auch das nicht deine Stärke«, schieße ich zurück, weil ich mich nicht so behandeln lasse. Auch nicht von ihm. Besonders nicht von ihm.
»Tu das bloß nicht, Sophia.«
»Und was bitte? Dich daran zu erinnern, dass du ohne eine halbwegs gute Bildung erst recht nicht aus dem Loch kommst, in dem …«
»Beende diesen Satz lieber nicht.«
»Und warum nicht?«
»Weil es dich nichts angeht«, sagt er so finster, dass mir kalt wird.
»Vielleicht nicht, aber vielleicht solltest du mal den Menschen zuhören, denen du nicht scheißegal bist.«
Er macht einen Schritt auf mich zu. Bedrohlich, verletzt und irgendwie … Ich kann es nicht genau sagen, aber die Worte bleiben mir im Hals stecken, weil sein Blick so unsagbar kalt geworden ist.
»Du hast kein Recht, über mich zu urteilen«, knurrt er.
»Stimmt, aber du führst dich gerade auf wie ein Arschloch«, zische ich und bin es nun selbst, die einen Schritt auf ihn zugeht.
Da ist es.
Das spöttische, bitterböse Grinsen, welches so gar nicht zu der Version von Arin passt, die eben noch mit mir im Bett gelegen hat, und das dennoch zur gleichen Person gehört. »Ja, und es hat mir besser gefallen, als du etwas im Mund hattest.«
»Das hast du gerade nicht ernsthaft gesagt, wie respektlos bist du bitte?«, schnaube ich.
»Geh doch zu Caren und heul dich über mich aus, oh, Moment, das geht ja gar nicht, denn das mit uns darf ja niemand wissen«, kontert er. »Es wäre ja peinlich, wenn deine ach so tollen Freunde wüssten, was du tust, wenn du nicht mit ihnen rumhängst.«
»Wow.« Ich schüttle den Kopf. Vor ein paar Minuten war mein Bauch noch voller Schmetterlinge – und jetzt fühle ich mich schmutzig und benutzt. Dass dieses Etwas zwischen uns nicht viel Romantisches in sich trägt, ist das eine, aber wenn er mir so wenig Respekt entgegenbringt, kann ich es nicht mehr fortsetzen. Ich greife nach meiner Jacke und öffne die Tür des fremden Schlafzimmers.
»Wo willst du jetzt hin?«, ruft Arin wütend.
»In deiner Welt ist es vielleicht egal, wie man mit Menschen redet«, sage ich leise. »Aber in meiner nicht. Ich bin nicht dein Punchingball. Handlungen haben Konsequenzen, Arin. Und ich werde meine jetzt ziehen.«
Er macht ein paar Schritte zur Tür, bleibt dann jedoch stehen, als wüsste er selbst nicht so genau, was er tun will. »Ach ja?«
»Ja.«
Wir starren einander eine Weile an. Dann drehe ich mich um und steige die große, geschwungene Treppe des Hauses hinunter.
»Sophia, warte«, schreit er mir hinterher, aber ich bleibe nicht stehen. Das habe ich schon zu oft getan. »Ich hab es nicht so gemeint.«
»Doch, hast du.«
»Und du hattest versprochen, nicht mehr über die Schule zu reden.«
Für einen Moment verharre ich. Über die Schulter sehe ich ihn an. »Tut mir leid, dass ich es in unserem Abschlussjahr wage, auch an deine Zukunft zu denken«, gebe ich so ruhig zurück, dass es mich selbst überrascht.
Arins Augen verengen sich noch mehr. »Sophia, komm schon …«, meint er. »Komm zurück ins Bett, lass uns einfach vergessen, was ich gesagt habe.«
Ich spüre das Knistern wieder, das Aufflammen des Verlangens und den Wunsch, mich einfach wieder an ihn zu schmiegen und für weitere himmlische Stunden einfach zu vergessen, was außerhalb unserer Blase in der Realität wartet. Arin kennt mich zu gut, um diesen Gedanken nicht auch zu spüren. Er zieht mich an sich und drückt mir ein gefaltetes Stück Papier in die Hand. Der zweite Brief diese Woche. Mein Herzschlag verdoppelt sich, und in meinem Magen beginnen kleine Wirbelstürme miteinander zu tanzen.
»Du weißt, ich will kein Mistkerl sein …«, raunt er mir ins Ohr und küsst meinen Hals, was die Wirbelstürme nur noch mehr durch meinen Körper toben lässt.
»Manchmal bist du es aber«, stelle ich klar und schiebe ihn ein Stückchen von mir weg, auch wenn ich weiß, dass ich es bereuen werde. »Es ist unser letztes Schuljahr, Arin.«
»Ist mir aufgefallen.«
»Wenn ich jetzt sage, dass es mir viel bedeuten würde, wenn du zumindest versuchst, nicht durchzufallen, wirst du wieder wütend, oder?«, frage ich vorsichtig, auch wenn ich lieber einfach schreien würde. Alles wäre so viel einfacher, wenn ich mich mehr von seiner Bad-Boy-Fassade blenden lassen könnte. Aber ich weiß, dass er nicht so ist. Zumindest nicht immer, und der Brief in meiner Hand ist nur einer von unzähligen Beweisen dafür, die ich sammle, um mich selbst daran zu erinnern.
»Lass uns das Thema einfach beenden.«
Ich sehe ihn an, aber auch wenn ich nur zu gern einfach tun würde, als sei alles okay, ist es das nicht. Vielleicht fing die ganze Sache zwischen uns als etwas an, das mehr auf unsere Körper bezogen war, aber jetzt ist es mehr, und das macht mir Angst. Sollte mir Angst machen, weil ich sehen kann, wie Arin auf eine Zukunft zusteuert, die eigentlich keine ist. »Nein«, sage ich also.
»Sophia, ich hab dir gesagt, du sollst dich nicht in meine Angelegenheiten einmischen.«
»Und das würde ich respektieren, wenn du mir egal wärst – aber es ist die letzte Klausur. Die letzte, die dafür sorgen kann, dass du in Mathe nicht durchfällst.«
»Scheiß drauf«, stößt er aus und fährt sich durch die Haare. »Es geht hier nicht um deine Zukunft, sondern um meine.«
Der Satz lässt etwas in mir zerbrechen, oder vielleicht zeigt er mir auch nur noch einmal schonungslos, was ich längst wusste. Es gibt hier nur zwei Ichs und kein Wir. Nicht außerhalb des Betts. Nicht einmal durch den Brief, den ich in meiner geballten Faust zerquetsche.
»So hab ich es nicht gemeint«, setzt Arin schnell hinterher, aber ich drehe mich nickend um und gehe weg, weg von ihm und diesem Etwas zwischen uns. Ich habe all diese Worte, Ausflüchte und Begründungen einmal zu oft gehört – und nun ist das, was auch immer zwischen uns war, vorbei, und das alles nur wegen einer einfachen Frage über Mathe. Zumindest rede ich mir das ein.
Ich habe kein Zeitgefühl mehr, stattdessen hat sich die Kälte in meinem Körper bis in meinen Verstand ausgebreitet.
Zitternd umschlinge ich mich selbst, während ich ein Stoßgebet in den dunklen Himmel schicke, dass mein Großvater endlich kommt. Doch auch das nächste Auto fährt an der kleinen Haltestelle mitten im Nirgendwo vorbei.
Das Buch in meiner Hand wackelt inzwischen so stark, dass ich die Worte gar nicht mehr richtig erkennen kann. Stattdessen sehe ich auf den Seiten voller Buchstaben immer wieder Statistiken. 6,1 Millionen Menschen auf dieser Welt unwissentlich mit einem Virus im Blut, und bis vor ein paar Wochen gehörte ich zu ihnen. Mit diesen Gedanken ist auch der letzte Rest meiner Lust zu lesen hinfällig. Also klappe ich Der Marsianer zu und verstaue den Roman in meinem Rucksack.
Die verlassene Bushaltestelle mitten im Nirgendwo von Idaho scheint mit jedem Atemzug in dieser Kälte kleiner und kleiner zu werden. Der Bus hat einen Schlenker von der Route 95 in Richtung der Wälder vollführt und mich hierhergebracht. Doch nun, da ich in der Baracke sitze und nur das Licht der einzigen Straßenlaterne über mir schimmert, fühle ich mich noch verlorener als zuvor. Irgendwo in meinem Kopf kann ich die Stimme meiner Mutter hören: Meine Tochter hätte das nicht getan. Wer bist du, Sophia?
In diesem Moment, mitten in der Nacht, allein mit der Kälte, fühlt es sich tatsächlich so an, als sei ich ein Niemand – sogar noch schlimmer: Vielleicht bin ich es nicht wert, gerettet zu werden.
Bevor ich vollends zusammenbreche, reißt mich ein Hupen aus meiner Starre. Ich springe von meinem Platz auf.
Der Jeep meines Großvaters hält direkt vor mir, und ich zögere keine Sekunde, als ich die Tür aufreiße, meinen Rucksack auf den Rücksitz werfe und einsteige.
Wir blicken einander wortlos an.
Niemand von uns scheint die richtigen Worte zu finden. Ich, weil ich nicht weiß, wie ich erklären soll, was eigentlich geschehen ist, und er, weil er eben mein Grandpa ist. Mit Worten umzugehen war noch nie seine Stärke, das scheint sich auch in den letzten Jahren nicht geändert zu haben.
Seine Finger gleiten unruhig über das Lenkrad, als würde er darauf warten, ob er wirklich losfahren soll. Darum bringe ich ein »Danke« hervor.
Er nickt und gibt Gas. Wortlos dreht er die Heizung höher, und ich halte meine kalten Finger in den warmen Luftstrom.
»Willst du mir erzählen, was passiert ist?«, fragt er nach einer Weile.
Ich sacke in meinem Sitz zusammen. »Muss ich?«
Seine schmalen Lippen zucken, als würde er etwas sagen wollen, das er eigentlich lieber nicht sagen möchte. »Soll ich deiner Mutter Bescheid geben?«
»Nein!«
»Das kam verdächtig schnell«, stellt er fest und betrachtet mich kurz von der Seite. Ihm muss ich seltsam fremd erscheinen, während er noch immer genauso aussieht, wie ich ihn in Erinnerung habe. Die Glatze ist halb unter einer knappen Wollmütze verborgen und der ungepflegte Bart ein dunkler, silbergrauer Schatten. Die Sonne hat die Furchen in seinem Gesicht vielleicht noch etwas vertieft in all der Zeit, die wir uns nicht gesehen haben, doch aus seinen Augen blickt mir noch immer das entgegen, was ich so vermisst habe. Das Gefühl von Familie.
»Sie hat mich rausgeworfen«, murmle ich leise.
»So viel konnte sich dieser alte Mann auch schon zusammenreimen, nur verstehe ich nicht, warum. Du hast immer zu ihr gehalten.«
»Ja, aber sie nicht zu mir«, gebe ich finster zurück. Sie hat mich in dem Moment im Stich gelassen, als ich sie am meisten gebraucht habe. »Könnten wir dieses Gespräch auf einen Tag verlegen, an dem ich mehr als zwei Stunden geschlafen habe?«
Wieder zuckt sein Mund, doch dann nickt er.
Unser Schweigen dehnt sich aus, während wir auf den dunklen Straßen in Richtung Belmont Bay fahren. Der undurchdringliche Wald, der Fluss und die Berge, die über alles zu ragen scheinen. Mein Herz stolpert kurz, als ich das Willkommensschild entdecke.
Ich hatte mir geschworen, diese Stadt nie wieder zu betreten. Nicht seit jener Nacht, in der meine Mutter mich vor die Wahl stellte, mit ihr zu gehen oder bei meinem Grandpa zu bleiben. Ich ging, weil mein gebrochenes Herz nicht zuließ, dass ich hierblieb. Und doch fahren wir nun an diesem Schild vorbei. »Grandpa?«
»Ja?«
»Hat sich die Stadt verändert?« Bei der Frage beginnt mein Herz wieder schneller zu schlagen, denn auch wenn ich weiß, dass ich keinen anderen Ort habe, an den ich gehen könnte, so will ein kleiner Teil von mir doch am liebsten wieder umdrehen.
»Es ist Belmont Bay, Phee. Nichts wird sich dort jemals ändern, zumindest nicht wirklich«, grummelt mein Großvater und fährt sich über die Nase.
Nun sind es meine Mundwinkel, die kurz nach oben zucken. »Du hast mich Phee genannt«, bemerke ich leise. »Das hat seit Jahren niemand mehr getan.«
»Wenn ich es lassen soll, musst du es mir sagen.«
»Nein, nein, es ist nur …«, setze ich an, weiß aber nicht, wie ich es sagen soll. »Ich hab dich vermisst.«
Er lächelt. Ich hatte vergessen, wie warm sein Lächeln sein kann. »Und ich dich.«
Als wir endlich in der Auffahrt seines Hauses stehen und mir bewusst wird, dass ich hier ein warmes Bett habe, in dem ich mich verkriechen kann, kämpfe ich mit den Tränen.
Grandpa nimmt kommentarlos meinen Rucksack und führt mich sachte ins Innere seines Hauses. Ehe ich dazu komme, mich umzusehen, springt mir Bo entgegen.
»Bo!«, rufe ich aus und muss lachen, als mir der große schwarze Hund einmal quer durch das Gesicht leckt. Mein Grandpa schmunzelt vor sich hin, lässt uns aber ein paar Augenblicke Zeit, damit wir uns begrüßen können.
Es ist, als würde ein winziger Teil der Schwere von mir abfallen, während ich das weiche Fell streichle. Dann allerdings entscheidet Bo, dass ich jetzt weniger interessant bin, und läuft lieber in die angrenzende Küche, um seinen Futternapf geräuschvoll über den Boden zu schieben.
Mein Großvater sieht mich an und nickt zur Treppe. »Dein altes Zimmer ist noch immer oben, aber ich hatte keine Zeit, das Bett zu beziehen.«
Ich winke ab. »Das kann ich machen.«
»Die Wäsche ist …«
»In der Abstellkammer, links, ganz oben?«, frage ich mit einem leichten Lächeln.
»Das weißt du noch?«
Ich nicke. »Sicher.«
Dann erst gestatte ich mir, mich umzusehen. Der große Wohnraum ist sauber und ordentlich. Auf dem Kamin stehen noch immer die Familienfotos und zeigen eine Version von mir, die schon lange nicht mehr existiert. Das Mädchen auf den Bildern hat mein Gesicht, aber sie ist eine andere. Der blonde Pony hängt auch ihr in die Augen, aber die Haare sind länger und fallen über ihre Schultern. Sie hält stolz die Urkunde des Mathewettbewerbs in den Händen, als sei diese Auszeichnung der Beweis dafür, dass die Logik der Zahlen ihr den Weg im Leben weisen könnte – wie sehr ich mich damals doch getäuscht habe.
Bei dem Schwarz-Weiß-Bild meiner Großeltern bleibt mein Blick hängen. Sie waren so glücklich zusammen. Bis einfach alles schiefging. Bis unsere Familie kaputtging.
Als würde er spüren, dass meine Gedanken düster werden, räuspert sich Grandpa. »Gut, ich dreh eine Runde mit Bo. Dann mach ich uns Kaffee, und du kannst duschen und was essen, bevor du dich hinlegst, wenn du willst«, schlägt er vor.
»Das wäre großartig«, sage ich, während ich die Treppen hinaufgehe, und meine es so, auch wenn jeder Schritt zu meinem alten Zimmer sich anfühlt, als würde ich in die Vergangenheit reisen.
Dieses Gefühl wird noch schlimmer, als ich die Tür öffne. Mein Grandpa hat nichts verändert. Es sieht noch immer genauso aus wie an dem Tag, als meine Mutter und ich diese Stadt verlassen haben. Auf dem kleinen Schreibtisch vor dem Fenster stapeln sich Papiere, Schulbücher und meine geliebten Textmarker in Dutzenden Farben.
In dem großen Regal an der gegenüberliegenden Wand hat sich der Staub auf die Bücher und Kartons voller Erinnerungen gelegt wie eine Decke. Wo sind nur die letzten sechs Jahre geblieben?
Auf meinem Bett sitzt der alte Plüschhase, den Grandma mir geschenkt hat. Ihr Tod kurz nach Carens spurlosem Verschwinden war der Grund, warum meine Mutter die Stadt verlassen wollte. Ich werfe meinen Rucksack in die Ecke neben der Tür, wie ich es so oft nach der Schule getan habe, und wage ein paar Schritte ins Zimmer. Meine Müdigkeit ist wie weggeblasen, als ich nach dem Stofftier greife und es fest an meine Brust drücke.
Neben meinem Bett rutsche ich auf den alten Dielenboden und vergrabe mein Gesicht in Mr Bunny, als könnte er mir all die Zeit wiedergeben, die ich in den letzten Jahren verloren habe.
3
Ein perfekter Tag in der perfekten Kleinstadt – zumindest für alle anderen.
»Komm schon, Stella, ich kann einfach alles machen«, sage ich fast flehend und betrachte die Floristin.
Von dem Duft der gefühlt hundert Blumen um mich herum kribbelt meine Nase. Aber auch die Pracht der verschiedenen Blüten kann mich nicht über Stellas angestrengte Miene hinwegtäuschen. Sie schüttelt den Kopf und wendet sich wieder ihrer Blumendekoration zu. »Tut mir leid, ich kann es mir nicht leisten, dass du dich wieder aus der Kasse bedienst«, antwortet sie streng, was mich wiederum fluchen lässt.
»Ich habe es dir zurückgezahlt.« Meine Stimme klingt gequält, um nicht zu sagen jämmerlich. Aber genau das bin ich. Stehe hier und bettle, während ich versuche, irgendwie Abstand von dem Menschen zu nehmen, der ich war.
»Ja, zur Hälfte.«
»Bitte, ich …«
»Arin«, unterbricht sie mich und seufzt dann tief. »Tut mir leid, aber nein. Ich finde es toll, dass du schon einige Monate clean bist, und ich hoffe, du findest etwas anderes. Aber ich kann dich nicht einstellen. Nicht noch mal.«
Innerlich schreie und fluche ich, aber reiße mich zusammen, so gut ich kann. Ich bin nicht wütend auf Stella, sondern auf mich selbst. Und auf alles, was ich verbockt habe. »Schon gut«, presse ich hervor.
Ihre Augen werden sanfter, doch das macht den Zorn gegen mich selbst nur noch viel schlimmer. »Arin …«
»Nein, lass es. Ich will dein Mitleid nicht«, gebe ich zurück und drehe ihr den Rücken zu. Ihre Abweisung kann ich ertragen, aber der mitfühlende Blick bringt mich fast um.
So viel zum Thema zweite Chancen.
Obwohl ich Stella zugutehalten muss, dass sie es zumindest einmal mit mir versucht hat. Das ist einmal mehr als die meisten in dieser gottverdammten Stadt.
Gerade jetzt würde ich am liebsten alles in Schutt und Asche legen. Die schönen historischen Backsteingebäude mit den blank polierten Fenstern, die mich zu verspotten scheinen, wie sie so ordentlich in einer Reihe stehen. Selbst die verdammten Türen der kleinen Läden sind farblich aufeinander abgestimmt.
In Belmont Bay passt alles perfekt zusammen.
Nur ich, ich falle aus dem Rahmen und werde noch wütender, je mehr ich mich selbst deswegen bemitleide. Ich zwinge mich, das leuchtende Rot im Licht der Sonne zu ignorieren, während ich Stellas Laden hinter mir lasse.
Der Friseursalon von Elif wird umrahmt von der winzigen Konditorei, in der ich ebenfalls rausgeflogen bin, und dem Buchladen, den ich nicht einmal mehr betreten darf, seit ich für Sophia ein Buch geklaut habe.
Sophia.
Die Physik der Materie. So hieß das Buch, das sie so gern lesen wollte und das ihre Mutter ihr nicht besorgen wollte. Der Gedanke an Sophia kommt so aus dem Nichts, dass ich noch wütender werde. Während ich über den schmalen Bürgersteig marschiere, wird die Wut so stark, dass ich sie irgendwo rauslassen muss. Also trete ich einmal gegen den roten Backstein des Hauses neben mir. Nur um kurz darauf erneut zu fluchen.
»Hey«, fährt Elif mich an. »Würdest du meinen Laden bitte nicht treten?« Sie steht auf der Treppe ihres kleinen Friseursalons und betrachtet mich kritisch.
Jetzt ist mir meine Aktion unangenehm. »Sorry.«
Sie leckt sich einmal über die Lippen, als würde sie überlegen, was sie als Nächstes sagt. »Alles gut bei dir?«
»Sehe ich etwa so aus?«
Heute trägt sie einen fliederfarbenen Hidschab, dessen Ton sich in ihrer Halskette widerspiegelt und einen schönen Kontrast zu ihrer hellbraunen Haut bildet. Ihre dunklen Augen betrachten mich einen Moment. »Komm rein, ich schneid dir die Haare«, sagt sie schließlich, und es klingt nicht nach einer Bitte.
Kopfschüttelnd streiche ich mir die Haare nach hinten. »Ich hab kein Geld.«
»Dann ist es ja gut, dass ich keins verlange. Du kannst mir helfen, die Lampen an der Außenfassade zu reparieren«, meint sie, und die Strenge in ihrer Stimme duldet keinen Widerspruch.
Also folge ich ihr in den kleinen Salon. Noch ist es ruhig, nur der Geruch des Jasminshampoos liegt bereits in der Luft. Sie knipst das Licht an und deutet auf einen der freien Stühle vor der Spiegelwand.
»Du warst schon lange nicht mehr hier«, stellt Elif fest.
»Die Miete ist gerade wichtiger als meine Haare«, gebe ich zu, während ich mich hinsetze. Sie wirft den kleinen schwarzen Umhang über mich, zieht ihren Stuhl etwas näher und zückt die scharfe Schere aus ihrem Gürtel.
»Es läuft also nicht gut mit der Jobsuche?«, will sie wissen, während sie mit der anderen Hand mein Haar kämmt.
Ich kann ihr nicht einmal durch den Spiegel in die Augen schauen. »Das wäre noch ziemlich positiv ausgedrückt.«
Die Wahrheit ist wohl, dass ich es geschafft habe, einfach alle Brücken abzubrennen, und nun sitz ich allein in einem Feuer, das ich selbst gelegt habe, und niemand hilft mir dabei, es zu löschen. Es wäre alles so viel einfacher, wenn ich einfach den Ruß einatmen und das Ganze hinter mich bringen würde – aber so funktioniere ich nicht. Ich mache immer weiter und weiter, zumindest rede ich mir das selbst ein. Elif scheint meinen inneren Monolog besser zu verstehen, als mir lieb ist.
Sie legt den Kopf schief, während sie mich betrachtet. »So schlimm?«, fragt sie sanft und hält inne.
»Noch viel schlimmer, und ich bin mit der Miete im Rückstand.«
»Das ist …«, murmelt sie leise.
»Scheiße.«
»Kein Fluchen in meinem Laden.«
»Sorry.«
Sie nickt, als sei es damit okay, und verzieht die Lippen, als würde sie darüber nachdenken, was sie nun tun kann. »Mit Geld kann ich dir leider auch nicht dienen, zumindest nicht regelmäßig. Aber ich könnte dennoch etwas Hilfe gebrauchen, die Klimaanlage funktioniert nicht mehr richtig, und ich schaffe es einfach nicht, dass der Wasserhahn aufhört zu tropfen. Um ehrlich zu sein: Ich komme aktuell kaum hinterher.« Elif nimmt meine Haare zwischen ihre Finger und beginnt zu schneiden, noch ehe ich sagen kann: »Ich kann es mir ansehen.«
Sie schenkt mir ein kleines Lächeln, während sie dafür sorgt, dass zumindest meine Frisur wieder sitzt. Als sie den Rasierer in meinem Nacken ansetzt, bin ich froh, dass sie mir etwas Raum lässt, um zu schweigen. Denn ich bin überfordert damit, dass jemand nett zu mir ist, obwohl die Person daraus keinen Vorteil ziehen kann. Oder zumindest keinen großen. In dieser Stadt würde jeder ihr dabei helfen, die kleinen Reparaturen zu machen. Nur hat sie nicht irgendwen gefragt, sondern ausgerechnet mich.
Elif nimmt mir den Umhang wieder ab und lächelt breit. »Siehst du, und schon ist der Tag nicht mehr ganz so furchtbar, und deine Frisur sitzt auch wieder.«
Ich streiche mir durch die Haare. Mein Spiegelbild sieht wieder vertrauter aus, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Die Seiten sind wieder kurz, und ich kann mir oben alles mit dem Gel, das Elif mir reicht, nach hinten stylen. Während ich noch dabei bin, alles so zu legen, wie ich es will, nickt sie abermals. »Damit hast du deinen Scumbag Boogie und ich jemanden, der meine Lampen wechselt«, meint sie und zwinkert.
Zähneknirschend stehe ich auf. »Warum bist du eigentlich immer so nett?«
»Bisher hast du mir keinen Grund gegeben, es nicht zu sein«, gibt sie zurück und scheucht mich zur Seite, damit sie meine Haare zusammenfegen kann.
»Danke.«
Sie blickt kurz zu mir auf und nickt. »Die Leiter und der Werkzeugkasten stehen hinten.«
»Ich mach mich gleich an die Arbeit.«
»Gut, meine erste Kundin kommt auch gleich.«
»Bis dahin sollte ich fertig sein«, sage ich schnell, weil ich verstehen kann, dass meine Anwesenheit vielleicht schlecht für ihr Geschäft sein könnte. Die Touristen kennen mich nicht, aber der Rest der Stadt wird schon darüber tuscheln, dass sie mir die Haare schneidet, kurz nachdem ich Stella angepampt habe.
Elif zieht die dunklen Augenbrauen zusammen. »So meinte ich das nicht.«
Vielleicht sagt sie sogar die Wahrheit, aber gerade weil sie nett zu mir ist, will ich nicht, dass jemand in der Stadt sie schlechter behandelt. »Ist schon okay, ich beeile mich.«
4
Das Licht der Mittagssonne fällt durch die kargen Äste der Bäume, während das Laub unter meinen Füßen bei jedem Schritt raschelt. Vereinzelte hellgrüne Knospen sind an den Bäumen und Sträuchern zu erkennen, doch der Frühling ist noch nicht in Idaho eingezogen, als würde er sich sträuben, aus seinem Schlaf zu erwachen.
Verdenken kann ich es ihm nicht.
Mir wäre es auch lieber, mich noch eine Weile zu verstecken, wie die Tiere, die Winterschlaf halten. Nur interessiert das weder das Virus, das sich in mein Immunsystem geschlichen hat, noch all meine anderen Probleme – wie zum Beispiel, dass ich Bo verloren habe.
Unsicher bleibe ich stehen und werfe die Hände in die Luft, wo ist der Hund meines Großvaters nur hingelaufen?
»Warum wolltest du auch unbedingt zurück nach Belmont Bay? Und warum hast du angeboten, mit Bo Gassi zu gehen, obwohl du genau weißt, dass er nicht auf dich hört?«, frage ich mich mürrisch selbst und suche zwischen den Bäumen weiterhin nach dem schwarzen Hund. »Bo!«
Blinzelnd versuche ich, etwas zu erkennen, das mir einen Anhaltspunkt gibt. Aber um mich herum sind nur Bäume, Laub und Reste von Schnee, die sich in meine viel zu dünnen Turnschuhe schieben. »Bo!«
Nur leider antwortet mir niemand.
Ich bin mir nicht sicher, ob Bo langsam selbst etwas von seinem Gehör eingebüßt oder ob er einfach beschlossen hat, mir schon meinen zweiten Tag zurück in dieser Stadt zur Hölle zu machen.
So oder so, ich muss ihn finden. Die Wälder in Idaho sind so dicht, dass man meinen könnte, die Bäume würden sich heimlich zusammenrotten, sobald man sie aus den Augen lässt.
»Bo!«, rufe ich mit dem Anflug von Verzweiflung – und höre ein Bellen. Sofort sprinte ich in die Richtung, aus der ich es gehört habe. Nicht weit von dem kleinen Weg, den wir gegangen sind, entfernt, zwischen den Bäumen vor mir ist ein Maschendrahtzaun, der den angrenzenden Trailerpark von diesem Gebiet des Waldes trennt. Zumindest war das wohl der Plan, allerdings zeigt mir ein mit Müll und Bierdosen gesäumter Trampelpfad den Weg zu einem Loch, das groß genug ist, damit ich zweimal hindurchschlüpfen könnte.
»Verdammt, Bo!«, fluche ich vor mich hin, zwinge mich aber dennoch, weiterzugehen. Meine Nervosität liegt nicht nur an Bo, sondern auch an der Gegend, denn die vernagelten Fenster an einigen der Trailer und die unheimliche Stille leisten ebenfalls einen Beitrag dazu. Fröstelnd schlinge ich die Arme um mich selbst, während ich die Umgebung scanne. »Bo!«, rufe ich noch einmal deutlich leiser, denn in den meisten Trailern sind die Vorhänge zugezogen, als würden die Bewohnenden noch schlafen, obwohl die Mittagssonne ihr Bestes gibt, um sie zu wecken.
Es ist niemand zu sehen, und doch traue ich mich kaum, weiter nach dem Hund meines Großvaters zu rufen.
Wieder ein Bellen.
Ich wirble herum, doch statt des Hundes entdecke ich, dass ich keineswegs so allein bin, wie ich es gern hätte. An einem der provisorischen Zäune, die den Wohnbereich um die einzelnen Trailer abgrenzen, stehen zwei Männer. Mit einer Hand wische ich mir über die Stirn.
»Können wir dir helfen?«
Das Alarmsignal in meinem Kopf fängt augenblicklich an zu schrillen. Meine Muskeln spannen sich an, während ich die zwei Männer vor mir betrachte. »Äh«, kommt es formschön aus meinem Mund, ehe ich mich daran erinnere, dass ich mich von zwei Typen nicht einschüchtern lassen darf. »Ich suche meinen Hund.«
»Damit können wir nicht dienen«, sagt der Erste. »Aber ich könnte dir meinen Hotdog anbieten.«
Ihr schallendes Lachen ist wie eine Ohrfeige. Vor Ekel verziehe ich den Mund. »Auf sexuelle Belästigung kann ich verzichten«, zische ich. Ich rufe noch einmal nach Bo, aber nichts. Kein Bellen. Und auch leider keine Filmsequenz, in der er im genau richtigen Moment auf mich zustürmt und die Störenfriede grimmig anknurrt.
»Du siehst aber aus, als würdest du Hilfe brauchen«, sagt einer meiner unliebsamen Beobachter, seine Stimme erinnert mich an den Stimmbruch meines Cousins. Er kommt näher, macht sogar Anstalten, nach meiner Schulter zu greifen.
»Nein«, stelle ich noch einmal klar und weiche fast unwillkürlich einen Schritt zurück.
»Schade. Wie wäre es, wenn du mir dein Handy gibst? Und dein Geld? Sieht nicht aus, als wüsstest du, wie du damit Spaß haben kannst.«
Seine Stimme löst jedes Warnsignal in meinem Körper aus, obwohl er klingt wie ein Frosch im Mixer.
»Komm schon, Kleines«, sagt Froschstimme grinsend. »Sei ein braves Mädchen und gib mir das Handy.«
»Nein.«
Schluckend betrachte ich die zwei Männer. Der Erste von ihnen leckt sich über die Lippen, hinter denen nur wenige Zähne sitzen – als hätte jemand sie ihm ausgeschlagen. Er ist locker zwei Köpfe größer als ich, doch mehr Sorge macht mir der zweite Kerl. Froschstimme ist schmächtiger, jedoch mit einem gierigen Blick, der mir Angst macht. Er scheint fest entschlossen, mir meine wenigen Habseligkeiten abzunehmen. Mein Herzschlag hämmert in meinem Kopf. Das Blut pumpt so heftig durch meine Adern, dass mir schwindelig wird. Panik droht meinen Körper zu übernehmen, doch ich schiebe sie in den hintersten Winkel meines Verstands.
Jetzt in eine Angststarre zu verfallen, könnte mich mein Leben kosten. Das Handy in der Hand, tippe ich 911 ein, aber ich weiß selbst, dass es mir nichts nützen wird. Die Polizei wird nicht rechtzeitig hier sein – selbst wenn ich es schaffe, den Notruf abzusetzen, bis der Sheriff in diesem Teil der Stadt ist, wurde ich längst überwältigt.
»Wenn ihr noch einen Schritt näher kommt, schreie ich«, drohe ich, was jedoch nur auf gehässiges Lachen stößt.
Verdammt, Bo! In was für eine Situation hast du mich hier nur gebracht, und wo steckst du?
»Wir könnten es für uns alle leichter machen, wenn du mir einfach das gibst, was ich will«, sagt Froschstimme.
Ich blicke über die Schulter, aber wir sind allein. Der Trailerpark ist abgeschieden, die meisten, die hier leben, sind um diese Uhrzeit in der Stadt und arbeiten – oder sie schlafen ihren Rausch aus und entscheiden sich dafür, dass sie alles andere nichts angeht. Niemand ist hier, außer mir und diesen Arschlöchern, die beim Anblick einer Frau offenbar denken, sie hätten ein leichtes Opfer gefunden.
»Haut. Endlich. Ab.«
Das tun sie nicht. Ich verfluche mich leise dafür, kein Pfefferspray dabeizuhaben. Bevor ich weiß, was geschieht, springt die große Kartoffel auf mich zu. Er greift nach meinem Telefon, doch ich weiche aus. Mein Handy donnert auf den Boden. So viel zum Thema Lebensretter.
Ich ducke mich und hole aus, woraufhin ich genauso laut aufstöhne wie die Kartoffel selbst. Meine Faust hat ihn auf der Nase getroffen. Tränen treten in seine Augen. Meine Fingerknöchel brennen. Ehe ich mich davon erholen kann, werde ich herumgedreht.
»Miststück«, knurrt der Erste und drückt mich an einen der angrenzenden Trailer. Er ist erstaunlich stark, doch ich schreie so laut in sein Ohr, dass er zusammenzuckt. Den kurzen Schreck nutze ich, um ihm mein Knie in die Weichteile zu rammen. Leider übersehe ich dabei, dass die Kartoffel wieder zu etwas anderem als Jammern fähig ist. Er packt mich von hinten, zerrt an meiner Jacke. Ich schreie, fluche und trete um mich wie ein wild gewordenes Pferd. Eine Hand presst sich auf meinen Mund, und ein Arm schnürt mir die Luft ab. Mein Körper bäumt sich auf. Gerade als ich denke, dass ich schon an meinem zweiten Tag zurück in dieser Stadt das Zeitliche segne, fällt ein Schatten auf mein Gesicht.
»Lasst. Sie. Los.«
Begleitet von einem tiefen Knurren, das ich nur von Bo kenne.
Die tiefe Stimme lässt mein Herz gefrieren, und damit bin ich nicht allein.
Einer der Männer erstarrt, während sich der andere zurückzieht. Er atmet so schwer, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen. Ich nutze die kurze Zeit, die ich habe, und winde mich aus dem gelockerten Griff.
»Verschwindet!«
Die Männer stolpern aufeinander zu, und erst jetzt wage ich es, meinen Helfer anzublicken. Sein Gesicht ist im Schatten einer Kapuze verborgen, aber sein breites Kinn könnte eindeutig eine Rasur vertragen. Bo sitzt neben ihm, knurrt noch immer und lässt die beiden Männer nicht aus den Augen.
»Ihr habt sie gehört«, donnert seine bassige Stimme und wird von dem Zähnefletschen des Hundes unterstrichen. Er hält Bo nicht fest, bedeutet ihm nur mit der flachen Hand, sitzen zu bleiben. Alles an dieser Szene wirkt bedrohlich. Der Unbekannte steht da wie ein Fels, und obwohl ich seine Hände nicht sehen kann, würde ich darauf wetten, dass er sie zu Fäusten ballt.
»Entspann dich, es ist nicht das, wonach es aussieht«, Froschstimme will mich am Arm packen, doch ich reiße mich los.
Der andere greift seinem Freund an die Schulter. Was er murmelt, kann ich kaum verstehen, das Adrenalin rauscht durch mein Blut, und ich bemerke erst jetzt wieder die Schmerzen in meiner Hand. Meine Fingerknöchel sind rot. »Verschwindet! Oder ich rufe die Bullen, nachdem ich eure Visagen gegen den Bordstein geschleudert habe«, knurrt der Fremde. Nein, nicht fremd. Auch wenn ich sein Gesicht noch immer nicht genau erkennen kann. Die Vibration seiner Stimme geht mir durch Mark und Bein. Meine Wirbelsäule kribbelt.
Die zwei Typen fangen an zu rennen, als hätte der Kerl einen Warnschuss abgegeben. Ich kann es ihnen nicht verdenken. Selbst ich bekomme wieder Angst.
Allerdings nicht, weil ich Angst vor ihm habe, sondern weil mir erst jetzt bewusst wird, wer hier vor mir steht.
»Geht es dir gut?«
»Ich denke schon«, bringe ich heraus. »Und dir geht es wohl auch gut«, schnaube ich an Bo gewandt, der mich mit fragenden braunen Augen ansieht. Der Hund kommt auf mich zu, und ich hocke mich hin, damit ich mein Gesicht in seinem dunklen Fell vergraben kann. Ihm geht es gut, mir geht es okay – mehr ist gerade nicht wichtig. »Tu das bitte nie wieder«, murmle ich in die pelzigen Ohren.
»Haben sie dir etwas getan?«, will Arin mit dem Anflug von Sorge wissen.
Zumindest rede ich mir ein, dass dieser Unterton Sorge ausdrücken soll. Ich schüttele den Kopf und blicke an mir hinunter. Mein Hals spannt, und mein Kopf fühlt sich seltsam dumpf an. Aber mir fehlt tatsächlich nichts, außer vielleicht der Glaube an die Menschheit. Warum müssen solche Sachen immer uns Frauen passieren? Und warum reicht es, wenn nur ein Mann dazu kommt?
Arin sieht mich erwartungsvoll an. Sein Anblick allein löst tausend Emotionen auf einmal aus, die ich weder benennen noch erklären kann – aber ich weiß, dass sie gerade zu viel für mich sind. »Danke, dass du Bo gefunden hast.«
»Er hat eher mich gefunden«, erklärt Arin und schiebt die Hände in die Hosentaschen seiner Jeans. »Du bist wieder in der Stadt?«
Da ich nicht weiß, was ich darauf sagen soll, hebe ich mein Handy vom Boden auf. Schon jetzt sehe ich, dass es nicht mehr zu retten ist. Das Display besteht nur noch aus flackernden Scherben.
Arin sieht mich an und schiebt sich die Kapuze vom Kopf. Das dunkle Haar fällt ihm in die Stirn. Ich weiche seinem Blick aus und wische mir eine Strähne aus dem Gesicht. Dabei blicke ich auf seine Füße. Seine nackten Füße.
»Hast du keine Schuhe?«
»Ich hab deine Schreie gehört und bin hergelaufen.«
»Ohne Schuhe?«
»Wäre es dir lieber gewesen, dass ich sie erst anziehe? Ich hab nicht darüber nachgedacht.«
Mit einer hochgezogenen Augenbraue blicke ich ihm ins Gesicht. Er lächelt auf eine verstörend nette Art. Das hier ist Arin. Der Arin. Mein Arin, hätte die frühere Sophia gesagt, während die jetzige sich daran erinnert, dass Menschen kein Besitz sind und dass Liebe das nicht ändert, die Liebe aber mich verändert hat. Ich nicht weiß, ob das gut oder schlecht ist, während zwei Sophias in meinem Inneren miteinander diskutieren.
Offenbar habe ich ihn ziemlich lange angestarrt, ohne etwas zu sagen. Er macht noch einen Schritt auf mich zu und betrachtet mein zerstörtes Handy.
»Shit.«
»Ja, Shit. Aber immerhin habe ich Bo wiedergefunden. Mein Grandpa wäre nicht erfreut, wenn ich ausgerechnet seinen Hund verliere«, gebe ich in dem Versuch zurück, einen Scherz zu machen.