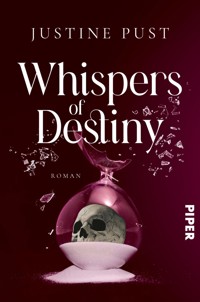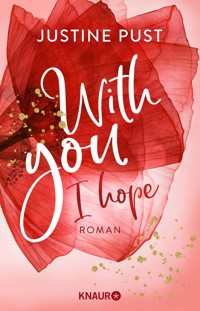9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Skyline-Reihe
- Sprache: Deutsch
Manche Menschen sind wie Sternschnuppen in der Nacht. Für Willa ist es Elias, der ihre Dunkelheit durchbricht: »Wo die Sterne uns sehen« ist der erste Liebesroman der bewegenden New-Adult-Reihe »Skyline« von Justine Pust. Studentin Willa engagiert sich im Ehrenamt und leitet gleich mehrere Selbsthilfegruppen: Für andere da zu sein, bedeutet ihr alles – gleichzeitig gelingt es ihr nur so, ihr inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Als Willa Elias im Gemeindezentrum bei der Rollstuhl-Basketballgruppe kennenlernt, fliegen zwischen ihnen die Funken. Mit ihm erscheint Willa alles einfach, doch was, wenn ihre Dunkelheit sein Licht verschluckt? Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr gerät Willas Kartenhaus ins Wanken – bis sie schließlich zu Mitteln greift, die nicht nur sie selbst verletzen ... Justine Pusts New-Adult-Roman »Wo die Sterne uns sehen« erzählt eine berührende Liebesgeschichte, die Mut macht – über Themen, die der Autorin sehr am Herzen liegen: Mental und Physical Health. Es ist der erste Band einer neuen New-Adult-Reihe, die in Frankfurt am Main spielt und in der Mental und Physical Health eine große Rolle spielen werden – ebenso wie die Frage, wie unsere Wünsche, Liebe und Freundschaft uns den Weg zeigen. »Diese Liebesgeschichte ist wie eine Sternschnuppe. Sie bringt Hoffnung, Liebe und weckt den Wunsch nach mehr.« (Autorin Stefanie Hasse) Entdecke auch die gefühlvolle New-Adult-Reihe »Belmont Bay« von Justine Pust. Dazu gehören folgende Liebesromane: »With you I dream«, »With you I hope« und »With you I heal«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Justine Pust
Wo die Sterne uns sehen
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Manche Menschen sind wie Sternschnuppen in der Nacht. Für Willa ist es Elias, der ihre Dunkelheit durchbricht: »Wo die Sterne uns sehen« ist der erste Liebesroman der bewegenden New-Adult-Reihe »Skyline« von Justine Pust.
Studentin Willa engagiert sich im Ehrenamt und leitet gleich mehrere Selbsthilfegruppen: Für andere da zu sein, bedeutet ihr alles – gleichzeitig gelingt es ihr nur so, ihr inneres Gleichgewicht aufrechtzuerhalten. Als Willa Elias im Gemeindezentrum bei der Rollstuhl-Basketballgruppe kennenlernt, fliegen zwischen ihnen die Funken. Mit ihm erscheint Willa alles einfach, doch was, wenn ihre Dunkelheit sein Licht verschluckt? Je mehr Zeit die beiden miteinander verbringen, desto mehr gerät Willas Kartenhaus ins Wanken – bis sie schließlich zu Mitteln greift, die nicht nur sie selbst verletzen ...
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Content Note - Hinweis
Widmung
Playlist
Teil 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Teil 2
Kapitel 39
Kapitel 40
Kapitel 41
Kapitel 42
Kapitel 43
Kapitel 44
Kapitel 45
Kapitel 46
Kapitel 47
Kapitel 48
Teil 3
Kapitel 49
Kapitel 50
Kapitel 51
Kapitel 52
Kapitel 53
Kapitel 54
Kapitel 55
Kapitel 56
Kapitel 57
Kapitel 58
Kapitel 59
Kapitel 60
Kapitel 61
Kapitel 62
Kapitel 63
Kapitel 64
Kapitel 65
Nachwort
Danksagung
Liste sensibler Inhalte / Content Notes
Bei manchen Menschen lösen bestimmte Themen ungewollte Reaktionen aus. Deshalb findet ihr am Ende des Buches eine Liste mit sensiblen Inhalten.
Dieses Buch ist für dich.
Und für alle 9215 Menschen, die ihren Stern nicht finden konnten.
Und für Christin.
Wir kämpfen für uns allein, aber Rücken an Rücken.
Teil 1
Ich glaub, wir fühlen schon wieder aneinander vorbei …
Elias
Kapitel 1
Wenn man die Schwerkraft überwindet, fühlt es sich an, als würde man himmelwärts fallen. Und ich weiß nicht, ob ich gerade falle oder fliege.
Eben noch hat die Geschwindigkeit mein Adrenalin nach oben getrieben und mich in einen Rausch versetzt – jetzt nehme ich alles wie in Zeitlupe wahr. Mein Körper schwebt durch die Luft. Ich lasse den Motorradlenker los, strecke die Arme aus, als wären sie Flügel – als könnte ich mit ihnen steuern, wohin ich fliege.
Plötzlich blendet mich etwas, sorgt dafür, dass ich die Augen zusammenkneife und mich von der Lichtquelle wegdrehe. Statt der Straße vor mir wende ich mich dem Himmel über mir zu. In dem dunklen Blau schimmern die Sterne wie ein Netz aus Kristallen. Der Anblick dieser einmaligen Schönheit trifft mich so unerwartet wie der heftige Aufprall.
Nach Luft schnappend, versuche ich im nächsten Moment zu verstehen, was gerade passiert ist. Warum ich nicht mehr fliege und warum die Schwerkraft mich plötzlich zu erdrücken scheint. In meinen Ohren rauscht es, nur wie aus weiter Ferne kann ich Stimmen hören. Rufe, die wie mein Name klingen.
Doch ich kann nichts sagen. Kann mich nicht bewegen.
Schmerz scheint jede Faser meines Bewusstseins zu durchdringen. Das Visier meines Motorradhelms ist zersprungen, aber ich kann sie noch immer zwischen den Rissen funkeln sehen. Die Sterne. Immer noch schön, die kleinen und großen Punkte. Nur die Dunkelheit um sie herum, die scheint plötzlich dichter zu werden. Als würde sie versuchen, das Licht zu verschlucken.
Etwas schiebt sich in mein Blickfeld. Diez. Er berührt mich. Blut. Da ist Blut an seinen Händen. Mein Blut.
Alles beginnt vor meinen Augen zu verschwimmen. Ich bin da, gerade noch so, aber ich kann spüren, wie das Leben aus mir herausfließt. Und ich kann nichts tun. Mich nicht bewegen. Nur nach oben blicken zum nachtschwarzen Firmament und zu den funkelnden Lichtern.
Orientierungslos zucken meine Augen umher, versuchen, sich an den Sternbildern festzuhalten, die mir so vertraut sind und mir zugleich das Gefühl geben, nur ein kleiner, machtloser Mensch zu sein.
Ich will nicht sterben. Ich will nicht, dass es vorbei ist.
Und dann ist der Schmerz plötzlich fort. Mein Herzschlag wird langsamer, leiser in meinen Ohren. Es gibt nur noch mich und die Nacht, und ich fühle mich, als sei ich ein Teil dieser Weite. Ein Teil des Universums, das ebenso verglühen wird wie die einsame Sternschnuppe, die den Himmel streift.
Mein Vater hat mir als Kind immer gesagt, dass man sich etwas wünschen darf, wenn man eine Sternschnuppe sieht. Ich habe nur noch einen Wunsch, während die Welt um mich herum aufhört, sich zu drehen. Mein Mund öffnet sich wieder, versucht, die Worte zu formen, die sich so tief in meine Seele brennen:
Bitte lass mich nicht sterben. Ich will leben.
Und dann fliege ich wieder.
Kapitel 2
Zwei Jahre später
Mit geschlossenen Augen stehe ich in der Sonne und genieße die Wärme, die sich in meinem Körper ausbreitet. Nach einem weiteren langen Tag voller Unikursen und meiner Arbeit im hiesigen Gemeindezentrum ist dieser Moment wie ein tröstendes Pflaster.
Blinzelnd öffne ich die Augen wieder, bin aber noch nicht bereit, ins Haus zu gehen, sondern blicke mit zusammengekniffenen Augen in den Himmel. Irgendwo dort sind die Sterne. Verborgen hinter dem strahlenden Blau.
Seufzend krame ich in meiner Umhängetasche nach meinem Schlüssel und öffne die Tür.
An den meisten Tagen bin ich dankbar dafür, in einer Dreier-WG mitten in Bockenheim gelandet zu sein, noch dazu in einem der frisch sanierten Altbaublocks. Eine Wohnung mit Doppeltüren, Parkettboden und sogar einem winzigen Balkon – das ist in Frankfurt als Studentin so etwas wie ein Sechser im Lotto. Nur befindet sich unsere Wohnung im obersten Stock, was bedeutet, dass es meine schmerzenden Füße erst mal bis dorthin schaffen müssen, ehe ich erschöpft aufs Sofa fallen darf.
Im Treppenhaus ziehe ich mich Stufe um Stufe am Geländer hoch und nehme mir fest vor, mich morgen nicht wieder dazu hinreißen zu lassen, Überstunden im Gemeindezentrum zu machen – auch wenn ich weiß, dass ich mir das regelmäßig vornehme, meinen Vorsatz jedoch immer wieder über Bord werfe.
Gerade habe ich den ersten Schritt in unsere Wohnung gesetzt, als jemand in mich hineinläuft.
»Oh, Entschuldigung.«
Perplex starre ich den jungen Mann an, der sich lässig das rote Haar nach hinten streicht und mich entwaffnend angrinst. »Schon okay«, sagt der Fremde und dreht sich zu meiner Mitbewohnerin Martha um, die hinter ihm im Flur steht. »Wir sehen uns.«
Sie erwidert nichts, sondern hebt einfach die Hand zum Abschied. Dann fällt die Tür hinter ihm ins Schloss.
»Wer war das denn?«, will ich anstelle einer Begrüßung wissen.
»Ach, nur Jordan«, sagt Martha, als sei nicht gerade ein gut aussehender Kerl an mir vorbeigelaufen.
Ich lasse meine Tasche neben die Garderobe fallen und schlüpfe aus meiner Jacke. »Nur Jordan?«
Martha zuckt mit den Schultern. Ihr langes schwarzes Haar hat sie zu einem unordentlichen Dutt zusammengebunden, aus dem Dutzende kleine Strähnen heraushängen. Ihr übergroßes Shirt ist ihr über die Schulter gerutscht und enthüllt eine der Tätowierungen, die sich über ihren gesamten Körper ziehen. »Wir haben nur gelernt«, behauptet sie, doch die Art, wie sie es betont, sorgt dafür, dass ich die Augenbrauen zusammenziehe.
»Nur gelernt?«
»Als Medizinstudentin habe ich keine Zeit, nebenher Sex mit meinen Kommilitonen zu haben«, erklärt sie mit einer ausladenden Handbewegung, wahrscheinlich, um zu signalisieren, dass sie nicht länger über Jordan reden möchte.
Mit einem kleinen Grinsen schüttle ich den Kopf. »Das lass ich gerade noch mal so durchgehen.«
Mit langen Schritten folge ich meiner Mitbewohnerin in die Küche. Dutzende Medizinbücher liegen verteilt auf dem Tisch herum, ergänzt durch Notizkarten in bunten Farben. Manchmal frage ich mich, wie Martha es schafft, unter all dem Druck noch zu funktionieren und gleichzeitig die Nächte damit zu verbringen, Cookies und Muffins für die WG zu backen.
Ihre dunklen Augen liegen auf mir, als ich mir einen Eistee aus dem Kühlschrank nehme und die Flasche in wenigen Zügen leere. Bis eben war mir gar nicht klar, wie groß mein Durst ist. Mal wieder. Zum Glück spart sich Martha jeglichen Kommentar. Stattdessen schnappt sie sich ihre kurze Lederjacke und sieht mich an.
»Ich wollte gerade meinen täglichen Spaziergang machen, bevor auch das letzte Sonnenlicht verschwunden ist«, meint sie. »Willst du mitkommen?«
Nachdenklich fahre ich mir durchs Gesicht. Davon abgesehen, dass meine Füße nach wie vor schmerzen, müsste ich eigentlich noch einiges von meiner To-do-Liste abarbeiten. »Ich weiß nicht.«
Martha mustert mich. Obwohl wir uns in vielen Dingen sehr ähnlich sind, könnten wir doch unterschiedlicher nicht sein. Mein hellblondes Haar ist das genaue Gegenteil von ihrem schwarzen. Während meine Haut schon verbrennt, wenn die Sonne sich kurz zeigt, schafft sie es, trotz ihrer Nachtaktivität immer auszusehen, als sei sie gerade erst vom Strandurlaub zurück.
»Ach komm schon, wir hatten in den letzten Wochen so wenig Zeit, einfach mal zu quatschen«, sagt sie und schiebt ihre Unterlippe vor.
Ich gebe mich geschlagen. »Okay, ich bring nur schnell meine Sachen weg.«
»Super.«
In meinem Zimmer werfe ich meine Tasche auf das Bett. Hinter meinen Schläfen drückt es, als würden sich Kopfschmerzen ankündigen. Obwohl mein Bett absolut verführerisch aussieht, versuche ich den Drang zu ignorieren, mir jetzt einfach die Decke über den Kopf zu ziehen und den Tag für beendet zu erklären.
Als ich zurück in den Flur komme, drückt Martha mir einen To-go-Becher mit Kamillentee in die Hand. »Wie war’s an der Uni?«, erkundigt sie sich, während wir die Treppen, die ich mich gerade erst hochgekämpft habe, wieder nach unten laufen.
»Eher ernüchternd«, antworte ich und puste über meinen Tee. »Die Arbeit im Gemeindezentrum mag ich deutlich lieber. Diese Extra-Blockseminare haben mir den Sommer ziemlich vermiest. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«
»Dass die Sommerkurse immerhin noch Plätze haben und du so nicht noch ein Semester dranhängen musst?«
»Guter Punkt.«
Martha hält mir die Tür auf und setzt sich die dunkle Sonnenbrille auf die Nase. »Aber jetzt ist es überstanden, oder? Heute ging dein letzter Kurs zu Ende?«
Der Gedanke lässt mich kurz stocken, aber ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Masterarbeit, ich komme«, sage ich und klinge dabei zuversichtlicher, als ich mich fühle.
»Na ja, erst mal ist die vorlesungsfreie Zeit dran, damit ihr die Reste des Sommers genießen könnt. Etwas, um das ich dich beneide, denn offenbar sind die Menschen im Medizinstudium nicht wirklich mitbedacht worden.«
Wir schlendern durch die Reihen der Wohnblöcke, die von der langsam untergehenden Sonne in ein warmes Licht getaucht werden. Die Spiegelungen in den Fenstern wirken fast golden. Mein Blick richtet sich wieder zum Himmel. Der Mond zeigt bereits sein blasses Gesicht, als wollte er die Sonne daran erinnern, dass es Zeit ist, den Platz für ihn und die Sterne zu räumen.
»Hast du schon mit deiner Chefin gesprochen?«, reißt mich Marthas Stimme aus meinen Gedanken.
Ich weiß, welches Thema jetzt folgt, und versuche mir nicht anmerken zu lassen, wie unangenehm es mir ist. »Nein, noch nicht. Aber wegen des BAföGs kann ich meine Arbeitszeiten ohnehin nicht verlängern, also ist das schon in Ordnung.«
Ganz so einfach lässt sich meine Freundin allerdings nicht überzeugen. »Aber du arbeitest doch momentan mehr Stunden, als man dir bezahlt?«
Dagegen kann ich schlecht argumentieren. Seit ich im Gemeindezentrum tätig bin, dreht sich der Großteil meines Lebens nur noch um meine Aufgaben dort. Es ist nicht so, dass mich jemand dazu zwingen würde. Für mich ist die Soziale Arbeit mehr als nur ein Job oder ein Studium. »Ja, aber ich liebe es«, versuche ich auszuweichen.
»Willa?«
»Ja?«
Martha bleibt stehen. Ich kann ihre Augen hinter der Sonnenbrille kaum erkennen, bin mir aber sicher, dass sie mich wieder mustert. »Ich bekomme dich kaum noch zu Gesicht«, meint sie ernst. Es ist kein Vorwurf, mehr eine Feststellung.
»Tut mir leid, es wird jetzt ruhiger. Die Kurse sind vorbei, meine Klausuren auch …«
Dieses Argument scheint sie zu beruhigen. Sie hakt sich bei mir unter und lächelt. »Gut, denn so langsam fehlen mir unsere Bücherabende.«
»Du willst mich doch nur wieder mit blutigen Thrillern quälen«, stöhne ich auf. Ich habe jetzt noch Albträume davon, was mir auf dem Heimweg alles passieren könnte.
»Von mir aus darfst du mich auch mit deinem Kitsch erschlagen, solange ich in den nächsten Wochen mal wieder was anderes als Medizinbücher in der Hand halte«, antwortet sie, und auch wenn ihr Lächeln noch immer dafür sorgt, dass sie fast unbeschwert klingt, kann ich zwischen den Zeilen hören, dass ich nicht die Einzige bin, die mit ihrem Studium struggelt.
»So schlimm?«
»Frag mich das nach der Klausur morgen noch mal.«
»Okay.«
Schweigend laufen wir weiter und lassen uns einfach treiben. Frankfurt zeigt sich in Bockenheim von einer seiner schönsten Seiten und übt auf mich noch immer die gleiche Faszination aus, die ich bei meinem Umzug hierher gespürt habe. Es ist immer etwas los, alles scheint ständig im Wandel zu sein.
Wir schlendern durch Einkaufsstraßen, vorbei an kleinen Cafés, Kneipen und dem Titania-Theater. In den großen Fenstern, die durch das blaue Metall unterbrochen werden, sehe ich unsere Spiegelung. Es sieht aus, als würden wir hierhergehören – mitten in das Leben rund um die Bockenheimer Warte.
Und doch merke ich, wie die Zweifel tief in mir wieder lauter werden. Je mehr die Sonne verschwindet und die schützende Wärme mit sich nimmt, desto mehr spüre ich wieder all die Dinge, die ich lieber zur Seite schieben und vergessen würde. All die Dinge, für die mir die Worte fehlen und die ich doch in die Welt hinausschreien will.
Martha entgeht nicht, dass ich mich verkrampfe. Sie drückt sich dichter an mich. »Ist alles okay?«
Drei so einfache Worte. Eine Floskel, die wir jeden Tag so oft hören, dass die eigentliche Bedeutung völlig verloren gegangen ist. Vielleicht habe ich diese Frage mittlerweile selbst so oft gestellt, ohne eine ehrliche Reaktion zu erwarten, dass es mir schwerfällt, sie überhaupt noch zu beantworten. Sogar mir selbst.
»Es ist alles okay«, sage ich sofort und schaffe es irgendwie, mein Lächeln aufrechtzuerhalten. Der Abend ist schön, ich bin genau da, wo ich immer hinwollte – und ich bin nicht allein.
Was für ein Recht habe ich schon, mir die Sterne zu wünschen, wenn die Sonne gerade scheint?
Nachdem Martha und ich wieder das Treppenhaus erklommen haben, bleibt sie irritiert vor unserer Wohnungstür stehen. Ich brauche einen Moment, um zu begreifen, warum sie innehält.
Die Tür steht ein Stückchen offen.
»Hast du nicht abgeschlossen?«, will sie wissen.
»Doch, ich glaube schon.«
Wir sehen einander an, und ich kann spüren, wie mein Puls sich beschleunigt. Ich schlucke meine Angst, so gut ich kann, hinunter und bin dankbar, dass es Martha ist, die unsere Tür aufstößt und wie in einem Film ruft: »Hallo?«
»Verdammt, wo seid ihr denn gewesen?«, hören wir eine vertraute Stimme und atmen erleichtert auf.
»Ada?«
Der pastelllila Schopf unserer Freundin taucht im Flur auf. »Ich hoffe, ihr habt Durst mitgebracht, Ladys«, ruft sie und lässt im wahrsten Sinne des Wortes die Korken knallen. Die Sektflasche in ihrer Hand schäumt über und hinterlässt Flecken auf dem Boden, noch ehe eine von uns es verhindern kann.
»Gibt’s ’nen Grund zu feiern?«, will Martha lachend wissen.
Adas blaue Augen blicken zwischen uns hin und her, als sie nickt und das Strahlen in ihrem Gesicht noch etwas heller wird. »Mein Vater wird morgen früh aus dem Krankenhaus entlassen.«
»Oh, Ada, das freut mich«, stoße ich aus und schließe sie in die Arme, um sie fest an mich zu drücken. Auch Martha fällt in die Umarmung ein.
»Mich auch!«
Sachte schiebt Ada uns von sich und deutet auf den Küchentisch. »Also schnappt euch ein Glas, und dann nichts wie aufs Sofa. Ich hab uns einen Film rausgesucht.«
Kapitel 3
Das ist nicht dein Ernst, Mirko!«, schnaube ich und stemme die Hände in die Hüften, während ich ihn anfunkle.
Mein Kollege sieht sich im Veranstaltungsraum um und zuckt mit den Schultern, als wollte er sagen, dass all das nicht mehr sein Problem ist. »Ich muss jetzt wirklich los.«
»Du kannst nicht einfach abhauen und mich mit all der Arbeit allein lassen«, hebe ich erneut zum Einspruch an. Früher dachte ich immer, in der Sozialen Arbeit seien alle Menschen eben das: sozial. Aber offensichtlich war das eine falsche Annahme.
»Tut mir leid, Willa«, behauptet er, was ihn aber nicht davon abhält, seinen Rucksack über die Schulter zu werfen und sich in Richtung Ausgang zu begeben.
Ich will mich ihm in den Weg stellen.
Will weiter diskutieren.
Will irgendwas tun.
Aber ich schaffe es nicht. Stattdessen spüre ich, wie ich einknicke. »Dann nimm wenigstens den Müll mit raus!«, rufe ich ihm hinterher, aber es ist schon zu spät. Mirko ist bereits durch die Tür verschwunden und lässt mich hängen.
Ich bin es eigentlich gewohnt, Überstunden zu machen. Normalerweise macht es mir auch nichts aus, die Letzte im Zentrum zu sein – im Gegenteil –, so habe ich immerhin etwas Ruhe, nachdem es den ganzen Tag in den Gängen gesummt hat wie in einem Bienenstock.
Aber heute fühlt es sich anders an. Härter.
Vielleicht liegt es daran, dass ich gerade meine erste Vorstandssitzung erlebt habe. Mir fällt es immer noch schwer zu überblicken, wie unser Verein aufgebaut ist und die unterschiedlichen Aufgaben verteilt sind. Nach all dem Input schwirrt mir der Kopf.
Und vielleicht bereue ich gerade, dass ich mich als Unterstützung zum Aufräumen gemeldet habe, denn so habe ich mir das nicht vorgestellt. Dass ich allein die Tische und Stühle an ihren Platz räumen, den Müll rausbringen und das Geschirr in die Küche schleppen muss, war nicht Teil des Deals. Mirko wäre dafür eingeteilt gewesen.
Manchmal wünschte ich, dass ich mehr wie meine Freundinnen wäre. Weder Ada noch Martha würden das mit sich machen lassen. Sie hätten Mirko die Stirn geboten und dafür gesorgt, dass er seinen Job genauso erledigt, wie es abgesprochen war.
Genervt puste ich mir eine Strähne aus dem Gesicht, als ich die Küche betrete, und werfe den Spülmaschinentab etwas zu fest in die dafür vorgesehene Öffnung. Es wird wirklich Zeit für meinen Feierabend. Mein Magen knurrt, und ich zittere, ohne dass ich sagen kann, ob es an der Wut, der Erschöpfung oder dem Druck in meinem Inneren liegt.
Typen wie Mirko sind einer der Gründe, weshalb ich keine Lust auf Männer oder Beziehungen habe. Sie spucken große Töne, machen Versprechungen und lassen einen dann sitzen – oder noch Schlimmeres.
Schluckend lehne ich mich gegen die Küchenwand. Nur für eine Minute die Augen schließen, damit ich den Rest des Abends noch irgendwie überstehe … Mit einer Hand fummle ich die Kopfhörer aus meiner Hosentasche, stecke sie mir in die Ohren und drehe die Musik auf. Dann mache ich weiter.
Eine halbe Stunde später kontrolliere ich noch einmal, ob alle Fenster in den Büros geschlossen sind, und will gerade meine Jacke holen, als mir ein Fluch entfährt: »Verdammt, Mirko, konntest du nicht mal das Licht ausmachen?« Die Glasfenster der großen Schwingtür zur Sporthalle leuchten mir auf dem Flur entgegen wie Augen. Die Sportgruppen sollten seit Stunden weg sein.
Obwohl ich schon halb am Ausgang bin, lasse ich meine große Umhängetasche auf den Boden gleiten. Eilig laufe ich zur Halle und schiebe die Tür auf.
Als ich in ein fremdes Gesicht blicke, das mich ebenso perplex ansieht, bleibt mir vor Schreck der Mund offen stehen.
Und für einen Moment ist es, als hätte jemand mein Leben auf Zeitlupe gestellt. Die Musik aus meinen Kopfhörern dröhnt in meinen Ohren, während ich in braune Augen starre. Mein Blick wandert über die Gesichtszüge meines Gegenübers. Das markante Kinn reckt sich nach vorne, und das künstliche Licht zeichnet einen Schimmer auf die stoppeligen Wangen.
Blinzelnd weiche ich zurück. »Was zum Teufel machst du hier?«, platzt es aus mir heraus.
Der Fremde sieht mich noch immer an. Seine dunklen Haare hängen ihm in die Stirn, was sich auch dann nicht ändert, als er sie lässig nach hinten schiebt. Widerspenstig fallen sie sofort wieder zurück an ihren Platz. Sein Grinsen kommt mir wie eine Herausforderung vor. Seine Lippen bewegen sich, formen Worte, die nicht bis zu mir durchdringen und trotzdem etwas in mir auslösen, das ich nicht verstehe.
Ich ziehe einen meiner Kopfhörer aus den Ohren. Mir ist bewusst, dass ich heftig reagiert habe. Meine Wut ist eigentlich gegen Mirko gerichtet und nicht gegen den Fremden.
Aber etwas an seinen Augen hat mich eiskalt erwischt, und mein rasendes Herz macht mir das Denken nicht einfacher.
»Es sollte eigentlich niemand mehr hier sein«, sage ich, während sein Blick noch immer auf mir liegt. Erst jetzt nehme ich eine Bewegung im Augenwinkel wahr und drehe mich zu einem der Basketballkörbe um, die an der Hallenwand angebracht sind. Ein Mädchen ist gerade dabei, Körbe zu werfen.
»Tut mir leid, ich wusste nicht, dass es ein Problem ist, wenn Stella und ich noch trainieren«, meint der Fremde und zieht meine Aufmerksamkeit damit wieder auf sich. Die blauen Chromfelgen vor den Speichen seines Rollstuhls schimmern im künstlichen Licht der Halle.
»Das Zentrum schließt um neunzehn Uhr dreißig«, gebe ich zurück, auch wenn das schlechte Gewissen sich bereits meldet, weil das Mädchen solchen Spaß zu haben scheint.
»Ich weiß«, antwortet er.
Ich verschränke die Arme vor der Brust und funkle ihn an. »Und warum seid ihr dann noch hier?«
»Stella wollte ihren neuen Rollstuhl testen«, gibt er zurück, als sei damit einfach alles erklärt. Und noch immer sitzt dieses verdammte Grinsen in seinem Gesicht. Es zeichnet Grübchen in seine Wangen, und es ärgert mich, dass mir dieses Detail auffällt.
Herausfordernd legt er den Kopf schief. Seine dunklen Brauen heben sich. »Ich habe mit Aygül gesprochen – sie meinte, sie würde Mirko Bescheid geben. Hat er nichts gesagt?«
»Nein.« Schluckend wird mir klar, dass die Geschäftsführerin unseres Vereins erwähnt hat, dass sie mit dem neuen Trainer der Jugendsportgruppen gesprochen hat. Nur hat sie mir dazu keinerlei weitere Infos gegeben – sondern wahrscheinlich Mirko. Ich habe keine Ahnung, wer hier vor mir steht.
Für einen Moment frage ich mich, ob ich gerade belogen werde – aber wer sollte schon lügen, nur um unsere Sporthalle für Rollstuhl-Basketball zu nutzen?
»Das tut mir leid, ich bin davon ausgegangen, dass alle Bescheid wüssten«, erklärt er deutlich sanfter, während sein Blick wieder meinen sucht. Aber ich weiche ihm aus, weil etwas an ihm mir zu nahe geht.
»Ich nehme an, du besitzt noch keinen Schlüssel?«, frage ich und versuche, nicht auf die Reaktionen meines Körpers zu achten. Ein hübsches Gesicht und ein entwaffnendes Lächeln reichen nicht aus, damit ich vergesse, wie ich in dieser Situation gelandet bin.
»Leider nicht«, gesteht er. »Ich verspreche dir, es dauert nicht mehr lange.«
Meine Zähne pressen sich aufeinander. Stella wirft noch immer Körbe und winkt mir zu, als sie mich entdeckt.
Ich kenne sie nur flüchtig. Das Gemeindezentrum ist groß, und es gibt jede Menge Projekte, Gruppen und Ehrenamtliche. Mit den Sportgruppen habe ich in der Regel nichts zu tun, mein Fokus liegt eher auf den Mental-Health-Projekten und den Selbsthilfegruppen.
»Hey!«, ruft sie begeistert. »Ich hab deinen Rekord gebrochen, Elias!«
Er lacht. »Ach ja?«
»Zwölf in Folge«, behauptet sie. »Damit hab ich unser Battle im Freikörbewerfen gewonnen!«
Ihr glücklicher Blick findet meinen, und auch wenn ich noch immer angefressen bin, muss ich lächeln. »Herzlichen Glückwunsch.«
»Da du mich vernichtend geschlagen hast, solltest du dich jetzt umziehen«, meint Elias freundlich, aber bestimmt. »Wir machen Schluss für heute.«
Stella widerspricht nicht, sondern macht sich auf den Weg in die Umkleidekabinen.
»Du bist der neue Trainer«, stelle ich fest.
Elias lacht. »Was hat mich verraten? Das Setting, die Sportklamotten?«
»Und die Tatsache, dass Sportlehrer meist gegen ihre Schülerinnen verlieren«, schieße ich zurück.
Seinem Grinsen tut das allerdings keinen Abbruch. Im Gegenteil, ihm scheint er sogar irgendwie zu gefallen, dieser kleine Schlagabtausch zwischen uns. »Hey, stell ja nicht meine Kompetenzen infrage, ich habe sie natürlich nur aus pädagogisch wertvollen Gründen gewinnen lassen.«
»Natürlich.«
Er reicht mir seine Hand. »Freut mich, dich kennenzulernen. Auch wenn ich mir gewünscht hätte, jemand hätte mich angekündigt. Ich bin Elias. Aber das weißt du ja jetzt schon.«
Für einen Moment sehe ich ihn nur an. Seine weiche Stimme sorgt dafür, dass sich meine Wut etwas auflöst.
»Willa.«
Unsere Hände berühren sich, und Wärme schießt durch meinen Körper, während mein Herz einen Extraschlag macht. Schnell ziehe ich meine Hand wieder zurück. »Ich würde jetzt wirklich gern Feierabend machen und die Halle abschließen«, stelle ich klar.
»Möchtest du deine Nächte etwa nicht hier verbringen?«, stichelt er und verzieht amüsiert den Mund.
»Nicht bei der Gesellschaft.«
»Autsch«, stößt er aus, lacht aber wieder, als würde meine Abwehrhaltung ihn bestens unterhalten. »Du kennst mich keine fünf Minuten, und schon habe ich einen Korb kassiert.«
»Ist ja offenbar nicht der erste heute.«
Dieses Lachen. Es lässt einen Schauder über meinen Körper laufen und sorgt dafür, dass sich sämtliche meiner Muskeln anspannen. Irgendetwas an Elias drückt Knöpfe in meinem Inneren, die ich sonst gut versteckt halte. Das Letzte, was ich heute Abend erwartet habe, ist, auf jemanden wie ihn zu treffen. Nichts scheint ihn zu verunsichern, weder meine anfängliche Wut noch meine reservierte Art. Sämtliche meiner Schutzmechanismen scheinen ihren Dienst zu versagen, wenn ich ihn zu lange anschaue, und ich verstehe nicht, warum. Ich weiß nur, dass mir heiß wird, wenn er mich ansieht.
»Ich warte im Foyer auf euch«, murmle ich und drehe ihm den Rücken zu. Im Gehen wische ich mir die Hände an der zerschlissenen Jeans ab, in dem Versuch, die Erinnerung an seine Wärme abzustreifen. Aber es ist vergeblich. Der Rhythmus meines Herzens ist noch immer durcheinander.
Es dauert nicht lange, bis sich sowohl Stella als auch Elias am Ausgang einfinden. Ich halte ihnen die Tür auf und schließe ab, ehe ich mich dem dunklen Parkplatz zuwende. Ein einsames Auto steht unter dem großen Ahornbaum, dessen Blätter leise im Wind rauschen. Der Spätsommer in Frankfurt ist noch nicht abgeklungen, aber ich kann ihn bereits spüren – den Herbst. Unwillkürlich schlinge ich die Arme fester um meinen Körper, spüre den Stich der Traurigkeit darüber, dass sich die schönste Zeit des Jahres verabschiedet, und blicke wieder in das Gesicht von Elias.
Offenbar hat er etwas gesagt, und ich brauche einen Moment, bis seine Frage vollends in meinen müden Verstand gesickert ist.
»Bist du mit der Bahn hier?«
»Ja.«
Er deutet mit dem Kopf auf seinen Wagen. Stella hat die Tür bereits geöffnet und zieht sich mit den Armen auf den Sitz. »Ich muss Stella ohnehin nach Hause bringen, soll ich dich mitnehmen?«
Die Frage überrascht mich, sodass ich ihn einen Herzschlag lang nur anblinzle. Was an unserem Zusammentreffen hat ihn bitte auf die Idee gebracht, dass ich von ihm nach Hause gebracht werden will?
»Danke, ich verzichte.«
Sein selbstsicheres Grinsen verschwindet zum ersten Mal an diesem Abend. »Das sollte keine blöde Anmache sein, ich dachte nur: Es ist spät, und ich schulde dir was dafür, dass wir länger in der Halle waren.«
»Schon in Ordnung«, wehre ich ab.
Er nickt. »Gute Nacht, Willa. Wir sehen uns.«
Und irgendwas an diesem Satz bringt mein Herz schon wieder zum Stolpern.
Kapitel 4
Es gibt Momente im Leben, da spürt man die Risse in der Seele besonders deutlich. Momente, in denen man hineinfällt in die Schluchten voller Zweifel, heimtückischer Gedankenspiralen und der allgegenwärtigen Stimme, die immer wieder flüstert: Du bist nicht gut genug. Und du wirst es nie sein.
Und immer wenn die Albträume kommen, sind diese Gedanken wieder viel zu laut. Am liebsten würde ich einfach vergessen. Mein gesamtes Leben vergessen und bis zu dem Punkt vorspulen, an dem ich in Frankfurt angekommen bin. Nur funktioniert das Leben so eben nicht – und Schatten, die mich verschlungen haben, versuchen genau das immer wieder.
Jetzt fehlt mir die Kraft, aus dem Bett zu steigen. Der Schlummeralarm meines Handys setzt zum dritten Mal an, doch ich schalte ihn erneut aus und blicke weiter an die Decke.
»Willa?«, ertönt Marthas Stimme vor meiner Tür, aber sie wartet nicht darauf, dass ich sie hereinrufe. Ihr Kopf erscheint im Türspalt. »Bist du wach?«, will sie wissen, bevor sie näher kommt.
»Ja, entschuldige«, murmle ich und setze mich auf, wobei ich darauf achte, dass meine übergroße Decke alles von mir abschirmt. Es mag albern wirken, besonders, da Martha sie kennt. Die Narben. Die unzähligen Narben auf meinen Armen, von den unzähligen Schnitten, die ich mir selbst zugefügt habe.
»Ich hatte nur die Befürchtung, dass du verschläfst«, erwidert Martha und legt den Kopf schief, während sie mich betrachtet. Das tut sie immer, wenn sie sich sorgt, aber nicht genau weiß, wie sie es sagen soll.
»Mir geht’s gut.«
Martha schüttelt den Kopf. »Hör auf zu lügen.«
Das ist das Problem an wirklich guten Freundinnen. Sie erkennen es viel zu oft, wenn man nicht bereit ist, ihnen die Wahrheit zu sagen. Obwohl ich zugeben muss, dass mein Zimmer wahrscheinlich auch nicht den Eindruck vermittelt, dass mit mir alles okay ist. Es ist selbst für meine Verhältnisse extrem unordentlich. »Ich steh jetzt auf«, verspreche ich, auch wenn ich mich nicht danach fühle.
Aufmunternd drückt Martha mir einen Kuss auf die Stirn. »Okay, ich warte mit einem gigantisch großen Kaffee auf dich.«
»Danke.«
»Keine Ursache.«
Sie schließt die Tür hinter sich, und ich schiebe die warme kuschelige Decke widerwillig von meinem Körper. Martha war der erste Mensch, dem ich erzählt habe, was mir passiert ist. Die erste Person, die mich nicht hinterfragt hat. Und irgendwie wurde sie so auch zu dem ersten Menschen in meiner Familie.
Mir ist nicht danach, mein Spiegelbild länger als nötig zu betrachten, also verzichte ich auf Make-up und ziehe mir nur schnell eine dunkle Jeans, mein Lieblingsshirt und einen schlabbrigen grauen Pulli über, ehe ich mir meine Haare zu einem großen Knödel zusammenbinde.
Das muss für heute reichen.
In der letzten Wäsche ist der Pulli ein kleines bisschen eingelaufen, sodass ich an den Ärmeln zupfen muss, um die Anfänge der Narbenlandschaft auf meinen Armen zu verbergen.
Mit meiner großen Umhängetasche trete ich aus meinem Zimmer, nur um im Flur fast über meine andere Mitbewohnerin zu stolpern.
»Ada!«
»Guten Morgen«, gibt sie gähnend zurück. Ada ist ein gutes Stück kleiner als ich, und der Geruch ihres schweren Vanilleparfüms umhüllt sie wie eine Wolke.
»Gut geschlafen?«
Der Ausdruck in ihrem Gesicht wird noch etwas knautschiger. »Es ging. Seid ihr heute Abend da?«, will sie wissen.
Martha und ich sehen uns an. »Klar, wollen wir einen Mädelsabend machen?«, frage ich. Nach meinem ewig langen Tag im Gemeindezentrum gestern wird mir ein Abend mit meinen Freundinnen hoffentlich guttun. Auch wenn ich mich dazu zwingen muss, mir diese kleine Pause zuzugestehen. In der Uni hänge ich hinterher, weil ich einige Abgaben von Hausarbeiten aufgeschoben habe. Und ich kann es mir nicht leisten, meinen BAföG-Anspruch zu verlieren.
»Es gibt da diese neue Buchverfilmung von Stephen King, die wir anschauen könnten«, schlägt sie vor.
Ich verziehe das Gesicht. »Bitte nicht schon wieder was Gruseliges!«
»Okay, wie wäre es mit einem Rewatch von Shadow and Bone?«
Martha rümpft die Nase. »Muss das sein?«
»Hey, das ist meine Lieblingsserie«, entgegnen Ada und ich wie aus einem Mund.
Martha rollt mit den dunklen Augen, aber ihre Mundwinkel ziehen sich nach oben. »Erinnert mich besser nicht daran.«
»Die Entscheidung ist gefallen«, sage ich bestimmt. »Ich muss jetzt zur Arbeit, aber ich könnte auf dem Rückweg veganes Eis besorgen.«
»Und Sahne?«
»Klar doch.«
»Vergiss die Streusel nicht«, instruiert mich Martha, während ich den Kaffee mit drei großen Schlucken austrinke.
»Wie könnte ich?«, erwidere ich und drücke ihr die leere Tasse in die Hand, dann greife ich nach meiner Jacke. »Wir sehen uns heute Abend!«
Manchmal kann ich selbst kaum glauben, wie sich mein Leben in den vergangenen zwei Jahren verändert hat. Die Spitze meines Bleistifts fliegt über das Papier, doch die Worte können nicht ausdrücken, was wirklich in mir vorgeht.
Welchen Weg kann ich wählen, wenn ich mich verändern will, aber Angst vor Veränderung habe?
Ich seufze und streiche die Zeilen in meinem Notizbuch gleich wieder durch. In meinem Kopf klangen die Worte anders, irgendwie besser und nicht, als hätte ich mittendrin den roten Faden verloren.
Ich stopfe das Notizbuch in meinen Rucksack, verlasse den Lesesaal der Bibliothek und mache mich auf den Heimweg.
Im Haus meiner Eltern brennt noch Licht, als ich meinen Wagen parke und die Bücher vom Beifahrersitz nehme, die ich mir gerade ausgeliehen habe. Mein Blick wandert zum Himmel.
Hier, etwas abseits der Stadt, sind die Sterne deutlich zu erkennen. Auch heute zeigt sich keine Sternschnuppe, der ich meine Wünsche anvertrauen könnte. Vielleicht, weil ich nur diesen einen hatte und er mir erfüllt wurde.
»Ich bin wieder da«, rufe ich ins Haus und lasse die Tür hinter mir zufallen.
Meine Mutter steckt den Kopf aus der Küche. »Soll ich deine Sportsachen gleich waschen?«
Es fällt mir schwer, nicht sofort die Augen zu verdrehen. »Ist nicht nötig …« Aber der Satz kommt nicht schnell genug aus meinem Mund, sodass meine Mutter bereits dabei ist, meinen Rucksack zu öffnen. Nur liegt ganz oben nicht meine Kleidung, sondern das Notizbuch.
»Oh?« Sie hebt das Buch hoch, als wüsste ich nicht, dass es sich dort befindet. »Du benutzt es noch?«
»Ja, aber das ist genauso privat wie meine dreckige Wäsche«, gebe ich zurück und schnappe mir meinen Rucksack wieder. »Würdest du das also bitte lassen?«
»Entschuldige, ich dachte nur, dass du genug um die Ohren hast«, sagt sie und hebt die Hände, als wollte sie signalisieren, dass wir einen Waffenstillstand haben. »Du bist gerade rechtzeitig zum Abendessen!« Sie schiebt sich das Haar aus dem Gesicht, das von grauen Strähnchen durchzogen wird.
Mein Lächeln ist nicht gespielt, doch es sind diese Momente, die mir den Kontrast zwischen meinem früheren und meinem jetzigen Leben allzu deutlich machen.
Das war das Schlimmste für mich.
Wieder hier zu sein.
Wieder zurückzumüssen.
Ein Stück von der Selbstständigkeit zu verlieren, die vor dem Unfall so selbstverständlich für mich war.
Ich liebe meine Familie. Ich bin dankbar für absolut alles, was sie für mich getan hat, noch tut und wahrscheinlich immer tun wird. Es ist nicht so, dass ich nicht gern mit ihr zusammen bin. Aber mit Mitte zwanzig wieder ins Elternhaus ziehen zu müssen, ist, gelinde gesagt, ein Schlag in die Magengrube. Da hilft es auch nicht, dass ich keine andere Wahl hatte. Eher im Gegenteil.
»Was gibt es zu essen?«
Ich begebe mich in die Küche. Schon allein der Geruch lässt meinen Magen knurren. Bis eben hatte ich keine Ahnung, wie groß mein Hunger eigentlich ist. Diez hat mich ziemlich auf Trab gehalten. Manchmal habe ich das Gefühl, mehr für sein Jurastudium zu tun als für mein eigenes in Sozialer Arbeit. Unsere Lerntreffen enden eigentlich immer damit, dass mir der Kopf vor lauter Paragrafen schwirrt. Auch wenn meine sozialen Batterien ziemlich erschöpft sind, beschließe ich, meiner Mutter Gesellschaft zu leisten. Leise fluchend hantiert sie hinter der Küchentheke. »Rosenkohl-Kartoffel-Gratin!«, höre ich ihre Antwort.
»Dann ist es ja gut, dass ich Diez heute nicht mitgebracht habe.«
Mit einem angestrengten Gesichtsausdruck hebt meine Mutter die übergroße Auflaufform auf den Tisch. Ihr tadelnder Blick streift meinen, und ihre schmalen Lippen verziehen sich zu einem sarkastischen Lächeln. »Diez liebt meine Küche!«
Schmunzelnd sehe ich sie an. »Diez hasst Rosenkohl. Und jetzt tu nicht so, als hättest du gekocht.«
Sie winkt ab und dreht mir wieder den Rücken zu, um die Teller und das Besteck aus dem Schrank zu holen. »Ich hatte die schwerste aller Aufgaben: das Essen nicht anbrennen zu lassen. Dein Vater hat nur das Schneiden, Abschmecken, und was auch immer man sonst noch machen muss, erledigt.«
Ihr Lächeln ist fast so strahlend wie die großen LED-Lampen an der Decke. Aber ich kenne sie einfach zu gut. Eltern versuchen immer, ihren Kindern vorzumachen, dass alles in Ordnung ist. Nur ist eben nicht immer alles in Ordnung.
»Wo ist er?«, frage ich, während meine Mutter mir ein Glas Orangensaft eingießt.
»Hat eine Extraschicht übernommen«, antwortet sie deutlich leiser. Auch das ist inzwischen meine Normalität. Mir ist bewusst, dass ich ziemlich privilegiert aufgewachsen bin. Soweit ich mich erinnere, hatten wir nie finanzielle Probleme. Ich hatte immer alles, was ich brauchte, und meistens bekam ich das, was ich wollte.
Und nun setzt sich das fort. Meine Eltern springen bei allen Dingen ein, die jetzt eben nötig geworden sind, besonders, wenn die Krankenkasse mal wieder einen Zuschuss nicht bewilligt. Ich besitze ein neues Auto, das ich trotz der Tatsache, dass eines meiner Beine nahezu bewegungsunfähig ist, fahren kann. Zwei Rollstühle, einen für den täglichen Gebrauch, einen für den Sport, ohne den ich einfach nicht leben will. Fuck, sie haben das halbe Haus umgebaut, damit ich über ein Schlafzimmer in der unteren Etage inklusive eigenem Badezimmer verfüge.
Und ich bin dankbar.
Sehr sogar.
Aber ich sehe sie auch. Die Spuren, die es hinterlässt. Meinen Vater bekomme ich kaum noch zu Gesicht, er übernimmt jede Schicht, die er kriegen kann, und jobbt sogar am Wochenende. Gleichzeitig kocht er und findet am Sonntag trotzdem immer die Zeit, mit meiner Mutter und mir einen Film anzuschauen.
Vielleicht ist das der Unterschied zwischen der Kindheit und dem Erwachsenendasein. Als Kind sieht man alles durch einen rosa Filter, der die hässlichen Dinge ausblendet und die schönen Sachen erst möglich macht. Ich wünsche mir diesen Filter oft wieder zurück.
»Wie war es heute früh bei der Physiotherapie?«
»Ziemlich gut«, sage ich und meine es auch so.
»Deine Begeisterung ist ja ansteckend.«
»Der neue Physiotherapeut ist nice, aber er bringt mich auch ganz schön an meine Grenzen«, gestehe ich und kratze mich am Kopf.
»Verstehe«, erwidert sie. »Bei mir war es mal wieder mein Chef, der mich an meine Grenzen gebracht hat.«
»Ist er immer noch wütend, dass ihr eine Gewerkschaft gründet?«
»Mehr als das, aber das wird ihm auch nichts nützen. Lass uns nicht davon sprechen, erzähl mir lieber, wie dein erstes Training gestern im Gemeindezentrum war!«
»Klasse«, antworte ich sofort und spüre, wie sich ein Grinsen auf mein Gesicht stiehlt. »Die Kids sind toll.«
»Und die Kollegen?«
Diese Frage lässt unwillkürlich Willas Gesicht vor mir aufblitzen. Sie hatte irgendwas an sich, das ich nicht so ganz in Worte fassen kann.
Obwohl ich sie nur dieses eine Mal gesehen habe, kann ich mich an jeden Millimeter ihres Gesichts erinnern. Ich sehe sie so deutlich vor mir, als würde sie gerade vor mir stehen – und das nicht nur, weil sie mir einen Korb gegeben hat.
»Ich hab noch nicht viele kennengelernt, aber einer der Kolleginnen habe ich gestern wohl den Feierabend versaut«, gestehe ich lachend.
»Was hast du getan?«
»Etwas in der Kommunikation ging schief, und vielleicht habe ich auch ein bisschen die Zeit vergessen.«
Sie lacht auf und schüttelt den Kopf auf diese Art, die Eltern oft an sich haben. »Ja, das klingt nach dir.« Meine Mutter setzt sich zu mir und befüllt unsere Teller. Beim Geruch des zerlaufenen Käses stöhne ich fast vor Verzückung. Genau das brauche ich jetzt. »Deine Großtante Erna hat nächste Woche Geburtstag, willst du mitkommen?«, sagt sie eher beiläufig, als ich gerade den ersten Bissen nehme.
»Ich kann nicht, der Vorbereitungskurs für das nächste Semester geht los.«
Meine Mutter stockt kurz, fast so, als würde sie darüber nachdenken, ob sie mir widersprechen soll. »Soll ich dir beim Lernen helfen?«
Beinahe hätte ich aufgelacht. Aber ich kenne das bereits. »Nein, Ma. Passt schon.«
Seit ich wieder zu Hause wohne, scheint meine Mutter manchmal zu vergessen, dass ich erwachsen bin und mein Studium nicht mit den Hausaufgaben aus der sechsten Klasse zu vergleichen ist.
Meine Ma sieht mich eindringlich an. »Bist du sicher?«
»Wenn ich mich richtig erinnere, war ich es, der all die Krankenkassenanträge für Förderungen ausgefüllt hat«, stichle ich grinsend. »Ich glaube also, dass du mir in Sachen Grundlagen des Rechts und Sozialrechts nicht wirklich helfen kannst.«
Sie muss lachen. »Manchmal vergesse ich, was für ein Besserwisser du bist.«
»Aber recht hab ich doch trotzdem?«
»Musst du das denn so rausposaunen?«, stichelt sie zurück.
Ich strecke ihr die Zunge heraus. »Von wem habe ich das wohl?« Wenn ich darüber nachdenke, bin ich manchmal vielleicht doch noch ein bisschen wie mit zehn …
»Gut, dann werde ich wohl allein bei Tante Erna sitzen und mich schrecklich langweilen.«
»Paps kommt nicht mit?«
Sie schüttelt den Kopf und schiebt sich lieber eines der Rosenkohlröschen in den Mund. Ich kaue noch und bedeute ihr mit den Händen, dass an ihrem Kinn etwas Soße hängt.
»Und was ist mit dem Wochenende darauf?«, fragt sie weiter. »Dein Vater hat frei, wir könnten uns mal wieder einen Film im Kino ansehen.«
»Ich fürchte, auch da muss ich absagen.«
»Und wieso?«
»Ich bin im Gemeindezentrum«, erkläre ich knapp.
Damit habe ich das Thema angeschnitten, das ihr Bauchschmerzen bereitet. »Willst du das wirklich neben dem Studium noch weitermachen?«
Ich kneife die Augen zusammen und sehe sie an. Dieses Gespräch hatten wir in den vergangenen Wochen zu oft. Meine Zwangspause ist vorbei.
Im nächsten Semester steige ich wieder in mein Masterstudium ein. Auch wenn ich im Stoff etwas hinterherhinke und vieles aus dem ersten und zweiten Semester nicht mehr vollends vor Augen habe, komme ich im Großen und Ganzen gut klar. Früher hatte ich auch nicht mehr Zeit zum Lernen oder Hausarbeitenschreiben als jetzt, dazu habe ich zu oft gefeiert und mich zu viel ausprobiert.
Ich wollte schon immer in die Soziale Arbeit. Das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass ich jetzt nicht mehr abwarten will, Berufserfahrung zu sammeln, und deswegen ehrenamtlich im Zentrum arbeite. Für einen Augenblick überlege ich, meiner Mutter genau das zu sagen. Doch sie kennt alle meine Beweggründe. Meine Antwort fällt daher nur knapp aus. »Ja.«
Dass ich mich ehrenamtlich engagieren will, fand meine Familie zwar ursprünglich gut, aber nur so lange, bis ihr klar wurde, wie viel Arbeit es bedeutet und dass es weit mehr als nur ein netter Zeitvertreib ist.
Meine Ma legt ihre Gabel zur Seite und reibt sich über die Stirn. »Ich will dich nicht bevormunden, ich will nur sagen …«
»Du machst dir Sorgen, ich versteh schon.«
Sie nickt langsam und lächelt mich halbherzig an. »Und ich geh dir damit auf die Nerven, oder?«
Damit trifft sie ins Schwarze, aber immerhin hält sie mich nicht davon ab, die Teller abzuräumen. »Ja, ziemlich. Aber das ist okay, ich liebe dich trotzdem.«
Ich verstaue das benutzte Geschirr in der Spülmaschine und wende mich ihr wieder zu.
»Und ich dich«, sagt sie und greift nach meiner Hand. »Ich wollte nie eine dieser Mütter werden, die ihrem Kind nichts erlauben.«
»Ich bin ja zum Glück kein Kind mehr.«
Theatralisch verdreht sie die Augen. »Super, danke, mein Sohn. Das hilft mir natürlich sehr.«
Lachend schiebe ich mich an ihr vorbei. »Ich geh in die Badewanne.«
»Brauchst du …«
»Mama!«
Sie bricht ihren Satz ab und sieht mich mit einem schiefen Lächeln an. »Okay. Wenn doch, gib Bescheid. Ich werde mich jetzt vor den Fernseher setzen und wahrscheinlich eingeschlafen sein, bis dein Vater kommt.«
»Alles klar, ich deck dich dann später zu«, gebe ich über die Schulter zurück.
»Gute Nacht.«
»Gute Nacht, Ma.«
Kapitel 5
Vorsicht!«, rufe ich aus und ducke mich vor der Handykamera weg, die gerade von Ada durch den Raum geschwenkt wird.
»Ups, sorry«, sagt sie und legt ihr Telefon zur Seite. »Ich hatte vergessen, dass du das nicht magst.«
»Du weißt genau, dass es nicht daran liegt«, murmle ich etwas zu scharf. Auch wenn es mir manchmal selbst albern erscheint, bekomme ich schon Herzrasen, wenn ich nur daran denke, dass jemand mich irgendwo auf Instagram oder TikTok wiedererkennen könnte. Nein, nicht jemand, eigentlich nur eine Person. Die Person, die für so viele Risse in meiner Seele verantwortlich ist.
Meine Freundinnen sind die einzigen Personen, die von alldem wissen, aber manchmal vergessen auch sie, wie tief die Wunden sind, vor denen ich mich verstecke. Und weil ich meine Rolle so gut spiele, vergesse ich es manchmal selbst. Bis zu diesen scheinbar kleinen Momenten, die mich wieder daran erinnern, dass ich nicht bin wie sie. Und es vielleicht nie sein werde. Alles, was mir bleibt, ist, meine Rolle weiterzuspielen, bis ich wieder vergesse, was in meinem Leben alles schieflief.
Mein schlechtes Gewissen meldet sich, sobald ich eine heiße Schokolade von Ada in die Hand gedrückt bekomme und sie und Martha den Mädelsabend einläuten. Einen zweiten Abend innerhalb von nur einer Woche freizunehmen, passt nicht in meinen Zeitplan. Wobei – wenn ich ehrlich bin, haben mich die dunklen Gedanken und die Erschöpfung zuletzt ohnehin daran gehindert, wirklich etwas von den Dingen abzuhaken, die sich auf meiner schier unendlichen To-do-Liste befinden.
»Ich hab den Hausmeister angerufen«, erkläre ich. »Nächsten Montag repariert er unser Kellerlicht, und wegen der leckenden Heizung will er jemanden vorbeischicken.«
»Wie schaffst du es nur, solche Dinge auch noch zu organisieren?«, will Ada wissen.
»Na ja, irgendwer muss es eben tun«, wehre ich ab und zucke mit den Schultern.
»Ja, aber heute Abend machen wir nichts mehr, was uns daran erinnert, dass wir Erwachsene sind!«, beschließt meine Freundin. Mit diesen Worten startet sie Shadow and Bone.
Vielleicht ist es genau das, was mir jetzt hilft. Eine kleine Gnadenfrist, etwas Luft und Ablenkung. Meine Freundinnen um mich herum und heiße Schokolade.
Nur weiß ich, dass ein paar Momente der Leichtigkeit die Schwere nicht vollends stoppen, die sich auf meinen Brustkorb gelegt hat und droht, mich in ein unsichtbares Loch zu saugen. Trotzdem bemühe ich mich zu lächeln, denn egal, wie ich mich gerade fühle: Jetzt geht es um meine Freundinnen. Um uns. Um das, was ich an meinem Leben mag.
»Eine Außenseiterin wird zur Heldin wider Willen – eine ganz klassische Fantasy-Trope«, brummt Martha und verdreht die Augen, während Alina Starkov über unseren Bildschirm flimmert.
Auf unserem kleinen Wohnzimmertisch stapeln sich die unterschiedlichsten Snacks. Von Eis über Chips bis hin zu Popcorn und Käsesoße ist alles da, was das Herz begehren könnte.
»Als ob irgendwer ihretwegen einschaltet«, meint Ada, den Blick fest auf den übergroßen Fernseher gerichtet, der sich vor unserem chaotischen Bücherregal befindet. Mit einer Hand nimmt sie sich Popcorn und tunkt es mit einer Selbstverständlichkeit, die ich nie verstehen werde, in die Käsesoße, ehe sie es zwischen ihren Lippen verschwinden lässt. »Wir sitzen einzig und allein wegen der Krähen hier!«
Dieses Argument scheint Martha allerdings nicht zu überzeugen. »Und trotzdem dreht sich die Hälfte der Serie um sie.«
»Ja, denn ihre Rolle ist wichtig, um das gesamte Universum zu verstehen«, versuche ich zu schlichten.
»Du meinst, sie wird gebraucht, damit wir ihre toxische Beziehung zum Bösewicht romantisieren können?« Martha schnappt sich das vegane Eis und zieht eine Augenbraue nach oben, während Ada sie empört ansieht.
»Hey!«, schnaubt sie. »Grisha-General Kirigan würde dich für so eine Aussage auf die Knie zwingen.«
»Das kann er ja mal versuchen, ich knips einfach das Licht an, und der ach so mächtige Schatten-Dude fällt um.«
Ich muss schallend lachen und halte mir die Hand vor den Mund, als meine Freundinnen mich anstarren. Dann müssen auch sie grinsen.
»Du darfst gar nicht lachen, du stehst ausgerechnet auf Matthias«, erinnert mich Ada unnötigerweise.
Martha steht von ihrem Platz auf und stellt ihr Eis zur Seite. »Der traumatisierte Mann, der durch den Schatten des Kriegs seelisch verwundet ist und zwischen seiner Pflicht und dem letzten Rest eines Gewissens hin- und hergerissen wird, während er mit seiner Gefangenen Nina durch den Schnee stapft und mit aller Kraft versucht, ihre Anziehungskraft zu ignorieren«, gibt sie theatralisch von sich und wirft sich dabei quer über den Sessel, als würde sie gerade in Ohnmacht fallen.
Genau das liebe ich an uns. Während meiner Schulzeit hatte ich nie Freundinnen, mit denen ich mich über Bücher und Serien austauschen konnte. Schon gar nicht über Fantasy- oder Liebesromane. Und auch wenn Martha und Ada nicht unbedingt meinen Lesegeschmack teilen, so geben sie ihm zumindest immer eine Chance. Manchmal sind sie sogar positiv überrascht. Ich liebe es eben einfach, in eine andere Welt abzutauchen, mich in eine der Figuren zu verwandeln und als diese zu verlieben. Für mich bedeuten Bücher Freiheit. Ultimative Freiheit und der ultimative Schutz davor, in der Realität tatsächlich verletzt zu werden.
»Beruhigt es dich, wenn wir schwören, dass wir in der Realität nicht auf unsere fiktionalen Vorlieben zurückgreifen?«, will ich schmunzelnd wissen.
»Das will ich doch hoffen, sonst gehen hier bald schräge, versaute Millionäre ein und aus«, meint Martha.
Ich werde rot. »Das war nur eine Phase«, nuschle ich und kann spüren, wie mir die Hitze ins Gesicht steigt. Es gefällt mir nicht, wie unangenehm es mir ist, dass ich gerne Bücher mit vielen sexy Szenen lese. Eigentlich müsste es mir nicht peinlich sein, schon gar nicht vor den beiden. Ist es aber trotzdem.
»Girl, wir alle haben eine spicy Phase. Meistens zu einer bestimmten Zeit im Monat«, kichert Ada und wackelt anzüglich mit den Augenbrauen, was mein Gesicht nur noch mehr glühen lässt.
»Du bist unmöglich!«
»Ja, ich weiß. Aber deswegen liebt ihr mich.«
Martha zuckt gelassen mit den Schultern. »Ich habe zu viele Unterhaltungen über Tentakel-Pornos geführt, als dass ich bei so einem Thema noch rot werden könnte.«
»Ihr beide verschlingt Unmengen an grausamen Thrillern, aber ich bin schräg, weil ich mir ab und an leichte und schmuddelige Lektüre gönne?«, frage ich halb im Spaß und halb im Ernst.
Ada deutet auf mein vollgestopftes Bücherregal. Ich habe mich geweigert, es nach Farben zu sortieren, und stattdessen die unterschiedlichen Genres unterteilt. Mit Abstand den meisten Platz nehmen die Liebesromane und erotischen Bücher ein. »Nein, du bist schräg, weil du es schmuddelig nennst.«
»Sag doch lieber: versaut«, hilft Martha aus.
Ada grinst in ihre heiße Schokolade. »Dirty.«
»Oder: die beste Masturbationsvorlage!«
Die beiden lachen wieder, weil ich inzwischen wahrscheinlich so tiefrot bin wie unser altes Ledersofa. »Manchmal hasse ich euch beide«, behaupte ich, muss aber trotzdem grinsen.
Ich bin nicht die Einzige mit ungewöhnlichen Lesevorlieben. Ada ist der ungefähr größte Sebastian-Fitzek-Fan, den es gibt. Die signierten Ausgaben seiner Bücher stehen fein säuberlich geordnet in einem extra von ihr angebrachten Regal neben dem Fernseher, als hätte sie einen Altar errichtet. Mein eigener mit sämtlichen Sonderausgaben von Leigh Bardugo ist direkt daneben, was mir das Recht abspricht, darüber zu urteilen.
Nur Martha ist eher praktisch veranlagt, wenn es um ihre Bücher geht. Etwas versöhnlicher kommt sie wieder zu uns auf das Sofa und sieht mich an. »Wir schubsen dich nur gern etwas aus deiner Komfortzone«, meint sie und lehnt den Kopf gegen meine Schulter.
»Stimmt.«
Ada schaltet den Fernseher aus. Es sieht ohnehin niemand mehr von uns hin, und wir können unseren Rewatch vor dem Beginn der neuen Staffel auch noch etwas aufschieben.
»Haben wir schon beschlossen, welches Buch wir diesen Monat lesen wollen?«, wechsle ich das Thema.
Martha überlegt einen Moment. »Ich glaube, Ada ist dran, unseren nächsten Buddyread zu wählen.«
Unsere Freundin schluckt und schiebt sich eine der lila Strähnen hinters Ohr. »Um ehrlich zu sein, hatte ich bisher keine Zeit, mir die Neuerscheinungen genauer anzusehen«, gesteht sie.
»Das ist doch völlig in Ordnung«, sage ich schnell und greife nach Adas Hand. »Wir müssen das nicht jetzt entscheiden.«
»Genau«, stimmt Martha mir zu. »Du hattest mit deinem Vater mehr als genug um die Ohren.«
Ada legt den Kopf schief und scheint für einen Moment darüber nachzudenken, ob sie auf dieses Thema eingehen will oder ob ihr die Kraft dafür noch fehlt. »Ich habe Angst davor, irgendwas zu planen«, gesteht sie deutlich leiser. »Denn auch wenn es ihm gerade wieder besser geht, wissen wir nicht, wie lange diese Phase anhält. Wann er wieder im Krankenhaus landet und der ganze Horror wieder von vorne beginnt.«
»Verständlich«, sagen Martha und ich wie aus einem Mund.
»Mach dir wegen uns keinen Stress.«
Ada lächelt. »Danke, dass ihr heute Abend für mich da seid.«
Ich drücke sie an mich. »Sind wir doch immer.«
»Ja, aber ich bin immer wieder dankbar dafür, dass ihr es mir verzeiht, wenn ich mich tagelang nicht melde und dann wieder angekrochen komme«, murmelt Ada gegen meine Brust, während ich spüre, wie auch Martha uns umarmt.
»Wir sind deine Freundinnen«, sage ich sanft. »So schnell wirst du uns nicht los.«
»Versprochen?«
Weitere Worte sind unnötig. Wir sitzen einfach da und halten uns in den Armen, bereit, uns gegenseitig vor der großen, bösen Welt außerhalb dieser vier Wände zu beschützen. Komme, was wolle.
Kapitel 6
Ich würde mich nicht als unsicheren Typ bezeichnen. Aber gerade habe ich das Gefühl, ich müsste mich jeden Moment übergeben. Das letzte Mal, als mir so zumute war, habe ich mein Mathe-Abi verhauen. Ich fahre mir übers Gesicht, dann schlucke ich meine Angst hinunter und durchbreche die unangenehme Stille, die den Raum erfüllt. »Also ist es keine gute Idee? Ich weiß, bei uns gibt es die Sportgruppen, aber die meisten von ihnen sind für unterschiedliche Altersgruppen von behinderten Menschen ausgelegt. Es gibt keine Sportgruppe, die explizit für alle bestimmt ist. Für Menschen mit und ohne Behinderung.«
»Doch, es ist sogar eine sehr gute Idee«, meint Aygül und blinzelt mich an.
Ich weiß allerdings nicht, ob ich erleichtert sein soll, denn ihr Blick macht mir keine Hoffnungen. Mit verkniffenem Mund lehnt sie sich auf ihrem Bürostuhl zurück, ohne noch einmal die Papiere anzusehen.
»Aber die Kosten dafür können wir über unseren Verein nicht decken.«
»Und was heißt das?«
Aygül überlegt einen Moment. »Dass es ein eigenes Projekt werden müsste«, erklärt sie ruhig. »Mit einer eigenen Finanzierung.«
»Aber wir haben doch schon Inklusionsprojekte?«, frage ich verwirrt.
Die Geschäftsführerin nickt, sieht mich aber noch immer mit ernstem Blick an. »Das stimmt, aber die Rahmenbedingungen sind da genau festgelegt – und das, was dir vorschwebt, ist etwas ganz anderes. Wir können nicht die Finanzierung eines anderen Projektes dafür hernehmen, du bräuchtest dafür eine eigene.«
»Und wie schaffe ich es, ein eigenes Projekt daraus zu machen?«, frage ich etwas leiser, während sich meine schwitzigen Hände verselbstständigen und über meine Beine reiben.
Aygül seufzt tief und schwer. Nicht aus Abfälligkeit, das kann ich ihr ansehen. Es ist vielmehr ein Seufzen aus Resignation. Ich weiß, dass unsere Geschäftsführerin mir gern helfen würde. Nur ihretwegen darf meine Jugendgruppe überhaupt die Sporthalle des Gemeindezentrums nutzen. Und sie hat sich dafür eingesetzt, dass der Eingang endlich barrierefrei gestaltet wird, als ich sie darauf hingewiesen habe. Sie gibt ihr Bestes, so wie alle hier. Nur leider, und das ist das wirklich Schlimme daran, reicht es nicht. Und wird es vielleicht nie. Weil selbst eine Handvoll Menschen, die ihr Bestes geben, eben nicht alle Probleme auf einmal lösen können.
Sie hat noch immer nichts gesagt, sondern betrachtet weiterhin das von mir ausgearbeitete Konzept. Dann schüttelt sie den Kopf, nur um gleich darauf erneut zu nicken. »Du brauchst jemanden, der mit dir einen Finanzplan aufstellt und nach potenziellen Geldern sucht«, erklärt sie, doch ihr Ton vermittelt mir bereits, dass dieser Satz nicht sehr positiv enden wird. »Leider überschreitet es meine Kapazität, deine Idee so aufzubereiten, dass wir sie als Projektantrag durchbringen können.«