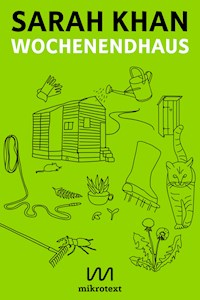
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mikrotext
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Ein Ort
- Sprache: Deutsch
Mehr Zeit im Grünen, auf dem Lande: Sarah Khan nimmt uns mit in diese Sehnsucht. Sie erzählt herrlich süffisant vom Suchen und Finden und Renovieren. Im und am Wochenendhaus. Wie überhaupt das richtige Domizil finden? Wie mit den Alteingesessenen klarkommen, konkret: Wessis vs. Ossis, Unkrautliebe vs. korrekte Blumenrabatte, Sonntagsmäher vs. Sonntagsruhe? Und warum verbringt man mehr Zeit in Baumärkten und in Gartenkluft als im Liegestuhl? Ist das „Häuschen“ eigentlich überhaupt irgendwann mal fertig? Täte es nicht auch ein Bauwagen? Nein? Und warum nicht? Ein persönlicher, oft augenzwinkernder Abgleich von Wunsch mit Wirklichkeit. Mit vielen Tipps für ein gelingendes Teilzeit-Landleben. Der zweite Band unserer Serie über Orte. Lesen Sie auch die essayistische Annäherung an den Bahnhof von Jan Fischer. „Die Wahrheit über das Haus im Grünen.“ rbb Kulturradio „Ostprignitz. Schon dieser Name kündet von einer verlangsamten Welt. Hier entdecken die Berliner Schriftstellerin Sarah Khan und ihre Familie eine ehemalige Dorfschule und verlieren ihr Herz. Schonungslose Bestandsaufnahme eines neuen Lieblingsprojekts.“ radio eins, Literaturagenten Sarah Khan, geboren 1971, ist Schriftstellerin und lebt in Berlin. Sie wuchs zwischen dem evangelischen Pastorat ihres Großvaters und dem Haushalt ihres Vaters, einem Teppichhändler aus Pakistan, in Hamburg auf. Sie veröffentlichte Geister-Reportagen, Ebay-Geschichten, drei Romane und eine Horrornovelle. 2012 erhielt sie den Michael-Althen-Preis für Kritik der FAZ.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 87
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Eine ehemalige Dorfschule in der Ostprignitz wird zum Wochendrefugium. Herrlich komisch erzählt die Schriftstellerin Sarah Khan vom Suchen, Finden und Renovieren. Plötzlich merkt sie, dass das Haus eine eigene Psyche besitzt und sauer wird, wenn die Familie zu selten kommt. Da tauchen Mäuse auf und Stadtgäste bringen verliebte Architekten mit. Im Garten macht sich die wilde Brombeere breit, die Einheimischen verteidigen die Sonntagsruhe mit allen Mitteln. Auch die skurrilen Seiten des Landlebens werden erörtert: Donauwellentest, Elfenhochzeit, Abwassergrube sowie die Kanadische Goldrute und ihre Bedeutung für Gartenblogger. Wie ein Ausflug ins Grüne. Einmal durchatmen.
Mit Illustrationen von Inga Israel.
Der zweite Text in unserer Serie: Ein Ort.
Sarah Khan
Wochenendhaus
Ein Ort
ein mikrotext
Erstellt mit Booktype
Cover und Illustrationen: Inga Israel
Covertypo: PTL Attention, Viktor Nübel
www.mikrotext.de – [email protected]
ISBN 978-3-944543-78-9
© mikrotext 2019, Berlin
Wochenendhaus
Inhalt
Impressum
Titelseite
Rausfahren
Wie ein Wochenendhaus ins eigene Leben tritt
Kleines Herz, Tiny House
Das Schöne in der Nähe
Das Problem der Sonntagsruhe
Meine Dienstleister
Ansprüche
Bromberta
Winterschlaf
Über die Autorin
Der Horrorpilz von Sarah Khan (Lesetipp)
Bahnhof: Ein Ort (Lesetipp)
Katalog
Sarah Khan
Wochenendhaus
Ein Ort
Rausfahren
Tausendundeine Tüte und viele Taschen warten darauf, dass es losgeht, aber vorher stopfen wir noch mehr rein. Oh Mann, die Butter, fast vergessen, was nicht sein darf, unter keinen Umständen, sonst machen die elenden Aufbackbrötchen morgen überhaupt keinen Spaß, noch mal der Kühlschrank auf, das gute Streichfett raus, in die Tupperdose damit, Kältepad dazu, ab in die Tüte, zu den Zeitungen, Magazinen und Büchern, zu dem Whisky, dem Klopapier, den neuen Reithosen. Jeder nimmt sich zwei, drei Taschen und läuft hektisch die Treppen runter, als würde einer unten mit der Stoppuhr stehen. Dann hält jemand mitten im Lauf, lässt alles sinken. „Ich hab noch was vergessen!“ Läuft wieder hoch, schließt die Tür auf, Beschimpfungen gellen durchs Treppenhaus, „immer verzögerst du ...!“, durch die Wohnung geflitzt, den Gegenstand gepackt, eine Sonnenbrille, einen Schal, das Ladegerät. Letzte Lichter ausgeschaltet. Endlich steht man auf der Straße, zwei Stunden später als geplant, trotzdem glorreich, noch ist Vormittag. Alles in den Kofferraum, nur die Wasserflasche, Äpfel und Kekse kommen nach vorne. Wrumm wrumm, los geht’s. Die erste Kreuzung, Blick auf die Nachbarschaft, wie die ihrer Wege geht, zum Bäcker, zum Kinderspielplatz, zum Einkaufen. Die Verlorenheit der Touristen, auf der Suche nach einem Frühstückscafé, bloß weg hier, am Wochenende gehören wir nicht dazu, am Wochenende gehören wir aufs Land. Bis zur Autobahn führen wir Verhandlungen darüber, welche Radiosender oder Podcasts wir hören. Vorbei am Einkaufszentrum, an neuen Wohnblöcken, am Krankenhaus und am Park, am Tennisclub, an Kentucky Fried Chicken und McDonald’s. Hinter dem Hüpfburg-Park kommt die Abfahrt. Vorher noch auf die Jet-Tankstelle, Benzin, Kaffee und für die jüngere Besatzung Croissants oder Eis. Die Frontscheibe nass wischen, den Luftdruck prüfen. Vor jeder Zapfsäule ein ähnlicher Anblick. Kaum sind wir auf der Autobahn, liegt gleich links die Start- und Landebahn vom Flughafen Tegel, und jedes Mal sind die Plane-Spotter eine Bemerkung wert, weil es ein Mysterium bleibt, wie sie zu ihrem Glück nur einen Blick auf die Flugzeuge brauchen. Hinter dem letzten Tunnel erreichen wir endlich die Stadtgrenze und die Geschwindigkeit kann leicht gesteigert werden. Sand säumt die Autobahn, Kiefern und Birken. Auf frisch gerodetem Gelände warten Betonröhren auf ihre unterirdische Verlegung, Schilder kündigen von Umleitungen ab nächstem Monat. Das Tempo wird vor den Brückenpfeilern gedrosselt, da stehen die Blitzer. Vorbei an weiteren Röhren, Kiefern, Birken. Dann das Spargelfeld, zwei Monate im Jahr zwingt es dazu, an der Verkaufsbude zu halten und zu entscheiden, ob neben Spargel auch Spargelschäler, neue Kartoffeln, Erdbeeren, Erdbeerwein und Sauce Hollandaise aus dem Tetra Pak gekauft werden will. Nehmen wir die dicken, geraden Stangen oder die krummen, die im Angebot sind? Dazu eine Tüte Bruch für die Suppe. Kofferraum auf, Kofferraum zu. Gespräche darüber, wer den Spargel wie zubereiten wird. Nach neuester Methode, in Alufolie gewickelt und im Ofen geschmort, gart er im eigenem Saft. Wer kocht, kann nicht den Rasen mähen, wer das Holz abbrennt, kann nicht den Gartentisch reparieren. Das Wochenende ist immer zu kurz, um nicht schon verplant zu sein. Überlegungen, wer aus dem Kreis der anderen Wochenendler zum Essen eingeladen wird. Ob die Kartoffeln reichen? Besser bei der nächsten Spargelbude nochmal halten. Bis zur Abfahrt gehen SMS raus: „Seid ihr draußen? Wollt ihr zum Spargel kommen?“ Minuten später die Antworten: „Sollen wir Wein mitbringen?“ oder „Wir sind in der Stadt, Tochter spielt Flötenkonzert im Nilpferdhaus“. In spargelfreier Zeit rast das Auto am Acker vorbei, und das ausgewachsene Spargelkraut oder die hektarweit aufgebrachte Thermofolie wird stumm zur Kenntnis genommen. Sind noch genug Vorräte im Haus, gibt’s noch Wein und Bier, müssen wir beim Aldi halten oder reicht es uns, zum Hofladen zu fahren und Koteletts vom Wollschwein zu kaufen? Hinter der Abfahrt kommen die Ortschaften, in denen LKW-Fahrer leben, die die Trucks um ihre Einfamilienhäuser parken. Wir fahren durch menschenleere Straßen, in denen sich die Blitzer hinter Türmchen verbergen. Passieren Gewerbegebiete, Zugschranken, eingefallene Brauereien und werden über Kreisverkehre auf weitere Straßenverläufe gelenkt, an Automaten-Tankstellen vorbei. Plakate verkünden Ü-40-Discos, Schützenvereinsfeste, Bürgermeisterwahlen. Zwischen den Ortschaften: Felder und vergammelte Kasernen. Dann die Dörfer mit den gepflegten Vorgärten, Forsythien mit Osterschmuck, Tische mit Eiern und Honig, die „Kasse des Vertrauens“ für das Wechselgeld. Milane kreisen über einem Feld, Störche staksen durch feuchte Wiesen. Falken, Ringeltauben. Am Kreuz für Ingo und Bianca ein frischer Blumenstrauß. Ein neongelber Fahrradfahrer verlangsamt auf der Landstraße und winkt, wir sollen vorbei. Ist der lebensmüde, warum nimmt der nicht den Radweg daneben? In der Ferne trabt ein Reiter im Westernsattel. Ein Autofahrer mit einheimischem Nummernschild grüßt.
„War das Eberhard?“
„Hat der ein neues Auto?“
„Der hatte doch immer ein rotes.“
Die polnischen Arbeiterinnen, die aus der Pilzfabrik kommen und bis zu ihrer Unterkunft zwei Kilometer laufen müssen, tragen weiße Hauben aus Vlies, die oft fortwehen und in den Sträuchern der Umgebung hängenbleiben. Überall Häubchen in der Landschaft. Die Frauen warten, bis wir vorbeigefahren sind, sie haben müde Gesichter und telefonieren. Das Geräusch einer Landmaschine wird lauter, frischer Astbruch liegt im Graben. Die Wolken verflüchtigen sich, in der letzten Kurve der Walnussbaum, dahinter die Weide mit den Mini-Shettys. Das ist keine irische Band, das sind ganz kleine Ponys, eins davon heißt Adolf, das soll witzig sein. Vorbei am Storchennest, am Friedhof, an den zugezogenen Gardinen und blattfrei gekehrten Zuwegen. Es geht auf die letzten Meter, dann haben wir das Ziel erreicht.
Wie ein Wochenendhaus ins eigene Leben tritt
Freitag bis Sonntag sind wir draußen. „Im Häuschen“, sagen wir, dabei ist das Haus nicht klein, aber wir sind von kleinbürgerlicher Herkunft und kennen es von der Elterngeneration, die fuhr „ins Häuschen“ oder „aufs Grundstück“. Das Wort „Wochenendhaus“ klingt ein bisschen geschwollen für meine Ohren, auch wenn es wohl das treffendere ist. Niemals sagen wir: Wir fahren ins Dorf. Und für den Begriff „Landhaus“ fehlt uns die katalogmäßige Innenausstattung im gehobenen Countryhouse-Stil. Wir, das sind zwei miteinander verheiratete Erwachsene und zwei Kinder im Teenageralter. Meine Familie möchte in diesem Buch nicht vorkommen, jedenfalls nicht wiedererkennbar, mit ihren individuellen Eigenschaften. Ich kann sie aber nicht ganz weglassen, denn ich fahre selten allein raus, zumal ich selbst nicht Auto fahre, weil ich Angst davor habe, zu nervös dafür bin. Vor 19 Jahren hatte ich mit einem Mietwagen beim Einparken einen kleinen Unfall, seitdem bin ich nicht mehr gefahren.
Das Haus ist etwa hundert Jahre alt und besitzt auf der Gartenseite einen Kopfsteinsockel. Es hat fünf Zimmer, ein Kaltdach mit Biberschwanzziegeln, Kachelöfen und einen hohen Sanierungsbedarf. Es war bis in die 1970er Jahre eine Dorfschule, auf dem Gebiet der DDR gelegen. Das größte Zimmer war der Klassenraum für eine altersgemischte Klasse, die anderen Zimmer bewohnte die Lehrerfamilie mit ihren sechs Kindern. Bei der Besichtigung sah man noch die Umrisse der Tafel an der Tapete und der Fußboden verriet, wo der Lehrerschreibtisch gestanden hatte. Im ersten Stock gab es eine kleine Räucherkammer am Schornstein, darin hatten sie die Schinken der Schweine geräuchert, die im Garten aufgezogen wurden. Die Schweinekoben standen noch und innen lagen vergilbte Behälter mit Resten von Holzschutzmitteln, die später, als wir uns darum kümmerten, kein Recyclinghof abnehmen mochte. Zwei Plumpsklos, aus Ziegelstein gemauert, standen mitten im Garten, das eine war für die Schüler, das andere für den Lehrer und seine Frau. Sie stehen heute noch da, ich habe die Türen noch nie geöffnet, ich stelle meine Harke gelegentlich daran ab. Man könnte die Plumpsklos zusammenlegen und eine Sauna einbauen, aber dann müsste man die Tür öffnen. Zur Schule gehörte eine Scheune, die als Schülerwaschraum diente und dessen Zwischendecke nun halb eingefallen ist, Stroh quillt hervor. Manchmal weht ein Sturm Ziegel von der Scheune und der Riss in ihrer Mauer wird größer, sie sackt ab. Immer wenn ich das bemerke und mir wieder Sorgen mache, dann schreibe ich eine E-Mail an den Baugutachter, der in der nächsten Kreisstadt wohnt und mit dem wir uns eigentlich einig gewesen sind. Ich frage ihn, wann er endlich seinen Kostenvoranschlag zuschickt. Er antwortet nie.
Das Haus befindet sich in ländlicher Lage, neunzig Kilometer von Berlin entfernt, im westlichen Brandenburg, das sich verwirrender Weise Ostprignitz nennt. Wenn ich vom Häuschen spreche, fällt mir auf, dass das Thema Reaktionen hervorruft, als würde es Schwachstrom leiten, von meinem Mund direkt in die Mimik der Mitmenschen hinein, die bekommen ganz feine Zuckungen im Gesicht, wenn ich sage: „Ich kann leider nicht zu deiner Ausstellung kommen, ich muss den Garten mähen. Das Gras ist schon so hoch.“ Geste zu den Knien.
Oder ich sage: „Ich würde euch gerne wiedersehen, aber das Häuschen ruft, lass uns unter der Woche treffen.“
Schön sagt sich auch: „Samstag bin ich draußen, das brauche ich einfach, sonst funktioniere ich den Rest der Woche nicht, und die Tochter will an einem Wanderritt teilnehmen.“
Klingt das angeberisch? Ich sage nur, dass ich am Wochenende keine Zeit habe, weil ich mich um einen ziemlich großen Garten kümmern muss, und dass es Freizeitreiter in der Familie gibt. Man sollte sich meine Situation da draußen aber nicht besonders malerisch vorstellen. Es ist anders. Es ist so, dass Sie, wenn Sie mit rauskämen, als erstes „Oh!“ sagen würden. Wie es darüber hinaus ist, beschreibe ich später noch.





























