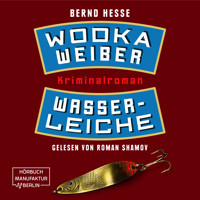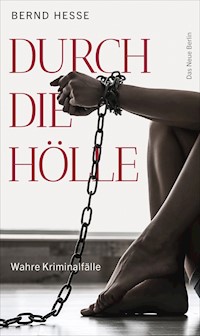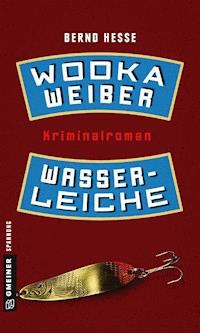
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Privatdetektiv Sven Rübel
- Sprache: Deutsch
Oderbruch. Der deutsch-polnische Privatdetektiv Sven Rübel hat Beziehungsstress: Seine Freundin Eileen möchte - unverständlicherweise, wie er findet - seine Mutter kennenlernen. Zudem macht ihm sein neuer Partner, der Ex-Polizist Frank Fechner, mit seiner Überkorrektheit das Leben schwer. Als ein Angler eine Frauenleiche aus der Oder fischt, eine Prostituierte verschwindet und ein scheinbar unbescholtener Bürger misshandelt wird, muss Rübel, trotz zwischenmenschlicher Turbulenzen, alles geben, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Hesse
Wodka, Weiber, Wasserleiche
Privatdetektiv Rübels zweiter Fall
Zum Buch
Stille Wasser Oderbruch. Der Privatdetektiv Sven Rübel hat Beziehungsstress: Seine Freundin Eileen möchte – unverständlicherweise, wie er findet – seine polnische Mutter kennenlernen. Zudem macht ihm sein neuer Geschäftspartner, der Ex-Polizist Frank Fechner, mit seiner Überkorrektheit und seinen hohen Ansprüchen das Leben schwer. Unterdessen ereignet sich Mysteriöses: Einbrecher stoßen in einer stattlichen Villa auf einen Folterkeller, ein Angler fischt eine tote Frau aus der Oder, eine Prostituierte verschwindet, und der Hund eines Rentners entdeckt einen scheinbar unbescholtenen Bürger halbtot geprügelt und mit einer Stichverletzung, vor dessen eigenem Haus, am Boden liegend. Rübel muss, trotz zwischenmenschlicher Turbulenzen, alles geben, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen.
Bernd Hesse wurde 1962 in Bad Saarow geboren. Er ist Kulturwissenschaftler und Jurist, hat zweimal promoviert, ohne zu plagiieren – so jedenfalls die Eigenauskunft des Autors. Als Strafverteidiger taucht er von Zeit zu Zeit tief in die Abgründe der organisierten Kriminalität ab, kehrt aber abends ganz bürgerlich zu seiner Ehefrau und mittlerweile vier Kindern zurück. Allesamt glücklich. Ebenfalls Eigenauskunft des Autors.
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Rubel, Rotlicht und Raketenwerfer (2018)
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2018 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2018
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © tka4/Fotolia.com
ISBN 978-3-8392-5866-8
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Inhalt
Zum Buch
Impressum
Haftungsausschluss
Inhalt
1. Kapitel: Blutige Oder
2. Kapitel: Krimi-Dinner in Slubice
3. Kapitel: Die Bestie in der Bank
4. Kapitel: »Wir überfallen eine Bank!«
5. Kapitel: Das unheimliche Haus
6. Kapitel: Die drei Todsünden
7. Kapitel: Hanna ist ganz anders
8. Kapitel: Der Untote
9. Kapitel: Eine Universität für alle Fälle
10. Kapitel: »Nägel mit Köpfen«
11. Kapitel: Wasser ist zum Waschen da …
12. Kapitel: Die letzte Hoffnung
13. Kapitel: Hanna ist wieder da
14. Kapitel: Autokorso gegen Klimakatastrophe
15. Kapitel: In der Höhle des Löwen
16. Kapitel: Blaubart
17. Kapitel: Großes Kino
18. Kapitel: Ein rabenschwarzes Schaf
19. Kapitel: Hanna ist wieder weg
20. Kapitel: Mörder lassen sich keine Zeit
21. Kapitel: Der Überfall
22. Kapitel: Licht am Ende des Tunnels
23. Kapitel: Smokers die younger
Lesen Sie weiter …
Lieblingsplätze aus der Region
1. Kapitel: Blutige Oder
Eileen stand vor dem Spiegel. »Na, wie sehe ich aus?«
»Klasse!«, antwortete ich ehrlich. »Sexy Po und schöner Busen.«
»Typisch Mann! Wie sehen die Klamotten aus? Hose in Mint und Oberteil in Rosa.«
Das hatte ich nun von meiner Ehrlichkeit.
Sie griff in den Schrank und zog ein hübsches Sommerkleid hervor, das grausilbern gehalten und mit einer Art schwarzem Muster versehen war, das mich an Blätterformen in geschmiedeten schwarzen Zäunen uralter Villen erinnerte. Das durfte ich aber so nicht sagen, weil das zu unromantisch geklungen hätte. »Das könnte ich anziehen, wenn du mich endlich mal deiner Mutter vorstellst.« Sie hängte das Kleid wieder in den Schrank. »Und?«, forderte sie immer noch ein Lob für ihre Bekleidung.
Ganz abweichen wollte ich von meiner ursprünglichen Auffassung nicht. »Ein supersexy Po in Mint und ein atemberaubender Busen in Rosa.« Ich hatte das für witzig gehalten, wurde aber umgehend eines Besseren belehrt.
Gereizt erwiderte sie: »Die Farben! Passen die so?«
Entweder waren wir an einen Punkt in unserer Beziehung gelangt, an dem alles gegen mich gewendet wurde, ganz egal, was ich sagte, oder Eileen war an diesem Tag nur besonders zickig.
»Das sieht frisch und lebendig aus.« Dann zeigte ich in Richtung Schrank. »Das da kannst du …« Ich verkniff es mir zu sagen »… zu einer Beerdigung« und beendete den Satz mit: »… zu einem traurigen Anlass tragen.« Sofort dachte ich an einen Besuch bei meiner Mutter und kam zu dem Ergebnis, dass es durchaus das richtige Kleid sein könnte.
»Entweder du bekennst dich zu mir und stellst mich deiner Mutter vor oder wir machen an diesem Punkt hier Schluss.« Eileen funkelte mich mit ihren Augen an.
Sie hatte den Nagel auch auf den Kopf getroffen: Ich wollte meiner Mutter nicht jede Freundin vorstellen und mir Sprüche über Hochzeit und Enkelkinder anhören müssen. Eileen hatte in den letzten Wochen erst zarte Andeutungen und dann schon recht deutliche Vorwürfe hören lassen. Meine polnische Mutter würde in ähnlicher Weise erst subtil Zweifel formulieren, ob sie wirklich die richtige Frau für mich wäre, um dann zu fragen, warum ich mir denn kein ordentliches polnisches Mädchen suchte, wie es mein deutscher Vater getan hatte. Dabei verschwieg sie geflissentlich, dass die Beziehung nicht allzu lange Bestand gehabt hatte und bald nach meiner Geburt jeder wieder sein Ufer der Oder für sich als Heimat auserkoren hatte. Mein Bruder war immer bei unserer Mutter geblieben; ich dagegen hatte viele Jahre auch bei meinem Vater in Frankfurt (Oder) gelebt, bevor mich beide auf das deutsch-polnische Internat nach Neuzelle abschoben und ich danach mein Glück in der polnischen Armee suchte; jeder begeht eben so seine Jugendsünden. Ich hatte danach Deutschland nicht für mich als Heimat gewählt, um nun mit einer Tochter der Freundinnen meiner Mutter verkuppelt zu werden. Es reichte mir schon, dass ich in einer schwachen Stunde eine deutsche Freundin meiner Mutter in meiner Detektei angestellt hatte. Eine gemeinsame Basis für die Freundschaft dieser so sehr unterschiedlichen Frauen hat sich mir nie erschlossen. Wären es Männer, würde man sagen, sie hätten eine gemeinsame Leiche im Keller. Ich versuchte hier nun die Situation ein wenig zu entspannen und reagierte gegenüber Eileen ganz cool. »Du siehst wunderbar aus, wenn du dich so aufregst.«
»Hör bloß auf mit solchen Macho-Sprüchen«, wurde sie noch lauter.
»Frauen mögen so was doch.«
»Keine Frau der Welt mag allgemein solchen Unsinn, sondern nur, wenn sie es mögen will.«
»Gibst du mir Bescheid, wenn du so etwas wieder magst?«
»Da gibt’s nichts zu sagen, das musst du spüren.« Sie musterte mich. »Hast du eine andere?«
»Und das ist die Frage, die eine Frau nicht stellen sollte. Wenn es nicht so ist, macht sie keinen Sinn, und wenn es so ist, dann sagt ein Mann das doch erst, wenn sozusagen die Koffer schon gepackt sind.«
»Das ist feige«, erklärte sie in vollem Ernst. »Ihr Männer seid einfach feige. Außerdem spüren wir Frauen ganz genau, wenn da was nicht stimmt.«
»Dann brauchst du ja auch nicht zu fragen.«
»Mein lieber Sven, so eine Trennung beginnt doch schon viel früher, nämlich im Kopf.«
Ich dachte, es besser zu wissen: »Ein gutes Stück tiefer.«
»Denkt ihr, soweit ihr denken könnt. Aber auch das«, sie schaute auf den oberen Teil meiner Hose und ließ sodann die Augen in Richtung meiner Stirn wandern, während sie fortfuhr: »wird von da gesteuert.«
»Du bist heute aber wieder zickig drauf«, stellte ich lapidar fest. »Hast du im Sekretariat wieder mit deinem Herrn Dorint Ärger gehabt?«
»Ich bin nicht zickig. Ich bin nur emotional flexibel. Und bei der Arbeit ist alles in Ordnung.« Sie schaute mich prüfend an und ergänzte: »Du bist ein Krebs. Die sind eigentlich treu.«
Irgendwie war ich trotz des Sternzeichenquarks erleichtert. »Dann ist ja gut.« Ich dachte bei mir: »Toll, ist man Krebs, glaubt die Frau, dass man nicht fremdginge. Da habe ich mit meinem Sternzeichen ja Glück.«
Eileen stellte klar: »Bin ja auch Krebs.«
Das wurde mir jetzt zu blöd. Warum stehen so viele Frauen bloß auf diesen esoterischen Sternzeichenunsinn? Ich dachte, nun mitreden zu können, und erlaubte mir die Bemerkung: »Das ist ja gut. Dann gehst du auch nicht fremd.«
»Ich bin aber eine Tigerfrau. Du bist Ratte. Und wenn dein Ding mit dir durchgeht, sei nur vorsichtig: Tiger frisst Ratte.«
Aha! So war das also. Gehörte es wirklich zu einer intakten Beziehung, sich diesen ganzen Scheiß anzuhören und dazu gute Miene zu machen? Auch in der Detektei lagen zu Dutzenden Yvonnes Frauenzeitschriften mit Horoskopen und untrüglichen Tipps für Glück, Gesundheit und Gemütlichkeit, wodurch sie die Einnahme von Antidepressiva jedoch nicht wesentlich senken konnte.
Ich empfand es als Glück, mein Smartphone läuten zu hören. Ein Blick auf das Display zeigte mir, dass es Tobias war.
»Wenn du da jetzt rangehst …«, drohte sie.
»Ich stecke mitten in laufenden Ermittlungen«, log ich. »Wenn sich da was Neues ergibt, muss ich ran.«
»Davon weiß ich doch nichts.«
»Nicht alles, was du nicht weißt, gibt es nicht.«
Ich nahm das Gespräch an. Tobias lud mich in einem so lauten Tonfall zum Angeln ein, dass es auch Eileen nicht überhören konnte. »Zwei Männer, zwei Angeln und zwei Bier, was kann es Schöneres geben? Außer natürlich … vier Bier.«
Eileens Augen warfen Blitze.
Unter völliger Anstrengung meines Geistes konnte ich noch eins draufsetzen: »Sechs Bier.«
»Also gebongt, Alter?«, missverstand Tobias mich.
Eileen ging zum Schrank, holte ihre Tasche heraus und begann demonstrativ zu packen.
»Nein! Geht nicht … Zurzeit ist es schlecht«, stammelte ich.
»Verstehe! Stehst ganz schön unterm Pantoffel, Alter.«
»Nein, so ist es nicht.«
Eileen packte weiter.
Tobias lachte. »Musst dich mal hören … Aufs Scheißhaus darfste aber noch ohne Erlaubnis, oda?«
»Das ist jetzt ein ganz schlechter Zeitpunkt«, versuchte ich zu erklären.
»Armer Kerl! Ej, Sven, diese Braut hat dir die Eier geklaut …« Dann lachte er laut auf. »Das reimt sich ja: Die Braut hat dir die Eier geklaut.«
Das Gespräch mit Tobias und die Beziehung mit Eileen neigten sich dem Ende entgegen. Mit Tobias könnte ich auch später noch reden. Wir würden noch oft zusammen an der Oder stehen, Fische herausholen und unseren Spaß haben. Für Eileen beendete ich das Gespräch nicht schnell genug. Sie packte eifrig weiter.
Nun war ich es, der auf stur stellte. Sie konnte mich doch nicht zwingen, das Gespräch mit meinem Freund abzuwürgen und einen Kniefall zu machen. So weit kommt’s noch! Oder sah ich das alles falsch?
Das mit Eileen sah aus, als ob ich es wieder einmal gründlich vermasselt hätte. Gingen zurzeit alle Beziehungen den Bach runter? Mein künftiger Partner in der Detektei, der Expolizist Frank Fechner, hatte auch schon verdächtig lange nicht mehr von seiner Freundin erzählt. Seltsam. Als die beiden um ihre Beziehung kämpfen und sie vor seinen damaligen Vorgesetzten geheim halten mussten, waren sie unzertrennlich und standen zueinander. Jetzt, wo sie miteinander leben konnten, ohne dass jemand Anstoß daran nehmen konnte, da schien es in der Beziehung zu kriseln.
Eileen schmiss die Tür hinter sich zu.
Wieder einmal hatte ich den Eindruck, vor dem Scherbenhaufen meines Lebens zu stehen.
Sein Gegner würde heute keine Chance haben. Diesmal würde er ihm nicht entkommen; das war sicher. Keiner seiner Bekannten, die von der Niederlage wussten, die ihm dieser Brocken zugefügt hatte, sollte sich länger lustig über ihn machen können. Er hatte seinen Gegner genau studiert, kannte dessen Verhaltensweisen, Aufenthaltsorte und Vorsicht. Tobias wusste, dass es kein leichter Job werden würde. Aber welcher Job war das in letzter Konsequenz schon?
Selbst wenn er mit dem Puffbus die deutschen Freier in eines der Freudenhäuser ins polnische Słubice fuhr, war das kein einfacher Job: Die Taxifahrer waren sauer über die entgangenen Fahrten und drohten ihm immer wieder, die Reifen seines Kleinbusses zu zerstechen, die Behörden kontrollierten immer wieder seine Papiere, weil sie stolz darauf waren, dass nach dem Brand im letzten Puff kein solches Etablissement mehr auf der deutschen Seite der Oder eröffnet hatte und sie zusehen mussten, wie sich die deutsche Kundschaft Befriedigung in Polen holte, und die religiösen Spinner mit schwarzem Anzug und Krawatte, die wollten ihn zur Abkehr seines verwerflichen Tuns bekehren. Noch schlimmer war da nur noch die Konkurrenz vom Straßenstrich. Die hatten ihn erst letzte Woche zusammenschlagen wollen. Tobias selbst konnte sich schon immer gut zur Wehr setzen und hatte es selbst im polnischen Knast geschafft, sich zu behaupten. Als diese rumänischen Typen in den ersten Morgenstunden aufgetaucht waren, hatte er gerade Gerry, einen alten Knastkumpel, im Bus sitzen, der die ganze Zeit mit seinem Schlagring in der Hosentasche spielte und nur nach einer Gelegenheit suchte, ihn wieder zu gebrauchen. Gerry hatte wie meist Hammer im Schlepptau, einen abgehalfterten Boxer, dessen eigentlicher Gegner nur noch der Alkohol war. Seinen Spitznamen hatte er dennoch nicht umsonst. Als sie mit diesen Typen fertig waren, hatten sie sie über das Geländer der Oderbrücke geschmissen. Es hatte an den Folgetagen über den Vorfall weder etwas in den deutschen noch in den polnischen Gazetten gestanden. Dann hatte es wenigstens keine Zeugen gegeben und die Ersatzspieler der Konkurrenz mussten es irgendwie an Land geschafft haben. Mal schauen, wann sie ihre erste Mannschaft vorbeischicken würden.
Aber das hier würde er allein zu Ende bringen. Tobias warf die Angel weit aus; schnell verlor er den Köder aus den Augen. Die Rolle an der Angel surrte und der Haken mit den vielen sich windenden Tauwürmern flog und flog. Als der Köder in die Oder eintauchte, wusste er, dass dieser an der richtigen Stelle gelandet war. Dort musste er schwimmen. Diesmal würde er ihm auch nicht entkommen. Extrastarke Rolle, extrastarke Schnur und eine Angel, die so elastisch war, dass er sie von der Spitze bis zum Griff biegen konnte, ohne dass sie Schaden nahm. Das Edelstahlvorfach verband den riesigen Haken mit der Schnur; da würde sich kein anderer Fisch ranmachen. Der Köder sank auf den Grund des Flusses und würde den Räuber anlocken.
Dass Tobias genau hier und jetzt angelte, hatte noch einen weiteren Grund: Gerry war heute ohne Hammer auf Tour. Der wollte heute mit einem jüngeren Typen, den Tobias gelegentlich bei einem Bierchen gesehen hatte und von dem erzählt wurde, dass er mit kleineren Einbrüchen seinen Hartz-IV-Satz aufstockte, einen Bruch machen. Das Angeln in der Öffentlichkeit bot ihm ein gelungenes Alibi. Die Polizei war bei solchen Einbrüchen recht einfallslos und ermittelte, wenn die Sache überhaupt eine entsprechende Bedeutung hatte, schnell gegen ihn und andere Bekannte, die wegen ihrer einschlägigen Vorkenntnisse in die engere Auswahl der Verdächtigen kamen, wenn sie nicht von vornherein von einer Tat ausgehen musste, die ihren Ausgang auf der anderen Seite der Oder genommen haben musste. Wenn er hier dann noch den Wels rausholte, würde es sogar Fotos mit Datum von ihm geben, die ihn hier an der Oder zeigten.
Er stand mit seiner Angel hinter dem weißen Ärztehaus an der Uferstraße, nur wenige Minuten vom Stadtzentrum entfernt. Dicht daneben das Kleist-Museum. Hatte der auch was über Fische geschrieben? Nicht, dass er sich erinnern konnte. Wie viele Frankfurter Schüler hatte auch er während der Schulzeit immer wieder Bücher von Kleist lesen sollen. Wie viele seiner Mitschüler hatte er die Bücher nicht gelesen. Hätten nicht Rowling oder Stephen King in Frankfurt (Oder) geboren sein können? Nein, es musste unbedingt Kleist sein. Im Knast hatte Tobias dann doch einige von Kleists Büchern gelesen, sich bei der Lektüre des zerbrochenen Krugs über den Dorfrichter ausgeschüttet, in einer Geschichte über ein Kloster oder so Mitleid mit den Nonnen empfunden und seinem Zellenkumpel die Stelle in einem anderen Buch vorgelesen, in der der Kopf eines Kindes an einer Säule zerschmettert worden war; danach hatte man im Knast Verständnis für seine Lektüre gezeigt, war das doch so etwas wie Horror. Nun war Tobias schon wieder einige Zeit in Freiheit und angelte lieber, als dass er las. Hier am Ufer des Grenzflusses kamen viele Passanten vorbei, um an den heißen Tagen die frische Luft zu genießen, die der Strom mit sich zog.
»Und, beißen sie?«, erkundigte sich ein älterer Passant.
»Noch nicht.«
»Auf was gehst du?«
»Wels!«, antwortete Tobias zuversichtlich.
»So ’n Riesenteil?«
»Habe neulich einen mit über zwei Metern drangehabt.« Stolz zeigte Tobias seine frische Narbe am Daumen. »Das war ein Zahn. Im letzten Moment ist der dann aber wieder rein ins Wasser. Sind schwer zu halten, diese Riesenbiester.«
»Ist das nicht zu früh für ’nen Wels?«
»Andere schwör’n auf die Nachtstunden. Den neulich hatte ich aber auch am späten Vormittag am Haken.«
»Dann wünsche ich noch Petri Heil!« Der Alte drehte sich zum Gehen.
»Petri Dank!«
Plötzlich ruckte es an der Angel. Der Alte blickte sich um und blieb stehen. Zunächst glaubte Tobias, dass sich der Haken irgendwo an einem Stein auf dem Grund, einer Wurzel oder sonst etwas verhakt hatte. Dann war er sich sicher, dass er den großen Brocken am Haken hatte. Der Wels zog mächtig. Ihm kam die starke Strömung der Oder zugute. Seine Beute zog und zog. Das war für einen solchen Mordsfisch nicht ungewöhnlich, aber er ruckte nicht, sondern zog kontinuierlich, was schon etwas befremdlich war. Er erinnerte sich an einen Wels, den er vor drei, vier Jahren gefangen hatte. Da war er sich vorgekommen wie der alte Mann bei Hemingway. Jener Wels hatte sich auch einfach auf den Boden der Oder sinken lassen. Damals war die Situation sehr ähnlich gewesen. Immer mehr Passanten hatten sich zu Tobias gesellt und seinen Kampf beobachtet. Jetzt hieß es kühlen Kopf zu bewahren und ihn immer etwas mehr an Land zu ziehen, als dieser Brocken Gegenwehr leistete. Er kurbelte die Rolle bis zu sechs Mal, während er sie dann mit festgestellter Bremse drei Runden laufen ließ. Es war, als ob der da draußen sich auf dem Grund der Oder von der Strömung mitreißen ließ und sich darüber lustig machte, wie sehr sich Tobias abmühte. Wenn der Angler die Rute hob, bog sich diese, als ob sie brechen wollte. Tobias hatte nicht den Eindruck, dass er seinen Fang müde machte; es schien ihm, als ob es eher umgekehrt der Fall wäre. Hauptsache, das Material hielt diesen Kampf aus. Als er wieder kurbelte, kam langsam etwas an die Wasseroberfläche.
»Da«, rief einer der Zuschauer begeistert und hob sein Handy, um zu fotografieren.
Die anderen Beobachter traten näher heran. Als Tobias die Kurbel losließ, tauchte seine Beute wieder ab und ließ die Kurbel mit Macht trotz der festgestellten Bremse in die andere Richtung drehen. Dem Angler wurde seltsam zumute. Der Fang verhielt sich anders als alles, was er bisher an der Angel gehabt hatte.
»Sieht aus, als ob’s ein alter Seesack wäre«, warf ein anderer Passant seine Meinung in die Runde, als Tobias die Angel weiter einholte.
Tobias’ Hoffnung, nicht für einen zeitgleich stattfindenden Bruch belangt werden zu können, erfüllte sich. Während er noch die unansehnliche, aufgedunsene Wasserleiche mit an den Füßen angebundenen Betonhohlsteinen landete, rief schon einer der Anwesenden die Polizei. Die Schnur, die die Füße der Wasserleiche mit den Betonsteinen verband, sah der speziell geflochtenen und eingefärbten Angelsehne sehr ähnlich, die Tobias verwendete.
Ein jüngerer Passant zog ebenfalls sein Handy aus der Hosentasche, jedoch nicht, um zu telefonieren; er hielt das Gerät hoch, zoomte die Wasserleiche heran und fotografierte wild drauflos. Ein junges Mädchen wurde aufgrund der sich ausbreitenden Unruhe auf die Gruppe aufmerksam und eilte zu den zuschauenden Passanten. Als sie die Situation erfasste, zog sie ihr Smartphone etwas verstohlener aus der Tasche als der jüngere Mann, der immer noch wild drauflos fotografierte. Das Gerät in Brusthöhe haltend, schoss sie ebenfalls Fotos der Wasserleiche und des Anglers.
»So ’ne Scheiße«, regte sich der Tätowierte auf, als er sich den rechten Unterarm an den Resten des Glases der gerade zerborstenen Terrassentür schnitt. »Muss denn heute alles schiefgehen?« Gerry, der sich immer dann, wenn er im Knast war, tätowieren ließ, war über und über mit bläulich schimmernden Bildchen versehen. Später kamen im Gesicht und anderen Körperregionen Tätowierungen hinzu, die die Handschrift eines professionellen Studios trugen. Er hatte in der Nähe von Eisenhüttenstadt einen wahren Künstler aufgetan, zu dem Kunden aus halb Europa anreisten. Für größere Werke, wie sie Gerry vorschwebten, waren Wartezeiten bis zu eineinhalb Jahren einzuplanen. Gerrys Problem war nur, dass er schon wieder mehrmals im Knast gesessen hatte, als endlich sein Termin herangerückt war. Die Tätowiermaschine des Meisters punktierte derweil die Dermis anderer Anhänger seiner Kunst.
Gerry hieß mit bürgerlichem Namen Gerald Radutzke, was aber nicht cool genug klang. Gerry klang wenigstens nach etwas. In seiner Brutalität gegenüber seinen Opfern war Gerry grenzen- und gnadenlos. Sein Markenzeichen war sein Schlagring, ein seltenes Stück, mit Totenköpfen verziert, das er meist bei sich trug, außer wenn er zu Gerichtsverhandlungen, Vernehmungen bei der Polizei oder wieder einmal in den Knast musste. Selbst unter seinen kriminellen Freunden war er wegen seiner Rohheit respektiert und gefürchtet, was ihm gefiel und zu immer noch grausameren Handlungen antrieb.
Maik sagte nichts und ging mit seinem Rucksack über der Schulter durch die Terrassentür. Er hatte auch das eine oder andere Tattoo am Körper; aber so wie Gerry würde er nie herumlaufen wollen. Er fand, dass sich Gerald ziemlich glatt anstellte. Warum hatte der auch die Ärmel der Jeansjacke unbedingt hochkrempeln müssen, als er die Glasscheibe der Terrassentür einschlug? Blöder konnte man kaum zu Werke gehen. Maik hatte sich auf den Bruch vorbereitet und sogar seine Ohrringe abgelegt, damit die bei einer Rangelei nicht hinderlich werden konnten oder er dadurch leichter zu identifizieren wäre. Maik schaute sich sogleich im Wohnzimmer um und registrierte den riesigen Philips-Flat-TV der neuesten Generation. Hier war vielleicht was zu holen. Könnten aber auch Fernsehverrückte hier wohnen, die das letzte Geld für so ein Teil ausgegeben hatten. Auf Gerrys Flüche gegen die Hauseigentümer reagierte Maik nicht; schließlich war es Gerry, der sich so blöd angestellt hatte. Er wusste um Gerrys Brutalität und auch darum, dass Menschen, die gerade körperlichen Schmerz erleiden, anders reagieren als sonst. Auch war Maik sich nicht sicher, ob Gerry so wegen des Schmerzes fluchte oder deshalb, weil der Schnitt eine seiner Tätowierungen verunstaltet hatte. Er lag mit seinen Überlegungen nicht verkehrt. Nachdem Gerry das Blut abgewischt hatte, sah die frische Schnittwunde so aus, als ob jemand versucht hätte, den Drachen, der auf Gerrys rechtem Unterarm gezeichnet war, zu köpfen. Ob das ein Zeichen war, ein Zeichen für Gerrys sinkenden Stern?, überlegte Maik. Das Blut war sicher ein Zeichen, aber eher für die Polizei. So was durfte man heute als mehrfach verurteilter Straftäter nicht mehr am Tatort zurücklassen. Aus ihren Strafakten war beiden bekannt, dass Blutuntersuchungen langwierig waren und überhaupt nicht sicher war, ob diese zum Ziel führten, aber Gerrys DNA befand sich wegen seiner vielen Gewaltstraftaten bereits in der Datenbank. Dann wiederum war seine Identifizierung ein Kinderspiel. Vielleicht hatte Gerry auch nur geflucht, weil er obendrein sauber machen musste. Der hatte seine letzte Wohnung, die er mit einem Platz im Obdachlosenheim in Frankfurt (Oder) getauscht hatte, verkommen lassen und nicht mal für sich selbst geputzt – da hatte der sicher wenig Lust, dies jetzt hier zu tun. Aber wenn das Blut erst einmal nicht mehr zu sehen war, würden die Angehörigen der Sonderkommission »Villa«, wie sie in Brandenburg für die Aufklärung der rapide angestiegenen Zahl der Wohnungs- und Hauseinbrüche genannt wurde, auch nicht zielgerichtet mit Luminoltests nach Blutspuren suchen. Bei dem Anstieg der Einbrüche würde ihr Bruch sicher ebenfalls nicht aufgeklärt werden können, wenn sie sich nicht zu trottelig anstellten. Hier im Oderbruch, so sehr in Grenznähe, nur einige Hundert Meter bis zur Oder, würde sicher jeder annehmen, dass Polen am Werk gewesen seien. Maik und Gerry gingen davon aus, dass sie sich das gut überlegt hatten.
Gerry wollte in die Küche gehen, um nach einem Eimer und einem Lappen zu suchen; vielleicht würde er auch in der Hausapotheke fündig werden und könnte sich ein wenig verarzten.
Maik hörte nur noch einmal ein kräftiges »Scheiße« seines Kumpels, bevor es laut krachte. Maik dachte, dass es mit Gerrys Konversation nie weit her gewesen war, aber das heute war doch mächtig einseitig. Er würde mal hinterhergehen und nachschauen, was dort geschehen war. Er erkannte gleich, dass die Küchentür eingetreten worden war. »Musst du hier gleich den Rambo raushängen lassen?«
»Diese Arschlöcher haben sogar die Küche abgeschlossen.«
Selbst für einen erfahrenen Kleinganoven wie Maik war ein solches Verhalten der Hauseigentümer eher ungewöhnlich. »Vielleicht gibt’s hier was zu holen. Da sollten wir gründlicher nachschauen. Habe ich auch schon mal gehabt«, konnte der Jüngere seine Berufserfahrungen weitergeben, »dass die ihren Familienschmuck in einen als Wurst- und einen anderen als Kaffeedose erscheinenden Behälter gesteckt hatten. Die Dosen sahen von außen wie die Originale aus, sag ich dir.« Was er nicht mitteilte, war der Umstand, dass er den Schmuck nur durch Zufall gefunden hatte, weil er während des Bruchs Hunger bekommen hatte. Gegenüber so einem Altgangster wie Gerry wollte er nicht als Frischling dastehen.
Gerry nahm ein Geschirrtuch und versuchte, es zu zerreißen. Es war aber an den Seiten so gut vernäht, dass das nicht gleich klappte. Dann ergriff er es an der Mitte und das Tuch begann zu knirschen. Durch die Anstrengung tropfte wieder Blut aus der Wunde auf den Boden. Das Tuch gab nach und Gerry versuchte, sich zu verbinden.
»Komm, ich helfe!«, wollte Maik seine Unterstützung anbieten.
»Quatsch! Das bekomme ich hin«, tönte Gerry und versuchte allein, seinen Unterarm zu verbinden, was recht ungeschickt wirkte.
Ohne noch einen Ton zu sagen, ergriff Maik seinen Rucksack, holte Tesafilm heraus, schritt zu Gerry und half diesem bei seinem Verband. Dann konnte er sich eine kritische Bemerkung doch nicht verkneifen. »Hauptsache, die Eigentümer machen sich keinen Kopf darüber, weshalb hier ein Geschirrtuch gestohlen wurde.«
Gerry begriff nicht. »Na und?«
»Dann kann man schnell auf die Idee kommen, dass sich jemand verbunden hat oder Spuren da waren, die jemand wegwischen wollte.«
»Biste jetzt ooch noch Spurenexperte?« Gerry bückte sich tatsächlich und wischte das Blut am Boden breit.
»Man sollte sich schon informieren, wenn man so einen Job hat.« Gegenüber Gerry traute sich Maik nicht einzuräumen, dass er sich zu Blutspurenuntersuchungen erkundigt hatte. Ausgangspunkt war aber nicht sein Job hier gewesen, sondern die amerikanische Krimiserie »Dexter«, in der ein Forensiker ein Serienmörder war. Der lief immer mit einer Sprühflasche herum, deren Lösung auch sehr alte und weggewischte Blutspuren unter UV-Licht leuchtend blau erscheinen ließ. Erst dachte Maik, dass sei alles Fernsehquatsch, musste sich dann aber schnell eines anderen belehren lassen.
»Du und Job«, schnaufte Gerry verächtlich. »Hast doch noch nie gesessen.«
»Spricht sicher mehr für mich als gegen mich, dass sie mich für so ’n Ding noch nie eingebuchtet ham.«
»Da lernste erst die richtigen Leute kennen, sage ich dir.« Gerry zog mit einem Eimer und einem Lappen, der einen ähnlich zerknautschten Eindruck hinterließ wie sein Gesicht, in Richtung Wohnzimmer, während Maik mit der systematischen Suche in der Küche begann.
Maik blickte zur großen Küchenuhr, die fast einer Bahnhofsuhr glich. Passte aber auch irgendwie in dieses große, alte Haus. Das hier sah aus wie eine alte Gesindeküche. Es war gerade zehn Uhr geworden, sie hatten ab jetzt gut über eine Stunde Zeit für ihre Arbeit. Selbst wenn hier ein Kind lebte und bei dem heißen Wetter hitzefrei hätte, müsste es erst mit dem Schulbus hierher nach Neu-Sophienhof fahren und dann zum alten Gutshaus laufen. Maik räumte alle Schränke aus, links beginnend bei der aufgesplitterten Küchentür. Alle Töpfe, Teller und das Geschirr lagen halbwegs geordnet auf dem Boden; es sah aus, als ob jemand seinen Umzug vorbereitete. Silberbesteck verwendeten die hier in der Gegend eher selten, wusste er und selbst wenn solches im Haus vorhanden war, konnte man es meist nicht in der Küche finden. Er schaute in die Schubladen, hob die Einsätze für das Besteck hoch und legte sie wieder zurück. Er bückte sich, kroch in die Schränke, fand nichts und krabbelte wieder heraus.
»Und«, erkundigte sich Gerry, als er mit Eimer und Lappen zurückkehrte, »schon paar Würstchen oder Kaffee gefunden?«
»Nischt.«
»Dann lassen wir das hier mal sein und ziehen weiter«, wollte der Tätowierte den Ton angeben.
Maik spürte, wie Gerry diese Rolle immer mehr für sich beanspruchte. Beide hatten noch nicht oft miteinander zusammengearbeitet. Sie kannten sich von Sauftouren mit gemeinsamen Bekannten. Gerry war bekannt und auf seine Weise geachtet und gefürchtet. Mit Furcht und Angst konnte er gut arbeiten. Häufig hing Gerry mit einem Obdachlosen, einem ehemaligen Boxer, zusammen, den alle »Hammer« nannten. Nach dem, was Maik gehört hatte, hatten die beiden schon einige Brüche miteinander begangen. Nichts Großes, nur schnelle und laute Einbrüche in Büros, Lager und Geschäfte. Häufig hatte es dabei nur ein paar Euro gegeben, die die Angestellten als Wechselgeld vom Pizzalieferanten zurückbekommen und meist in die obere Schublade ihres Schreibtisches gelegt hatten. Maik hingegen hatte die meisten seiner Dinger allein gedreht und nahm nur hin und wieder jemanden mit auf seine Streifzüge. Er hatte die Erfahrung gemacht, dass sich bei solchen Einbrüchen nur zwei sehr entgegengesetzte Vorgehensweisen lohnten. Der schnelle Zugriff, der auch einmal gewagt werden konnte, wenn jemand im Haus oder im Garten war: Dafür war es förderlich, wenn eine Tür, ein Fenster oder eine Terrassentür offen standen, damit er schnell ins Haus rennen konnte und nicht viel Lärm veranstalten musste. Handtaschen, Brieftaschen und Handys wurden meist im Flur gelagert, weshalb der Weg bei solchen Taten meist dahin führte. Was er auf dem Weg dahin so an tragbaren Wertsachen fand, nahm er ebenfalls mit. Bei einem solchen Blitzeinbruch musste er so schnell wie möglich hineingelangen, alles greifen und pfeilschnell wieder hinausrennen und fliehen. Daneben hatte Maik den gründlichen und systematischen Einbruch für sich gefunden, den er meist am späten Vormittag durchführte, wenn die Bewohner alle zur Arbeit und die ersten noch nicht zurückgekehrt waren. Auch Urlaubsreisen und die Abwesenheit bei Fahrten an Feiertagen ließen Häuser vereinsamen. Selbst dabei konnte viel schiefgehen, aber geschenkt bekam man nichts auf der Welt. Wenn man das so machte, dann musste man systematisch bleiben und gründlich durchsuchen und nicht von einem Zimmer ins andere springen. Er fing meist mit dem Schlafzimmer an, weil er da am häufigsten fündig geworden war, dann folgten Wohnzimmer und, soweit es eines gab, Arbeitszimmer. Kinder- und Zimmer von Jugendlichen konnte man sich schenken. Die Kids von heute räumten genauso wenig auf wie weg. Da musste man aufpassen, dass man sich nicht noch die Gräten brach. Bei den Kindern waren bloß billiger Elektronikschrott und nicht zu versilbernder Modeschmuck zu finden, je nach Geschlecht. Offensichtlich trauten die Eltern ihren eigenen Kindern noch weniger als einem ordentlichen Dieb, sonst würden sie in den Zimmern ihrer Sprösslinge ja auch was verstecken. Was Gerry hier abzog, das ging jedenfalls gar nicht. Der hinterließ Spuren wie ein Elefant und arbeitete unsystematisch wie ein Anfänger. Der mochte ja bei seinen Schlägereien einen Namen haben, aber hier war er nicht zu gebrauchen. Es ging nicht an, dass der den Ton angab. Selbst wenn die Situation mit Gerry eskalieren sollte, fühlte Maik sich körperlich ebenbürtig. Also widersprach Maik vorsichtig: »Wir sollten weiter systematisch vorgehen. Nicht hier ein wenig suchen und dort. Die Eigentümer denken bei der Wahl der Verstecke anders als wir.«
Gerry bohrte mit den Augen in Maiks Innerstem. »Hast du nicht selbst gesagt, dass Haustresore woanders zu finden sind? Was machen wir dann in der Küche?« Dann wurde sein Tonfall herausfordernder. »Was soll der Scheiß hier?« Er trat kräftig gegen einen Stapel Töpfe, der sich krachend und Scherben verteilend in der Küche ausbreitete.
»Weil die Situation hier anders ist als sonst. Die Küche war abgeschlossen. Das ganze Haus ist anders, als sonst Häuser sind«, antwortete Maik ruhig und überlegte kurz, wo er die scharfen Messer hingelegt hatte. Die waren wirklich scharf. Das war eine richtige Sammlung. Das war hier auf dem Lande im Oderbruch vielleicht üblich, wenn man selber schlachtete. Tiere hatte er aber nicht gesehen. Bei solchen Messerfetischisten wie hier hatte er schon Überraschungen erlebt. Aber das musste er dem Stümper Gerry nicht erklären. Auf eine offene Auseinandersetzung mit dem Tätowierten wollte Maik es nämlich nicht ankommen lassen. Unabhängig vom Ausgang eines Kampfes würde er zu viele Spuren hinterlassen, und alles würde auf ein Zerwürfnis zwischen den Einbrechern hindeuten; Indizien, die man den Bullen nicht liefern sollte.
»Wer hat denn das alte Haus hier im Oderbruch ausgesucht, hä?«, wollte Gerry Maik weiter provozieren, der aber ruhig blieb.
»Das ist das größte Haus in der Gegend, eines der ganz alten Gutshäuser. Da wohnen keine Armen drinnen«, erklärte Maik.
»Allet Quatsch«, widersprach Gerry, »nach der Wende konnte man so wat für ’n Appel und ’n Ei bekommen. Da waren früher Kindergärten und Heime und so ’n Zeug drinne.«
Maik grinste: »In so ’nem Heim biste groß jeworden, wa?«
»Erzähl kein’ Scheiß.«
»Jedenfalls müssen wir systematisch vorgehen«, beharrte Maik auf seinem Standpunkt. »Wir finden nichts, wenn wir von einem Zimmer ins nächste springen. Ich hab Geld, Münzen und Wertsachen schon an den unglaublichsten Stellen gefunden: in einem Heizkörper, im Hohlraum eines Toilettenbürstenhalters, auch die gute alte Diele ist noch ein Klassiker. Anders, wenn das Ganze versiegelt und lackiert ist. Aber auch dann kann was drunter sein. Das ist dann aber kein Bargeld. Das ist wie mit Geldanlagen: Wo man nicht täglich ranmuss, das kann in Aktien und so ’nem Scheiß angelegt werden. Kohle muss dagegen griffbereit sein.« In diesem Augenblick fiel sein Blick auf die große Küchenuhr. Das Ziffernblatt war dicht am Glas, weshalb das ganze Gehäuse recht schmal hätte ausfallen können. Es war aber breit. Das fiel nur nicht sofort wegen der weißen Farbe auf.
»Unsinn. Wir müssen gucken, wo was ist, und dann ab weiter. Bin doch kein Gas-, Wasser-, Scheiße-Installateur und guck in die Scheißhäuser.« Er zeigte Maik einen Vogel.
»Glaub mir! Dein wievielter Bruch ist das, hä?« Maik ging auf die Küchenuhr zu.
»Meinetwegen. Mach, wat du willst. Dann teilen wir aber auch nicht. Jeder behält ab jetzt das, was er findet.« Gerry wollte sich zum Gehen abwenden und blickte unsicher auf den Jüngeren.
Maik griff an die Küchenuhr.
»Willste denn jetzt auch noch die Batterien wechseln?«
Plötzlich schwang die Küchenuhr zur Seite und ein Geheimversteck wurde sichtbar, in dem Geldscheine und Autoschlüssel zu sehen waren. Maik nahm die Scheine und steckte sie sich in die Hosentasche. »Okay, jeder behält, was er findet.«
»Zufall!«, knurrte Gerry böse und verschwand.
Maik legte die Fahrzeugschlüssel zurück in das Fach hinter der Uhr und klappte die Uhr wieder in ihre Ausgangsstellung zurück. Er suchte weiter, traute dem Frieden aber nicht, weshalb er immer wieder die Tür im Blick hatte, genauso wie die Gegenstände, die er als Waffe benutzen konnte. Es würde das erste und letzte Ding sein, welches er zusammen mit Gerry drehte, versprach er sich. Wie es so mit Versprechen ist, die man sich selber gibt, sollte alles ganz anders kommen. Maik machte sich weiter an die Arbeit und untersuchte die Küche gründlich.
Plötzlich polterte es durch das Haus. Was war das denn schon wieder? War dieser Typ völlig durchgeknallt? Oder musste der nur seiner Wut darüber Luft machen, dass Maik ihm nicht gefolgt war? Noch einmal erscholl durch das ganze Haus ein markerschütternder Schlag. Maik griff sich eines der Messer, die er sich für einen Kampf mit Gerry ausgeguckt hatte, und ging in Richtung des Geräuschs. Im großen Hausflur sah er, nur unweit der Haustür, eine offen stehende Tür, hinter der eine Treppe nach unten in den weitläufigen Kellerbereich führte. Schon erscholl ein weiterer Donnerschlag. Maiks Füße trugen ihn immer schneller und tiefer. Sogleich erfasste ihn die Kälte der Tiefe. Im geräumigen Kellergang mussten sich seine Augen einen Moment an das funzelige Licht einer Kellerlampe gewöhnen. Die Kulisse mutete seltsam an, wie unterirdische Gänge in einem alten Verlies. Mehrere Türen des verzweigten Kellerganges standen offen. Am Ende des Ganges sah er einen Schatten, auf den er sich zubewegte. Der Keller roch modrig, wie die meisten Keller im Bruch. Lagen schon die Häuser hier unter dem Wasserspiegel der Oder und ständig der Gefahr des Wassers ausgesetzt, so flossen die Keller bei den sich ständig wiederholenden Binnenhochwassern im Bruch regelmäßig voll. Sie waren so gebaut, dass das Wasser dann auch gut bei Trockenheit wieder abfließen konnte, was aber blieb, war ein modriger Geruch. Die vielen Kellerräume hatten sicher einem früheren Eigentümer als Lager oder Ähnliches genutzt.
Gerry hatte irgendwoher einen schweren Vorschlaghammer geholt und schlug nun wieder auf eine große, schwere Eisentür ein, an der sich vier kleine Kerben rund um das Sicherheitsschloss abzeichneten. Er blickte auf den mit dem Messer Bewaffneten und glaubte zu verstehen. Er ließ den Stiel des Hammers durch einen kräftigen Ruck in der rechten Hand etwas höher rutschen, sodass die Hand nun kurz unter dem Hammerkopf war, und ergriff mit der linken das Ende des Stiels. »Hast wohl gedacht, dass ich hier den großen Schatz gefunden habe, und wolltest mich gleich dazulegen, weil wir ja nicht mehr teilen?«
»Blödsinn!«, konterte Maik glaubwürdig, »ich habe nur eine unklare Situation befürchtet und mich bewaffnet.« Er ging auf die Stahltür zu und drückte die Klinke; sie war verschlossen.
»Was denkst du, wie blöd ich bin?«, echauffierte sich der Tätowierte.
Darauf antwortete Maik besser nicht. »Was, glaubst du, ist dahinter?«
»Etwas, das zu verstecken sich lohnt«, frohlockte der Tätowierte in Gedanken an fette Beute. »Wie in deiner Küche.«
Maik schaute sich um. »Fällt auf, dass das die einzige Stahltür ist.«
»Bist ja gar nicht so doof, Jungchen«, entgegnete Gerry und setzte weiter provozierend nach: »Zieh du dir mal deine Schürze an und mach die Arbeit in der Küche weiter, Kleiner.«
Maik überlegte kurz, ob er es diesem Großmaul nicht doch zeigen sollte; mit dem Messer würde er schneller sein als Gerry mit dem schweren Hammer.
Gerry schwang den Hammer noch mehrmals mit aller Kraft gegen das Türschloss, bis die Tür ein wenig nachgab. Das um den Unterarm gewickelte Handtuch färbte sich dunkelrot.
Nun war auch Maiks Interesse geweckt. »Ist ja gesichert wie die Bank von England …« Dann war ihm, als höre er ein Geräusch. »Ruhig mal! Hast du auch was gehört?«
Der Tätowierte lauschte kurz. »Quatsch! Hörst Gespenster, Kleiner.«
»Hast du dich mal genauer umgeschaut? Würde mich nicht wundern, wenn es hier welche gäbe.«
»Ach, hast ja bloß Schiss, wenn eina kommt … Wenn jetzt eina aufschlägt, ist das doch nur die Alte, die halbtags arbeitet oda so.«
Maik wollte nicht unbedingt von den Bewohnern erwischt werden. Gerry hingegen war das ziemlich egal. Ehe die Polizei hier draußen war, würden sie schon längst über alle Berge sein. Und wenn die Bewohner ihn selbst angriffen, dann würde er sich schon um sie kümmern. Maik verstand diese Gelassenheit des Älteren nicht und begründete sie für sich nur mit dessen Dummheit. Eine Körperverletzung gegen einen Bewohner würde er nicht riskieren wollen; das stand in keinem Verhältnis zu einer möglichen Beute bei einem solchen Bruch. Gerry hatte aus seiner Sicht alle Gründe der Welt, hier nicht gesehen werden zu wollen; so bunt, wie der Tätowierte war, und das bis ins Gesicht hinein, würde ihn jedes Opfer auf einer Lichtbildvorlage sofort identifizieren können.
Gerry wurde ungeduldig und begann nun, auf die andere Seite der Tür einzuschlagen, dort, wo er die Scharniere der Tür auf der Innenseite vermutete. Nur leicht bröselte etwas Putz auf den Boden. Er musste einsehen, dass die Idee nicht so Erfolg versprechend war, wie es ihm in den Sinn gekommen war. Wieder marterte er die Stahltür auf der Seite des Schlosses. Endlich begann die Tür, sich etwas weiter zu bewegen. Maik schaute auf seine Uhr und überlegte, ob sie die Sache hier besser nicht bald abbrechen sollten. Was erwartete Gerald denn hinter dieser Tür? Vielleicht nur der Hobbyraum des Familienvaters. Als besonders gesichert würde Maik den Raum nicht einmal bezeichnen. Noch ein paar Schläge mit dem Hammer und Gerry würde ihn geöffnet haben. Die Tür sah aus wie eine Brandschutztür. Vielleicht lagerte darin etwas, was feuergefährlich war, oder etwas, was im Falle eines Brandes besonders gesichert werden sollte. Vielleicht hatte es auch nur blöde Brandschutzauflagen von einem überflüssigen Amt gegeben. Maik stellte sich vor, wie dieses Haus hier seit Hunderten Jahren gestanden hatte und so ein Beamter vorbeigekommen war, um festzustellen, dass das ja so überhaupt nicht ginge. Genau an dieser Stelle hier müsse eine Brandschutztür eingebaut werden. Sicher hatte er auch schnell eine Vorschrift gefunden, der zufolge das sofort nötig wäre.
Endlich sprang die Tür auf. Gerry tastete nach einem Lichtschalter und wurde fündig. Was sich ihnen darbot, hätten sie nie für möglich gehalten. Beiden entglitten die Gesichtszüge. Das durfte doch nicht wahr sein!
Es war Jörns Tag der Entlassung aus der Haft. In wenigen Minuten würde die Stahltür der Justizvollzugsanstalt Cottbus-Dissenchen sich hinter der für ihn günstigen Seite schließen. Ein Empfangskomitee erwartete er ebenso wenig wie überhaupt eine Menschenseele. Vielleicht würde Gerry kommen; der hatte manchmal solche Sachen drauf. Zu seiner letzten Verhandlung vor dem Amtsgericht Frankfurt (Oder) hatte er ihn auch begleitet. Jörn Schmidt konnte nicht wissen, dass Gerry gerade bei der Arbeit in einem großen alten Bauernhaus im Oderbruch in Neu-Sophienhof war. Jörn hatte auf den Entlassungstag hin gezählt; heute war sein Tag null. Schiefgehen durfte eigentlich nichts mehr. Draußen war man erst, wenn sich die Tür hinter einem schloss und man die Grillen von den Wiesen vor dem Knast zirpen hörte.
Kurz vor der Haftentlassung konnte da schon die eine oder andere böse Überraschung auf ihn zukommen: Untersuchungshaft wegen ein paar Dingern, die er vor seiner letzten Verurteilung gedreht hatte, die aber bisher niemand ihm hatte zuordnen können, oder die Sachen, die er hier im Gefängnis veranstaltet hatte, wurden ihm in letzter Sekunde doch noch zum Verhängnis.
Sein im Bau gefundener neuer Kumpel spürte die innere Anspannung. Er beruhigte Jörn mit einem »Wird schon alles schiefgehen«.
Von seinen früheren Gefährten hatte sich niemand über die Monate sehen lassen; seine Freundin hatte in der Zeit seiner Haft die Beziehung beendet. Seinen alten Kumpels machte er keinen Vorwurf. Die hatten alle selbst schon gesessen und keine Lust auf ein Wiedersehen mit solchen Mauern und immer wieder schwer ins Schloss fallenden Türen. Seiner Ex nahm er das übel. Hier drinnen und dann noch von dem Menschen verlassen, den man zu lieben glaubte. Um die blöde Kuh und ihren Lover würde er sich auch bald kümmern. Eine Frau bräuchte er jetzt auch. Mit dem hier im Knast verdienten Geld würde er von Frankfurt (Oder) über die Brücke in die alte Dammvorstadt nach Słubice gehen und eines der Mädchen aufsuchen, die er schon vor seinem Haftantritt und trotz der Beziehung mit seiner Freundin regelmäßig besucht hatte. In Frankfurt selbst sollte der letzte Puff, so, wie es die Knastnachrichten hier verbreitet hatten, einem Feuer zum Opfer gefallen sein. Nicht einmal einen ordentlichen Puff bekamen die in dieser Stadt hin. Jörn schüttelte den Kopf. Das würde sich ändern. Und wenn ihm die Konkurrenz mit einem warmen Abriss drohte, würde er schon wissen, wie er sich zur Wehr setzen könnte.
Sein Zellengenosse deutete das falsch und legte ihm die Hand auf die Schulter: »Freu dich, du bist bald raus. Was würde ich drum geben, mit dir tauschen zu können.« Jörn scheute eine umständliche Erklärung und nickte bloß.
Jeden Augenblick würde einer der Justizvollzugsbeamten kommen und ihn bis zum Ausgangsbereich durch zahllose Türen und Tore schließen, um ihn dann einem anderen Beamten zu übergeben, der ihn bis in die ersehnte Freiheit geleiten würde. Die Entlassungen fanden am Vormittag statt, das sparte dem Land das Mittagessen. Oft hatte er hier drinnen gehört, welche Kosten durch einen Häftling pro Tag entstanden und dass er für diesen Preis auch gut und gerne Urlaub in einem guten Hotel hätte machen können. Diesen Vorwurf fand er widersinnig. Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte sich der Staat diese Kosten gerne sparen können; er hätte sogar ein viel einfacheres Hotel genommen.
Jörn trat an das vergitterte Fenster mit Blick in den Innenhof der Anstalt. Niemand, der noch nicht gesessen hatte, könnte sich die Last der Freiheitsbeschränkung wirklich vorstellen. Auch ein Selbstversuch in einem kleinen Zimmer der eigenen Wohnung könnte nicht den psychischen Druck entstehen lassen, der auf einem Gefangenen lastete. Das wäre freiwillig und man könnte so einen Versuch jederzeit abbrechen. Hier war es das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht gegenüber der staatlichen Gewalt. Man konnte nicht einfach mal hinausgehen ins Grüne. Auch wenn Jörn dafür keine Ader hatte, kein großer Naturfreund war und in Freiheit kaum das Bedürfnis hätte, bei dieser Affenhitze ins Freie zu treten, kam es im Knast gerade darauf an, dies überhaupt nicht zu dürfen, wenn man es wollte, und schon gar nicht dahin zu gehen, wohin man wollte. Die da draußen mochten sagen, dass er sich das ja selber zuzuschreiben hätte. Er müsste ja nicht Taten begehen, die ihn hierherbrachten. Hätte er sich schön konform verhalten, wie es die gesellschaftliche Norm vorschrieb, wäre er ja nicht im Knast gelandet. Er konnte aber nicht leben wie die da draußen. Die merkten doch überhaupt nicht mehr, wie sie wie eine stumpfsinnige Herde Vieh morgens zur Arbeit und am Abend wieder in ihre Ställe getrieben wurden; zwischendurch bekamen sie Brot und Spiele, etwas zu essen, Fernsehen, was zum Saufen und, wenn es klappte, noch ein paar Tage Urlaub. Aber sonst sollten sie schön funktionieren. Da konnte er nicht mitmachen. Das wollte er nicht. Die Rechnung hatte man ihm hier präsentiert.
Er hatte es ja versucht mit einem bürgerlichen Leben. Es war aber nicht sein Ding. Sich von irgendwelchen Idioten, die ihm nicht das Wasser reichen konnten, sagen zu lassen, was er zu tun oder zu lassen hatte, das konnte keiner von ihm verlangen, das verletzte seinen Stolz.
Und er hatte es ja auch versucht; war sogar bei der Bundeswehr gewesen. Die hatten ihn aus dem Dienst entlassen, weil er beim Kiffen erwischt worden war. Okay, es war nicht nur das Kiffen gewesen, er hatte den Stoff auch besorgt. Aber doch nur, weil die anderen Schlappschwänze gewesen waren und keine Beziehungen zu den richtigen Leuten gehabt hatten. Da hatten doch alle mitgemacht. Und wer hatte wieder alles ganz alleine abbekommen? Jörn Schmidt.
Mit der Bäckerlehre hatte er doch auch einen schweren Job versucht. Viel schwerer als der Scheiß, den die da draußen so tagtäglich verzapften. Allein, wenn er nur an die Arbeitszeiten zurückdachte, musste er den Kopf schütteln. So schwer wollte er das Geld sein Arbeitsleben lang nicht verdienen. Und dieser bescheuerte Bäckermeister erst. Der hatte ja seine Kohle drin. Ihm vorwerfen, wenn er mal etwas später gekommen war oder etwas gekifft hatte. So ein Spießer! Selbst den Verkäuferinnen an die Brüste oder den Arsch fassen, vor ihm aber den Moralapostel herauskehren.
Wenn er endlich draußen wäre – diesmal würde alles anders werden. Nicht, dass er vorhatte, sich eine Arbeit zu suchen und damit seinen Lebensunterhalt nach landläufiger Meinung auf sogenannte redliche Art und Weise zu verdienen. Sich den ganzen Tag abzurackern und nur ab und zu im Fernsehen zu sehen, wie Superreiche ein luxuriöses Leben in Villen und auf Jachten führten, das war nicht sein Ding. Diesmal würde er sich sein Stück vom Kuchen schon holen. Das war so sicher wie das Amen in der Kirche. Im Knast wurde es einem richtig bewusst, wie kostbar Lebenszeit war. Er hatte davon nichts mehr zu verplempern. Die Rechnung war ganz einfach, dachte Jörn, er hatte nur soundso viel Lebenszeit, sagen wir 85 Jahre, wenn er sich nicht vorher totsaufen würde, und nur das eine Leben. Das Geldverdienen konnte er nicht nach hinten verschieben, das Geld brauchte er jetzt. Und wenn es ihm keiner gab, musste er es sich zwangsläufig holen. Die würden alle staunen. Und wenn er erst die richtig dicke Kohle hätte, würde keiner mehr von diesen Verwaltungsheinis oder Bullen sich an ihn herantrauen. Dann würde er plötzlich Freunde unter jenen Leuten haben, die jetzt noch die Nase über ihn rümpften. Er würde so einem piekfeinen Klub beitreten und ab und zu Gäste auf ein Glas Wein einladen, bei dem ihre Hände zittern würden, wenn sie den Preis hörten.
Sein Zellengenosse holte ihn in die Wirklichkeit zurück. »Wenn du draußen bist, organisiere alles nach Plan. Kein Sterbenswörtchen, worum es wirklich geht.«
Jörn Schmidt hatte seine Lektion gelernt: »Bin doch nicht blöd. Die Unterlagen sind alle hier.« Er klopfte auf die gepackte Tasche und blickte seinem Gegenüber fest in die Augen. »Auf dem Papier alles legal, da können sie ihre neugierigen Nasen reinstecken, wie sie wollen … Einen Steuerberater habe ich diesmal auch schon.«
»Hm«, entgegnete dieser stolz.
»Meinst du, dass du deine Zulassung nach dem Knast so schnell wiederbekommst?«
»Klar doch! Mit deiner Hilfe. Sobald der Laden läuft und wir Kohle rausziehen können, kann ich geordnete Vermögensverhältnisse nachweisen. Vielleicht noch eine kurze Wohlverhaltensphase und dann kann ich da weitermachen, wo ich aufgehört habe.«
»Richtig. Die werden alle glotzen, was wir auf die Beine stellen«, sah sich Schmidt schon in der Rolle des erfolgreichen Kriminellen oder Geschäftsmannes.
»Nach außen nur du«, sicherte sich der Steuerberater ab.
Jörn zwinkerte mit einem Auge. »Na klar doch, nur ich.«
Das wiederum passte seinem Zellenkumpel auch nicht. »Versuch bloß nicht, mich zu bescheißen, du. Draußen kenne ich Leute.«
»Ich auch«, würgte Schmidt diese Debatte gleich ab. »Haben wir die Zeit hier gemeinsam durchgestanden oder nicht? Sind wir Kumpels oder nicht?«
»Klar doch … Sind einfach die Nerven, verstehst du? Ich hab noch ein paar Monate.«
Schmidt nickte, als sich der schwere Schlüssel im Schloss der Zellentür drehte.
Noch war es ein friedliches Bild: Die geschäftigen Leute am Bahnhof vor der idyllischen Berglandschaft ahnten nichts vom drohenden Inferno. Ein akkurat uniformierter Stationsvorsteher der Deutschen Bahn, der mit einer Hand die Signalkelle hob und mit der anderen Hand eine Trillerpfeife zum Mund führte, um den Leuten zu gebieten, sich von der Bahnsteigkante fernzuhalten, war ein Sinnbild für Ordnung und Sicherheit. Dennoch versuchte eine junge Frau im quietschgelben Kleid, mit ihrem anthrazitfarbenen Koffer noch schnell in den Regionalzug zu huschen. Die beschauliche Kulisse wurde nicht von herumliegenden Flaschen, Zigarettenschachteln, Papiertaschentüchern oder vergleichbarem Unrat getrübt. An diesem Plätzchen schien die Welt noch in Ordnung.
Die Details dieses Moments waren vom Schöpfer mit erstaunlicher Präzision eingefangen. Die junge Frau und der Stationsvorsteher waren die ersten Opfer. Wutentbrannt war der Einbrecher in den mit einer stabilen Stahltür gesicherten Kellerraum des großen, alten Bauernhauses in Neu-Sophienhof gestürmt, nachdem sich seine Augen an das grelle Licht gewöhnt hatten, um mit dem schweren Vorschlaghammer auf die Eisenbahnanlage einzudreschen. Der Hammer durchfuhr die splitternde Platte, Gleise, die beiden Figuren, eine Bahn mit Hänger stoben durch den Kellerraum. Als Gerry das schwere Werkzeug zum zweiten Schlag erhob, hingen Kabel daran, die er aus dem Unterbau der Platte ans Licht gezerrt hatte. Das in einem vom Bauherrn und Eigentümer des Bauernhauses in stundenlanger mühevoller Handarbeit errichtete, in einem Braunton gehaltene Bahnhofsgebäude, liebevoll mit Blumenkästen verziert und mit kleinen weißen Fensterkreuzchen versehen, war im Bruchteil einer Sekunde der Wucht des Schlages gewichen, genau wie der dahinter gelegene Parkplatz mit der angrenzenden Straße und den Fachwerkhäusern des beschaulichen Städtchens.
Während Gerry seiner Wut und Enttäuschung durch weitere Zerstörung der Spielzeugeisenbahn freien Raum ließ, schüttelte Maik ob dieser Entgleisung den Kopf. Er hatte sich als Kind immer eine Eisenbahnplatte solchen Ausmaßes gewünscht. Sein Großvater, ein von Entbehrung, Krieg und der schweren Nachkriegszeit gezeichneter Mann, der ab und an versucht hatte, Maik die Vaterfigur zu ersetzen, die der Junge eigentlich gebraucht hatte, war schon sehr alt gewesen, weshalb dessen eingeschränkte Geschicklichkeit es nicht mehr zugelassen hatte, solch eine Eisenbahnplatte zu gestalten. Mit seinen Fertigkeiten versuchte der Alte dennoch gemeinsam mit dem Jungen eine Anlage zu errichten, an der sie gemeinsame Stunden verbracht hatten, die sich Maik immer wieder gerne in Erinnerung rief, die einige seiner schönsten Kindheitserinnerungen überhaupt waren. Die Mutter hatte sich zu dieser Zeit endlich von dem ständig betrunkenen und sie prügelnden Mann getrennt. Maik wollte seinen Kindern ein besserer Vater sein, als seiner es gewesen war. Er konnte dem irrwitzigen Treiben seines Kumpans nicht weiter zusehen und blickte sich suchend im geräumigen Keller um. Sein Blick heftete sich auf eine weitere Stahltür am Ende des Raumes, als ihm ein Spielzeugauto gegen die Schläfe schoss. »Au!«, schrie er auf. »Jetzt krieg dich mal wieder ein.«
Gerald schaute sich um, als ob Maik der Nächste wäre, dem er gerne einen Schlag mit diesem Gerät würde versetzen wollen.
Maik blickte auf den blutdurchtränkten Verband. »Du tropfst wieder.«
»Na und? Ich dresch auf die Scheiße hier so lange ein, wie ich will«, meinte Gerry aufgebracht.
»Erst mal müssen wir deinen Verband erneuern. Ich hol was vom Bettzeug ausm Schlafzimmer.«
»Nich nötig«, meinte Gerry in seiner großspurigen Art und zog seine Jeansjacke aus. Dann zog er auch das T-Shirt aus, das einmal weiß gewesen war, und begann, es klein zu reißen.
Maik verband Gerry wortlos und schaute sich um. An die der Tür gegenüberliegenden Seite war eine große Holzplatte gelehnt, die so aussah, als ob sie den Boden für eine weitere Modellbahnanlage oder für eine Vergrößerung der alten bilden sollte. Dann wäre sie aber mit einigen Dingen aus dem Raum hier verstellt worden. Vor der großen Holzplatte stand aber nichts. Das war unüblich, da sie noch nicht gebraucht worden war. Nachdem Maik seinen Kumpan erneut verbunden hatte, ging er auf die Platte zu, schaute dahinter und fand seine Vermutung bestätigt.
Gerry hatte sich die Jeansjacke über den freien, tätowierten Oberkörper gestreift und hob tatsächlich wieder den Hammer, um auf den Resten der Eisenbahnanlage herumzudreschen.
»Heb dir deine Kraft lieber für die Tür da auf«, richtete Maik seinen Blick auf die weiße Stahltür, die nun am anderen Ende des Raums zum Vorschein gekommen war.
Diesmal war es Gerry, der seinen Kopf schüttelte. »Noch so ’ne Scheißtür?« Er hob den Hammer und reichte ihn Maik. »Diesmal bist du dran.«
»Und was dahinter ist, ist meins?«
»Quatsch, wir teilen, wie abgemacht.«
Diesen Sinneswandel führte Maik nur darauf zurück, dass Gerry körperlich doch ganz schön geschafft aussah. Das Teilen fand er gerecht, da er jetzt oben in den Räumen nicht weitersuchen konnte. Weiter überlegte er nicht. Ihnen lief langsam die Zeit davon. Jedenfalls er selbst wollte niemandem der Hauseigentümer begegnen. Oder von diesen vielleicht noch hier unten eingeschlossen werden und warten müssen, bis die Polizei kam. Wenn die hier auf dem Dorf so etwas nicht sogar in die eigene Hand nahmen. Nun war es Maik, der auf die nächste Tür einschlug. Es waren jedoch präzise und kraftvoll ausgeführte Schläge und nicht die eines Irrsinnigen. Nach ungefähr einer Minute gab auch diese Tür nach. Der Anblick des zweiten Kellerraumes erstaunte sie nicht minder. Es war eindeutig. Hier lebte so ein verklemmter Sadist seine Neigung aus. Ein Stuhl in der Mitte, darüber ein Haken in die Decke eingelassen, allerlei Seile und Sexspielzeuge in den Regalen, auch eine Kamera und sogar ein kleiner CD-Player mit Bildschirm. Es lagen CDs mit Datum und einige Speicherkarten und USB-Sticks im Regal, die Gerry einsteckte.
»Willste wohl ’nen gemütlichen Filmabend machen.«
»Quatsch doch nicht so ’ne Scheiße … Oder vielleicht doch. Aber wenn da det druff is, wat ich denke, dann lässt der Hausherr vielleicht den enen oda anderen Euro springen, um seine Filmchen wiederzubekommen.«
Die anderen Räume des Hauses durchsuchten sie nur noch flüchtig; Gerry immer noch mit dem Hammer in der Hand.
Maik rief im aufgeregten Ton: »Guck mal hier.« Er streckte Gerry entgegen, was sie beide aus ihren Gerichtsverhandlungen gut kannten: einen Kommentar zum Strafgesetzbuch.
»Vielleicht ’n Richter oder Anwalt oder so ’n Zeug«, kommentierte Gerry angewidert.
»Da sollten wir doch schnell machen, dass wir rauskommen«, schlussfolgerte Maik.
»Warum?«, blieb Gerry ganz cool. »Der hat doch viel mehr Schiss, dass das rauskommt, was wir da unten jesehn und jefunden ham, als wir, dass wa erwischt wern. Kannste globen.«
»Kann sein … Wir sollten jetzt machen, dass wir rauskommen.«
»Schisser!«, zischte Gerry beleidigend und sah Maik dabei herausfordernd an. »Machste gleich ein?«
»Dir werde ich es zeigen, du Arsch«, dachte Maik bei sich, »aber auf meine Weise. Einfach einen brutal zusammenschlagen, das kann ich auch. Aber du, du bist gemeingefährlich. Du bist echt krank und gehörst weggeschlossen. Wenn sich sonst niemand drum kümmert, dann werde ich es in die Hand nehmen.«
Bevor sie das Haus verließen, warf Gerry das schwere Werkzeug wie ein Hammerwerfer nach einer Drehung mit Wucht gegen den großen Philips-Flachbildschirm, der donnernd zu Boden ging. »Das haben die Arschlöcher davon. Sich großkotzig so ’ne Protzkiste in das Riesenhaus stellen, aber nich mal was zum Klauen da.«
2. Kapitel: Krimi-Dinner in Slubice
»Das kann doch nicht wahr sein«, erklärte ich mein Unverständnis mehr für mich als für Frank.
»Was denn?«
Während wir uns zu Fuß von der Magistrale in Richtung der Oderbrücke bewegten, schüttelte ich den Kopf. »Wir sind noch in Deutschland.«
Frank reagierte lächelnd: »Mit brillanter kriminalistischer Scharfsinnigkeit erkannt.«
»Die Brücke ist für den Fahrzeugverkehr gesperrt, sodass weder von rechts noch von links Fahrzeuge kommen können. Trotzdem stehen die Leute am späten Abend vor der roten Fußgängerampel. Das ist doch typisch deutsch.«
»Stimmt«, nahm mir Frank den Wind aus den Segeln.
Wir bogen vor der Ampel nach rechts in Richtung Brücke und ließen die Leute weiter stehen. Vielleicht würden die angewachsen sein, wenn wir zurückkehrten.
Der Abend mit meinem neuen Partner war bisher von seinen Ergebnissen her nicht ganz so verlaufen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Die Lokalitäten hatten wir entsprechend unserem Vorhaben zunächst in Frankfurt (Oder) und dann wenige Meter weiter auf polnischer Seite in Słubice ausgewählt, was so weit in Ordnung war. Lediglich mit den Inhalten unserer Debatten konnte ich mich nicht so recht anfreunden.
Gewohnheitsgemäß bestellte ich auf polnischer Seite meine dortige Lieblingsmarke »Absolvent«. Wir tranken ein Glas und bestellten eine weitere Runde, als der Kellner die Gläser vom Tisch nahm. Mit zügigen Schritten entfernte er sich von unserem Tisch.
Frank schaute auf die Oder. »Und da hat Tobias die tote Frau herausgeholt?«, erkundigte er sich mit Blick auf die Oder.
»Hm. Da hinten, kurz vor dem Ziegenwerder.« Ich wies mit dem Kopf in die Richtung der Halbinsel auf deutscher Seite. Ich war froh, dass wir die Angelegenheit der Finanzierung der Detektei nicht auch in dieser Kneipe gleich wieder aufgriffen, obwohl die nun von Frank aufgeworfene Frage auch nicht viel erbaulicher erschien. Mir war sofort klar, dass es Frank nicht so sehr um das Thema der Leiche ging, sondern vielmehr darum, dass er nicht mehr in die Ermittlungen involviert war.
»Peter Behrend, mein früherer Partner bei der Polizei …«
»Ja, ja, ich kenn ihn«, unterbrach ich Frank und nahm ihm so die Last ab, erklären zu müssen, dass Peter ja nun nicht mehr sein Partner sei. Sie hatten über Jahre miteinander gearbeitet, sich vertraut und einander Dinge anvertraut, die kaum jemand sich traute, einem anderen mitzuteilen.
»… der ist jetzt an dem Fall dran.«
»Und«, forderte ich ihn auf, weiter zu dieser Sache zu berichten, »gibt es schon Erkenntnisse zur Todesursache?«
»Mit hoher Wahrscheinlichkeit erwürgt.«
Der Kellner brachte die zweite Runde und wir unterbrachen unser Gespräch. Das hier musste niemanden in unserer Umgebung interessieren. Da viele Polen Deutsch sprachen, war es nicht unwahrscheinlich, dass er uns verstehen konnte.
Nachdem der Kellner schnellen Schrittes seinen Slalom in Richtung entfernterer Tisch fortgeführt hatte, meinte ich: »So sollte niemand aus dem Leben scheiden. Wer war sie denn?«
»Haben noch keine Identität feststellen können. Soll aber um einiges jünger sein, als es zunächst durch die Presse mitgeteilt worden ist.«
»Wasserleichen eben«, warf ich wissend in die Runde und schaute in mein leeres Glas.
»Genau … Da war es für den Zeichner auch schwer, für die Zeitung neben dem Foto der Wasserleiche ein Gesicht zu malen, wie das Mädchen zu Lebzeiten ausgesehen haben könnte.«
»Sonst noch Anhaltspunkte?«
»Dein Kumpel Tobias konnte den Hinweis geben, dass er eine vergleichbare Angelsehne verwendet wie die, mit der der Frau die Betonsteine an die Füße gebunden worden sind.«
»Fireline«, wusste ich zu sagen.
»Macht keinen Spaß, sich mit dir zu unterhalten, wenn du schon alles weißt.«
Wir erhoben unsere Gläser und leerten sie in einem Zug.
»Weiß ich ja nicht. Kenne nur generell das Problem, dass Laien bei der Altersbestimmung von Wasserleichen eher danebenliegen, und angle selbst mit der Fireline für die ganz schweren Brocken.«
»Da bist du ja ein Tatverdächtiger«, witzelte Frank.
»Nur Betonsteine habe ich zurzeit nicht verfügbar.« Ich blickte suchend auf. Als sich meine Blicke mit denen unseres Kellners trafen, bedeutete ich ihm, dass wir noch ein Gläschen vertragen konnten.
»So was liegt doch überall herum. Das waren die einfachen Steine, die es in jedem Baumarkt gibt.« Frank gefiel wohl das Spiel, mich als Täter noch nicht sofort ausklammern zu können.
»Und der Täter oder derjenige, der die Leiche verschwinden lassen wollte, hat geglaubt, dass ein paar Steine ausreichen, um die Leiche zu versenken und bei der derzeitigen Strömung der Oder am Platz zu halten?«
»Scheint so. Oder er wollte nur für einige Zeit das Verschwinden der Toten vertuschen.«
Ich blieb mit meinen Gedanken bei den Fakten: »Zumindest hat er es geschafft, den Fundort vom Tatort zu trennen.«
»Genau so. Das erschwert die Ermittlungen um einiges.«
»Hat er schon eine Spur?«
»Nichts Konkretes.«
»Dir fehlt die Arbeit bei der Polizei, was? Würdest jetzt wohl gern bei den Ermittlungen dabei sein?«
Frank schaute in sein leeres Glas, als ob da die Antwort zu finden wäre, drehte es hin und her und ließ nur ein kurzes »Hm« hören.