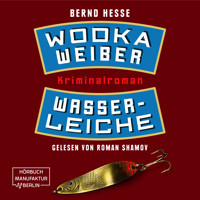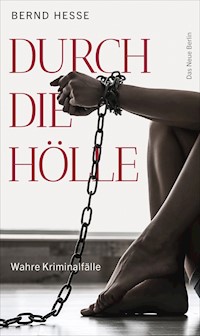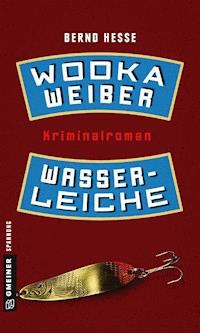Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Das Neue Berlin
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Ein Bauunternehmer ist ermordet worden. Der Mann hat sich in seinem Leben viele Feinde gemacht, der Kreis der Tatverdächtigen ist groß. Doch alle Spuren verlaufen im Sand, bis die Polizei die Sprachnachricht »Der Abriss ist erfolgt« abfängt. Dieser Fall eines Auftragsmordes liegt einer der neun spannenden Geschichten zugrunde, die von Mord, Betrug, Drogenhandel und Raub handeln und in unterschiedlichen sozialen Milieus von der Obdachlosenszene bis in die Chefetage von Unternehmen spielen. Bernd Hesse ist Rechtsanwalt und hat einige der Täter als Strafverteidiger vor Gericht vertreten. Er rekonstruiert Tathergänge, Motive, die Ermittlungsarbeit der Polizei sowie die juristische Aufarbeitung aus nächster Nähe. »Es sind Fälle, die würde man in einem fiktiven Krimi für unglaubwürdig halten ...« Märkische Oderzeitung
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 311
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernd Hesse
Die letzte Baustelle
Wahre Kriminalfälle
Das Neue Berlin
Über das Buch
Ein eingespieltes und eingeschworenes Team arbeitet in der Kanzlei in Frankfurt an der Oder; die Mandanten von Rechtsanwalt und Strafverteidiger Bernd Hesse wissen das zu schätzen. In höchst unterschiedlichen Fällen wird er beauftragt. Wenn er hier den Stoff für seine Geschichten findet, geht es Hesse nicht nur um Spannung und interessante kriminalistische und strafrechtliche Aspekte, sondern um die Schicksale hinter den Geschehnissen.
Über den Autor
Bernd Hesse wurde 1962 in Bad Saarow geboren. Nach dem Abitur und einer Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenmonteur arbeitete er als Rohrleitungsmonteur für Erdölanlagen. Später studierte er Jura an der Freien Universität Berlin und promovierte zum Dr. iur. Nach seiner Zulassung als Rechtsanwalt studierte er Literaturwissenschaft und Linguistik an der Europa-Universität Viadrina und promovierte zum Dr. phil. Er betreibt eine Rechtsanwaltskanzlei in Frankfurt (Oder) und Berlin, ist auf Wirtschaftsrecht, Arbeitsrecht und Strafrecht spezialisiert und als Strafverteidiger tätig. Das Brandenburgische Oberlandesgericht bestellt ihn regelmäßig zum Ausbilder. Neben juristischen Publikationen veröffentlichte er die Kriminalromane »Rubel, Rotlicht und Raketenwerfer« und »Wodka, Weiber, Wasserleiche«, zwei Sammlungen authentischer Kriminalfälle (»Die Hinrichtung«, »Durch die Hölle«) und ein Anekdotenbuch über E.T.A. Hoffmann.
Inhalt
Die letzte Baustelle oder Pacta sunt servanda
Nur ein paar Gramm
Erst hat man kein Glück und dann kommt auch noch Pech dazu oder Kurz in den Schlagzeilen der Nation
Neues Spiel, neues Glück!
Klaustrophobie
Witwenmord
Über den Tod hinaus
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen
Tu nie was Gutes, dann kann dir auch nichts Schlechtes widerfahren
Die letzte Baustelle oder Pacta sunt servanda
Der Grundsatz »pacta sunt servanda«, nach dem Verträge einzuhalten sind, entstammt entgegen einem weitverbreiteten Irrglauben und wie der lateinischen Schreibweise zufolge vermutet werden könnte, nicht dem römischen Recht, sondern entwickelte sich erst im kanonischen Recht des Mittelalters. Sei es, wie es sei, dieser Grundsatz wurde zwei Verbrechern zu einem schrecklichen Verhängnis.
*
Franziska fuhr mit einem alten schwarzen Rad am Ufer eines Spreearms entlang. Das Radfahren tat ihr gut, auch wenn Berlin nicht ungefährlich für Radfahrer war. Die Eile der Stadt, die Sorglosigkeit gegenüber anderen … ach Quatsch, ihre Gedanken drifteten ab, plätscherten einfach vor sich hin, obwohl ihr dieses Rad einiges an Mühe abforderte. Sie hatte es über eine Ebay-Kleinanzeige erworben. Zwei Räder waren ihr in der Hauptstadt der Fahrraddiebe schon gestohlen worden. Die Hände würde sie denen abhacken, wenn sie die beim Klauen erwischte ... Hier musste es sein, sie war ganz in der Nähe ihres Ziels. Die Wege vor sich beobachtend, nahm sie den Schatten in der kleinen Parkanlage rechts vor ihr nicht wahr. Ihr Herz pochte nicht nur von der Anstrengung.
Da vorne lief er tatsächlich und hatte einen Hund dabei, einen recht großen. Angst vor Hunden hatte sie nie gehabt. Aber da sie sich mit Hunden auskannte, begegnete sie ihnen mit Respekt. Anders war es mit dem Mann am anderen Ende der Leine. Wie lange hatte sie sich seine und die Bilder seines Geschäftspartners im Internet angesehen? Immer strahlende Lebemänner. Gut, langsam in die Jahre gekommen, aber im Geschäft weiterhin viel Biss, viele Ideen, sicher noch mehr Träume und ganz bestimmt viele Leichen im Keller. Zumindest eine davon war ihr bekannt. Ihre schwarzen Haare lugten nur etwas unter dem Helm hervor. Wenn sie jetzt über einen spitzen Stein führe und einen Platten bekäme, würde es den ganzen Plan zunichtemachen, durchfuhr es Franziska. Zu lange hatte sie darauf hingearbeitet, zu lange hin und her gegrübelt, ob es richtig war, alles wieder aufzuwühlen. Vielleicht hätte sie besser zu Hause bleiben und alles auf sich beruhen lassen sollen. So kamen doch die meisten Menschen ganz gut mit ihrem Leben zurecht.
Sie radelte nun etwas langsamer, noch völlig unbeachtet von ihrem Ziel. Ihre Hände begannen zu schwitzen. Gerade als sie an ihm vorbeifahren wollte, zog der Hund, den er nicht unter Kontrolle zu haben schien, auf die andere Seite des Weges. Franziska musste abbremsen, klingelte und rief gleichzeitig: »Passen Sie doch auf!«
»Das ist kein Radweg!«, fuhr er sie an und zog seinen Hund zu sich.
»Geh erst mal mit deiner Töle in die Hundeschule!«, feuerte Franziska zornig zurück und war schon vorüber. Zum Glück hatte er so sehr auf seinen Hund achtgegeben, dass er sie nicht angesehen und ihr nur von hinten nachgeschaut hatte. Das mit der »Töle« tat ihr im Nachhinein leid, da sie Hunde mochte, und auch den dort, nur nicht seinen Besitzer. Was konnte der Hund dafür, mit so einem Gassi gehen zu müssen!
Wolfgang S. genoss die herbstliche Kühle des abendlichen Spaziergangs durch Berlins Mitte mit seinem Weimaranerrüden Max. Er mochte sein Haus in Duisburg, wusste aber auch die Tage in Berlin zu schätzen, wo für ihn zurzeit mehr Geld zu machen war. Nachdem sich in seinem Leben die finanzielle Lage mal wieder konsolidiert hatte, stellte sich aber erstaunlicherweise keine Zufriedenheit ein. Das stimmte nicht ganz, gestand er sich ein. Eine Genugtuung gab es ihm schon, es immer wieder zu schaffen, sich aufzurappeln und durchzubeißen. Als Taxifahrer das Studium finanziert, eine Anwaltskarriere hingelegt, viele Narren aufs Kreuz gelegt, sich verzockt, die Anwaltszulassung verloren, mal Koffer mit Kohle herangeschleppt, mal Gläubiger an den Hacken gehabt, auch solche, die ihm für nicht gezahlte Raten Körperteile abzutrennen drohten, Geld auf immer wieder andere Weise herangeschafft: Klubs, Mädchen, Autoersatzteile, Stahl, Öl, Immobilien und noch so einiges. Ein stetiges Auf und Ab. Wenn man nicht zugreift, bekommt man auch nichts. Man darf in diesem Leben nicht darauf hoffen, dass einem was geschenkt wird. Und jetzt hatte er es wieder geschafft.
Der frühe Abend schenkte frische Luft, Bewegung und einen klaren Kopf, den er für den nächsten Tag brauchte. Den letzten Gedanken verwarf er sogleich. Die ganze Zeit über hatte er einen klaren Kopf gebraucht. Morgen würde gefeiert!
Für sich wählte Wolfgang die Wege entlang des Spreearms an der Fischerinsel und für Max die entlang der Wiesen und Parkanlagen. Am Uferstreifen gab es Abschnitte für beide: auf der einen Seite Wasser, auf der anderen Gebüsch. Dass er in Berlin und bei seinen Geschäften seit geraumer Zeit beobachtet wurde, bemerkte er nicht. In seiner Berliner Zweitwohnung würde bei ihrer Rückkehr auf Max dessen Hundefutter und auf ihn eine Flasche sehr guten Rotweins warten. Man musste sich das Leben auch schön machen, und davon verstand er schließlich einiges. Außerdem hatten sie etwas zu feiern.
»Max, zieh nicht so!«
Plötzlich hörte er eine Fahrradklingel dicht hinter sich und eine keifende Frau, der er nur entgegenbrüllte, dass dies hier kein Fahrradweg sei, während er Max zu sich zog. Die junge Frau kreischte was von »Töle« und »Hundeschule« und war genauso schnell verschwunden, wie sie gekommen war. Sicher so eine fahrradbesessene Ökotrulla mit unrasierten Achseln, die dachte, dass die Welt ihr gehöre und Haustiere methanausscheidende Luxusartikel einer Überflussgesellschaft seien.
Verärgert zog er wieder an der Leine. Der Hund hatte kein Verständnis für seinen Herrn, wie Menschen die Stellung zu ihrem Hund gelegentlich bezeichneten, und zog seinerseits. Der Mensch lief viel zu langsam. Hier auf der Fischerinsel, mitten in Berlin, kannte Max alle Gerüche; da war nicht viel Neues hinzugekommen. Ihn zog es fort.
Der Mann riss nun noch mal an der Leine. Der Hund blickte sich um und starrte den Mann einen Augenblick an. Sein Herr sah etwas Merkwürdiges in den Augen seines Hundes. Die empfand er für einen Augenblick als unnatürlich hell. Er lächelte. Der Hund war nach seinem Geschmack. Da mochte sein Geschäftspartner frotzeln, wie er wollte. Schon als Wolfgang sich darüber informiert hatte, was für einen Hund er sich anschaffen sollte, meinte er, dass die charakteristischen Eigenschaften jener Rasse diejenigen seien, die sie beide verbanden: stur, intelligent und energisch. Er selbst war in die Jahre gekommen, aber mit diesem Hund traute sich keiner zu dicht an ihn heran.
Max und er hatten viele Gemeinsamkeiten. Er selbst hatte sich im wahrsten Sinne des Wortes durchbeißen müssen und ließ nicht locker, wenn er seine Beute erst mal zwischen den Zähnen hatte. Ihm war bewusst, dass er bei dieser Selbsteinschätzung übertrieb. Aber sie gefiel ihm. Und letztlich logen sich doch alle selber die Taschen voll. Und er hatte auch ein gutes Recht dazu. Schließlich hatte sich der Selfmade-Millionär erst nach oben kämpfen müssen.
Mit den Worten »Lass das!«, »Aus!« und »Pfui!« zog er Max von etwas weg, was nun das Interesse des Hundes geweckt hatte und so klein war, dass Wolfgang es nicht erkennen konnte. Immer wieder hatte er von Leuten gelesen, die Giftköder oder Wurststückchen mit Rasierklingen ausbrachten, um Hunde zu töten. Bei diesem Gedanken schüttelte er kaum merklich den Kopf. Die Menschheit schien komplett verrückt zu sein.
Seine Gedanken strebten zum kommenden Tag. Auch dafür waren solche Hunderunden geeignet: Er ließ das Geschehene Revue passieren und schmiedete neue Pläne. Der nächste Tag war mit Terminen vollgepfropft, die ihm früher lagen: feierliche Einweihung des neuen Gebäudekomplexes in Anwesenheit einer Senatorin – der regierende Oberbürgermeister wollte sich wohl aus politischen Gründen nicht sehen lassen, da es keine Sozialwohnungen zu verteilen gab –, anschließend Pressekonferenz und am Ende die Party in ihrer Firma.
Ab da wäre es wieder eine Veranstaltung für ihn. Manni würde sich nicht lumpen lassen, sondern die Puppen tanzen lassen, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Manfred K. und er kannten sich schon viele Jahre, waren vor Urzeiten Anwälte in unterschiedlichen Kanzleien in Nordrhein-Westfalen gewesen, begegneten sich nicht nur am Abend in der Klubszene, verloren sich dann aber aus den Augen, genauso wie sie ihre Anwaltszulassungen verloren, weil die kreuzbraven Tugendwächter der Anwaltskammern der Auffassung waren, dass ihr recht legerer Umgang mit Mandantengeldern nicht standesgemäß sei. Mannis Interesse für die Rechtswissenschaften hielt sich in Grenzen; er wollte nur so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich machen. Darin waren sich beide einig. Wolfgang selbst war ein guter Unterhalter und Gastgeber, war bei ihren Feiern auch spendabel und konnte an deren Ende die eine oder andere Frau abschleppen. Manni konnte die Gesellschaften immer noch ein wenig besser unterhalten, sie bei der Stange halten und nebenher Geschäfte eintüten. Mit seinem Esprit schaffte der es auch, einen Hydranten für Philatelie zu begeistern.
Seine Abneigung gegen Presseauftritte hatte Wolfgang bei weiteren Geschäften mit nordafrikanischen Machthabern entwickelt, die Geld in die Kassen spülen sollten. Als sich in den Neunzigerjahren die offiziellen Ansichten zu diktatorischen Herrschern, deren Öl und Geld wandelten und Menschenrechtsverletzungen sowie Demokratiedefizite moniert wurden, kramten Schmierfinken die alten Bilder heraus und störten seine Geschäfte. All das Gute, was er geleistet hatte, sollte plötzlich null und nichtig sein. Journalisten, die einst lobend über ihn und seine Geschäfte berichtet hatten, wandten sich nun von ihm ab und bewarfen ihn mit Dreck, nur um den Eindruck einer eigenen reinen Weste zu vermitteln.
Seit dieser Zeit drängte er sich bei Presseterminen nicht mehr in die erste Reihe und spann die Fäden im Hintergrund. Seine Erfahrung sagte ihm auch, dass Geschäftsleute mit Macht und Reichtum im Hintergrund agierten. Sollten sich die mediengeilen Wirtschaftspromis selbst ans Messer liefern. Je mehr Neid sie auf sich vereinten, desto schneller fanden sich willfährige Handlanger, die sie zu Fall brachten. Die Geschäftswelt war ein Haifischbecken und er würde sich nicht mehr zum Fraße vorwerfen lassen.
Manfred und er waren bei großen Geschäften in der Stahlindustrie wieder aufeinandergetroffen, hatten ihre Freundschaft aufgefrischt und neben ihren anderen Unternehmungen eine Gesellschaft zum Stahlhandel gegründet und dort einen Geschäftsführer eingesetzt. Dann gab es Ermittlungen gegen diesen, weil Steuervorteile für Auslandsgeschäfte erschlichen worden waren, zu denen es keine wirklichen Geschäftsvorfälle gab, ein Steuerstrafverfahren wurde eingeleitet, der Geschäftsführer in persona für über eine Million Euro nicht gezahlter Steuern haftbar gemacht, und am Ende hatte er sich in der Garage erhängt. Das war alles ziemlich furchtbar. Seine kleine Tochter hatte ihn gefunden und musste später psychiatrisch behandelt werden. Das hatte ihnen beiden ordentlich zugesetzt. Zwar nahm die Witwe ihre Zahlungen an, warf ihnen aber vor, am Tod ihres Mannes schuld zu sein. Sie hatten ihn, so, wie er sich immer gegeben hatte, als abgebrühter eingeschätzt. Nun mussten sie auch damit leben. So konnten sie nicht weitermachen und gingen wieder ihrer eigenen Wege, verloren sich in der Hektik des Geschäftslebens erneut aus den Augen und begegneten sich jahrelang nicht mehr. Nun waren sie ambitionierte Teilhaber eines stetig wachsenden Immobilienunternehmens, das in ganz großem Stil in der Hauptstadt mitmischte. Wenn das so weiterging, würden sie auch beim großen Deal um die am Alexanderplatz zu errichtenden Wolkenkratzer dabei sein. Da ging es dann nicht mehr nur um Millionen. Das wäre das ganz große Geschäft! Seine Gedanken zauberten ihm ein breites Lächeln auf das Gesicht.
Vielleicht würde er seine Pläne für den Abend noch ändern und sich zum Ku’damm chauffieren lassen, wo Max ungeachtet aller lebensmittelhygienischen Vorschriften sein nur leicht angebratenes Steak ungewürzt und klein geschnitten auf einem Teller Meißener Porzellan serviert bekommen würde. Das Hundefutter und der Wein in der Wohnung würden so oder so nicht alt werden. Wolfgang genoss den Gedanken an gutes Essen für seinen Hund und für sich. Den Grundsatz, dass die Tiere zuerst zu versorgen sind, hatten sein Großvater und sein Vater so tief in ihn gepflanzt, dass er auch dem Stadthund Max zugutekam. Sie waren als Flüchtlinge nach dem Krieg an den Niederrhein gezogen und hatten dort eine Landwirtschaft aufgebaut. Als ob Max die Gedanken seines Herrn erraten hätte, schaute er ihn mit seinen unheimlich wirkenden gelben Augen erwartungsvoll an. Mit Max an seiner Seite spürte er, wie Passanten bemüht waren, einen größeren Abstand zu wahren. Das war ein vergleichbarer Effekt wie mit seinem großen Wagen auf der Straße. Als junger Anwalt mit einem VW Golf, da saßen die vom nachfolgenden Verkehr schon fast auf seiner Rückbank.
Die traute Zweisamkeit wurde von jemandem im Schatten beobachtet, der seit einiger Zeit in der kleinen Parkanlage stand, schräg gegenüber dem Haus mit den Eigentumswohnungen.
Am Geländer lehnte sich Wolfgang weit vor und sah in den Fluss, als Max anschlug und eine Fledermaus dicht an seinem Kopf vorbeiflog, um auf der anderen Seite in einem Baum zu landen. Unbekümmert setzten sie ihren Spaziergang fort.
Was Wolfgang sich nie hätte träumen lassen, war der Umstand, dass er gerade einem Mordanschlag entkommen war. Keine Fledermaus war soeben an seinem Kopf vorbeigezischt, sondern ein von einer Armbrust abgefeuerter Stahlbolzen, der nun in einem Baum auf der anderen Flussseite eingeschlagen war. Nur seine Bewegung über das Brückengeländer hatte ihm das Leben gerettet. Außer dem Schützen, der sich geduckt im Gestrüpp der kleinen Parkanlage gegenüber dem Geländer nahezu geräuschlos entfernte, nahm niemand Notiz von dem Geschehen.
*
»Du?«, empfing ihn am darauffolgenden Tag sein Geschäftspartner. »Hätte nicht geglaubt, dass du dich noch sehen lässt.«
Lässig lupfte Wolfgang die Manschette seines weißen Hemdes und schaute auf seine goldene Uhr. »Ich hatte gestern noch einen schönen Abend.«
»Hoffentlich mit einer schönen Frau.«
»Mit einer guten Flasche Wein.«
»Du kommst auch in die Jahre.«
Davon wollte Wolfgang nichts wissen, ließ sich von Manni provozieren, nahm einer jungen, schwarzhaarigen Kellnerin ein Glas Champagner vom Tablett, in dem die kleinen, durchsichtigen Blasen nach oben strebten, und flüsterte: »Darf ich Ihnen auf Ihren süßen Po hauen?«
Beim Blick in die bräunlich und grün wirkenden Augen der jungen Dame wusste er, die Frage der Falschen gestellt zu haben. Es konnte gut sein, dass das Tablett mit den Gläsern in seinem Gesicht landen würde. Stattdessen zischte sie: »Darf ich Ihnen in Ihre kleinen Eier treten?«, freute sich, dass er sie nicht erkannt hatte, und verschwand.
Manni hätte beinahe den Champagner in die Gegend geprustet, schluckte und grinste breit: »Sag ich doch. Du kommst in die Jahre. Die jungen Frauen von heute bekommst du nicht mit einem platten Spruch rum.«
»Mit einem platten eben nicht. Dann muss ich tiefer in die Trickkiste greifen. Bevor die Feier heute beendet ist, habe ich mich mit ihr verabredet.«
Manni lachte sein provokantestes Lachen. »Ja klar, zum Femegericht in ihrer Umweltaktivistengruppe mit dir als Angeklagten. Und bezüglich der dich erwartenden Strafe hat sie ja schon eine Andeutung gemacht.«
Wolfgang hielt dagegen. »Wetten?«
»Du bist und bleibst ein Spieler. Fordere dein Glück nicht heraus!«
»Wetten?«, blieb Wolfgang stur.
»Fünfhundert?«
»Das gilt.«
»Die Kohle kannst du eigentlich gleich rüberwachsen lassen.«
»Bist du denn deine platten Sprüche heute schon bei der Journaille losgeworden?«
Manfred K. berichtete, wie er sich schon von der Presse hatte ablichten lassen, auf ihn einstürmende Fragen beantwortet, Kritiker mit Charme in die Schranken gewiesen und das Unternehmen nach seiner Überzeugung würdig repräsentiert hatte.
Bei der Feier in den Geschäftsräumen konnte auch Wolfgang noch etwas vom Erfolg genießen. Zwar war der große Rummel mit den Politikern und in ihrem Gefolge Pressefotografen und Journalisten vorbei, aber es gab noch ein paar wichtige Hände zu schütteln. Ein paar Banker, Vorstände und Geschäftsführer von Baufirmen waren zu begrüßen, die gerne noch etwas mehr am Projekt verdient hätten, die aber alle, so viel Überblick hatte er, ihren Schnitt gemacht hatten. Es war ein Tag, an dem er mit Stolz auf etwas Erreichtes zurückblicken konnte, schon wieder weiterarbeitete und neue Sachen einrührte.
Gerade als er die junge und sehr attraktive Kellnerin erspähte, die er so dreist angesprochen hatte, und ihr mit einigen schnellen Schritten den Weg abzuschneiden gedachte, wurde er daran gehindert.
»Da haben Sie uns aber um ein schönes Sümmchen gebracht«, erscholl eine ärgerliche Stimme von der Seite, die einem kräftigen, breitschultrigen Mann um die Vierzig gehörte, mit frühen Geheimratsecken auf dem runden Kopf, unsteten Schweinsäuglein und einer zu dem sonst derben Aussehen nicht passen wollenden kleinen, feinen Nase. Er war sich sicher, ihn noch nie gesehen zu haben.
»Verzeihung, kenne ich Sie?«
Der Mann stellte sich als Unternehmer einer Firma vor, deren Bauleistungen Wolfgang für einen skandinavischen Baukonzern geprüft hatte.
Wolfgang hatte keine Lust, sich jetzt und hier auf ein intensiveres Gespräch einzulassen; ihm war sofort klar, um welche Sache es sich handelte. Die Firma hatte nicht erbrachte Leistungen in erheblichem Umfang in Rechnung gestellt und Nacharbeiten nur mangelhaft ausgeführt. Das hatte Wolfgang als Ergebnis seines Prüfauftrages dem Konzern mitgeteilt. Die vorläufige Konsequenz war die unterbliebene Zahlung der Schlussrate von immerhin 1,3 Millionen Euro für die Berliner Baufirma. Aber auch die Zahlungen in anderen Geschäften zwischen den Skandinaviern und der kleineren Berliner Baubude wurden erst einmal blockiert. Dabei ging es um über drei Millionen Euro.
Manfred und Wolfgang hatten die Wohnungen, die saniert werden sollten, selbst von einem bundeseigenen Immobilienunternehmen erworben und mit einem ordentlichen Gewinn an den skandinavischen Konzern weiterveräußert. Dann sollten die Skandinavier sie nach ihren Vorstellungen auch noch mit der Sanierung beauftragen. Den Zuschlag dafür hatte aber das relativ kleine Bauunternehmen bekommen, dessen Chef Rudi R. nun vor ihm stand. Wolfgang war es eine Genugtuung gewesen, den Skandinaviern aufzuzeigen, dass sie Betrügern aufgesessen waren.
Luka C., der südeuropäische Bauleiter des Berliner Unternehmens, der sich immer wie der zweite Chef aufspielte, hatte auch versucht, Wolfgangs Schweigen über die Angelegenheit zu erkaufen, was Wolfgang aber von sich wies. In welchem Verhältnis die beiden miteinander standen, war ihm dabei nicht ganz klar. Wolfgang kannte die Branche gut genug und konnte sich verschiedene Szenarien vorstellen. Der ausländische Bauleiter, der eher den Eindruck machte, Geschäftspartner des Berliners zu sein, hatte einen entschlussfreudigeren und durchsetzungsstärkeren Eindruck hinterlassen als der eigentliche Chef. Ein Eindruck, der sich durch seinen Auftritt bei der Feier verstärkte. Nicht, dass Wolfgang irgendwelche Skrupel gehabt hätte, Geld für eine bestimmte Leistung – oder in diesem Falle besser »Nichtleistung« – von diesen Leuten anzunehmen; dazu wusste er nur allzu gut, wie es in der Branche lief. Hier lag der Fall aber ein wenig anders. Für die meisten der Gäste war es nicht unüblich, sich Gefallen zu erkaufen oder eine Katastrophe dadurch abzuwenden, dass man in die Tasche griff. Mit Vertretern der öffentlichen Hand gestaltete sich solches Geschäftsgebaren leider immer schwieriger. In der Wirtschaft schlichen sich solche Bedenken gegen jahrtausendealte Handelsbräuche ebenfalls ein. Die Saubermänner und -frauen würden seiner Auffassung nach Deutschland noch kaputt regulieren. Wolfgang war stolz auf die von ihm gefundene Definition von Korruption, wobei er sich nicht ganz sicher war, ob er diese schon irgendwo einmal gelesen hatte. Danach sei Korruption das Handaufhalten beim Schließen der Augen. Aber bei der Baufirma, deren vermeintlicher Chef Rudi R. ihn gerade belästigte, lag das anders. Die musste er als Konkurrenz ausschalten. Und den Mann würde er hier auch gerne persönlich rauswerfen. Früher hätte er das sofort getan, heute hatten sie dafür eine spezielle Security-Firma engagiert. Deren Mitarbeiter wollte er nicht extra bemühen.
Und überhaupt wollte er in dieser Sache kein Theater erleben. Er und Manfred verfolgten den Plan, mit ihrer Immobilienfirma selber wieder in das Geschäft mit den Skandinaviern einzusteigen; die kauften hier immer noch Wohnungen wie andere Brötchen. Da kam es ihnen gerade zupasse, das Bauunternehmen schlecht dastehen zu lassen, von dessen angeblichem Chef er gerade angequatscht worden war. Er kanzelte ihn kurzerhand ab und verwies auf die Möglichkeit, ordentliche Arbeit zu leisten und saubere Rechnungen zu legen.
Als er kehrtmachte, stand er unvermittelt vor der schwarzhaarigen Schönheit, die jetzt härtere Getränke auf dem Tablett und härtere Züge im Antlitz trug. Wolfgang musterte sie kurz von oben bis unten, sah ein Tattoo auf dem rechten Unterarm mit einem Spruch, den er so schnell nicht lesen konnte, und beeilte sich mit einer Entschuldigung. »Verzeihen Sie meine Grobheit vorhin!« Und da sie sich überhaupt nichts anmerken ließ, setzte er hinzu: »Ich wollte vor meinem Freund den dicken Max markieren. Sorry! Es tut mir außerordentlich leid.« Da sie immer noch nicht erkennen ließ, wie sie seine ernsthaft vorgebrachte Entschuldigung auffasste, ergänzte er: »Sie machen hier Ihren Job und werden dann blöd angemacht. So etwas ist mehr als ärgerlich.«
»Genau!«, ließ sie sich zu einer Art Antwort herab und Wolfgang feierte innerlich, weil es ihm gelungen war, das Eis zu brechen. Sie sprach mit ihm. Dann platzte es aus ihr heraus: »Was bilden Sie sich denn ein?« Die Stimme der Frau bebte. »Ich habe mich erkundigt. Sie sind einer der Auftraggeber der Firma, bei der ich mir ein wenig zum Studium hinzuverdiene. Wenn Sie noch einmal meinen Weg kreuzen oder mich ansprechen, schreibe ich noch heute Abend einen Artikel über Sie, den ich den Journalisten schicke, die vorhin hier Schlange standen. Da können Sie dann lesen, wie Sie mir sabbernd auf den Ausschnitt stierten und mich wie ein Stück Ware taxierten.« Sie setzte ein gespieltes Lächeln auf und verschwand, ohne eine Erwiderung abzuwarten. Auf ihrem Unterarm stand: »Renide! Omnes necare non potes«, was bedeutet: »Lächle! Du kannst sie nicht alle töten.«
Manfred steuerte auf ihn zu. »Sorry, Alter. Hätte ich dir sagen müssen, das ist Franzi.«
»Who the fuck is Franzi?«
»Franziska, die Kleine von unserem früheren Geschäftspartner.«
»Welchem?«
»Du weißt doch. Der sich erhängt hat.«
Wolfgang spürte ein Unwohlsein; ein solches, das im Bauch beginnt und eine Übelkeit verursacht. »Ach du liebe Güte! Wie kommt die denn her? Bist du verrückt, die bei uns beschäftigen zu lassen! Die gibt uns Arsen in die Drinks!«
»Bleib mal ganz locker! Habe ich doch auch erst heute Morgen erfahren. Ihre Mutter hat angerufen. Und an irgendetwas müssen wir alle sterben.«
»Bekommt sie immer noch Geld von dir?«
»Seitdem wir die Firma plattgemacht haben, nicht mehr.«
»Dann«, begann Wolfgang sauer, »gilt die Wette nicht.« Und setzte versöhnlicher hinzu: »Du alter Ganove! Mich so ins Messer laufen zu lassen. Da kann ich mich ja ins Zeug legen, wie ich möchte. Und es ist nicht nur mir, sondern auch dem Mädchen gegenüber nicht fair.«
Manfred lächelte böse. »Das wollte ich mir eine Zeit ansehen. War doch besser als Kino. Aber jetzt sollte damit Schluss sein, bevor es eskaliert.«
In der Gewissheit, dass das Schwanzlängenmessen mit Manni nie ein Ende finden würde, wollte er ihm nichts schuldig bleiben. »Mit Empathie ist es wie mit Intelligenz: Man merkt selbst nicht, wenn es an ihr mangelt. Und welches Motiv hatte sie, den Job heute bei uns anzunehmen?«
»Sie wollte uns mal sehen, schauen, wie weit ihr Vater hätte kommen können, möchte uns wegen Geld anhauen oder wer weiß was.«
»Das ist eine völlig beschissene Situation! Ich fühle mich von dir wie von ihr manipuliert. Das ist eine Lage, die mir äußerst missfällt. Wir müssen die Kontrolle wiedergewinnen. Lass sie mal durchchecken! Wer weiß, was da noch zutage tritt. Initiative hat sie ja, und Mut. Das muss man ihr lassen. Vielleicht kann sie bei uns einsteigen. Das sind wir ihrem Vater schuldig.«
»Als was denn? Und schuldig? Nee, wir sind niemandem was schuldig. Er hat seine Chance gehabt und die Sache vergeigt. Wenn er gleich den Strick nimmt … seine Sache. Du siehst wieder nur eine Frau, und schon …« Manni winkte ab.
Den restlichen Abend war Wolfgang, wie es später Zeugen bestätigten, in sich gekehrt, nicht so ein von Lebenslust strotzender Macher wie sonst. Mit einem Gläschen in der Hand, sich unter den Gästen umschauend, gab er immer mal wieder ein verbindliches Wort von sich. Vielleicht würde er sich von Manni trennen und sein eigenes Ding machen. Manfred hatte ohnehin eine Vielzahl von Geschäftsideen, deren Verwirklichung mehr als ein Menschenleben erfordern würde. Dieses Stehaufmännchen der Wirtschaftswelt würde es noch weit bringen. Er selbst war manchmal müde und konnte sich auch vorstellen, in seinem Leben noch einmal etwas völlig anderes zu machen. Manni war einer, der es allein geschafft hatte, ohne reiches Elternhaus, einer, der sich durchzubeißen verstand. »Keiner schüttelt Niederlagen einfach so ab. Die Kunst besteht darin, es so aussehen zu lassen, als ob einen das alles nicht anfechten würde, und immer wieder aufzustehen.« Wie zur Bestätigung seiner Worte nickte er sich selber zu.
Anders als Franzis Vater, der an der ersten Insolvenz zerbrochen war, an dem Unglück, welches er damit über die Beschäftigten gebracht hatte. »Er war, wie man gemeinhin sagt, ein guter Mensch«, resümierte Wolfgang, »aber nicht für die Härte der Welt geschaffen.« Seiner Familie hatten sie, ohne es zu wollen, wehgetan, ihn geopfert und letztlich verraten. Diese Erkenntnis schmerzte und Wolfgang litt darunter. Es war nicht so, wie Manni es abtat. Er fand die Tochter zweifelsohne attraktiv, aber es stand zu viel zwischen ihnen. Und er hatte die Absicht, etwas gutzumachen.
Doch die Hektik des Alltags, neue, aussichtsreiche Geschäfte, Fahrten zwischen Duisburg und Berlin sowie die Zeit, in der er sich um seinen letzten ehrlichen und uneigennützigen Freund Max zu kümmern hatte, verschlangen alle ehernen Pläne, Franzi unter die Arme zu greifen.
*
Einen Monat später drehte Wolfgang mit Max wieder eine ihrer gewohnten Abendrunden. Die Frische des Abends erstaunte ihn nach der Rückkehr aus Nordrhein-Westfalen erneut. Hier hatte das Klima doch irgendwie kontinentaleren Charakter. Max war sein treuer Begleiter und schnüffelte wieder Berliner Boden. Als sie über die Fischerinsel liefen, zog Max in Richtung der Büsche. Sollte er ruhig schnuppern. Wer keine Zeit hat, seinen Hund alles beschnuppern zu lassen, der sollte sich erst gar keinen anschaffen. Schnell konnte er aber die Aufmerksamkeit des Rüden auf die andere Seite des Weges lenken, wo die Pfosten des Geländers offensichtlich schon viele Hunde angelockt haben mussten. Wolfgang schaute in die nun fast schwarz wirkende Spree hinunter, in der sich die Lichter der Großstadt spiegelten. Er ging weiter in Richtung der Wohnung, als eine dunkle Gestalt hinter ihm aus dem Gebüsch trat, auf ihn zielte und drei Schüsse aus einer Pistole abfeuerte.
Wolfgang war tot, bevor er auf dem Boden aufschlug. Die Hundeleine glitt ihm aus der Hand. Max beschnupperte den Leichnam und ging alleine zur Wohnung zurück, wo er noch vor der verschlossenen Haustür stand, als die von Passanten alarmierte Polizei eintraf.
Eine Stunde später war es am Tatort auf der Fischerinsel in Berlin-Mitte taghell. Die in weiße Overalls gekleideten Kriminaltechniker hatten Scheinwerfer aufgebaut, das Areal weitläufig abgesperrt und den unmittelbaren Tatort mit Planen vor neugierigen Blicken gesichert. Kurze Zeit später trafen die ersten Pressefotografen ein. Wenn man es nicht besser wüsste, hätte man glauben können, es würde wieder eine Nachtszene für einen Film gedreht, was in Berlin glücklicherweise viel häufiger der Fall ist als ein nächtlicher Tatort mit einem erschossenen Opfer.
Drei Schüsse von hinten, die in den Kopf, das Herz und den Rücken trafen: Das sah nach einer Hinrichtung aus. Da wollte der Mörder auf Nummer sicher gehen. Die Kugel, die das Herz durchschlagen hatte und vorne aus dem Brustkorb wieder ausgetreten war, konnte nicht gefunden werden.
Eine am Tatort gesicherte Blutspur, die nicht vom Opfer stammte, konnte gesichert, aber nicht zugeordnet werden.
Dass es sich um Mord handelte, davon konnten die Ermittler von Beginn an ausgehen, da eines der sogenannten Mordmerkmale, hier die Heimtücke, bei einer Tötung von hinten als gegeben anzunehmen war. Viel mehr konnte man aus dem Tatort zunächst nicht schließen. Spekulationen, denen zufolge der Mörder ein Bekannter des Toten gewesen sein könnte, der im Fall des Überlebens des Opfers von diesem nicht erkannt werden wollte und deshalb von hinten geschossen hatte, oder dass es sich um eine Täterin gehandelt hatte, die mit einer Gegenwehr rechnen musste, wenn sie sich vor das Opfer gestellt hätte, oder dass der Täter in maßloser Wut handelte, weil er gleich drei Schüsse abgefeuert hatte, konnten ohne weitere Anhaltspunkte nicht einmal als Arbeitshypothese dienen.
Unmittelbare Zeugen der Tat gab es nicht. Eine Dame wollte nach den Schüssen ein schnell davonrasendes Auto wahrgenommen haben, ein anderer Zeuge beschwor, eine Person gesehen zu haben, die sich mit dem Rad vom Tatort entfernt hatte.
Die Eindrücke von Zeugen sind häufig fragile Beweismittel, denn Wahrnehmungsfähigkeit und Erinnerungsvermögen schlagen uns oft ein Schnippchen. Edgar Allan Poe lässt in »Der Doppelmord in der Rue Morgue« Zeugen aus einem verschlossenen Zimmer Stimmen hören, die der Gendarm als Stimme eines Franzosen und die schrille Stimme als die eines Spaniers beschreibt. Der Silberschmied meint hingegen, dass die schrille Stimme die eines Italieners gewesen sei. Der Restaurateur ist sich sicher, in der schrillen Stimme die eines Franzosen erkannt zu haben. Der Schneider und der Begräbnisbesorger ordnen die schrille Stimme einem Engländer zu. Bei Poe hat diese unterschiedliche Wahrnehmung noch einen anderen Aspekt, weil jeder Zeuge in der schrillen Stimme eine Sprache entdeckt, die er selbst nicht spricht, aber vom Klangbild erkannt haben will. Letztlich projizieren die Zeugen ihre Annahmen auf etwas, was sie gar nicht kennen, in diesem Fall die schrille Stimme eines Orang-Utans.
In ihrer neapolitanischen Tetralogie beschreibt Elena Ferrante, wie Zeugen des Mordes an den Camorristi Solara einmal einen Mordschützen sehen, der in einem roten Ford Fiesta geflohen sei, ein anderer zwei Täter und eine Fluchtfahrerin in einem gelben Fiat 147 ausmacht und wieder ein anderer berichtet, drei zu Fuß flüchtende Männer gesehen zu haben.
Neben den verschiedenen Grundbedingungen zu Wahrnehmungen, wie Gefühlen, Erwartungen, Einstellungen, Leistungsfähigkeit der Sinnesorgane, Hirnstrukturen, Stoffwechsel, Hormonhaushalt, aber auch äußeren Umständen wie Lichtverhältnissen und Wetter, haben es alle an Ermittlungs- und gerichtlichen Verfahren Beteiligten immer wieder mit Wahrnehmungsphänomenen zu tun, wie der Konsistenz, also dem inneren Drang, das Wahrgenommene mit den bisherigen Erfahrungen in Einklang zu bringen. Hier gab es Schüsse, und schon fallen uns die quietschenden Reifen der Fluchtfahrzeuge aus Kriminalfilmen ein.
Den Ermittlern im Fall des ermordeten Wolfgang S. erging es mit den unterschiedlichen Zeugenaussagen nicht anders.
Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Beamten kennen die Statistik: Je länger die Ermittlungen in einem Mordfall andauern, desto geringer wird die Chance der Aufklärung. Zunächst wurde im unmittelbaren Umfeld geforscht. Dabei stießen die Ermittler auf einen anderen, damals noch ungeklärten Mordfall: Ein weiterer Geschäftspartner von Manfred K. war zwei Jahre zuvor in Nordrhein-Westfalen in seinem Haus ermordet worden.
Zwei maskierte Männer hatten sich nach Einbruch der Dunkelheit gegen neunzehn Uhr im Garten der Villa des Geschäftspartners verborgen gehalten, bis dessen Freundin von einem Einkauf zurückkehrte. Die Villa war schon äußerlich erkennbar technisch gegen Einbruch gesichert. Die Täter blieben hinter einem Gebüsch des Vorgartens versteckt, bis die Frau ausstieg und die Einkaufstüten aus dem Mercedes heben wollte. Sofort überwältigten sie die arglose Frau, sprühten ihr Reizgas ins Gesicht und schlugen mit brachialer Gewalt auf sie ein. Sie zwangen sie, ihnen die Tür zur Villa zu öffnen. In der Villa angelangt, schlug einer der Täter unvermindert auf die Frau ein, die erhebliche Verletzungen erlitt, während der andere mit einer Pistole in der Hand im Haus nach Beute suchte. Der robuste Geschäftsmann mit früheren Beziehungen in die Demimonde kam aus der Sauna gestürzt und setzte sich splitterfasernackt, wie er war, gegen den Einbrecher zur Wehr. Der maskierte Einbrecher schoss zweimal auf den Mann, der in den Oberkörper getroffen wurde, sich noch einige Meter durch das Haus schleppte und dann zusammenbrach. Die Täter schlugen die Frau, bis sie den Safe öffnete, räumten diesen aus, sperrten die Frau in den Keller und verschwanden. Aus dem Safe erbeuteten die Verbrecher wertvolle Uhren und Schmuck. Den ebenfalls wertvollen Gemälden, die an den Wänden hingen, schenkten sie genauso wenig Interesse wie der Sportwagenflotte im Garagenteil der Villa. Nach den Schüssen waren die Täter in Panik geraten und hatten sogar mehrere Bündel mit Bargeld übersehen, die offen auf einem Nachttisch lagen, der nur ungefähr drei Meter vom Safe entfernt stand. Als die Frau sich aus dem Keller befreien konnte und im Haus nachschaute, fand sie ihren toten Freund. Danach rief sie gleich die Polizei an.
Alle Ermittlungsbemühungen führten trotz der Aufnahmen der Überwachungskameras, der Verfolgung von über eintausend Spuren, der Befragung von Hunderten Zeugen und der Veranlassung von kriminaltechnischen Untersuchungen bis zum Zeitpunkt des Mordes in Berlin nicht zum Erfolg. Auch die Hinweise, die nach einer Aufnahme des Falles in die Sendereihe »Aktenzeichen XY … ungelöst« eingegangen waren, führten nicht zu den Tätern.
Die beiden Fälle in Nordrhein-Westfalen und Berlin wiesen zu wenig Parallelen auf, um weiterhin in einen Zusammenhang gebracht zu werden. Am Rhein war der Geschäftsmann im Zusammenhang mit einem Raub getötet worden. Es gab zwei Täter und die Tötung des Opfers war nicht das eigentliche Ziel der Tat gewesen. An der Spree hatte nur ein Täter gehandelt, es war nichts gestohlen worden und der Mord war das beabsichtigte Ziel der Tat gewesen. Der einzige Zusammenhang, der sich den Ermittlern erschloss, war die Verbindung der Opfer zu Manfred K. Auch wenn diese Spur zu erkalten schien, behielten sie die Ermittler im Blick.
Fünf Jahre vor dem Mord an Wolfgang S. war in Senden bei Münster ein Freudenhaus Opfer der Flammen geworden. Alles sah danach aus, dass der nun ermordete Immobilienunternehmer damals das Bordell geleitet und es sich um eine Brandstiftung durch einen Konkurrenten gehandelt hatte. Noch schlimmer war der unaufgeklärte Tod einer neunzehnjährigen Prostituierten, die in den Flammen umgekommen war. Die Arbeitshypothese, dass Angehörige der Prostituierten sich an Wolfgang S. rächen wollten, da er das Mädchen nicht ausreichend geschützt hatte oder die Namen der vermutlichen Täter nicht preisgeben wollte, war ein weiterer Ansatz, der zu verfolgen war. Was gegen die Annahme eines solchen Racheaktes sprach, war das Zeitmoment. Den Erfahrungen aus der kriminalistischen Praxis zufolge besteht üblicherweise ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen dem ursprünglichen Geschehen und der Rachehandlung.
Der Geschäftspartner und Freund Manfred K. war es, der selbst die Initiative ergriff und der Polizei vorschlug, einen Betrag für Hinweise auszuloben, die zur Ergreifung des Mörders von Wolfgang S. führen würden. Die aufgrund der Auslobung eingegangenen Hinweise waren zunächst nicht zielführend.
Um die Ermittlungen zu forcieren, wurde eine Sonderkommission eingesetzt, die die Kreise der Ermittlungen nach vielen Vernehmungen im unmittelbaren privaten und geschäftlichen Umfeld immer weiter zog, wobei auch immer tiefer in der Vergangenheit gesucht wurde. Dabei wurden nun auch der Geschäftsführer der Berliner Baufirma und sein Bauleiter gehört. Es war den Kriminalbeamten bekannt geworden, dass der Chef bei der Feier Wolfgang wegen der noch ausstehenden Schlussrate in Millionenhöhe angesprochen und der andere zuvor versucht hatte, die Sache durch die Zahlung von Schwarzgeld auf seine Weise zu klären. Obwohl formell der Deutsche der Unternehmer und der Südeuropäer lediglich Bauleiter und eigentlich Angestellter des Berliner Bauunternehmers war, schienen sie sich eher als Geschäftspartner zu verstehen. Als Zeugen brachten sie ihren Unmut über Wolfgangs Prüfung zum Ausdruck, da es am Bauvorhaben zwar Mängel gab und Rechnungen auftauchten, zu denen keine adäquaten Leistungen erbracht worden waren, jedoch der Einbehalt der kompletten Schlussrechnung ihrer Ansicht zufolge nicht gerechtfertigt war, was jetzt gerichtlich zu klären sei.
»Da werden wir uns mit unserer Auftraggeberin auf eine Summe vergleichen, und das war’s dann.«
Die vernehmende Beamtin bohrte skeptisch nach. »So einfach geht das?«
»Die meisten Bauprozesse enden mit solchen Vergleichen«, erzählte der kräftige Bauleiter mit den Schweinsäuglein und der auffällig nicht zum Gesicht passenden kleinen Nase. »Vor Jahren hatten wir mal für einen Anwalt ein Haus gebaut. Unser Anwalt hatte uns gewarnt, dass man für Anwälte, Lehrer und Ärzte nicht baue, weil das nur Ärger gäbe. Wir wollten es besser wissen – und haben draufgezahlt. Der Typ zahlte die Schlussrate nicht und meinte, dass wir ihn ja verklagen könnten und wir uns dann im Gerichtsverfahren auf die Zahlung der Hälfte einigen könnten. Deshalb bot er uns den Ausgleich des hälftigen Betrages freiwillig an. Was ich aber eigentlich sagen möchte …«
»Ja?«
»Was uns mit der Prüfung durch die Immobilienfirma passiert ist, gehört zum Geschäft, dafür bringt man aber niemanden um.«
Das klang für den Anfang plausibel und beide Geschäftsleute hatten für die Tatzeit Alibis: Einer war bei einer Familienfeier mit zwanzig Gästen gewesen und der andere mit Freunden auf der Bowlingbahn. Das war natürlich noch alles zu überprüfen.
Nach einem Hinweis von Manfred K. vernahmen zwei andere Mitarbeiter der Sonderkommission Franziska S.
»Bin ich eine Tatverdächtige?«, wollte die junge Frau erstaunlich unbeeindruckt wissen.
Einer der Beamten wollte sie einerseits beruhigen, andererseits aber auch zu einer Aussage bewegen. »Wir gehen nur einem Hinweis nach und vernehmen Sie als Zeugin. Diese Fragen müssen Sie auch wahrheitsgemäß beantworten, solange Ihnen kein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, da wir in einer Mordsache im Auftrag der Staatsanwaltschaft ermitteln.«
»Woher soll ich denn wissen, ob ich vom Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch machen kann?«