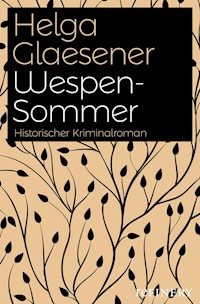6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Refinery
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Toskana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Cecilia Barghini ist schockiert – ein grausiger Mord erschüttert das Städtchen Montecatini. Ein junger Fischer wurde von Hunden zerrissen. Wurde er Opfer eines Eifersuchtsdramas? Oder hat sein Tod mit einem böswilligen Sabotageakt zu tun? Cecilia hilft Richter Rossi bei seinen Ermittlungen. Ihr Eifer bringt sie in höchste Gefahr, als sie auf einer Kutschfahrt dem Mörder begegnet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Das Buch
Die Toskana im 18. Jahrhundert: In den Sümpfen des Padule wird die Leiche eines Fischers gefunden, gefesselt und von riesigen Hunden zu Tode gebissen. Wer hat die Tiere auf Menschen abgerichtet? Richter Enzo Rossi hat schnell einen Verdächtigen, aber der leugnet standhaft. Cecilia hilft Rossi bei den Ermittlungen, doch ihr Eifer bringt sie in höchste Gefahr: Bei einer Kutschfahrt wird sie Zeugin eines Überfalls und kommt beinahe ums Leben. Enzo Rossi ist sicher: Nun hat es der Mörder auf Cecilia abgesehen.
Der zweite Band der spannenden historischen Kriminalromane um die Florentinerin Cecilia Barghini.
Die Autorin
Helga Glaesener, 1955 geboren, hat Mathematik studiert, ist Mutter von fünf Kindern und lebt mit ihrer Familie in Aurich, Ostfriesland. Seit ihrem Bestseller Die Safranhändlerin hat sie im List Verlag zahlreiche historische Romane veröffentlicht. Zuletzt erschien Wespensommer, das erste Buch über Cecilia Barghini und Richter Enzo Rossi.
Von Helga Glaesener sind in unserem Hause bereits erschienen:
Wespensommer Safran für Venedig (nur als E-Book)Die Safranhändlerin Wer Asche hütet Du süße sanfte Mörderin Die Rechenkünstlerin Der singende Stein Der Weihnachtswolf (nur als E-Book)
Helga Glaesener
Wölfe im Olivenhain
Historischer Roman
List Taschenbuch
Neuausgabe bei Refinery
Refinery ist ein Digitalverlag
der Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Juni 2018 (1)
© 2007 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
Covergestaltung: © Sabine Wimmer, Berlin
E-Book: LVD GmbH, Berlin
ISBN 978-3-96048-206-2
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Für Lena, weil sie liebt … und liest
Prolog
Padule di Fucecchio, Toskana, Januar 1781
Es war der sechzehnte Tag des neuen Jahres, und Gildo Algarotti zitterte vor Kälte. Ein eisiger Nordwind fegte über die Kuppen des Apennin und fraß sich unerbittlich durch seinen fadenscheinigen Wollmantel. Er knabberte an seinen Zehen, er ließ die Ohren jucken und die Nase laufen. Verdrossen trottete der alte Mann den Weg entlang, seinen Beutel über der Schulter, und dachte daran, wie er im fernen Lüttich vor Marie und Clément von der Heimat geschwärmt hatte: In Italien, Leute, ist das Wetter der Freund der armen Menschen. Sonnenschein, und der Wind streichelt dich – das ist, als spürtest du die Hand deiner Mutter auf der Haut …
Nichts spürte er, außer dass er bald krepieren würde, wenn er nicht ins Warme kam.
Na schön, dachte er, während er sich umschaute. Was die Landschaft anging, konnte er nicht klagen. Das Röhricht des Fucecchio-Sumpfes, durch den sein Weg ihn führte, strahlte wie ein goldener Flaum, und das Wasser spiegelte einen lichtblauen Himmel – so was gab’s im Norden nicht. An den Weidenzweigen blinkten gefrorene Wassertropfen wie Diamanten. Ein Festsaal für Feentanz und Elfenreigen, dachte er mit einem schiefen Lächeln wegen seines romantischen Herzens, das ihm alle traurigen Erfahrungen nicht hatten austreiben können. Im Moment hätte er allerdings sämtlichen Flitter der Natur gern gegen einen einzigen brennenden Holzscheit getauscht.
Ihm war das letzte Mal warm gewesen, als er vor den Hunden davongerannt war. Das war am Morgen dieses Tages gewesen, in einem Dorf, das Ponte der-Teufel-mochte-wissen-wie hieß. Seine Laune verdüsterte sich, als er an die Köter dachte, die ihn in der Scheune aufgestöbert und gnadenlos über den Hof und durch das Dorf gejagt hatten. Der Bauer, der Saukerl, hatte sie erst zurückgepfiffen, nachdem Gildo die Brücke überquert hatte und in diesem verhexten Sumpf gelandet war. Seitdem irrte er umher, ohne einen Schimmer, wo er sich befand und wohin es sich zu laufen lohnte.
Er hätte natürlich hinter der Brücke warten können, bis der Bauer verschwunden war, und dann wieder ins Dorf gehen und die Straße nach Montecatini suchen. Aber … nun ja – er mochte keine Hunde. Tatsächlich hatte er sogar eine Heidenangst vor ihnen. Er wäre niemals in das Dorf zurückgekehrt. Die Viecher besaßen ein verdammt gutes Gedächtnis, und je löchriger der Mantel, umso wütender bissen sie zu.
Gildo schritt schneller aus, in der Hoffnung, sich auf diese Weise ein bisschen aufzuwärmen. Dabei folgte er einem Weg aus gefrorenen Karrenspuren, um sich nicht in tückisches Gebiet zu verirren. Hier wimmelte es von Mooraugen, immer wieder blitzte Wasser zwischen den gelben Halmen auf. Wenn er fehltrat … Seine Phantasie zeigte ihm eine angefressene Wasserleiche, die mit Stangen an Land gezogen wurde. Fröstelnd schaute er zur Sonne, um sich zu vergewissern, dass er nicht im Kreis wanderte.
Und dann sah er plötzlich das Haus.
Es war ein neueres Gebäude, die Wände aus gelbem Sandstein, das Dach mit scharlachroten Ziegeln gedeckt, in der Mitte ein riesiger, quadratischer Schornstein, allerdings ohne die Rauchfahne, die zu dieser Jahreszeit obligatorisch war. Gildo blieb stehen. Er runzelte die Stirn. Seine langen Wanderungen durch Italien und Mitteleuropa hatten ihn mit einem gesunden Misstrauen gegen alles versehen, was sonderbar war. Und etwas Sonderbareres als dieses Haus war ihm noch nie untergekommen. Es wirkte so fehl am Platz wie ein Kamel auf einer Kuhweide. Erst einmal der Standort, und dann: Die Fenster waren vergittert. Sogar die im Obergeschoss. Warum baute man in einem Sumpf ein Gefängnis? Und wenn es sich nicht um ein Gefängnis, sondern um ein Wohnhaus handelte, und der Besitzer so ängstlich war, dass er sich hinter Gittern verbarrikadierte – warum wohnte er dann in dieser schrecklichen Einsamkeit, wo ihm niemand zur Hilfe eilen konnte?
Zögernd ging der Alte weiter. Als er näher kam, sah er, dass es in dem Haus gebrannt haben musste. Flammen, die aus den Fensterhöhlen geschlagen waren, hatten mit schwarzen Zungen über die Außenmauern geleckt. Er blieb erneut stehen. Über sich hörte er den miauenden Ruf eines Bussards, der im Aufwind über dem Wasser kreiste. Er stopfte die Hände unter seine Achseln, um sie zu wärmen.
Weg von hier, Gildo, dachte er, hau ab. Nichts für dich. Das Haus schien ihm mit seinen verbrannten Fensterluken zuzuzwinkern wie ein boshafter Geist. Aber dann standen vor seinem inneren Auge plötzlich die Reste halb verbrannter Möbel, hölzerne Bodendielen und dergleichen mehr, lauter Zutaten für ein Feuerchen, das ihm die Glieder wärmen würde.
Unschlüssig blies er den Atem in die Luft und starrte auf die Rußfladen.
Ihm fiel ein, dass er dringend sein Döschen mit falschem Arsenik auffüllen musste. Der Winter war für Leute wie ihn eine schlimme Zeit. Er war Theriakkrämer und bot ein Mittel gegen Vergiftungen und Krankheiten feil. In dieser Jahreszeit war das schwierig, denn das klamme Wetter ließ seine Finger steif werden, und … nun ja.
Seine Methode war einfach und wirksam. Wenn er in einen Ort kam, bestellte er beim Apotheker einige Stückchen Arsenik, die er in Papier einwickelte und ihn aufzubewahren bat. Auf dem Markt pries er später sein Theriak, ließ von einem eifrigen Zuhörer das Arsenik aus der Apotheke holen – kein Betrug, liebe Leute, der Apotheker kann’s bezeugen! – und tauschte, während er wortreich sein Vertrauen ins Theriak beschrieb, das Gift gegen ein Teigstück aus Zucker, Mehl und Safran aus. Er verschluckte das falsche Arsen – wie hielten sie den Atem an! – und dann das Theriak … und alles Weitere geschah von selbst.
Nur durften seine Finger nicht steif sein.
Gildo seufzte und näherte sich widerwillig dem Haus. Die Tür war aus schwerem Eichenholz – und sie stand offen. Das ist ja wie eine Einladung, Junge, du hast Glück! Aber seine Schritte wollten nicht schneller werden.
Dann hörte er das Gebell.
Trotz seines Alters – er war bereits über sechzig – schaffte Gildo es mit einem einzigen Satz ins Röhricht, wo er zu Boden glitt. Er lachte ein bisschen über sich und war froh, dass ihn niemand gesehen hatte. Schon wieder Hunde. Diese verdammten Viecher schienen ihn heute zu verfolgen. Aber der Wind stand günstig. Er blies ihm ins Gesicht, so dass die Köter ihn mit etwas Glück nicht riechen konnten.
Gildo zitterte, während Sumpfwasser seine Hose durchtränkte. Er starrte zu der offenen Tür. Aus dem Hausinnern drangen unterschiedliche Belllaute. Er kam zu dem Schluss, dass er es mit drei Hunden zu tun hatte. Große Hunde, dachte er. Verflucht groß, die mussten Lungen wie Kürbisse haben. Er spähte durch die Halme und meinte, etwas Schwarzes im Türspalt zu sehen. War das eines der Tiere? Nee, so groß wurden die nicht, das gab’s gar nicht. Das war ja ein halbes Rind! Gildo ließ die Stirn auf den gefrorenen Matsch sinken und bemühte sich, sein schlagendes Herz zur Ruhe zu bringen.
Seine Hundekenntnisse stammten aus vielen tristen Erfahrungen. Die schrecklichsten hatte er zum Glück nicht am eigenen Leib erlitten. Da war dieser Norweger gewesen, Leif, den sie den Stotterer nannten, dem hatte ein Bullenbeißer, der zu einer Jagdgesellschaft gehörte, das halbe Gesicht weggerissen. War er auch dran gestorben. Gildo hatte ihm in seiner letzten Stunde die Hand gehalten. Dann dieser glotzäugige Köter, den sie auf den ersten Blick als zahme Töle abgestempelt hatten – und der sich dann in Marie Martins Oberschenkel verbissen hatte: Sie mussten wohl eine Viertelstunde auf ihn einprügeln, bis er von Marie abließ. Da war er schon fast tot gewesen, und Clément hatte trotzdem noch den Kiefer mit einer Eisenstange aufstemmen müssen. Die Töle hatte nicht gebellt, deshalb hatten sie ihre Gefährlichkeit unterschätzt.
Ansonsten konnte man sich auf sein Gehör verlassen: Die Kläffer, die sich einfach nur aufregten und die man mit einem Tritt beiseite fegen konnte, die heimtückischen Grummler, die gereizten Knurrer …
Die Hunde aus dem Haus … waren nicht einzuordnen.
Gildo lag mit der Hüfte auf seinem Bündel, er spürte den Druck der Dose, in der er sein falsches Arsenik aufbewahrte. Seine nervöse Blase meldete sich. Er bildete sich ein, dass der Wind ihm den Geruch von Frühlingsblumen zutrug, aber das war mit Sicherheit ein Wunschtraum, jetzt im Januar. Plötzlich hörte er, wie die Haustür scharrte. Ein kräftiges Geräusch, als hinge sie schief in den Angeln und würde mit Gewalt über den Boden gezerrt. Er hätte hinübergespäht, aber er traute sich nicht. Jemand sprach mit leiser Stimme auf die Hunde ein, um die Viecher zu beruhigen.
Das Bellen wurde leiser, die Gesellschaft entfernte sich, bis schließlich jedes Geräusch verstummt war.
Wäre es nicht so kalt gewesen, Gildo hätte bestimmt noch ein Weilchen auf dem Boden ausgeharrt – nur um sicherzugehen. Aber der Frost biss und zwickte. Mühsam rappelte er sich auf und humpelte zum Haus. Jetzt gab es keine Wahl mehr. Er musste seine Kleider trocknen. Die Tür war von der Hitze des Feuers verzogen, und er brauchte eine Menge Kraft, um sie aufzustemmen.
Verdutzt blieb er stehen. Er hatte einen Korridor erwartet oder eine Stube oder vielleicht ein ausgeräumtes Warenlager – aber was sich ihm darbot, war so bizarr, das er sich einen Moment in einen Albtraum versetzt fühlte. Das Haus wurde von einer Maschine bewohnt.
Entgeistert starrte Gildo auf zwei riesige Metallzylinder, über denen eine Art hölzerne Wippe schwebte, mit einem Hammer an jedem Ende. Überall hingen Ketten, dazwischen waren Eisengestänge montiert, und durch die Gestänge erblickte er ein gigantisches Eisenrad. Doch die Maschine war zerstört worden. Ihre Zylinder waren eingedellt, einer der Hammer abgebrochen, das Gestänge aus den Verankerungen gerissen – als hätte sie sich mit einer größeren und zornigeren Maschine in einen Kampf eingelassen. Sämtliche Holzteile waren verkohlt und mit fettigem Ruß bedeckt.
Abgestoßen und neugierig zugleich stieg Gildo einige Treppenstufen hinab. Unterhalb der Maschine befand sich ein runder Ofen, der offenbar mit Kohle gespeist worden war, denn auf dem gekachelten Fußboden davor entdeckte er Kohlenstaub und schwarze Kohlebröckchen. Vor dem Ofen lag ein stinkender, frischer gelber Hundehaufen.
Gildo hatte genug. Durch eines der Fenstergitter fielen Sonnenscheinquadrate vor die Ofentür. Draußen mochte es kalt sein, aber alles war besser als dieses Haus.
Er hätte später nicht sagen können, warum er ein zweites Treppchen erklomm, statt ins Freie zurückzukehren. Er hätte nicht sagen können, warum er auf das Eisenrad zustrebte, und auch nicht, warum er den riesigen, umgestürzten, vom Feuer versengten Tisch umrundete.
Er bemerkte zunächst die Blutlache. Dann sah er den Mann. Der Bursche lag am Boden. Seine Glieder waren verrenkt, Hände und Füße gefesselt. Er war geknebelt, und aus dem geknoteten Tuch am Hinterkopf quollen seidig-schwarze Locken. Der Mann war nackt, sein Hintern und die Beine mit Bisswunden übersät, in denen Blut schimmerte wie Wein. Schwankend zwischen Entsetzen und Neugierde tat Gildo einen weiteren Schritt, so dass er das Gesicht des Gemarterten erkennen konnte.
Der Anblick sollte sich ihm unlöschbar einprägen. Augen, schwarz und blank wie Glasperlen im Schnee, starrten ihm über dem Knebel entgegen, als flehten sie ihn um Hilfe an. Gildo fuhr der Schreck in sämtliche Glieder. Er traf keine Entscheidung. Seine Beine trugen ihn fort, als würden sie von einer fremden Macht bewegt. Weg von dem entsetzlichen Haus, weg von dem Gefolterten. Weg von dem Hundehaufen.
Bis ans Ende seines Lebens sollte ihn die Frage quälen, ob der Mann, den er dort neben der Maschine hatte liegen lassen, zu diesem Zeitpunkt noch gelebt hatte.
1. Kapitel
»Es ist ein Loch! Es ist nichts als ein ummauertes Loch!«, brüllte Enzo Rossi und stieß mit dem Ende seines Besenstiel so heftig gegen die Innenwand des Kaminschlots, dass der Putz herabrieselte.
Cecilia, die in der Tür zum Speisezimmer des Palazzo della Giustizia stand, betrachtete ihn kopfschüttelnd. Er kniete mit verrenktem Hals und Gliedern vor der Öffnung des Kamins – die Arme schwarz, das Gesicht mit Streifen durchzogen wie bei einem Zebra, das weiße Hemd verdorben. »Es muss dort eine verdammte Krümmung …«, fluchte er. Ein weiterer Stoß mit dem Besenstiel ließ eine schwarze Wolke aus der Kaminöffnung steigen.
»Ich würde nach Vitale Greco schicken«, meinte Bruno Ghironi, der Sbirro, der zum allmorgendlichen Appell angetreten war, bedächtig.
Damit wiederholte er, was Cecilia selbst schon vorgeschlagen hatte. Warum rufst du keinen Kaminkehrer, Rossi? Der Mann hat das gelernt; er weiß, wie man es macht. Doch es scheint das Schicksal von Ratschlägen zu sein, dass sie umso vehementer abgelehnt werden, je klarer ihr Nutzen auf der Hand liegt.
Dabei war Enzo Rossi kein Dummkopf. Die Urteile, die er in seiner Eigenschaft als Richter von Montecatini fällte, stellten die Leute zufrieden, weil sie von Sachkenntnis und gesundem Menschenverstand zeugten. Erzgroßherzog Leopoldo hatte ihn in seine Compilations-Kommission berufen, um bei der Justizreform des Landes zu helfen. Ein gescheiter Mann also. Und doch fuhrwerkte er seit über einer Stunde mit Besen, Mistforken und anderem Gerät im Schlot herum, in einem verbissenen Zweikampf, über dessen Ursache man nur rätseln konnte. Der Herrgott hat die Männer dank ihrer Vernunft bestimmt, über die Weiber zu herrschen? Man sieht es, Signor Kant.
Die alte Sofia, das Hausfaktotum, steckte den Kopf durch die Tür und musterte missbilligend den Schmutz. »Ich muss ’ne Menge Dreck wegmachen, nachher«, murrte sie. »Und oben fegen und unten fegen, … aber will ja keiner was von wissen, … wie alles Mühe macht …« Als niemand auf ihr Nölen antwortete, zog sie wieder von dannen.
»Nun komm, … Cecilia … Gib mir das Ding da, … das mit dem Haken …« Rossi streckte die Hand aus, den Kopf schon wieder unter dem Schlot.
»Der Kaminkehrer …«, begann sie.
»Ich habe es gleich. Verstehst du?«
Achselzuckend reichte sie ihm das Werkzeug und kehrte ins Nebenzimmer zurück. Sie hatte leider viel zu spät entdeckt, dass der Kamin im Speisezimmer mit dem Ungetüm in der Bibliothek den Schlot teilte und die fettige Pest in ihr Heiligtum trug. Im Sonnenlicht konnte sie nun das gesamte Ausmaß des Unglücks bewundern. Die Möbel sahen aus, als wäre ein schwarzer Sandsturm durch den Raum gefegt, Trauergirlanden aus Ruß umkränzten die Kaminkacheln und auf den Spanntapeten hafteten fedrige Flocken. Doch am schlimmsten stand es um die Bücher.
Wehmütig fuhr Cecilia mit der Hand über die ledernen Einbände, auf denen winzige Rußpartikel klebten, die man mit Sicherheit nicht würde abwischen können. »Rossi, du verdirbst die Bücher!«
Sie nahm einen Stapel Zeitungen und stieg auf die Leiter, die der Sbirro ihr vor den Bücherschrank gestellt hatte, entschlossen, ihre Rettungsmaßnahmen fortzusetzen, auch wenn es fast schon zu spät war. Umständlich entfaltete sie eines der Blätter, Teil der Meinungen der Babette, für die sie gelegentlich eine Beobachtung aus der Provinz schrieb. Sie wollte das Papier gerade über die Bücher in den oberen Borden schieben, als ihr Blick auf die umrandete Rubrik mit der Überschrift Gemischtes fiel.
2. Januar, Firenze: Ball im Teatro della Pergola.
Teatro della Pergola. Sie hatte nicht die Absicht, sich zurück zu erinnern, wahrhaftig nicht, aber von einem Moment zum anderen überfluteten sie die Bilder, und plötzlich sah sie alles wieder vor sich: die kristallenen Lüster, die verspiegelten Wände, die weichen Teppiche, über die Lakaien mit Tabletts voller funkelnder Weingläser schritten – und natürlich Inghiramo.
Der große Inghiramo, Tragödiendichter, der aufsteigende Stern am Theaterhimmel … Er hatte das Teatro für sie in einen Garten Eden verwandelt, in dem er ihr – wie ehemals die Schlange – den Apfel der Liebe unter die Nase hielt. Und vermutlich hatte er sich dabei totgelacht über das blankäugige Närrchen, das in seiner ringelnden Gestalt eine reine Seele zu erspähen meinte. Wie konnte ich nur, dachte Cecilia. Wie konnte ich …
Sie wollte das Blatt auf den Büchern ausbreiten, doch es glitt ihr aus den Händen und segelte zu Boden.
»Weiter«, hörte sie Rossi fauchen.
Sein wohlbeleibter, schmutziger, treu ergebener Sbirro fuhr gehorsam fort, die Straftaten aufzuzählen, die Montecatini in der vergangenen Woche erschüttert hatten. »Als Zweites, Giudice …« Die Sache mit Elio und Carlo. Der Streit wegen der Scheunennutzung schwelte immer noch, und Carlo hatte Elio einen Kirschkernkacker genannt, was der anzuzeigen wünschte. Zum Dritten war Rosaria Foddis von einem durchziehenden Kesselflicker betrogen worden. Sie hatte einen Nachttopf ausbessern lassen, der aber, wie sie unter bedauerlichen Umständen feststellen musste, immer noch leckte. Und nun war ihr venezianischer Teppich …
»Ein Nachttopf?«
»Jawohl, Giudice. Ich habe den Kesselflicker erwischt, als er über die Gemeindegrenze nach Buggiano wollte, und ihn fest –«
»Nachttopf!«
»Ich könnte …«
»Merda!« Rossis Stimme ging in einem Poltern unter, und aus der Öffnung des Bibliothekskamins stieg eine weitere Rußwolke.
Enerviert verdrehte Cecilia die Augen. Sie kletterte die Leiter hinab und hob das Zeitungsblatt wieder auf. Rasch überflog sie den Artikel auf der Suche nach Großmutters Namen, fand ihn aber nicht, was sie auch nicht wunderte. Zum einen war Großmutter nicht prominent genug, um in der Babette Erwähnung zu finden, zum anderen hatte Cecilias Affäre mit dem Theaterdichter ihr die Freude an der Bühnenkunst verdorben. Wie du mir überhaupt jede Freude verdorben hast, hätte Großmutter jetzt hinzugefügt. Und das nach allem, was ich für dich getan habe!
Cecilia seufzte.
Sie war gerecht genug, um die Liebe und die sorgfältige Erziehung zu würdigen, die Großmutter ihr nach dem Tod der Eltern hatte angedeihen lassen. Sogar ihren Versuch, eine Hochzeit mit dem unglückseligen Augusto zu arrangieren, nachdem sie von der Affäre erfahren hatte, musste man als Beweis aufrichtiger Zuneigung werten. Doch dann hatte die alte Frau Cecilias schwellenden Bauch bemerkt und drastische Maßnahmen ergriffen. Cecilia, immer noch ein Närrchen, wenn auch inzwischen weniger blankäugig, hatte die Qual des Schnürens Tag für Tag ertragen, ohne zu erkennen, was damit beabsichtigt war, und am Ende hatte sie ihr Kind verloren, mitten in der Nacht, auf einem Abort. Das war zu schmerzlich, um es zu vergeben. Auch jetzt noch, nach über einem Jahr. Cecilia warf das Blatt in den Korb mit dem Kaminholz und riss das Fenster auf, um frische Luft hereinzulassen.
»Es zieht!«, brüllte Rossi.
Sie tat, als hörte sie nicht. Die Luft draußen war schneidend, aber klar wie Quellwasser, und sie sog gierig die Lungen voll. Fort mit den nutzlosen Erinnerungen. Florenz war Vergangenheit, … ihr Zuhause der Palazzo della Giustizia in Montecatini.
Cecilia musste lächeln, als sie an den hochtrabenden Namen dachte, der so gar nicht zu dem heruntergekommenen grauen Steinhaus mit den wackligen Fensterläden und den altersmürben Schindeln passte. Müßig ließ sie die Augen über den Marktplatz schweifen. Links vom Palazzo befand sich das Teatro dei Risorti, in dem die Gerichtsverhandlungen stattfanden. Daran schloss sich ein Wohnhaus an, dann ein uralter Turm, den eine montecatinische Adlige in eine Kapelle zu Ehren der Heiligen Jungfrau hatte umbauen lassen. Den Rest des Ovals beanspruchten wieder Bürgerhäuser. Und natürlich das Kaffeehaus, dessen mit Eisblumen verzierte Fenster darauf hinwiesen, dass Goffredo ordentlich heizte – und das schon seit einer Woche, seit diese Kälte über den Ort hereingebrochen war. So ging es nämlich auch; man musste nicht erst warten, bis der halbe Haushalt erfroren war!
Vor dem Kaffeehaus goss ein alter Mann einen Eimer rosa gefärbtes Schmutzwasser in die Gosse. Ansonsten war der Markt wie leer gefegt.
Ich bin am Ende der Welt, dachte Cecilia, während sie fröstelnd die Arme um den Oberkörper schlang. Sie versuchte sich Florenz in Erinnerung zu rufen. Die Parfümerien und Hutgeschäfte, die Theater, die Boboli-Gärten mit den Brunnen und Attraktionen, Tancredis Literaturzirkel, in dem die Neuerscheinungen des Buchmarkts besprochen und unter den Tischen die Libells ausgetauscht wurden, in denen scharfzüngige Poeten die Florentiner Oberschicht schmähten …
Die einzige Zeitschrift, die in Montecatini regelmäßig angeliefert wurde, war Rossis Juristenblatt, das zum Fische einpacken taugte oder um an Langeweile zu sterben. Und dennoch, gestand sie sich ein, hatte sie die Hauptstadt, seit sie hier gestrandet war, um Rossis kleine Tochter zu erziehen, noch kein einziges Mal wirklich vermisst.
Sie beugte den Kopf vor, als sie hörte, wie die Haustür geöffnet wurde. Rossi schien den Kampf mit dem Kamin aufgegeben zu haben. Er trat mit seinem Sbirro in den Vorgarten hinaus.
»… hat man ewig Ärger«, tönte Brunos Bass durch die Winterluft. »Komödianten ist ein anderes Wort für Gesindel – da hat Signor Fabbri recht, wenn ich das so sagen darf. Die verstehen’s nur, wenn man Fraktur redet. Ein Tritt in den Hintern, sobald sie ihren Fuß in unsere Stadt setzen.«
»Ein Exempel statuieren.«
»Genau, ja. Man muss …«
Rossi unterbrach ihn gereizt, während er den Arm in seinen Mantel schob. »Das einzige Exempel, Bruno, das man statuiert, wenn man ein Exempel statuiert, ist das Exempel einer Ungerechtigkeit!«
»Giudice …«
»In meinem Gerichtsbezirk werden keine Exempel statuiert«, erklärte der Richter verdrossen. »Sollte ich dich jemals dabei erwischen – und es ist mir gleich, wie hehr deine Motive sind –, dann schmeiß ich dich raus. Das ist mein Ernst, Bruno.«
Die beiden überquerten den Marktplatz. Bevor sie in dem Gässchen neben dem Kaffeehaus verschwanden, drehte Rossi sich noch einmal um. »Es ist in Ordnung, Cecilia, du kannst ihn holen lassen.«
»Wen denn?«, fragte sie scheinheilig.
Zwei arbeitsreiche Stunden später drückte sie Vitale Greco einige Münzen in die Hand.
»Dass sie’s immer erst selbst versuchen«, murrte der Kaminfeger und nickte in Richtung Besen mit der Miene eines Mannes, dem die Torheit seiner Mitmenschen als Ranzen voller Steine auf den Buckel gepackt wird. Er war ein nervöser, dürrer, kleinwüchsiger Kerl mit raschen Bewegungen und einer unglaublichen Gelenkigkeit, die es ihm erlaubte, sich wie eine Ratte in den Kaminschloten zu bewegen. Des Übels Wurzel, das er in Gestalt eines Dohlennestes und der toten Nestbauerin aus dem Flugruß gezerrt hatte, lag auf einem Kehrblech.
»Er ist geläutert«, versicherte Cecilia und pustete in ihre kalten Hände. Sie hatte die Fenster offen stehen lassen in der Hoffnung, dass wenigstens ein Teil des Schmutzes den Weg nach draußen suchen und die frische Luft ihre Lungen reinigen würde. Inzwischen war es nicht mehr ganz so hell wie noch vor einer Stunde.
»Armes Ding.«
»Bitte?« Cecilia sah, dass der Kaminfeger aus dem Fenster spähte, und sie trat zu ihm und lugte neugierig ebenfalls auf den Marktplatz. Eine Kutsche rollte über das Pflaster, und als sie vorüber war, kam eine Frau zum Vorschein, die, auf eine Krücke gestützt, an dem weißen Marmordenkmal mit der römischen Dame vorbeihumpelte.
»Francesca Brizzi«, erläuterte Greco.
»Ich glaube nicht, dass ich sie kenne.«
Die Fremde war nicht mehr ganz jung, Mitte zwanzig vielleicht. Sie trug einen schlichten grauen Mantel mit einer weiten Kapuze, die sie zurückgeschlagen hatte. Ihre Hände steckten in dicken Wollhandschuhen. Trotz der Gehbehinderung strahlte sie etwas Kraftvolles, Zielstrebiges aus. Ihr Haar war lockig und hübsch, mit mehreren Schleifen gebunden, und sie hatte ein etwas kantiges Gesicht, das Cecilia aber sofort sympathisch fand.
Greco schnaubte durch die Nase. »Francesca kann von Glück sagen, dass sie ihr eigenes Geld verdient, und das sollte sie sich auch klarmachen, zum Trost. Am besten wäre es, wenn sie alles auf sich beruhen lässt. Ändern kann man jetzt sowieso nichts mehr. Und was man nicht ändern kann …«
»Worum geht es denn?«
»Haben Sie noch nicht davon gehört, Signorina? Was im Sumpf passiert ist? Scheußliche Sache!« Der Kaminkehrer zuckte die Achseln und schulterte sein Wegzeug. Mit einem Nicken verschwand er im Korridor.
Die hinkende Frau kam ihm durch den kleinen Vorgarten entgegen. Sie grüßte höflich, und er grüßte ebenso höflich zurück. Einen Moment später pochte es an der Tür.
»So kommen Sie doch bitte herein, Signora Brizzi.«
Natürlich war wieder niemand vom Personal zur Stelle, um zu öffnen. Sofia drückte sich vor jeder Arbeit, an die man sie nicht mit Gewalt zerrte, Anita hantierte in ihrer Küche, und wo Irene sich befand – die Zofe, die Rossi für die beiden Damen seines Hauses engagiert hatte –, mochte der Himmel wissen.
Cecilia wollte nach dem Mantel des Gastes greifen, doch die Fremde war zu sehr mit ihren eigenen Gedanken beschäftigt, um die Geste zu bemerken. Sie trat ins Speisezimmer und musterte stirnrunzelnd den Ruß an Möbeln und Wänden.
In diesem Moment erblickte Cecilia die Verunstaltung ihres Gesichts. Francescas linke Wange war nach innen gedrückt, durch eine Verletzung, bei der offenbar der Wangenknochen gebrochen war. Die Haut kräuselte sich über der verheilten Wunde in einer tassenförmigen Narbe mit ausgefransten Rändern. Eine Fratze. Allerdings nur halbseitig, denn der rechte Teil des Gesichts war bei dem Unfall, den es gegeben haben musste, völlig unversehrt geblieben.
»Also Signorina …«, begann Francesca Brizzi.
Cecilia errötete, als trüge sie durch ihr taktloses Starren eine Mitschuld an der Entstellung der jungen Frau. Rasch fiel sie ihr ins Wort: »Wenn Sie sich vielleicht setzen …«
»Das ist ein Bulle gewesen, im Stall meines Patenonkels. Ich hab mich dran gewöhnt.« Francesca hob gleichgültig die Schultern. »Das Bein hat er auch zertreten.« Sie lehnte die Krücke in eine Ecke, humpelte zu dem Sessel, von dem Cecilia eilig das Tuch herabzog, und ließ sich darin nieder. Ihr Blick wanderte zu dem Kehrblech, auf dem immer noch die Dohle lag, und sie starrte darauf, während sie nach den nächsten Worten suchte. »Wo ist Enzo? Ich muss ihn sprechen.«
»Nun, ich fürchte …«
»Mein Bruder ist ermordet worden.«
Schockiert suchte Cecilia nach einer Antwort. Was sagte man da? Herzliches Beileid? Wie entsetzlich, meine Liebe? Sie öffnete die Tür des Aufsatzschranks, um Wein und zwei Gläser herauszunehmen, doch der Ruß hatte auch vor dem Schrankinneren nicht haltgemacht. Durch den Korridor rief sie nach Irene. Dann zog sie das Laken von einem zweiten Stuhl und nahm der Fremden gegenüber Platz.
»Er ist nicht da?«, fragte ihre Besucherin.
»Leider. Und ich fürchte …«
»Er ist also nicht da.«
Cecilias Herz krampfte sich vor Mitleid zusammen. Mein Bruder ist ermordet worden. Signora Brizzi musste diesen Bruder sehr geliebt haben. Ihr Gesicht war steinern, und die Trauer umgab sie wie ein Panzer aus dickem, schwarzem Eis. Die Kälte, die von ihr ausströmte, ließ Cecilia frieren. »Ihr Bruder …«
»Mario.«
»Er hieß Mario?«
»Wir sind Zwillinge. Wir wurden innerhalb von wenigen Minuten geboren«, sagte die Frau, ohne dass sich ihre Züge belebt hätten.
»Tatsächlich.«
Francesca legte die Arme um den Oberkörper. Es sah aus, als fröre sie in ihrem schwarzen Eispanzer. Gedankenverloren machte sie Anstalten, sich selbst zu wiegen, doch als ihr einfiel, wo sie sich befand, ließ sie die Arme wieder sinken. »Sie wissen nicht, wann Enzo zurückkehrt?«
»Sicher bald.«
Es klopfte. Irene betrat mit ihrem üblichen hochnäsigen Knicks das Zimmer und servierte den Wein. Cecilia sah sie die Nase rümpfen über den groben Mantelstoff und die billigen Stiefel des Gastes. Verärgert schickte sie die Zofe wieder hinaus. »Was ist denn nun geschehen?«, fragte sie, nicht, weil sie es wissen wollte, sondern weil sie den Druck spürte, der den Eispanzer zu sprengen drohte.
Francesca richtete ihren Blick wieder auf die tote Dohle. Sie sprach sehr nüchtern, als sie berichtete. Ihr Bruder Mario war in einem der Häuser unten in den Sümpfen, in dem die Mönche ihre Dampfmaschinen aufgestellt hatten, tot aufgefunden worden. Neben der Maschine. Von Hunden zu Tode gebissen. »Die Viecher haben ihn umgebracht, aber Marios Mörder ist Sergio Feretti. Das weiß ich.«
»Sie wissen …?«
Francesca sprach weiter, als hätte sie den Einwurf gar nicht gehört. »Ich bin zum Giusdicente Lupori in Buggiano gegangen. Aber der sagt, die Beweise reichen nicht aus. Was soll das heißen, die Beweise reichen nicht aus?, hab ich ihn gefragt. Sergio hat meinen Bruder gehasst. Vor zwei Jahren hat Mario einen Bastard in Sergios Hundezwinger gelassen. Der Rüde hat eine der Hündinnen gedeckt. Aus Rache hat Sergio Marios Boot zerschlagen. Und dann war Krieg. Sergio hat Mario die Braut ausgespannt … Und nun hat er ihn umgebracht.«
Cecilia merkte, dass jemand die Haustür öffnete.
»Ist er das?«, fragte Francesca.
»Ich denke.«
Rossi musste die Stimme der Besucherin gehört haben, denn er kam ins Speisezimmer, ohne den Mantel auszuziehen. Seine Stiefel hinterließen matschige Rillen auf dem Dielenboden, die mit dem Ruß zu schwarzwässrigen Pfützen zusammenliefen. »Du?«, fragte er. Es klang weder erfreut noch verärgert. Eher begriffsstutzig.
Du?
Francesca wich dem Blick des Richters so wenig aus wie er dem ihren. Cecilia sah, wie sie die blassen, bläulichen Lippen aufeinanderpresste. Die Narbe in ihrem Gesicht spannte sich, und ihre Augen wurden lebendig. Sogar die Starre des Körpers ließ nach, als gäbe es plötzlich etwas Stärkeres als ihre Trauer. Und das war … Leidenschaft?
Warum Du?
Herausfordernd lehnte die Besucherin sich zurück. Eine stolze Geste von Frau zu Mann.
Du also. Cecilia blickte peinlich berührt zur Seite. Sie hatte nie darüber nachgedacht, dass es in Rossis Leben irgendwelche Liebschaften gegeben haben könnte. Aber die Blicke, die die beiden miteinander tauschten, waren von solcher Intimität, dass man sie kaum anders deuten konnte.
»Was ist denn los?«, fragte Rossi und zog sich einen Stuhl heran. Er warf seinen Mantel über die Lehne und setzte sich. Es war auffällig, dass er seinen Platz möglichst weit entfernt von der Besucherin gewählt hatte.
»Sergio Feretti hat meinen Bruder umgebracht.«
Das war das Letzte, was Cecilia hörte, bevor sie den Raum verließ. Enzo Rossi war mit ihrer Cousine Grazia verheiratet gewesen. Und selbst wenn er die Affäre mit Francesca erst nach deren Tod begonnen haben sollte – mit diesem liederlichen Kapitel in seinem Leben wollte sie nichts zu tun haben!
2. Kapitel
Sehr viel zu tun verschaffte ihr allerdings die Rußkatastrophe. Sofia mit den gichtigen Gliedern und dem maiskorngroßen Verstand war für eine umfassende Reinigungsaktion nicht zu gebrauchen. Also schickte Cecilia gleich am nächsten Morgen die Köchin Anita in die Via Fiesolana, um fragen zu lassen, ob ihre Tante und ihre Cousine bereit wären, das Haus zu putzen. Anschließend machte sie einen Rundgang durch den Palazzo, um den Umfang des Schadens zu begutachten.
Im Keller, der wegen der Hanglage Fenster zu den Olivenhainen besaß, befand sich die Küche. Cecilia fuhr mit den Fingern über die gescheuerten Töpfe, die an den Eisenhaken von der Decke hingen, und blickte auf schwarze Fingerkuppen. Hier würde in jedem Fall sauber gemacht werden müssen.
Anschließend begutachtete sie Dinas Zimmer, das noch hinter der Küche lag.
Rossis Tochter war ein Wildfang, und sie hatte das übliche Durcheinander hinterlassen. Kleider lagen auf dem Boden verstreut, neben dem Bett hing ein aus buntem Papier und Lumpen zusammengeschusterter chinesischer Drachen, und in einer Vase auf der Kommode standen selbst geschnitzte Pfeile, die eine Horde Kastaniensoldaten das Fürchten lehren sollten. Auf dem Bett thronte ihre Lieblingspuppe mit den blonden Haaren. Von dem Mädchen selbst war allerdings keine Spur zu entdecken, was Cecilia nicht wunderte, denn Dina besaß einen enormen Freiheitsdrang.
Kopfschüttelnd hob sie ein Buch mit französischen Gedichten auf, das das Kind wohl absichtlich zwischen Kommode und Bett geschoben hatte. Nein, mein Engel, dachte sie. Auf die kurze Kinderzeit folgt ein langes Frauenleben. Und das hat viel mit französischen Reimen zu tun. Dieser Kampf wird also ausgefochten werden. Obwohl – oder gerade weil – es deinen Papà nicht kümmert, was du hier treibst.
Cecilia strich über eine Stuhllehne und schaute wieder auf ihre Fingerspitzen. Der Ruß schien diesen Raum glücklicherweise verschont zu haben.
Die Zimmer im Obergeschoss hatten ebenfalls kaum etwas abbekommen, wohl weil sie nicht an den Schlot angeschlossen waren. Speisezimmer und Bibliothek würde man allerdings mit viel Wasser und Lauge reinigen müssen, und die schöne, grüne Samttapete im Speisezimmer war unwiederbringlich ruiniert.
Leider hatte Cecilia keine genaue Vorstellung davon, wie es im Geldbeutel des Hausherrn aussah. Sie führte ein Haushaltsbuch, das sie ihm regelmäßig vorlegte, aber er überflog es so gelangweilt, als wären die Zahlen das Ergebnis einer kindlichen Rechenübung, und gab nie einen Kommentar dazu ab. Er hatte schlicht keine Lust, sich mit Geldangelegenheiten zu befassen, und er brauchte es auch nicht, weil er so genügsam war wie ein Zaunpfahl.
Die Bücher sind dahin, aber neue Tapeten wird er bezahlen, beschloss Cecilia und nahm sich vor, in dem kleinen Laden in Buggiano nach Velintapeten zu fragen und Rossi das benötigte Geld dafür abzuschwatzen.
Letzteres versuchte sie noch am gleichen Tag, als sie ihm einen Becher seiner geliebten Pfefferschokolade ins Arbeitszimmer brachte. Rossi brütete über Papieren und kratzte mit der Stahlfeder über weiße Bögen. Es war kalt im Zimmer, aber das schien ihn nicht zu stören, so wenig wie es ihn störte, wenn er eine Mahlzeit ausließ oder zu Fuß die steinige Abkürzung durch die Brombeeren nach Montecatini Terme nahm.
Cecilia suchte nach einem Plätzchen für die Schokoladentasse und schuf es sich schließlich selbst, indem sie einige Bögen auf dem Tisch beiseite schob.
Rossi murmelte unwillig. So gleichgültig ihm der Rest des Hauses war, so zimperlich stellte er sich mit dem Arbeitszimmer an. Wenn man ihm glauben durfte, hatte darin alles eine ausgetüftelte Ordnung: die Büchertürme auf dem Boden, die Rollen und Kladden in den Regalen, die Entwürfe hier und die gehefteten Dokumente dort. Dass ja niemand etwas anrührte, geschweige denn von seinem Platz bewegte! Da der Raum dennoch einigermaßen sauber war, musste er gelegentlich selbst zu einem Putztuch greifen – eine irritierende Vorstellung, aber was war nicht irritierend an diesem Mann?
»Neue Tapeten? Wieso?«, wollte er wissen, als sie ihm ihr Anliegen vortrug.
»Weil es nötig ist.«
»Es ist nötig?«
»Ja.« Sie wusste, dass er es schätzte, wenn sie nicht lange um den heißen Brei herumstrich.
»Wie lange noch?«
»Wie lange noch was?«
»Die Putzerei. Das Geschnatter im Haus macht mich verrückt.«
»Zwei Tage.«
Wortlos zerknüllte er ein Papier und schleuderte es in die Ecke, wo sich bereits ein kleines Häufchen angesammelt hatte. Auch diese Häufchen beseitigte er selbst. Nichts wird hier angerührt! Von niemandem!
»Zwei, aber vielleicht auch drei«, meinte Cecilia. »Es kommt darauf an, wie viel Ruß sich in den Ritzen verkrochen hat. Unglaublich, was dieses Haus an Nischen und Eckchen aufzuweisen hat. Wir hätten gut daran getan, vor der Kaminreinigung die Türen abzudichten. Das hätte uns eine Menge Arbeit erspart. Oder besser noch: Gleich Signor Greco …«
»Zwei! Und keinen Tag länger.«
»Vorausgesetzt, Eusebia kann auch morgen zum Putzen kommen. Allein schafft Genoveffa das nicht so schnell. Aber auf Paolos Hintern sitzt ein Furunkel …«
»Cecilia …«
»Eusebias Enkel. Paolo. Er kratzt daran herum. Soll er krank werden, der arme kleine Engel?« Eines der Papierblätter war unlädiert zu Boden gesegelt. Cecilia versuchte mit schrägem Hals die Worte zu entziffern. Gedrechselte, mit lateinischen Ausdrücken gespickte Wendungen, in denen item und ergo fröhliche Reigen tanzten. Sicher etwas, was mit Rossis Arbeit in der Kommission zu tun hatte.
»Ich hab’s verstanden«, gab Rossi mit einem Stöhnen nach. »Ich bin schuld, ich werde dir Tapeten bezahlen.«
»Und schon lass ich dich in Ruhe.«
»Es geht um die Finanzpacht, Weib«, erklärte er gequält. »Ich weiß, du hältst es für Böswilligkeit. Aber Finanzpacht ist ein kompliziertes Gebiet. Tausenderlei Interessen sind gegeneinander abzuwägen …«
Cecilia lachte. »Morgen Abend ist alles sauber.«
»Das Gesetz besteht aus so vielen Ausnahmen, Besonderheiten und Gewohnheitsrechten, dass man damit um ganz Florenz einen Kranz flechten könnte. Es hängt mir, ehrlich gesagt, zum Hals heraus. Ich will einfach damit fertig werden.«
Die Finanzpacht mag jedermann zum Hals heraushängen, aber nicht dir, dachte Cecilia. Enzo Rossi liebte seine juristischen Tüfteleien wie andere Leute Anagramme oder Zahlenrätsel. Ihn machte weder der Hausputz noch die Finanzpacht verrückt, sondern diese Signora Brizzi, Francesca, mit den leidenschaftlichen Augen. Darauf hätte sie wetten mögen. »Konntest du der Dame behilflich sein?«, fragte sie.
»Welcher Dame?«, grummelte er.
»Francesca Brizzi.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
Seine Lippen kräuselten sich. »Weil der Mord nicht in meinem Gerichtsbezirk geschehen ist. Sehe ich aus wie der Granduca, der sich in alles einmischen darf?«
»Ein schrecklicher Tod. Die arme Signora.«
»Ja.« Es war eindeutig, dass er keine Lust hatte, weiter über seine vergangene Liebe zu reden.
»Morgen ist der Lärm vorbei«, versprach Cecilia ihm noch einmal.
»Und die Tapeten?«, hielt er sie zurück. »Wie lange dauert es, das Zeug an die Wand zu bringen?«
»Kommt drauf an.«
»Auf Paolos Hintern?«
»Ob sie geklebt oder gespannt werden.«
»Seit wann klebt man Tapeten?«, fragte er verblüfft.
»Es ist preisgünstiger. Man fertigt Bögen aus Velinpapier, bedruckt sie mit Temperafarben und klebt sie direkt auf den Putz.«
»Und das geht schneller, als sie zu spannen?«
»Ja«, behauptete Cecilia.
»Es geht nicht schneller.«
»Vielleicht, ich habe keine Ahnung.«
Rossi legte die Feder, mit der er geschrieben hatte, aus der Hand, lehnte sich zurück und seufzte. »Wie bist du in mein Leben gekommen, Cecilia Barghini?«
»Durch unentschuldbare Leichtfertigkeit deiner- und meinerseits. Wir haben einen Moment nicht aufgepasst, und da ist es eben passiert.«
Sie sah ihn lächeln, zum ersten Mal seit er den Kamin gereinigt hatte. »Also gut. Morgen ist Dienstag. Ich muss in Buggiano rapportieren, und Secci leiht mir dafür seine Kutsche. Komm also mit, kauf die verfluchten Tapeten und lass sie kleben, wenn es dich glücklich macht.«
Buggiano war ähnlich wie Montecatini in zwei separate Ortschaften aufgeteilt. Die verschlafene Altstadt, die bergauf an der alten Frankenstraße lag und aus einer berühmten Kirche und hübschen alten Häusern zwischen Zitronengärten und Thymianhängen bestand, und dem moderneren, in der Ebene gelegenen Ort, der sich aus dem zur Burg gehörigen Marktflecken entwickelt hatte. Das Geschäft mit den Tapeten befand sich wie die meisten Geschäfte unten im Tal.
»Erst die große Kröte, dann die kleine«, sagte Rossi und lenkte den Wagen die Bergstraße hinauf.
Die kleine Kröte, die er schlucken musste, waren die Tapeten. Die große der Besuch bei seinem Vorgesetzten, Giusdicente Lupori. Während sie den Weg hinaufzuckelten, wunderte Cecilia sich wieder einmal, mit welchem Gleichmut die beiden Männer zum Alltag übergegangen waren, nachdem Lupori seinen Untergebenen durch eine hundsgemeine Intrige ins Gefängnis verfrachtet und damit beinahe umgebracht hätte. Das war etwas, was sie nicht verstand. Rossi brüllte durch sein Gericht, wenn jemand es wagte, in seinem Allerheiligsten auf den Boden zu spucken, er stritt mit Goffredo wegen der Lizenzen, aber dem Mann, der ihn hatte ermorden wollen – und sie nannte es Mord, auch wenn damals alles nach Recht und Gesetz vor sich gegangen war –, begegnete er mit unerschütterlicher Höflichkeit.
»Wird sie schwer zu schlucken sein, die Kröte?«, fragte sie, als sie den Hof vor Luporis Gericht erreichten.
»Nichts, was einen umbringt«, erwiderte er abweisend und sprang vom Bock.
Cecilia rieb die Hände im Muff. Es war nicht mehr ganz so kalt wie in den letzten Tagen, aber wenn man gezwungen war, unbeweglich auf der Bank eines Lando auszuharren – eines vorsintflutlichen, äußerst zugigen Lando, dem ausrangierten Gefährt, das Rossis Assessore ihnen bei Bedarf auslieh, weil Rossi keine Lust hatte, sich ein eigenes anzuschaffen –, dann zwickte die Kälte in jedes Glied.
Sie brauchte allerdings nicht lange zu warten. Rossi hatte das ehrwürdige Gerichtsgebäude kaum betreten, da kehrte er auch schon zurück. Er wendete den Lando und bog in die Gasse ein, in der es steil wieder hinab zum Tor ging. Sein Blick war steinern, ansonsten verlor er kein Wort.
Cecilia mummelte sich tiefer in ihre Decke und genoss den Blick auf die Hügel mit den zypressengesäumten kurvenreichen Wegen und die Weinäcker, die sich bald darauf vor ihr ausbreiteten. Über den Äckern flatterten Vögel, deren schwarzes Gefieder in der Januarsonne glänzte. Jemand hatte eine Vogelscheuche aufgestellt, die mit einem ramponierten Zylinder und an den Stamm gehefteten Stiefeln ihren Besen schwang, um die Amseln und Krähen zu verscheuchen – allerdings ohne sichtbaren Erfolg. Kinder rannten einen steinigen Pfad hinauf, und aus einer Bauernkate mit angebautem Ziegenstall wehte der Geruch von angebratenem Knoblauch. Sie fand es beinahe schade, als der Lando die letzte Kurve nahm und in den Marktflecken einbog.
Borgo a Buggiano zog sich an einer Hauptstraße entlang, die schließlich auf den Markt mündete. Es war Markttag und entsprechend jede freie Fläche von Händlern besetzt oder von ihren drängelnden Kunden beschlagnahmt. Gänse schnatterten in mistverschmierten Käfigen, ein Rechenmacher pries von einer umgedrehten Regentonne herab seine Geräte an … hält hundert Jahre, wer jetzt nicht kauft, zahlt morgen das Doppelte …, Bäuerinnen schwatzten hinter den Melkeimern und Küchenfässchen, die sie verkauften, Kühe brüllten und stampften in den eigenen Fladen … Diskret hielt Cecilia sich den Muff vor die Nase. Irgendwo wurden Maronen gegart. Sie hatte Hunger, aber diesem Gemisch – Fladen und Maronen und dazu die Ausdünstungen der Menschen – war ihr Magen nicht gewachsen. Vielleicht reagierte er auch auf das Schaukeln des Landos.
Rossi lenkte ihr Gefährt stoisch durchs Gewühl. Sie kamen nur schrittweise voran und mussten sich eine Latte von Flüchen anhören.
Schließlich tauchte am Endes des Markts das rot-goldene Schild auf, mit dem Giovan Battista Redi sein Geschäft anpries: Decorazione e Tappezzeria. Rossi sicherte den Wagen mit der Bremse und half Cecilia über das Treppchen auf die Straße. Eine kalte Windbö blies ihr ins Gesicht. Sie wich einem Mann mit einem weißen Pelzmantel aus und dann einem Jungen, der auf einem Brett Salzfische balancierte …
Und in diesem Moment sah sie die Frau.
Man hatte sie in eine Trülle gesperrt, einen drehbaren Pranger aus hölzernen Gitterstäben, ähnlich einem Vogelkäfig, mannshoch und so breit im Durchmesser, dass gerade eine Person darin Platz hatte. Um den Pranger tobte die übliche Bande von Gassenjungen, die sich damit vergnügten, der Trülle Stöße zu versetzen, um sie zum Kreiseln zu bringen. Das Strafinstrument war gut geschmiert, und so sauste der runde Käfig bald in diese und bald in jene Richtung.
»Rossi, warte …«
Aber er hatte bereits in dieselbe Richtung geschaut. Sie sah, wie er erbleichte. Man hatte Francesca Brizzi die Krücke fortgenommen. Daher musste sie das gesunde Knie gegen das Gitter drücken, um nicht in sich zusammenzusinken. Ihre Hände umklammerten die Holzstäbe. Ihre Lippen waren blau vor Anstrengung oder vor Kälte, denn sie trug nur ihr fadenscheiniges Kleid. Der Mantel lag neben der Trülle auf dem Boden.
Entsetzt griff Cecilia Rossis Arm.
Die Trülle drehte sich in einem neuen Wirbel. Die Jungen schubsten sich und lachten über die Bemerkung einer Frau, die sich an ihnen vorbeidrängte. Ein Mann mit einer verdreckten blauen Perücke spuckte in den Käfig. Er feierte seine Zielsicherheit mit einem erfreuten Schenkelklopfer.
Als Rossi ihre Hand abstreifte, zuckte Cecilia zusammen.
»Verschwinde. Kauf die Tapeten.«
Die Trülle bekam einen neuerlichen Stoß. Es war eigentlich unmöglich, dass Francesca in diesem Gewimmel, das an ihr vorbeisauste, irgendeine bestimmte Person ausmachen konnte, und doch schien es Cecilia, als würde sie ihr in dem kurzen Moment, in dem der Schwung des Käfigs nachließ, direkt ins Gesicht schauen.
Sie wollte etwas sagen, aber Rossi schob sie zur Tür. Und im nächsten Augenblick wurde sie von der Eleganz des Einrichtungsladen umfangen. Der Lärm brach ab. Es war, als hätten sich Markt, Trülle und das gesamte vulgäre Pack, das sich dort tummelte, in Luft aufgelöst. Als Cecilia sich umdrehte, sah sie durch das Fenster, wie Rossi auf den Lando sprang. Die Trülle war ihren Blicken entschwunden.
»Signora, buongiorno.« Eine rundliche Dame steuerte auf sie zu und wedelte mit den Händen. Und in der folgenden halben Stunde war jeder Gedanke, der sich nicht mit Einrichtungen und Tapeten befasste, unmöglich.
Signor Redi selbst war nicht anwesend, wie die Dame ihr auseinandersetzte, aber sie kannte sich ebenfalls vorbildlich aus im Geschäft, denn sie war Signor Redis Schwiegermutter, und ehemals hatte das Geschäft ihrem leider viel zu früh verstorbenen Gatten gehört. Aber natürlich stand sie auch dem Schwiegersohn zur Seite, und das von Herzen gern, denn der Schmuck eines Hauses berührte doch das Weibliche in seiner tiefsten Form, und gerade Wandbekleidungen …
Cecilia schaute zur Tür, aber ein Vorhang sperrte den Markt aus. Die Signora empfahl ihr Velintapeten, wie sie erwartet hatte, und zwar marmoriert, sowohl für das Speisezimmer als auch für die Bibliothek und die Diele. In einem Ockerton, der so neutral war, dass er sich auch mit dem schwierigen Grün, das Cecilia beschrieb, aufs Günstigste vermählen würde. Sie hatte Farbproben. Wenn die Signorina einmal schauen wollte … Vielleicht konnte man in einem kleineren Zimmer auch ein zartes Malvenrot wagen …
Ich hätte zu ihr gehen und ihr Mut zusprechen müssen, dachte Cecilia, während ihr Blick wieder zur Tür irrte. Obwohl – vielleicht hätte es Francescas Kränkung auch verdoppelt, wenn sie gemerkt hätte, dass sie von einer ihr bekannten Dame gesehen wurde. Sie weiß es sowieso, dachte Cecilia. Wir haben einander in die Augen geschaut. Und Rossi war einfach davongefahren. Himmel, was hatte er vor? Sie sah ihn vor sich, wie er sich wutentbrannt auf den Mann stürzte, der seine Geliebte in Schande brachte.
»Signora?«
»Verzeihung. Ja?«
»Ich fragte, wann die Ware geliefert werden soll.«
Ware … »Möglichst bald. Morgen.«
Morgen war, wie das Lächeln der Schwiegermutter andeutete, lächerlich. Möglichst bald hieße: In zwei Wochen, denn zuvor mussten ja die Bögen bedruckt werden, und Signor Redi befand sich, wie schon erwähnt, auf Reisen … »Aber unsere Handwerker sind äußerst schnell und sauber, Signorina Barghini.«
»Davon bin ich überzeugt.« Cecilia nahm ihren Pompadour auf. Sie würde zur Trülle gehen. Sie würde dafür sorgen, … ja was? Dass Francesca ihren Mantel bekam! Und dass der verdammte Büttel endlich seine Pflicht tat und die Delinquentin vor Belästigungen schützte.
»Felice giorno, Signorina Barghini, es war mir eine außerordentliche Freude …«
Der Lärm vor dem Geschäft traf Cecilia wie ein Schlag ins Gesicht. Das Gedränge um die Trülle war noch größer geworden, ein Hexenkessel. Aber es ging nicht mehr um Francesca. Die Menschen hatten neben dem Fischstand einen Halbkreis gebildet und starrten aufs Höchste gespannt in ihre Mitte. Cecilia konnte zwar nichts sehen, doch dann hörte sie die verhasste, schmeichelnde Stimme Luporis. Er schien auf eine Uhr zu schauen, denn er sagte: »Noch einen kurzen Augenblick, verehrter Herr Kollege. Bis Punkt zwölf. Alles hat seine Ordnung.« Keckernd lachte der Mann auf. »Aber was muss ich Ihnen das erzählen?« Einen Moment war es Cecilia, als röche sie den widerlichen, süßen Parfümpuder, mit dem der Giusdicente immer die Perücke bestäubte.
Eine Frau zog ihre beiden Kinder aus dem Kreis, und Cecilia erhaschte einen kurzen Blick auf Rossi, der, immer noch bleich wie der Tod, auf die Trülle stierte. Dann begann die Kirchturmuhr zu schlagen, und der Büttel setzte sich in Bewegung. Unter dem Schweigen der Menge, die zu spüren schien, dass ihr Johlen nicht mehr angebracht war, wurde Francesca aus dem Strafgerät entlassen. Die Leute wichen zurück, und Cecilia sah, wie die Frau elend und schwach vorwärts wankte. Rossi lief ihr entgegen, um sie zu stützen, und sie warf sich blind in seine Arme.
Jetzt war auch Lupori zu erkennen, der neben seiner Kutsche mit dem protzigen Wappen stand. Seine Lippen kräuselten sich vor Befriedigung. Sicher hatte er kein Mitleid mit einer Frau, die bespuckt wurde. Aber dieser Anblick – Rossi verstört, Francesca hemmungslos weinend – musste ihm ein Fest sein. Er drehte sich um, steif von der Krankheit, die ihn plagte, und ließ sich von seinem Kutscher aufs Gefährt helfen. Im Knopfloch seiner Weste stak das obligatorische Blumensträußchen – Kunstblumen aus zartrosa Seide.
Mistkerl, formte Cecilia stumm mit den Lippen.
Als er fort war, wandten die Leute sich wieder ihren Einkäufen zu. Rossi sagte etwas zu Francesca, und Cecilia sah, wie die Seifensiederin sich ungestüm frei machte. Sie schaute sich um, als würde ihr erst jetzt wieder klar, wo sie sich befand und an wen sie sich geklammert hatte. Ihr Gesicht verhärtete sich. Heftig schüttelte sie auf eine Frage Rossis den Kopf. Dann humpelte sie zu ihrer Krücke und verließ mit schlurfenden Schritten, aber hoch erhobenen Hauptes, den Markt.
Der Mantel, dachte Cecilia, doch da war Francesca schon verschwunden. Sie ging hinüber zur Tülle und hob das graue Kleidungsstück auf und dann auch noch die Wollhandschuhe, die darunter lagen. Sie war zutiefst niedergeschlagen.
Rossi begann erst wieder zu sprechen, als er den Lando aus dem Borgo auf die Landstraße gelenkt hatte. »Sie ist zu Lupori gegangen und hat ihm Vorwürfe gemacht, weil er wegen Marios Tod nicht ermittelt. Er ist kein Mann, der sich beschimpfen lässt – das hätte sie wissen müssen.«
So war also das Resümee? Cecilia hieb mit der Faust neben sich auf den Sitz. Aber natürlich war es nicht gerecht, Rossi etwas vorzuwerfen. Wie er ganz richtig gesagt hatte: In Buggiano waren ihm die Hände gebunden. Einen Moment versuchte sie sich vorzustellen, wie es sein mochte, bespuckt zu werden. Nahm man als Frau aus dem Volk so eine Schande gleichmütiger hin? Nein, Francesca war alles andere als gleichmütig gewesen. Verdammt seist du, Lupori!, dachte Cecilia mit Leidenschaft.
Sie sah, dass Rossi mit beiden Händen die Zügel umklammerte. Halblaut murmelte er: »Francesca hat mit dem Seifensieden begonnen, als der Abfluss des Sumpfes bei Ponte a Cappiano gestaut wurde und die Moorseen auszutrocknen begannen. Die Fischer haben nichts mehr gefangen. Mario hat rebelliert, aber Francesca hat gesagt: Vorbei ist vorbei, und mit der Seife angefangen. Sie hat einen nüchternen Verstand. Ich habe ihr erklärt, dass Lupori gefährlich ist, eine Natter. Ich dachte, sie hätte es begriffen. Und dann geht sie hin und beschimpft ihn.«
»Und was hast du zu ihm gesagt?«, fragte Cecilia.
Er lächelte bitter und schwieg.
Als Cecilia beim Verlassen der Kutsche Francescas Mantel an sich nahm, entschied sie, dass es das Beste sei, ihn Abate Brandi zu übergeben, dem Benediktinermönch, der für den Granduca das Kurbad errichtete.
Denn obwohl Francesca ihren Mantel natürlich zurückbekommen musste – er war ja ihr einziger Schutz gegen die Kälte –, würde niemand erwarten können, dass sie selbst die Botin spielte für die Frau, mit der der Mann ihrer Cousine eine Liebschaft gepflegt hatte.
Warum, dachte sie einen Augenblick später etwas weniger überheblich, dafür aber umso besorgter, hatte das Weib sich nur vor all den Leuten in Rossis Arme werfen müssen? Ungeschickter ging es ja wohl kaum. Unter den Augen Dutzender Menschen. Ihr ist schwindlig gewesen, sie hat nicht nachgedacht, flüsterte die barmherzige Cecilia, aber die andere Cecilia, die klar erkannte, zu was die Gerüchte diese törichte Begebenheit aufbauschen würden, war einfach nur verärgert. Sie hatte keine Ahnung, ob Lupori Rossi aus seinen Amouren einen Strick drehen könnte, aber die Ratlosigkeit machte sie nur noch wütender.
Gemäß ihrem Entschluss begab sie sich bei nächster Gelegenheit hinab nach Montecatini Terme, wo der Abate fast immer zu finden war.
Der neue Ortsteil präsentierte sich als riesige Baustelle. Überall wuchsen die in klassizistischem Stil errichteten Sanatoriumsgebäude heran, in denen nach dem Willen des Granduca Leopoldo die Kranken der Toskana Heilung von ihren Darmleiden finden sollten. Die schwefelhaltigen Quellen waren bereits in alter Zeit bekannt gewesen. Nach ihrer kurzzeitigen Nutzung im Mittelalter waren die Bäder jedoch verfallen, und erst unter dem unermüdlichen Leopoldo hatte man sich wieder des kostbaren Besitzes erinnert. Der Granduca hatte den Wiederaufbau den Benediktinern der Badia Fiorentina übertragen und damit von ihrer Aufgabe begeisterte Männer gefunden. Schon jetzt, am frühen Morgen, sah man Mönche vor unverputzten Mauern stehen und an frisch gegossenen Fundamenten vorbeieilen.
Cecilia erkundigte sich nach dem Abate und fand ihn schließlich mit einer Bauzeichnung in der Hand im Gespräch mit einem älteren Mann, den sie für einen Architekten hielt. Die beiden inspizierten ein Röhrensystem, das kreuz und quer in einem abgezäunten Rechteck verlief. Sie wartete, bis der Architekt sich verabschiedet hatte.
»Brizzi? Francesca Brizzi?«, brummte der Abate, als sie ihr Anliegen vortrug. Unwillig schüttelte er den Kopf – eine kahle Kugel, die auf einem dünnen Geierhals saß und völlig unpassend einen voluminösen Körper krönte. »Das ist doch die Schwester von diesem verdamm… nun gut, Gott hat den Mann zu sich genommen, und ich bin der Letzte, der einem Toten etwas Schlechtes nachsagt. Wissen Sie, was er getrieben hat?«
Cecilia schüttelte den Kopf.
»Ist mit seinesgleichen durch die Nacht geschlichen und hat mir die Dampfpumpen ruiniert. Gestänge zerschlagen, Sand ins Räderwerk geschüttet, sogar Brandstiftung. Er war einer der Anführer – das schwöre ich. Ein verbrecherisches Subjekt. Und dumm dazu, wo doch die Sache mit den Teichen längst entschieden ist. Wir brauchen das Wasser hier oben. Der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Habe ich den Kerlen auch erklärt, als sie kamen, sich zu beschweren. Ich habe kein Herz aus Stein, aber der Fortschritt …«
»Abate Brandi …«
»Will damit natürlich nicht sagen, dass es mir recht wäre, wie er umgekommen ist. Eine schreckliche Sache.«
»Ja wirklich.«
Der Abate streichelte mit der fetten Hand über die Zeichnung, die er inzwischen zu einer Rolle gedreht hatte, und linste zu seinen Rohren hinüber. »Sie können mir den Mantel natürlich trotzdem hierlassen. Werde Frater Michele schicken, der kann ihn der Signorina bringen und Trost spenden und all das … Na ja, wenn sie überhaupt will. Scheint ja auch ein aufsässiges Subjekt zu sein, wenn sie in der Trülle steckte.«
Cecilia legte ihren Arm um den Mantel in dem plötzlichen Gefühl, als müsste sie ihn vor dem Mönch beschützen. »Ich sehe, Sie sind ein viel beschäftigter Mann, Abate …«
»Dürfen mich nicht für herzlos halten. Aber es war eine mörderische Arbeit, die Maschine auseinanderzunehmen und von dem Sand zu reinigen, das kann ich Ihnen versichern! Gehen Sie einfach zu Fra Michele …« Brandi nickte ihr zu, und dann war er auch schon fort, zuerst mit den Blicken, gleich darauf mit den Füßen. Ein Lastkarren, von zwei Ochsen gezogen, brachte Steine.
Als Cecilia kurz vor der Dämmerung heimkam, stürmte ihr Anita durch den Vorgarten entgegen. Die junge Köchin hatte einen feuerroten Kopf und verweinte Augen. »Es hat wieder gekracht, Signorina.«
»Was denn?«
»Die Kleine und der gnädige Herr. Er hat sie verhauen, und sie liegt in ihrem Bett und weint. Der Giudice hat gesagt, sie bekommt kein Abendbrot. Und Irene …« Der Name war eingebettet in einen Schwall unausgesprochener Schimpfwörter. »… sagt, ich darf nicht zu ihr ins Zimmer. Ich verderbe sie! Ist das zu glauben? Mit einem Dörrobstkrapfen verdirbt man ein Kind? Hat man das je gehört?«
Cecilia merkte, wie sich hinter ihrer Stirn ein Kopfschmerz zusammenbraute. Dieser Tag war von der ersten Stunde an scheußlich gewesen. Und nun auch noch Sturm im eigenen Haus.
Sie ging in das Kinderzimmer hinab, wo Dina auf ihrem Bett lag, die Beine angezogen, im Arm ihre Puppe, an deren Hand sie nuckelte.
»Ich war’s nicht, und es ist gemein, dass er mir nicht zuhört.« Sie konnte sprechen, ohne die Puppenhand aus dem Mund zu nehmen.
»Du warst was nicht?« Cecilia setzte sich auf die Bettkante und entzog ihr die Puppe, während sie gleichzeitig eine Decke über sie ausbreitete. Dieses magere Äffchengesicht, dachte sie. Diese wilden Augen, bei denen man nie weiß, ob sie Grazias Leidenschaft oder Rossis Ungeduld spiegeln. Wo waren eigentlich die Schleifen geblieben, die Irene dem Mädchen am Morgen mit so viel Ziepen in die Haare gesteckt hatte?
»Piero Pinelli hat auf Giulios Schuh gepinkelt, und da hat Giulio mit dem Stein nach ihm geworfen. Giulio hat geworfen! Sein Stein hat das Glasding getroffen, aber ich bin nicht dran schuld. Ich hab nur dabeigestanden – und nicht mal gelacht.«
»Dina, mein Kind …«
»Ich hab Piero auch nicht geärgert. Das waren die Jungs.«
»Mitgegangen, mitgehangen«, erklärte Cecilia weise.
»Mein Vater hat mir nicht verboten, mit Piero und Giulio zu spielen, also kann er mich deshalb …«
»Er hat dir verboten, allein draußen herumzustreunen.«
»Hat er nicht. Sie haben das verboten, Cecilia. Ihm ist egal, was ich mache.«
»Das stimmt doch nicht, Schätzchen«, widersprach Cecilia. Sie seufzte und erhob sich. Einen Moment war sie unschlüssig, ob sie das Abendbrotverbot aufheben sollte, aber sie entschied sich dagegen. Keinem war gedient, wenn sie Dina in dem Glauben bestärkte, in Cousine Cecilia eine Verbündete gegen den Vater zu haben. Stattdessen machte sie sich auf den Weg ins Arbeitszimmer.
Der Raum war leer. Auf dem Boden lagen immer noch die zerknüllten Papierbällchen, und auf der Schreibtischplatte stand eine leere Fiascoflasche. Die Tür zu dem schmiedeeisernen Balkon war geöffnet, eisige Luft wehte herein. Nachdem Cecilia sie geschlossen hatte, kehrte sie in die unteren Räume zurück. Es war inzwischen dunkel, und Irene war damit beschäftigt, die Öllampen zu entzünden.
»Der Giudice?«, fragte sie. »O ja, er ist fort. Er hat das Kind ausgescholten …« Das Kind, dachte Cecilia und schnitt in Gedanken eine Grimasse, weil das Wort aus Irenes Mund klang, als wäre von einem Möbelstück die Rede. »… und dann ist er fortgegangen. Er geruhte allerdings nicht, mir anzuvertrauen, wohin er …«
»Schon gut, schon gut.«
Als Rossi heimkehrte, war er schlechter Laune. »Was?«, fragte er, als er sich aus dem Mantel geschält hatte und Cecilia sein Gesicht zuwandte.
Sie ging ihm voran ins Speisezimmer und schloss die Tür. »Du hättest sie zumindest anhören können.«
»Ich habe sie angehört.« Er nahm die Kerze vom Aufsatzschrank und entzündete damit die Öllampe auf dem Tisch.
»Die ganze Geschichte – einschließlich Piero Pinelli und Giulios Schuh?«
»Bitte?«
»Du hast bedacht, dass Giulio geworfen, Dina aber nur dabeigestanden hat?«
»Dina!« Er stellte die Lampe ab, nahm einen Bogen bunt bedruckten Papiers vom Tisch und warf ihn nach einem kurzen Blick auf das Geschriebene wieder zurück. »Ich war bei Francesca. Ich hatte gehofft, sie zur Vernunft bringen zu können, wenn ich noch einmal mit ihr rede. Aber sie war nicht da.« Er ließ sich in seinen Sessel sinken.
Sei froh, dachte Cecilia. »Dina …«
»… lügt. Sie sagt, was ihr in den Sinn kommt. Das war schon immer so bei ihr.«
»Mich belügt sie nicht.«
»Dann hast du Glück. Oder ein getrübtes Auge. Sie ist wie Grazia – sie biegt sich die Dinge so zurecht, wie es ihr am besten passt.«
Grazia, dachte Cecilia gereizt. Immer wieder Grazia. Dina verehrte ihre tote Mutter bis ins Schwärmerische. In der Erinnerung des Kindes war sie zu einem Engel geworden, der unter dem hartherzigen Ehemann zu leiden gehabt hatte, und es bereitete ihr ausgesprochene Freude, die boshaften Bemerkungen nachzuplappern, die die vergötterte Mutter über den Vater gemacht hatte. Rossi andererseits fühlte sich durch das Mädchen ständig an die verhasste Ehefrau erinnert. Wie reißt man Bretter von den Köpfen?
»Du kannst das ruhig lesen.«
»Was?«
»Die Ankündigung. Du starrst schon die ganze Zeit darauf.«
»Ich starre auf gar nichts.« Cecilia nahm das Papier vom Tisch und hielt es gegen das Kerzenlicht. Es handelte sich um den Entwurf eines Plakats, in dem angekündigt wurde, dass zum Karnevalsende von der Compagnia Ferrari König Hirsch dargeboten werden würde – ein tragikomisches Märchen, zur Erheiterung und Belehrung der geschätzten Zuschauerschaft. Eintritt einen halben Julio. Mit der an den Rand gekritzelten Frage, ob Rossi seine Genehmigung zur Aufführung erteilen würde.
Cecilia fühlte, wie ihr Herz zu flattern begann. »Wer führt diese Truppe?«
»Weiß ich nicht.«
Nun, Inghiramo auf gar keinen Fall. Der Mistkerl war nach Neapel gegangen, nachdem er sie in Großmutters Laube geschwängert hatte. Er war froh gewesen, dem Dilemma mit heiler Haut entkommen zu sein, und würde sich ihr niemals wieder freiwillig nähern. Außerdem, dachte Cecilia, würde er sich nicht dazu erniedrigen, eine Komödie aufzuführen. Wo er doch das Heitere so verachtete. Er war ein Mann der Tragik, der bedeutungsschweren Worte, ein … ein Lump, so aufgeblasen wie eine Kröte. Sie ärgerte sich, dass sie überhaupt einen Gedanken an ihn verschwendete.
»Mario Brizzi wurde von umherstreifenden Banden ermordet«, murmelte Rossi. »Das ist Luporis Version. Francesca kann sie nicht entkräften.«
»Ja, aber ich …«
»Wenn es tatsächlich Beweise dafür gäbe, dass Sergio Feretti bei dem Mord seine Finger im Spiel hatte, müsste Lupori das untersuchen. Die existieren aber nicht. Mario Brizzi war ein Hitzkopf. Seine Liebste hat ihn sitzen lassen und sich mit Feretti zusammengetan, der ein übler Kerl ist und den ich nicht ausstehen kann. Aber … begreifst du? Wenn Feretti