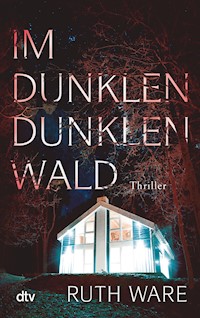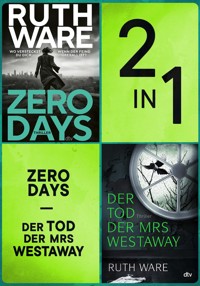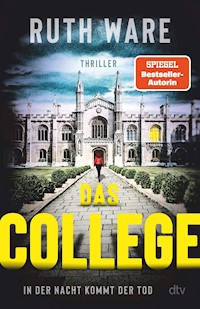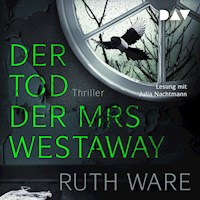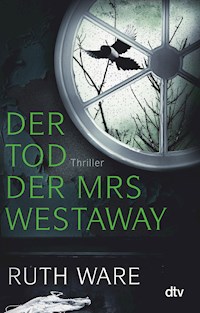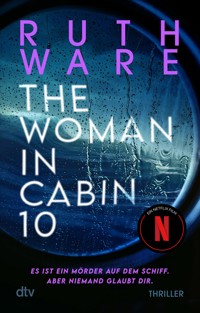
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben hat? Was tust du, wenn du Zeugin eines Mordes wirst – und niemand glaubt dir? Ein Luxusschiff mit Kurs auf die norwegischen Fjorde. Eine Frau, die Zeugin eines Mordes wird. Aber hat es diesen Mord wirklich gegeben? Meisterhaft erzählte Psycho-Spannung Die Reise auf einem Luxusschiff mit Kurs auf die norwegischen Fjorde: Für die Journalistin Lo Blacklock ein wahr gewordener Traum. Doch gleich in der ersten Nacht auf See erwacht sie von einem Schrei aus der Nachbarkabine. Sie hört, wie etwas ins Wasser geworfen wird – etwas Schweres, wie ein menschlicher Körper. Lo alarmiert den Sicherheitsoffizier. Aber die Nachbarkabine ist leer, ohne das geringste Anzeichen, dass hier jemand gewohnt hat. Die junge Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert zu haben. Wie kann eine Frau verschwinden, die es nie gegeben hat? »Ein packender Thriller, der die Leser völlig in seinen Bann schlagen wird. Vorsicht, die letzten Kapitel könnten Herzrasen verursachen.« Library Journal »Ein atmosphärischer Thriller, voller Spannung und unvorhersehbarer Wendungen.« The Washington Post Ein stilvoller Thriller mit einer fehlbaren, aber sympathischen Heldin und einem rasanten Plot.« Sunday Mirror
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über das Buch
Eine exklusive Luxuskreuzfahrt durch die norwegischen Fjorde: Für Lo Blacklock ist es ein wahrgewordener Traum. In der ersten Nacht auf See erwacht die Journalistin von einem Geräusch aus der Nachbarkabine. Und dann hört sie, wie etwas ins Wasser geworfen wird. Etwas Schweres, ungefähr von der Größe eines menschlichen Körpers. Und die Reling ist blutverschmiert. Lo alarmiert den Sicherheitsoffizier. Doch die Nachbarkabine steht leer. Keine Kleider, keine Blutspuren sind darin zu finden. Und es gibt auch keinen Eintrag im Passagierregister. Die Frau aus Kabine 10, mit der Lo noch am Vortag gesprochen hat, scheint nie existiert zu haben ...
Von Ruth Ware sind im dtv außerdem erschienen:
Im dunklen, dunklen Wald
Wie tief ist deine Schuld
Der Tod der Mrs Westaway
Hinter diesen Türen
Das College
Das Chalet
Zero Days
Ruth Ware
The Woman in Cabin 10
Thriller
Deutsch von Stefanie Ochel
Für Eleanor
In meinem Traum trieb die Frau in den kalten, lichtlosen Tiefen der Nordsee, weit unter den peitschenden Wellen und den Schreien der Möwen. Ihre lachenden Augen waren weiß und vom Salzwasser aufgequollen, die bleiche Haut runzlig, und ihre Kleider hingen, von spitzen Felsen zerrissen, in Fetzen an ihrem Leib.
Ich sah ihre langen schwarzen Haare, die im Wasser wie dunkles Seegras wogten, sich in Muscheln und Fischernetzen verfingen und von der Strömung ans Ufer gespült wurden. Wie schlaffe, zerfranste Seile lagen sie am Strand, während das Geräusch der Wellen, die unablässig gegen den Kies schlugen, in meinen Ohren dröhnte.
Als ich aufwachte, war ich vor Angst wie gelähmt. Ich brauchte eine Weile, bis ich wieder wusste, wo ich war, und noch länger, um zu begreifen, dass das Rauschen in meinen Ohren nicht Teil meines Traums war. Es war real.
Das Zimmer war dunkel, in der Luft lag der gleiche feuchte Dunst wie in meinem Traum, und als ich mich aufsetzte, spürte ich einen Luftzug auf der Wange. Das Geräusch schien aus dem Bad zu kommen.
Zitternd stieg ich aus dem Bett. Die Tür zum Bad war geschlossen, doch als ich näher hinging, wurde das Rauschen lauter. Mein Puls ging schneller. Ich fasste mir ein Herz und stieß die Tür auf. Das Prasseln der Dusche erfüllte den kleinen Raum, während ich mit bebenden Fingern nach dem Lichtschalter tastete. Licht durchflutete das Bad – und da sah ich es.
Auf dem beschlagenen Spiegel stand in riesigen Buchstaben: HALTDICHRAUS.
Erster Teil
1
Freitag, 18. September
Das erste Anzeichen, dass etwas nicht stimmte, waren die Pfoten der Katze auf meinem Gesicht, die mich mitten in der Nacht aus dem Schlaf rissen. Ich hatte wohl am Abend die Küchentür offen gelassen. Es rächte sich eben, betrunken nach Hause zu kommen.
»Hau ab«, stöhnte ich. Delilah miaute und stieß ihr Köpfchen gegen mein Kinn. Ich vergrub das Gesicht im Kissen, was allerdings nur dazu führte, dass sie den Kopf jetzt an meinem Ohr rieb, und so rollte ich mich schließlich auf die Seite und schubste sie gnadenlos vom Bett.
Mit einem entrüsteten Maunzen plumpste sie auf den Boden, und ich zog mir die Decke über den Kopf. Aber selbst durch die Stoffschicht konnte ich deutlich hören, wie Delilah an der Tür scharrte, die leicht im Rahmen klapperte.
Die Tür war zu.
Mit klopfendem Herzen setzte ich mich auf, worauf Delilah ein freudiges Miauen ausstieß und mit einem Satz zurück auf dem Bett war. Ich drückte sie fest an mich, damit sie stillhielt, und lauschte.
Vielleicht hatte ich vergessen, die Küchentür zu schließen, oder sie zugeschlagen, ohne darauf zu achten, ob sie richtig ins Schloss fiel. Aber die Schlafzimmertür ging nach außen auf – eine der Macken meiner eigenwillig geschnittenen Wohnung. Die Katze konnte sich unmöglich hier eingeschlossen haben. Jemand musste die Tür zugemacht haben.
Ich saß da wie erstarrt, presste Delilahs warmen, bebenden Körper an mich und horchte.
Nichts.
Dann ging mir ein Licht auf – sie musste sich unter dem Bett versteckt haben, als ich nach Hause kam, sodass ich sie versehentlich hier drin eingesperrt hatte. Mir fiel ein Stein vom Herzen. Ich konnte mich zwar nicht erinnern, die Schlafzimmertür geschlossen zu haben, aber vielleicht hatte ich sie geistesabwesend hinter mir zugezogen, als ich ins Bett ging. Ehrlich gesagt war ab der U-Bahn-Station alles ziemlich verschwommen. Schon auf der Heimfahrt hatten sich die Kopfschmerzen eingestellt, und jetzt, wo meine Panik langsam verebbte, meldeten sie sich im Hinterkopf wieder. Ich musste wirklich aufhören, unter der Woche Alkohol zu trinken. Mit zwanzig war das in Ordnung gewesen, aber inzwischen konnte ich den Kater nicht mehr so leicht abschütteln.
Delilah wand sich in meiner Umklammerung und bohrte mir die Krallen in den Unterarm, sodass ich sie schließlich losließ, nach meinem Morgenmantel griff und ihn überzog. Dann nahm ich sie wieder hoch, entschlossen, sie hinaus in die Küche zu befördern.
Als ich die Schlafzimmertür öffnete, stand da ein Mann.
Ich würde wirklich gerne beschreiben, wie er aussah, aber ich habe nicht die geringste Ahnung. Das sagte ich auch der Polizei. Ungefähr fünfundzwanzigmal. »Haben Sie denn nirgends ein Stück Haut gesehen? Auch nicht ganz kurz? Nicht mal am Handgelenk?«, fragten sie immer wieder. Nein, nein und nein. Er trug einen Kapuzenpulli, ein Tuch über Nase und Mund, alles andere lag im Schatten. Bis auf seine Hände.
Er trug Latexhandschuhe. Dieses Detail war es, das mich in Panik versetzte. Die Handschuhe sagten mir: Ich weiß, was ich tue. Sie sagten: Ich bin vorbereitet. Sie sagten: Vielleicht geht es mir um mehr als dein Geld.
Eine endlose Sekunde lang standen wir einander gegenüber, fixierten seine glänzenden Augen meine.
Tausend Gedanken auf einmal rasten mir durch den Kopf: Wo ist mein Handy? Warum habe ich nur so viel getrunken? Nüchtern hätte ich ihn reinkommen hören. Oh Gott, wäre doch bloß Judah hier.
Und dann die Handschuhe. Himmel, diese Handschuhe. So professionell. So klinisch.
Ich sagte nichts, rührte mich nicht. Ich stand einfach nur da, in meinem schäbigen Morgenmantel, und zitterte. Delilah strampelte sich aus meinen erschlafften Armen frei und raste durch den Flur in Richtung Küche.
Bitte, dachte ich. Bitte tu mir nicht weh.
Wo war nur mein Handy?
Dann sah ich, dass der Mann etwas in den Händen hielt. Meine Handtasche – die neue Burberry-Tasche, was mir allerdings in dem Moment vollkommen irrelevant erschien. An der Tasche war nur eines wichtig: Mein Handy war darin.
Um seine Augen herum bildeten sich Fältchen, sodass ich mich fragte, ob er hinter der Maskierung vielleicht lächelte. Ich spürte, wie mir das Blut aus Kopf und Fingern wich, sich in meiner Körpermitte sammelte, um mich auf das vorzubereiten, was jetzt kam. Kampf oder Flucht – was auch immer angebrachter schien.
Er machte einen Schritt nach vorn.
»Nein«, sagte ich. Es sollte klingen wie ein Befehl, doch es wurde ein dünnes, ängstliches Flehen: »N-nei…«
Weiter kam ich nicht. Er knallte die Tür vor mir zu, wobei sie mich an der Wange erwischte.
Eine ganze Weile stand ich wie angewurzelt da und hielt mir die Hand ans Gesicht, stumm vor Schock und Schmerz. Meine Finger waren eisig, aber auf der Wange spürte ich etwas Warmes und Feuchtes. Es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass ich blutete. Die Zierleiste an der Tür hatte mir eine Platzwunde eingetragen.
Am liebsten wollte ich ins Bett zurück, den Kopf unters Kissen stecken und einfach nur weinen. Doch eine fiese kleine Stimme in meinem Kopf wiederholte unablässig: Er ist immer noch da. Was, wenn er ins Zimmer kommt? Wenn er dich holen kommt?
Plötzlich polterte es im Flur, als wäre etwas zu Boden gefallen. Angst durchzuckte mich, doch statt aus meiner Schockstarre zu erwachen, war ich wie gelähmt. Komm nicht zurück. Komm nicht zurück. Ich merkte, dass ich die Luft anhielt, und zwang mich, tief und zittrig auszuatmen, bevor ich ganz langsam die Hand in Richtung Tür ausstreckte.
Wieder hörte ich ein Krachen im Flur – das Splittern von Glas –, und da packte ich den Türknauf und stemmte die Füße in den Boden, wild entschlossen, die Tür so lange wie möglich zuzuhalten. Meine nackten Zehen krallten sich in die Lücken zwischen den alten Dielen. Mit angezogenen Knien hockte ich da und versuchte, mein Schluchzen im Stoff des Morgenmantels zu ersticken, während ich zuhörte, wie er die ganze Wohnung durchwühlte. Ich hoffte inständig, dass Delilah inzwischen im Garten war, in Sicherheit.
Endlich, eine halbe Ewigkeit später, hörte ich, wie die Haustür auf- und wieder zuging. Ich blieb sitzen, das Gesicht gegen die Knie gepresst, um mein Weinen zu dämpfen, denn ich konnte nicht glauben, dass er wirklich weg war. Dass er nicht wiederkommen würde, um mir wehzutun. Meine Finger waren schon ganz taub und steif, trotzdem wagte ich es nicht, den Griff loszulassen.
Wieder sah ich die kräftigen Hände vor mir, das fahle Weiß der Latexhandschuhe.
Ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergegangen wäre. Vielleicht hätte ich die ganze Nacht dort gehockt, unfähig, mich zu rühren. Doch dann hörte ich die Katze draußen miauen und an der Tür kratzen.
»Delilah«, krächzte ich. Meine Stimme zitterte so sehr, dass sie nicht mehr nach mir klang. »Hey, Delilah.«
Durch die Tür hörte ich sie schnurren, und das vertraute, tiefe, kettensägenartige Rasseln brach schließlich den Bann.
Meine verkrampften Finger lösten sich. Ich streckte sie vorsichtig, was ziemlich wehtat, dann stand ich auf, versuchte, meine zitternden Beine zu stabilisieren, und drehte am Türknauf.
Er drehte sich. Mühelos. Viel zu leicht, ohne dass sich der Schnapper einen Millimeter rührte. Der Typ hatte von außen die Spindel entfernt.
Scheiße.
Scheiße, Scheiße, Scheiße.
Ich saß in der Falle.
2
Erst nach zwei Stunden konnte ich mich aus dem Zimmer befreien. Festnetz hatte ich keines, sodass ich niemanden anrufen konnte, und mein Schlafzimmerfenster war vergittert. Ich stocherte so lange mit meiner besten Nagelfeile am Schloss herum, bis sie abbrach, doch schließlich gelang es mir, die Tür zu öffnen, und ich wagte mich vorsichtig in den schmalen Flur hinaus. Obwohl meine Wohnung nur aus drei Räumen bestand – Küche, Schlafzimmer und ein winziges Bad – und man sie eigentlich von meiner Zimmertür aus komplett einsehen konnte, verspürte ich das dringende Bedürfnis, jeden noch so kleinen Winkel zu kontrollieren, selbst den Schrank im Flur, in dem ich meinen Staubsauger aufbewahrte. Ich musste einfach sichergehen, dass der Typ wirklich weg war.
Zitternd und mit pochendem Schädel ging ich nach draußen und stieg die Stufen zur Wohnung meiner Nachbarin hinauf. Über die Schulter spähte ich zurück auf die nächtliche Straße, während ich darauf wartete, dass Mrs Johnson öffnete. Nach meiner Schätzung musste es etwa vier Uhr morgens sein, und es dauerte eine Ewigkeit, bis mein Klopfen sie endlich weckte. Schließlich hörte ich sie murrend die Treppe herunterstapfen. Sie öffnete die Tür einen Spaltbreit. In ihrer Miene spiegelte sich eine Mischung aus Schlaftrunkenheit und Furcht. Doch als sie mich im Morgenmantel auf ihrer Türschwelle erblickte, Gesicht und Hände voller Blut, riss sie die Augen auf und löste hastig die Kette von der Tür.
»Ach du liebe Zeit! Was ist denn mit Ihnen passiert?«
»Ein Einbrecher.«
Das Sprechen fiel mir schwer. Ich weiß nicht, ob es an der kühlen Herbstluft oder am Schock lag, aber auf einmal zitterte ich am ganzen Körper, und meine Zähne klapperten so sehr, dass ich Angst bekam, sie könnten mir im Mund zerbrechen. Ich schüttelte die Vorstellung ab.
»Sie bluten ja!« Sie musterte mich besorgt. »Du liebe Zeit, so kommen Sie doch rein!«
Ich folgte ihr ins Wohnzimmer ihrer Maisonettewohnung, die zwar klein, düster und völlig überheizt war, mir aber in diesem Moment als idealer Zufluchtsort erschien. Daran konnte selbst der wildgemusterte Paisley-Teppichboden nichts ändern.
»Bitte, setzen Sie sich.« Sie deutete auf ein rotes Plüschsofa, bevor sie ächzend in die Knie ging, um sich am Gasofen zu schaffen zu machen. Es knackte, die Flamme schnellte empor, und noch während Mrs Johnson sich mühsam aufrichtete, fühlte ich die Temperatur um ein Grad steigen. »Ich mache Ihnen einen schönen heißen Tee.«
»Nicht nötig, Mrs Johnson, wirklich nicht. Meinen Sie …«, setzte ich an.
Doch sie schüttelte nur streng den Kopf. »Nichts geht über heißen, süßen Tee, wenn man unter Schock steht.«
Also fügte ich mich. Die zitternden Hände fest um meine Knie gekrallt, wartete ich, während sie in der winzigen Küche hantierte und schließlich mit zwei Tassen auf einem Tablett zurückkam. Ich nahm eine, zuckte zusammen, als ich die Hitze auf der Wunde an meiner Hand spürte, und nippte am Tee. Er war so süß, dass er sogar den Blutgeschmack in meinem Mund überdeckte, was unter diesen Umständen wohl ein Segen war.
Mrs Johnson rührte ihre Tasse nicht an, sondern betrachtete mich nur mit Sorgenfalten auf der Stirn.
»Hat er …« Ihre Stimme versagte. »Hat er Ihnen etwas angetan?«
Es war klar, was sie damit meinte. Ich schüttelte den Kopf, aber ich musste noch einen weiteren brühheißen Schluck nehmen, bevor ich mir das Sprechen zutraute.
»Nein, er hat mich nicht angerührt. Die Platzwunde kommt daher, dass er mir die Tür ins Gesicht geknallt hat. Und dann habe ich mich in die Hand geschnitten, als ich versucht habe, mich aus meinem Zimmer zu befreien. Er hatte mich eingesperrt.«
Ein Schauer durchfuhr mich, als ich daran zurückdachte, wie ich mit Nagelfeile und Schere auf das Schloss eingehackt hatte. Judah zog mich wegen meiner Vorliebe für improvisiertes Werkzeug gerne auf – weil ich Schrauben mit einem Buttermesser rausdrehte oder einen Fahrradreifen mithilfe einer Gartenschaufel von der Felge löste. Letzte Woche erst hatte er sich über meinen Versuch lustig gemacht, den Duschkopf mit Isolierband zu reparieren, und dann den ganzen Nachmittag damit zugebracht, ihn in mühevoller Kleinarbeit mit Epoxidharz zusammenzukleben. Aber er war weit weg in der Ukraine, und ich durfte jetzt nicht an ihn denken. Sonst würde ich heulen, und wenn ich einmal damit anfing, würde ich vielleicht nie wieder aufhören.
»Ach, Sie armes Ding.«
Ich schluckte.
»Mrs Johnson, haben Sie vielen Dank für den Tee – aber eigentlich wollte ich fragen, ob ich kurz Ihr Telefon benutzen kann, um die Polizei zu rufen. Er hat nämlich mein Handy mitgenommen.«
»Aber natürlich, es steht da drüben. Aber jetzt trinken Sie erst mal Ihren Tee aus.«
Sie deutete auf ein Beistelltischchen mit Spitzendecke, auf dem sich das wohl letzte Wählscheibentelefon Londons befand, wenn man von den Vintage-Läden in Islington mal absah. Gehorsam trank ich meine Tasse aus, bevor ich zum Hörer griff. Einen Moment lang verharrte mein Finger über der Neun, aber dann überlegte ich es mir anders. Er war ja weg. Was sollten sie jetzt noch tun? Es war kein Notfall mehr.
Also wählte ich die Rufnummer für nicht akute Angelegenheiten und wartete darauf, dass jemand abnahm.
Unterdessen kreisten meine Gedanken um die Hausratversicherung, die ich nicht hatte, das Türschloss, das ich hätte verstärken lassen sollen, und die Katastrophe, zu der sich diese Nacht entwickelt hatte.
Noch Stunden später ging mir das durch den Kopf, während ich dem Mann vom Schlüsseldienst dabei zusah, wie er das dürftig angeschraubte Schnappschloss der Vordertür durch einen ordentlichen Riegel ersetzte, und mir geduldig seinen Vortrag über Einbruchschutz sowie den Zustand der Hintertür anhörte, die er als Lachnummer bezeichnete.
»Das ist bloß ’ne billige Holzfaserplatte. Ein Tritt und die ist durch. Soll ich’s Ihnen zeigen?«
»Nein«, wehrte ich hastig ab. »Nein danke. Ich lasse sie ersetzen. Sie machen nicht zufällig auch Türen, oder?«
»Nein, aber ein Kumpel von mir. Ich schreib Ihnen die Nummer auf. Und in der Zwischenzeit sagen Sie Ihrem Göttergatten, er soll ’ne ordentliche Achtzehn-Millimeter-Sperrholzplatte draufnageln. Sie wollen doch bestimmt nicht, dass sich das von gestern Nacht wiederholt.«
»Nein«, stimmte ich zu. Die Untertreibung des Jahrhunderts.
»Ich hab ’nen Kumpel bei der Polizei, von dem weiß ich, dass ein Viertel aller Einbrüche Wiederholungstaten sind. Die Täter kommen zurück, um sich mehr zu holen.«
»Na wunderbar«, erwiderte ich. Genau das, was ich jetzt hören wollte.
»Achtzehn Millimeter. Soll ich’s Ihrem Mann aufschreiben?«
»Nein danke, ich bin nicht verheiratet.« Und obwohl ich Eierstöcke habe, kann ich mir eine zweistellige Zahl gerade noch so merken.
»Ach so, verstehe. Ja dann«, brummte er, als wäre dadurch irgendetwas klarer. »Mit dem Türrahmen können Sie übrigens auch niemandem imponieren. Sie brauchen einen London-Bar. Ohne den nützt Ihnen das beste Schloss nichts – wenn die es Ihnen aus dem Rahmen treten, stehen Sie genauso blöd da. Ich hab noch einen im Wagen, der passen könnte. Sie wissen, was das ist?«
»Ja, weiß ich«, antwortete ich matt. »Eine Metallleiste, die über dem Schloss befestigt wird, oder?« Ich hatte zwar den Verdacht, dass er aus der Situation das Maximum für sich herausholen wollte, aber das war mir im Moment egal.
»Wissen Sie was?« Er stand auf und steckte sein Werkzeug in die Overalltasche. »Ich montiere Ihnen den London-Bar, und dazu mache ich Ihnen noch gratis eine Sperrholzplatte an die Hintertür. Im Wagen hab ich noch eine, die von der Größe einigermaßen passen müsste. Kopf hoch, junge Frau. Auf diesem Weg kommt er jedenfalls nicht mehr rein.«
Irgendwie fand ich seine Worte nicht besonders tröstlich.
Als er weg war, machte ich mir eine Tasse Tee und lief in der Wohnung auf und ab. Dabei kam ich mir vor wie Delilah, als ein Kater sich einmal durch die Katzenklappe Zutritt verschafft und in den Flur gepinkelt hatte – stundenlang war sie durch die Zimmer getigert, hatte sich an sämtlichen Möbelstücken gerieben und in alle Ecken gemacht, um Stück für Stück ihr Revier zurückzuerobern.
Auch wenn ich nicht so weit ging, ins Bett zu machen, hatte ich ebenfalls das Gefühl, dass jemand in mein Allerprivatestes vorgedrungen war. Genau wie Delilah hatte ich das dringende Bedürfnis, mir zurückzuholen, was der Typ geschändet hatte. Geschändet?, ertönte eine sarkastische Stimme in meinem Innern. Mach mal halblang, du Drama-Queen.
Aber so empfand ich es. Meine kleine Wohnung war durch sein Eindringen beschmutzt worden und nun nicht mehr sicher. Die Aussage bei der Polizei war eine Tortur gewesen – ja, ich habe ihn gesehen, nein, beschreiben kann ich ihn nicht. Was in der Tasche war? Ach, wissen Sie, bloß mein ganzes Leben: Geld, Handy, Führerschein, meine Tabletten, im Grunde alles, was ich tagtäglich brauche, von Wimperntusche bis zur Monatskarte.
In meinem Kopf hallte der kühle, unpersönliche Tonfall des Polizisten noch nach.
»Um was für ein Mobiltelefon handelt es sich?«
»Nichts Wertvolles«, erwiderte ich matt. »Ein altes iPhone. Das Modell weiß ich gerade nicht, aber das lässt sich rausfinden.«
»Danke. Jegliche Information zu Modell und Seriennummer könnte helfen. Sie haben auch Tabletten erwähnt – welche Art von Tabletten, wenn ich fragen darf?«
Ich ging sofort in die Defensive. »Was hat denn meine Krankengeschichte damit zu tun?«
»Gar nichts.« Der Polizist blieb vollkommen ruhig und geduldig, was mich nur noch mehr aufbrachte. »Es ist bloß so, dass manche Medikamente auf dem Schwarzmarkt beliebt sind.«
Dass die Wut, die in mir hochkochte, unangemessen war, wusste ich – er machte ja nur seine Arbeit. Aber schließlich war der Einbrecher derjenige, der das Verbrechen begangen hatte. Warum also kam ich mir vor wie bei einem Verhör?
Ich hatte meinen Tee in der Hand und war auf dem Weg ins Schlafzimmer, als plötzlich jemand an die Tür hämmerte. Das laute Geräusch, das durch die stille Wohnung hallte, jagte mir einen solchen Schrecken ein, dass ich zusammenfuhr und instinktiv in Deckung ging.
Vor meinem inneren Auge blitzte wieder das maskierte Gesicht auf, das fahle Weiß der Latexhandschuhe.
Erst als es ein zweites Mal klopfte, erwachte ich aus meiner Erstarrung und sah die zerbrochene Tasse auf den Fliesen. Meine Füße standen in einer Lache aus Tee.
Wieder pochte es.
»Einen Moment!«, rief ich, auf einmal wütend und den Tränen nah. »Ich komme ja schon! Können Sie mal aufhören, gegen die Tür zu hämmern!«
»Entschuldigen Sie«, sagte der Polizist, als ich schließlich öffnete. »Ich wusste nicht, ob Sie mich gehört haben.« Und dann, als er die Pfütze und die Scherben sah: »Himmel, was ist denn hier los? Noch ein Einbruch? Haha.«
Es war schon Nachmittag, als er endlich mit dem Protokoll fertig war. Als er weg war, klappte ich meinen Laptop auf, der zum Zeitpunkt des Einbruchs glücklicherweise im Schlafzimmer gelegen hatte. Neben meinen ganzen Unterlagen für die Arbeit, von denen die meisten nirgends sonst gespeichert waren, befanden sich darauf auch alle Passwörter, einschließlich – und bei dem Gedanken fasste ich mir an den Kopf – einer Datei, die ich zuvorkommenderweise »Banksachen« benannt hatte. Bis auf meine PINs stand so ziemlich alles da drin.
Die übliche Flut von E-Mails ergoss sich in mein Postfach, darunter eine mit dem Betreff »Wolltest du dich heute noch blicken lassen :)?«. Erschrocken stellte ich fest, dass ich völlig vergessen hatte, bei ›Velocity‹ Bescheid zu sagen.
Anstatt zu antworten, holte ich den 20-Pfund-Schein aus der Teedose, den ich dort als Taxigeld für Notfälle aufbewahrte, und stattete dem etwas zwielichtigen Handyladen an der U-Bahn-Station einen Besuch ab. Nach einigem Hin und Her konnte ich dem Verkäufer schließlich ein Prepaid-Handy mit SIM-Karte für fünfzehn Pfund abschwatzen, mit dem ich mich ins Café gegenüber setzte und die stellvertretende Feature-Redakteurin Jenn anrief, die mir im Büro gegenübersaß.
Ich schilderte ihr, was geschehen war, allerdings so, dass es deutlich amüsanter und absurder klang, als es tatsächlich gewesen war. Ich malte ihr bis in kleinste Detail aus, wie ich mit der Nagelfeile am Türschloss herumhantiert hatte; die Handschuhe und das Gefühl von Ohnmacht und Todesangst unterschlug ich ebenso wie die erschreckend realistischen Flashbacks, die mich seitdem heimsuchten.
»Ach du Scheiße!« Ihre Stimme am anderen Ende der wackeligen Verbindung klang entsetzt. »Geht es dir gut?«
»Ja, mehr oder weniger. Aber ich werde heute nicht mehr kommen. Ich muss die Wohnung in Ordnung bringen.« Wobei es in Wahrheit gar nicht so schlimm war. Für einen Kriminellen hatte er die Wohnung in recht gepflegtem Zustand hinterlassen, das musste man ihm lassen.
»Ach Gott, Lo, du Arme. Hör mal, soll ich für die Nordlicht-Sache eine Vertretung finden?«
Kurz wusste ich nicht, wovon sie sprach – dann fiel es mir wieder ein: die Aurora Borealis, ein kleines, exklusives Luxuskreuzfahrtschiff für Reisen zu den norwegischen Fjorden. Durch eine glückliche Fügung, die ich mir selbst noch nicht ganz erklären konnte, war ich in den Besitz einer der wenigen Pressekarten gekommen, die für die Jungfernfahrt vergeben worden waren.
Es war eine großartige Gelegenheit, denn obwohl ich für ein Reisemagazin arbeitete, verbrachte ich den Großteil meiner Tage damit, Meldungen aus irgendwelchen Pressemitteilungen zusammenzuschustern und Bilder für die Artikel, die meine Chefin Rowan von ihren Luxusreisen in die Redaktion sandte, auszuwählen. Eigentlich hätte sie selbst fahren sollen, aber weil sie kurz nach der Zusage feststellen musste, dass ihr die schwangerschaftsbedingte Morgenübelkeit doch stärker zu schaffen machte als gedacht, fiel mir die Kreuzfahrt wie ein großes Geschenk in den Schoß, ein Paket gefüllt mit Verantwortung und Möglichkeiten. Es war ein Vertrauensbeweis, denn schließlich hätte sie diesen Gefallen genauso gut auch anderen, sehr viel erfahreneren Kollegen erweisen können. Wenn ich es geschickt anstellte, konnte ich mir dadurch beim Gerangel um Rowans Mutterschutzvertretung einen Vorteil verschaffen und würde vielleicht endlich jene Beförderung bekommen, die sie mir schon seit Jahren versprach.
Allerdings sollte es schon dieses Wochenende losgehen. Sonntag, um genau zu sein. In zwei Tagen.
»Nein«, versicherte ich hastig und war selbst überrascht, wie entschlossen ich dabei klang. »Nein, ich zieh das auf jeden Fall durch. Mir geht’s gut.«
»Bist du sicher? Was ist mit deinem Pass?«
»Der war im Schlafzimmer, den hat er nicht gefunden.« Gott sei Dank.
»Bist du ganz sicher?«, fragte sie noch einmal, hörbar besorgt. »Das ist eine große Sache – nicht nur für dich, sondern fürs Magazin, meine ich. Wenn du es dir nicht zutraust, würde Rowan sicher nicht wollen, dass …«
»Ich traue es mir zu«, unterbrach ich sie. Unter keinen Umständen würde ich mir diese Gelegenheit entgehen lassen. Wer wusste schon, ob ich noch mal eine bekäme. »Versprochen. Ich will das wirklich machen, Jenn.«
»Okay …«, sagte sie schließlich zögernd. »Dann also volle Fahrt voraus, ja? Heute Morgen ist das Pressepaket angekommen, das schicke ich dir gleich zusammen mit den Zugfahrkarten per Kurier. Rowans Notizen müssten hier auch noch irgendwo sein. Hauptsächlich geht es wohl um eine angemessene Lobeshymne auf das Schiff, weil Rowan die Firma gerne als Werbekunden hätte, aber unter den Gästen sollten auch ein paar interessante Leute sein – wenn du also noch das eine oder andere Porträt einbauen kannst, umso besser.«
»In Ordnung.« Von der Theke des Cafés nahm ich einen Stift und machte mir auf einer Papierserviette Notizen. »Wann geht es noch mal los?«
»Dein Zug fährt um zehn Uhr dreißig in King’s Cross ab – aber ich leg dir alles ins Pressepaket.«
»Alles klar. Vielen Dank, Jenn.«
»Kein Problem«, erwiderte sie. In ihrer Stimme klang etwas Wehmut mit, und ich fragte mich, ob sie gehofft hatte, selbst für Rowan einspringen zu können. »Pass auf dich auf, Lo. Mach’s gut.«
Es dämmerte schon, als ich langsam zurücktrottete. Mir taten die Füße weh, meine Wange schmerzte, und ich wollte einfach nur nach Hause und ein langes, heißes Bad nehmen.
Die Tür zu meiner Souterrainwohnung lag wie immer im Schatten, und mir kam wieder mal der Gedanke, dass ich eine Sicherheitsleuchte brauchte, und sei es nur, um in der Handtasche meine Schlüssel zu finden. Doch selbst im Dämmerlicht konnte ich die Holzsplitter an der Stelle sehen, wo er das Schloss aufgebrochen hatte. Es war mir ein Rätsel, dass ich ihn nicht gehört hatte. Tja, was erwartest du, du warst eben betrunken, sagte die fiese kleine Stimme in meinem Kopf.
Immerhin fühlte sich das neue Schloss beruhigend stabil an. Drinnen angekommen verriegelte ich die Tür, streifte die Schuhe ab und schlich erschöpft in Richtung Bad. Mit einem Gähnen stellte ich das Badewasser an und ließ mich auf den Toilettendeckel fallen. Ich zog mir die Strumpfhose aus, begann, mein Oberteil aufzuknöpfen … und dann hielt ich inne.
Normalerweise lasse ich die Badezimmertür offen – schließlich gibt es nur mich und Delilah hier, und die Wände der Kellerwohnung sind ziemlich anfällig für Feuchtigkeit. Außerdem tue ich mich generell schwer mit geschlossenen Räumen, zumal dieser hier sich bei heruntergelassenem Rollo besonders eng anfühlt. Doch obwohl die Wohnungstür abgeschlossen und zusätzlich durch den London-Bar verstärkt war, überprüfte ich zur Sicherheit das Fenster und schloss die Badezimmertür ab, bevor ich mich auszog.
Ich war so hundemüde. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie ich in der Badewanne einschlief, unter die Wasseroberfläche sank und wie Judah eine Woche später meinen nackten, aufgedunsenen Körper entdeckte … Ich schüttelte den Gedanken ab. Ich musste aufhören, so melodramatisch zu sein. In der knapp einen Meter zwanzig langen Wanne musste ich mich schon mühsam verrenken, um nur das Shampoo aus den Haaren zu spülen, von Ertrinken ganz zu schweigen.
Das heiße Wasser brannte in der Platzwunde auf meiner Wange, und ich schloss die Augen und versuchte, mich an einen anderen Ort zu versetzen, weit weg von diesem klaustrophobisch kleinen Raum, von diesem verkommenen London mit all seiner Kriminalität. Ein Strandspaziergang im hohen Norden vielleicht, dazu das beruhigende Rauschen der … äh … Ostsee? Für eine Reisejournalistin bin ich beunruhigend schlecht in Geografie.
Doch die unerwünschten Erinnerungen stürmten weiter auf mich ein. Was der Schlosser über Wiederholungstaten gesagt hatte. Wie ich, die Füße fest gegen die Bodendielen gestemmt, vor der Schlafzimmertür kauerte. Der Anblick der kräftigen Hände im gelblichweißen Latex, die schwarzen Härchen, die sich darunter abzeichneten …
Verdammt.
Ich schlug die Augen auf, aber diesmal half der Realitätsabgleich nichts. Stattdessen sah ich die feuchten Badezimmerwände bedrohlich näher rücken, als wollten sie mich zermalmen.
Du drehst schon wieder durch, zischte die Stimme. Merkst du das nicht?
Sei still. Sei still, sei still, sei still. Ich kniff die Augen zu und versuchte, die Bilder durch Zählen aus meinem Kopf zu vertreiben. Eins. Zwei. Drei. Einatmen. Vier. Fünf. Sechs. Ausatmen. Eins. Zwei. Drei. Einatmen. Vier. Fünf. Sechs. Ausatmen.
Nach einer Weile verblassten die Bilder, aber an Entspannung war trotzdem nicht zu denken. Plötzlich spürte ich den heftigen Drang, dem stickigen, engen Raum zu entkommen. Ich stieg aus der Wanne, wickelte mich in ein Handtuch und lief ins Schlafzimmer, wo der Laptop noch auf dem Bett lag.
Ich klappte ihn auf und tippte in die Google-Suchmaske: »Wie viel % Einbrüche sind Wiederholungen?«
Ich klickte auf das erstbeste Ergebnis und überflog die Seite, bis ich zu diesem Absatz kam: »Wenn Einbrecher wiederkommen – Einer landesweiten Erhebung zufolge handelt es sich bei 25–50 % aller Einbrüche im Laufe eines Jahres um Wiederholungstaten. Geschätzt wird außerdem, dass 25–35 % der Einbruchsopfer im gleichen Zeitraum erneut zum Opfer werden. Statistiken der britischen Polizeibehörden legen nahe, dass 28–51 % der Wiederholungstaten innerhalb eines Monats stattfinden, 11–25 % innerhalb einer Woche.«
Na toll. Also hatte mich der freundliche Schlosser mit seinen Schreckensszenarien nicht ängstigen wollen, sondern sogar noch untertrieben – wobei mir die rätselhafte Diskrepanz zwischen den fast fünfzig Prozent Wiederholungstaten und den nur fünfunddreißig Prozent auf der Seite der Opfer Kopfzerbrechen bereitete. So oder so gefiel mir der Gedanke, in diese Statistik zu fallen, überhaupt nicht.
Weil ich mir geschworen hatte, an diesem Abend keinen Alkohol zu trinken, machte ich mir, nachdem ich Vorder- und Hintertür, Fensterschlösser und dann ein zweites und drittes Mal die Vordertür kontrolliert hatte, eine Tasse Kamillentee.
Dann verzog ich mich mit meinem Tee, dem Laptop, dem Pressepaket und einer Packung Schokoladenkekse ins Schlafzimmer. Es war erst acht Uhr, und ich hatte noch nicht zu Abend gegessen, aber ich fühlte mich vollkommen erschöpft – zu erschöpft, um zu kochen oder auch nur den Lieferservice anzurufen. Ich öffnete die Presseinformationen zur Fjordkreuzfahrt, kuschelte mich unter die Bettdecke und wartete darauf, dass mich der Schlaf übermannte.
Das tat er aber nicht. Ich tunkte Keks um Keks in meinen Tee und las Seite um Seite voller Fakten und Zahlen zur Aurora. Nur zehn luxuriös ausgestattete Kabinen … maximal zwanzig Passagiere … handverlesenes Personal aus den weltbesten Restaurants und Hotels … Selbst die technischen Details zu Tiefgang und Tragfähigkeit des Schiffs konnten mich nicht in den Schlaf lullen. Ich war und blieb hellwach, völlig erschlagen und aufgedreht zugleich.
Während ich dort in meinen Kokon gewickelt lag, versuchte ich, nicht an den Einbrecher zu denken. Ich zwang mich, über die Arbeit nachzudenken und darüber, was ich bis Sonntag noch alles erledigen musste. Die neue Bankkarte abholen. Packen und für die Reise recherchieren. Ob ich Judah vor der Abreise noch sehen würde? Bestimmt würde er versuchen, mich unter der alten Nummer zu erreichen.
Ich legte die Presseinfos zur Seite und öffnete mein E-Mail-Postfach.
»Hi Schatz«, tippte ich, stockte dann und biss auf meinem Fingernagel herum. Was sollte ich schreiben? Ihm von dem Einbruch zu erzählen hatte keinen Zweck, jedenfalls im Moment nicht. Er würde sich nur Vorwürfe machen, dass er nicht da gewesen war, als ich ihn gebraucht hätte. »Ich hab mein Handy verloren«, schrieb ich stattdessen. »Lange Geschichte, erklär ich dir später. Aber wenn was ist, im Moment bitte per E-Mail, keine SMS. Wann kommst du am Sonntag zurück? Ich muss wegen der Kreuzfahrt schon morgens nach Hull. Hoffe, wir sehen uns noch, bevor ich fahre – aber sonst dann nächstes Wochenende? Kuss, Lo.«
Ich klickte auf Senden und hoffte, er würde sich nicht wundern, warum ich nachts um Viertel vor eins E-Mails verschickte. Dann klappte ich den Laptop zu, nahm mein Buch und versuchte, mich in den Schlaf zu lesen.
Ohne Erfolg.
Um 3:35 Uhr taumelte ich in Richtung Küche, griff nach der Ginflasche und mixte mir den stärksten Gin Tonic, den ich noch runterbringen konnte. Wie lebensrettende Medizin stürzte ich ihn hinunter, schüttelte mich wegen des scharfen Geschmacks und schenkte sofort den nächsten ein. Auch dieses Glas trank ich leer, wenn auch etwas langsamer. Danach blieb ich eine Weile stehen und spürte, wie der Alkohol in meinen Adern kribbelte, die Muskeln lockerte und meine Unruhe dämpfte.
Schließlich leerte ich den restlichen Gin ins Glas, nahm es mit ins Schlafzimmer und legte mich hin. Steif und angespannt, den Blick fest auf das leuchtende Display der Uhr gerichtet, wartete ich darauf, dass der Alkohol seine Wirkung tat.
Eins. Zwei. Drei. Einatmen. Vier … Fünf … Fü…
Irgendwann muss ich doch eingeschlafen sein. Eben noch hatte ich mit müden, schmerzenden Augen den Wecker angestarrt und gesehen, wie die Ziffern auf 4:44 Uhr sprangen, und im nächsten Moment blinzelte ich in das pelzige Gesicht von Delilah, die mich mit ihren Schnurrhaaren in der Nase kitzelte und mir so mitteilte, dass es Zeit für Frühstück war. Ich stöhnte. Mein Kopf schmerzte noch stärker als gestern, wobei ich nicht sicher war, ob es an der Wunde lag oder an einem weiteren Kater. Der letzte Gin Tonic stand noch halb voll auf dem Nachttisch neben dem Wecker. Als ich daran roch, musste ich fast würgen. Er bestand sicher zu zwei Dritteln aus Gin. Was hatte ich mir nur dabei gedacht?
Die Uhr zeigte 6:04 Uhr, was bedeutete, dass ich keine anderthalb Stunden geschlafen hatte, doch jetzt war ich nun mal wach. Ich stand also auf, zog den Vorhang beiseite und blickte hinaus in die graue Dämmerung, von der aus sich einzelne Sonnenstrahlen wie dünne Finger durch die Fenster meiner Souterrainwohnung hereinstahlen. Es war ein kalter und ungemütlicher Morgen, und ich fröstelte, als ich in meine Hausschuhe schlüpfte und durch den Flur zum Thermostat lief, um die Zeitschaltung abzustellen und die Heizung in Gang zu setzen.
Es war Samstag, und so musste ich zwar nicht arbeiten, aber weil die Reisevorbereitungen, die Umleitung meiner Handynummer auf das neue Telefon und die Ausstellung der neuen Bankkarte fast den ganzen Tag in Anspruch nahmen, war ich am Abend ganz benommen vor Müdigkeit.
Es war genauso schlimm wie damals, als ich von Thailand über L.A. zurück nach Hause geflogen war – nach einer Reihe von Nachtflügen war ich vor Schlafentzug völlig neben mir und hoffnungslos desorientiert gewesen. Irgendwo über dem Atlantik sah ich ein, dass Schlaf offenbar keine Option mehr war und es keinen Zweck hatte, es weiter zu versuchen. Als ich mich später zu Hause aufs Bett fallen ließ, war es wie ein Sturz ins Bodenlose, kopfüber in die Besinnungslosigkeit. Erst als Judah zweiundzwanzig Stunden später mit der Sonntagszeitung gegen meine Tür hämmerte, wachte ich, ganz zerschlagen und mit steifen Gliedern, wieder auf.
Diesmal aber war mein Bett kein Zufluchtsort mehr.
Vor der Abreise musste ich mich unbedingt wieder fangen. Ich hatte die einmalige, unbezahlbare Gelegenheit, mich nach zehn Jahren in der Tretmühle des Copy-and-Paste-Journalismus endlich zu beweisen. Das war meine Chance, zu zeigen, dass ich es draufhatte – dass ich wie Rowan netzwerken, mich auf jedem gesellschaftlichen Parkett bewegen und das Magazin in die Welt der Reichen und Schönen bringen konnte. Denn Lord Bullmer, der Besitzer der Aurora Borealis, war ganz ohne Frage Teil dieser Welt. Schon ein Prozent seines Werbeetats würde reichen, um ›Velocity‹ mehrere Monate über die Runden zu bringen. Dazu kamen die bekannten Reiseautoren und Fotografen, die zweifellos zur Jungfernfahrt eingeladen worden waren und deren Namen sich unter den Artikeln im Magazin sehr gut machen würden.
Meine Absicht war nicht, Bullmer beim Abendessen in Verkaufsgespräche zu verwickeln, das wäre viel zu plump und geschäftsmäßig. Wenn es mir aber gelänge, seine Nummer zu bekommen und dafür zu sorgen, dass er meinen Anruf auch entgegennahm … dann wäre ich meiner Beförderung schon ein ganzes Stück näher.
Während ich zum Abendessen mechanisch eine Tiefkühlpizza in mich hineinstopfte, bis ich nicht mehr konnte, setzte ich meine Lektüre des Pressepakets fort. Doch die Wörter und Bilder tanzten vor meinen Augen, die Adjektive verschwammen ineinander: exklusiv … funkelnde … luxuriöse … von Meisterhand gefertigt … formvollendet …
Mit einem Gähnen ließ ich die Broschüre sinken und blickte auf die Uhr. Schon nach neun. Gott sei Dank, endlich konnte ich schlafen gehen. Während ich alle Türen und Schlösser doppelt und dreifach kontrollierte, sagte ich mir, dass die grenzenlose Erschöpfung auch eine positive Seite hatte. Eine Wiederholung von gestern Nacht würde es nicht geben. Sollte der Typ tatsächlich zurückkommen, würde ich den Einbruch vermutlich verschlafen.
Um 22:47 Uhr wusste ich, dass ich mich geirrt hatte.
Um 23:23 Uhr heulte ich wie ein kleines Kind.
Würde das jetzt so weitergehen? Würde ich nie wieder schlafen können?
Ich musste schlafen. Ich musste einfach. In den letzten drei Tagen hatte ich – ich zählte es an den Fingern ab, zum Kopfrechnen war ich nicht in der Lage – weniger als vier Stunden Schlaf gehabt.
Ich konnte den Schlaf schmecken. Ich konnte ihn fühlen, so nah war er, nur ganz knapp außer Reichweite. Ich musste einfach einschlafen. Ich würde sonst den Verstand verlieren.
Wieder kamen mir die Tränen, obwohl ich nicht mal sagen konnte, warum ich eigentlich weinte. Vor lauter Frust? Vor Wut – auf mich selbst, auf den Einbrecher? Vor Erschöpfung?
Was ich wusste, war: Der Schlaf kam nicht. Wie ein uneingelöstes Versprechen schwebte er, nur Zentimeter entfernt, vor meiner Nase. Er glich einer Fata Morgana, die immer weiter zurückwich, je schneller, je verzweifelter ich ihr nachrannte. Oder einem Fisch im Wasser, der mir immer wieder durch die Finger glitt.
Oh Gott, ich will doch nur schlafen …
Delilah wandte ruckartig den Kopf zu mir um. Hatte ich das etwa laut gesagt und es nicht mal gemerkt? Herrgott, langsam wurde ich wirklich verrückt.
Flashback. Ein Gesicht. Glänzende Augen im Dunkeln.
Ich fuhr senkrecht in die Höhe, das Blut pochte mir in den Schläfen.
Ich musste hier raus.
Vor lauter Erschöpfung wie in Trance, stand ich taumelnd auf, schob meine Füße in die Schuhe und zog, noch im Schlafanzug, den Mantel an. Dann nahm ich meine Tasche. Wenn ich nicht schlafen konnte, würde ich spazieren gehen. Irgendwohin, egal wohin.
Wenn der Schlaf nicht freiwillig kam, würde ich ihn eben jagen.
3
Die nächtlichen Straßen waren zwar nicht menschenleer, aber es waren auch nicht die gleichen, auf denen ich mich jeden Tag zur Arbeit bewegte.
Zwischen den schwefelgelben Lichtkegeln der Laternen waren sie düster und grau. Eisige Böen fegten hindurch, wehten mir Fetzen alter Zeitungen gegen die Beine und wirbelten am Straßenrand Blätter und Dreck auf. Als zweiunddreißigjährige Frau, die in den frühen Morgenstunden allein unterwegs war – noch dazu im Schlafanzug – hätte ich mich vermutlich fürchten sollen. Doch hier fühlte ich mich sicherer als in meiner Wohnung. Hier draußen würde man mich wenigstens schreien hören.
Ein festes Ziel hatte ich nicht, ich wollte einfach so lange weitergehen, bis ich zu müde war, um mich auf den Beinen zu halten. Erst irgendwo zwischen Highbury und Islington bemerkte ich den Regen; er musste schon vor einiger Zeit eingesetzt haben, denn ich war ganz durchnässt. In meinen durchweichten Schuhen stand ich da und versuchte, mein ermattetes, umnebeltes Gehirn dazu zu bringen, einen Plan zu entwickeln, als sich meine Füße plötzlich, wie von selbst, wieder in Bewegung setzten – doch sie liefen nicht nach Hause, sondern nach Süden, in Richtung Angel.
Wohin ich lief, begriff ich erst, als ich dort war, als ich unter dem Vordach des Gebäudes stand und wie benommen das Klingelschild anstarrte, wo in seiner säuberlichen Handschrift sein Name geschrieben stand: LEWIS.
Er war nicht da. Er war in der Ukraine und würde erst morgen zurückkommen. Doch ich hatte seinen Zweitschlüssel in der Manteltasche und fühlte mich außerstande, zu meiner Wohnung zurückzulaufen. Du könntest ja ein Taxi nehmen, höhnte die Stimme in meinem Kopf. Aber der Fußweg ist wohl gar nicht das Problem, du Feigling.
Ich schüttelte den Kopf, dass die Wassertropfen nur so flogen, und suchte am Schlüsselbund nach dem richtigen Schlüssel für die Außentür. Dann schlüpfte ich hinein, ins drückend warme Treppenhaus.
Im zweiten Stock angekommen, schloss ich vorsichtig die Wohnungstür auf.
Es war stockdunkel. Alle Türen waren zu, und die Diele hatte keine Fenster.
»Judah?«, rief ich. Ich wusste natürlich, dass er weg war, aber es war nicht auszuschließen, dass er einen Freund hier übernachten ließ, und ich wollte nicht für einen nächtlichen Herzinfarkt verantwortlich sein. Schließlich wusste ich nur allzu gut, wie sich so ein Schreck anfühlte.
»Hey, ich bin’s, Lo.«
Aber es kam keine Antwort. In der Wohnung war es still – kein Laut war zu hören. Ich öffnete die Tür zur Wohnküche und trat auf Zehenspitzen ein. Das Licht schaltete ich gar nicht erst an, sondern schälte mir bloß die nassen Kleider vom Leib und warf sie in die Spüle.
Dann lief ich nackt weiter ins Schlafzimmer, wo das breite, in Mondlicht getauchte Doppelbett stand. Es war leer, aber die Laken waren zerwühlt, als wäre er eben erst aufgestanden. Ich krabbelte in die Mitte des Betts, spürte die weichen Laken und sog seinen Duft ein, den Geruch von Schweiß, Aftershave – und ihm.
Ich schloss die Augen.
Eins. Zwei …
Der Schlaf brach über mich herein und verschluckte mich wie eine riesige Welle.
Die Schreie einer Frau rissen mich aus meinem Tiefschlaf. Ich hatte das Gefühl, als würde jemand auf mir sitzen und mich festhalten, während ich mich mit aller Macht dagegen wehrte.
Eine Hand, die viel stärker war als meine, packte meinen Arm. Blind vor Panik tastete ich mit der freien Hand in der Dunkelheit nach etwas, das ich als Waffe benutzen konnte, und schloss die Finger um den Fuß der Nachttischlampe.
Die Hand des Mannes lag jetzt auf meinem Mund, wollte mich ersticken, und als das Gewicht seines Körpers mich zu erdrücken drohte, nahm ich all meine Kraft zusammen, hob die schwere Lampe hoch und schlug zu.
Ein Schmerzensschrei ertönte, und durch den Schleier meiner Angst hörte ich eine Stimme, die Worte undeutlich und verwaschen.
»Lo, ich bin’s doch! Ich bin’s, verdammt, hör auf!«
Oh Gott.
Meine Hände zitterten so stark, dass ich bei dem vergeblichen Versuch, das Licht einzuschalten, irgendetwas umwarf.
Neben mir hörte ich Judah keuchen. Es klang feucht und erstickt, was mich noch mehr in Panik versetzte. Wo zum Teufel war die Lampe? Dann begriff ich – ich hatte sie Judah ins Gesicht geschmettert.
Meine Beine waren weich wie Gummi, als ich aus dem Bett kletterte und zum Lichtschalter wankte. Im nächsten Moment wurde das Zimmer vom grellen Schein eines Dutzends Halogenstrahler geflutet, die jedes Detail des grauenhaften Anblicks vor meinen Augen unbarmherzig offenlegten.
Judah kauerte auf dem Bett, die Hände vor dem Gesicht, Bart und Oberkörper blutverschmiert.
»Oh mein Gott, Judah!« Ich rannte zu ihm zurück und riss mit zitternden Händen ein paar Taschentücher aus der Schachtel neben dem Bett. Er drückte sie sich ans Gesicht. »Oh Gott, was ist bloß passiert? Wer hat denn so geschrien?«
»Du«, stöhnte er. Die Tücher waren bereits blutdurchtränkt.
»Was?« Mein Adrenalinspiegel war so hoch, dass ich nicht klar denken konnte. Verwirrt sah ich mich im Zimmer um, auf der Suche nach der Frau und dem Angreifer. »Was meinst du?«
»Als ich reinkam«, sagte er, »hast du plötzlich losgeschrien, im Halbschlaf.« Die Papiertücher dämpften seinen Brooklyner Akzent zu einem undeutlichen Nuscheln. »Ich hab versucht, dich zu wecken, und dann …«
»Oh Scheiße.« Ich schlug die Hände vor den Mund. »Es tut mir so leid.«
Diese Schreie – sie hatten so real geklungen. War das wirklich nur ich gewesen?
Vorsichtig nahm er die Hand vom Mund. In dem scharlachroten Bausch lag etwas Kleines, Weißes. Erst als ich ihm ins Gesicht sah, wurde mir klar, was es war – ihm fehlte ein Zahn.
»Oh Himmel.«
Er sah mich an, während ihm das Blut weiter aus Mund und Nase tropfte.
»Was für ein Empfang«, war alles, was er sagte.
»Es tut mir so leid.« Tränen stiegen in mir hoch, aber vor dem Taxifahrer wollte ich nicht weinen. Mühsam schluckte ich sie runter. »Judah?«
Er antwortete nicht, sondern blickte stumm aus dem Fenster in die graue Dämmerung, die sich über London ausbreitete. Zwei Stunden hatten wir in der Notaufnahme der Uniklinik gewartet, wo sie dann doch nur die Platzwunde an seiner Lippe genäht und ihn an einen zahnärztlichen Notdienst überwiesen hatten. Dort hatte man den Zahn wieder in die Lücke gesteckt und Judah mehr oder weniger erklärt, jetzt hieße es Daumen drücken. Offenbar bestand die Möglichkeit, dass der Zahn wieder anwuchs. Falls nicht, würde er entweder eine Brücke oder ein Implantat brauchen. Müde schloss er die Augen. Mir war vor lauter Schuldgefühlen ganz schlecht.
»Es tut mir so leid«, wiederholte ich noch verzweifelter. »Ich weiß nicht, was ich sagen soll.«
»Nah, mir tuss leid«, sagte er matt. Er klang wie ein Betrunkener, weil die örtliche Betäubung ihm das Sprechen schwer machte.
»Dir? Warum, was tut dir leid?«
»Weiß nicht. Dass ich’s verbockt hab. Nicht für dich da war.«
»Bei dem Einbruch, meinst du?«
Er nickte. »Ja, und überhaupt. Ich wünschte, ich wäre nicht so viel unterwegs.«
Ich lehnte mich zu ihm rüber, und er legte den Arm um mich. Mit dem Kopf an seiner Schulter lauschte ich dem langsamen, gleichmäßigen Klopfen seines Herzens, das einen beruhigenden Kontrast zu meinem eigenen, panisch rasenden Puls bildete. Unter der Jacke trug er das blutverschmierte T-Shirt, dessen Stoff sich auf meiner Wange angenehm weich anfühlte. Ich holte langsam, bebend Luft, sog seinen Geruch ein und spürte, wie sich mein Herzschlag auf seinen Rhythmus verlangsamte.
»Du hättest doch auch nichts tun können«, flüsterte ich an seiner Brust.
Er schüttelte den Kopf. »Trotzdem hätte ich da sein müssen.«
Es wurde bereits hell, als wir den Taxifahrer bezahlten und langsam die zwei Stockwerke zu Judahs Wohnung hochstiegen. Die Uhr zeigte schon fast sechs. Mist, in wenigen Stunden musste ich den Zug nach Hull nehmen.
Drinnen zog sich Judah aus, und wir ließen uns nebeneinander ins Bett fallen, Haut an Haut. Er zog mich an sich, schloss die Augen und atmete tief ein. Ich konnte vor Müdigkeit kaum klar denken, doch statt mich vom Schlaf übermannen zu lassen, kletterte ich in einem Impuls auf ihn und küsste seinen Hals, seinen Bauch, den dunklen Haarstreifen unter seinem Nabel.
»Lo …«, stöhnte er, und versuchte, mich zu sich nach oben zu ziehen, um mich zu küssen, doch ich schüttelte den Kopf.
»Nicht, denk an deinen Mund. Leg dich zurück.«
Er ließ den Kopf aufs Kissen sinken, und in dem blassen Dämmerlicht, das durch die Vorhänge drang, sah ich, wie sich die Muskeln an seinem Hals anspannten.
Acht Tage waren wir getrennt gewesen und würden uns erst in einer Woche wiedersehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?
Hinterher lag ich in seinen Armen und wartete, dass sich meine Atmung und mein Herzschlag wieder beruhigten. Ich fühlte, wie sich seine Mundwinkel an meiner Wange zu einem Lächeln hoben.
»So schon eher«, sagte er.
»Eher was?«
»So hatte ich mir den Empfang schon eher vorgestellt.«
Mein Gesicht verspannte sich, und er strich mir über die Wange.
»Lo, das war ein Scherz.«
»Ich weiß.«
Eine ganze Weile lagen wir schweigend da, bis er langsam wegzudämmern schien. Ich schloss die Augen und wollte mich der Müdigkeit hingeben, als ich plötzlich spürte, wie seine Armmuskeln sich anspannten und er tief Luft holte.
»Lo, ich will nicht schon wieder fragen, aber …«
Er brauchte nicht weiterzusprechen. Ich wusste, was er sagen wollte. Es war das Gleiche, was er bereits an Silvester gesagt hatte – dass er den nächsten Schritt tun wollte. Eine gemeinsame Wohnung.
»Ich muss darüber nachdenken«, antwortete ich schließlich. Meine Stimme klang seltsam fremd und bedrückt.
»Das hast du schon vor Monaten gesagt.«
»Ich denke eben immer noch nach.«
»Ich habe mich jedenfalls entschieden.« Er fasste mich leicht am Kinn und wandte mein Gesicht sanft zu seinem. Was ich darin sah, ließ mein Herz plötzlich heftig schlagen. Ich wollte ihn berühren, doch er packte mein Handgelenk und hielt es fest. »Lo, hör auf, das immer weiter hinauszuzögern. Ich war wirklich geduldig, das weißt du, aber so langsam glaube ich, dass wir vielleicht nicht auf einer Wellenlänge sind.«
In meinem Innern machte sich eine vertraute Panik breit – eine seltsame Mischung aus Hoffnung und Furcht.
»Nicht auf einer Wellenlänge?« Mein Lächeln fühlte sich gezwungen an. »Hast du wieder Oprah geguckt?«
Abrupt ließ er meine Hand los, und als er sich abwandte, war sein Ausdruck seltsam kühl. Ich biss mir auf die Lippe.
»Hey …«
»Nein«, sagte er. »Lass. Ich wollte darüber reden, aber du ja ganz offensichtlich nicht, also … Hör zu, ich bin müde, es ist schon bald Morgen. Lass uns schlafen.«
»Judah«, flehte ich, wütend auf mich selbst, weil ich mich so mies verhielt, wütend auf ihn, weil er mich bedrängte.
»Ich habe Nein gesagt«, nuschelte er erschöpft ins Kissen. Ich dachte, er meinte unser Gespräch, doch dann fuhr er fort: »Zu einem Jobangebot. Zu Hause in New York. Ich habe abgelehnt. Deinetwegen.«
Verdammt.
4
Mein Schlaf war schwer und dumpf wie unter Beruhigungsmitteln, als der Wecker mich nur wenige Stunden später in die Wirklichkeit zurückholte. Ich hatte keine Ahnung, wie lange das Ding schon klingelte, wahrscheinlich eine ganze Weile. Der Kopf tat mir weh und ich musste mich erst orientieren, bevor es mir gelang, den Wecker auszuschalten, damit Judah, der dem Lärm zum Trotz weiter tief und fest schlief, nicht doch noch wach wurde.
Nachdem ich mir den Schlaf aus den Augen gerieben und mich gestreckt hatte, um die Verspannung in Nacken und Schultern zu lösen, richtete ich mich mühsam auf, stieg aus dem Bett und ging in die Küche. Während der Kaffee durchsickerte, nahm ich meine Tabletten ein und durchstöberte dann das Bad nach Schmerzmitteln. Außer Ibuprofen und Paracetamol fand ich ein braunes Plastikdöschen mit Tabletten, die Judah einmal wegen einer Sportverletzung verschrieben bekommen hatte. Ich drehte den kindersicheren Verschluss auf und nahm die Pillen in Augenschein. Es waren riesige rot-weiße Kapseln, sie sahen sehr wirksam aus.
Letztendlich wagte ich es doch nicht, sie zu nehmen, sondern drückte mir stattdessen aus den diversen Blistern zwei Ibuprofen und eine Paracetamol mit Expresswirkung in die Handfläche und würgte sie mit einem Schluck Kaffee runter – schwarz, denn Milch gab es nicht. Den Rest des Kaffees trank ich langsamer, während ich mir die letzte Nacht, mein dummes Verhalten und Judahs Worte durch den Kopf gehen ließ.
Ich war überrascht. Mehr noch, ich war schockiert. Über seine langfristigen Pläne hatten wir nie gesprochen, obwohl ich wusste, dass er seine Freunde in den USA, seine Mutter und seinen kleinen Bruder vermisste – die ich im Übrigen alle noch nicht kennengelernt hatte. Warum hatte er den Job abgelehnt? Weil er ihn nicht wollte? Oder wegen uns?
In der Kanne war noch genug Kaffee für eine halbe Tasse, und so goss ich den Rest in einen zweiten Becher, den ich vorsichtig ins Schlafzimmer trug.
Judah lag, alle viere von sich gestreckt, auf der Matratze, als wäre er dort hingefallen. Im Film wirken die Leute im Schlaf immer friedlich. Judah nicht. Sein übel zugerichteter Mund war zwar halb hinter seinem Arm verborgen, doch mit der hakenförmigen Nase und der gerunzelten Stirn sah er aus wie ein wütender Falke, der den Abschuss durch einen Wildhüter überlebt hatte und nun auf Rache aus war.
Vorsichtig setzte ich die Tasse auf dem Nachttisch ab, legte mein Gesicht neben ihm aufs Kissen und küsste seinen Nacken. Die Haut war warm und überraschend weich.
Er bewegte sich im Schlaf, schlang einen langen, sonnengebräunten Arm um meine Schultern, und als er seine haselnussbraunen Augen öffnete, wirkten sie sehr viel dunkler als sonst.
»Hey«, sagte ich leise.
»Hey.« Mit einem herzhaften Gähnen zog er mich an sich. Kurz leistete ich Widerstand, als ich an das Schiff dachte, den Zug und das Taxi, das in Hull auf mich wartete, doch dann schmolzen meine Glieder dahin wie heißes Plastik, und ich ließ mich neben ihn sinken, in seine Wärme. Einen Moment lang lagen wir da und sahen einander in die Augen, bevor ich die Hand ausstreckte und vorsichtig das Pflaster über seiner Lippe berührte.
»Glaubst du, er wird wieder anwachsen?«
»Keine Ahnung«, antwortete er. »Hoffentlich. Montag muss ich nach Moskau, und ich habe keine große Lust, mich da mit Zahnärzten rumzuschlagen.«
Ich schwieg. Er schloss die Augen und streckte sich, bis seine Gelenke knackten. Dann rollte er sich auf die Seite und legte mir zärtlich eine Hand auf die Brust.
»Judah …«, sagte ich und hörte selbst eine Mischung aus Verärgerung und Sehnsucht in meiner Stimme.
»Was ist?«
»Ich kann nicht. Ich muss gehen.«
»Dann geh doch.«
»Lass das. Nicht.«
»Lass das, nicht? Oder lass das nicht?« Ein schiefes Lächeln breitete sich auf seinem Gesicht aus.
»Beides. Du weißt, was ich meine.« Ich setzte mich auf und schüttelte den Kopf. Es tat weh, und ich bereute die abrupte Bewegung.
»Wie geht es deiner Wange?«, fragte er.
»Okay.« Ich tastete vorsichtig danach. Sie war zwar noch geschwollen, aber nicht mehr so stark.
Er machte ein besorgtes Gesicht und streckte einen Finger aus, um den Bluterguss zu streicheln, doch ich wich unwillkürlich zurück.
»Ich hätte da sein sollen«, sagte er.
»Warst du aber nicht«, gab ich patziger als beabsichtigt zurück. »Bist du ja nie.«
»Wie bitte?«
»Du hast mich schon verstanden.« Mir war klar, dass ich überzogen reagierte, aber die Worte stürzten nur so aus mir heraus. »Was wird denn in Zukunft sein? Angenommen, ich ziehe hier ein – wie sieht der Plan aus? Soll ich hier herumsitzen, wie Penelope mein Leichentuch weben und das Feuer am Brennen halten, während du mit den anderen Auslandskorrespondenten in irgendeiner russischen Bar Scotch trinkst?«
»Wo kommt denn das jetzt her?«
Ich schüttelte nur den Kopf und schwang die Beine aus dem Bett. Dann suchte ich die Klamotten, die ich bei Judah aufbewahrt und nach unserer Rückkehr vom Notdienst auf den Fußboden geworfen hatte, zusammen und zog mich an.
»Ich bin einfach nur müde, Judah.« Müde war untertrieben. Die letzten drei Nächte hatte ich jeweils nicht mehr als zwei Stunden geschlafen. »Und ich weiß nicht, worauf das hier hinausläuft. Es ist schon schwer genug nur mit uns beiden. Ich habe keine Lust, womöglich allein mit einem Kind und einer postnatalen Depression zu Hause zu sitzen, während du in den finstersten Löchern diesseits des Äquators in Kugelhagel gerätst.«
»In Anbetracht der jüngsten Ereignisse könnte man behaupten, dass ich in meiner eigenen Wohnung größeren Gefahren ausgesetzt bin«, erwiderte Judah, ruderte jedoch zurück, als er meinen Gesichtsausdruck sah. »Entschuldige, das war gemein. Ich weiß doch, dass es ein Unfall war.«
Ich zog meinen immer noch feuchten Mantel über und nahm meine Tasche.
»Mach’s gut, Judah.«
»Was heißt ›mach’s gut‹? Wie meinst du das?«
»Wie du willst.«
»Was ich will, ist, dass du aufhörst, so ein Drama aus allem zu machen, und endlich bei mir einziehst. Ich liebe dich, Lo!«
Die Worte trafen mich wie eine Ohrfeige. Ich blieb auf der Türschwelle stehen. Die Müdigkeit hing wie ein schweres Gewicht an meinem Hals, das mich zu Boden zog.
Die Latexhandschuhe, das leise Lachen …
»Lo?«, fragte Judah verunsichert.
»Ich kann das nicht«, sagte ich, ohne ihn anzusehen. Mir war selbst nicht klar, was ich meinte – ich kann nicht gehen, nicht bleiben, diese Unterhaltung nicht weiterführen, dieses Leben? »Ich muss … Ich muss weg.«
»Also, was diesen Job angeht«, setzte er an, mit einem Anflug von Zorn in der Stimme. »Dass ich ihn abgelehnt habe – willst du sagen, das war ein Fehler?«
»Ich habe dich nicht darum gebeten.« Meine Stimme zitterte. »Nie. Also gib mir nicht die Schuld daran.« Ich warf mir die Tasche über die Schulter und wandte mich zum Gehen.
Er schwieg und versuchte auch nicht, mich aufzuhalten. Beim Hinausgehen schwankte ich wie eine Betrunkene. Erst in der U-Bahn wurde mir bewusst, was gerade passiert war.
5
Ich liebe Häfen. Ich mag den Geruch von Teer und Seeluft und das Geschrei der Möwen. Vielleicht liegt es daran, dass wir früher in den Sommerferien so oft mit der Fähre nach Frankreich gefahren sind; jedenfalls überkommt mich am Hafen immer ein Gefühl von Freiheit, wie ich es an Flughäfen niemals spüre. Mit Flughäfen verbinde ich nur Arbeit und Sicherheitskontrollen und Verspätung. Ein Hafen dagegen steht für … keine Ahnung, etwas anderes. Für Entkommen vielleicht.
Während der Zugfahrt hatte ich versucht, die Gedanken an Judah zu verdrängen und mich mit Recherchen zur Kreuzfahrt abzulenken. Richard Bullmer war nur wenig älter als ich, doch sein Lebenslauf konnte einem Minderwertigkeitsgefühle bescheren – mir wurde ganz schwindelig bei der Liste seiner Firmen und Führungspositionen, die ihn Stufe um Stufe zu immer mehr Geld und Einfluss gebracht hatten.
Auf Wikipedia fand ich das Foto eines sonnengebräunten, gutaussehenden Mannes mit pechschwarzem Haar, Arm in Arm mit einer atemberaubend schönen Blondine Ende zwanzig. »Richard Bullmer mit seiner Frau, der Erbin Anne Lyngstadt, bei ihrer Hochzeit in Stavanger«, stand darunter.
Aufgrund seines Titels war ich davon ausgegangen, dass er seinen Reichtum auf dem Silbertablett serviert bekommen hatte, doch Wikipedia zufolge hatte ich ihm wohl Unrecht getan. Zwar hatte er es in jungen Jahren anscheinend durchaus angenehm gehabt – private Grundschule, dann Eton, gefolgt vom Balliol College in Oxford. Allerdings war während des ersten Studienjahrs sein Vater gestorben – die Mutter schien bereits vorher von der Bildfläche verschwunden zu sein –, und weil Erbschaftssteuer und Schulden das Familienanwesen und alles Vermögen verschlangen, fand er sich mit neunzehn Jahren obdachlos und allein wieder.
Unter diesen Umständen wäre schon der erfolgreiche Abschluss in Oxford eine Leistung gewesen, doch während seines dritten Studienjahres hatte er noch dazu ein Internet-Start-up gegründet. Dessen Börsengang 2003 war der erste in einer Reihe von Erfolgen, die schließlich im Stapellauf dieses kleinen Luxuskreuzfahrtschiffs zur Erkundung der skandinavischen Küsten gipfelte. »Buchen Sie die Aurora für die Hochzeit Ihrer Träume, ein außergewöhnliches Firmenevent, das Ihre Klienten begeistern wird, oder einfach eine exklusive, unvergessliche Ferienreise für sich und Ihre Familie«, hieß es in dem Pressepaket. Während der Zug weiter gen Norden sauste, sah ich mir den Grundriss des Kabinendecks genauer an.
Im Vorderteil des Schiffs – dem Bug, rief ich mir ins Gedächtnis – befanden sich zwei große und zwei mittelgroße Suiten. Im hinteren Teil gab es sechs weitere, kleinere Kabinen, die hufeisenförmig um den Flur angeordnet waren. Die Kabinen waren durchnummeriert, wobei im Heckbereich die geraden Zahlen auf der einen Seite des Flurs lagen und die ungeraden Ziffern auf der anderen. Nummer 1 befand sich an der Bugspitze und im abgerundeten Heck lagen die Kabinen 9 und 10 nebeneinander. Da die Suiten vermutlich für VIPs reserviert waren, ging ich davon aus, dass man mich in einer der kleineren Kabinen unterbringen würde. Der Grundriss enthielt keine Maßangaben, und ich dachte mit ungutem Gefühl an einige der Fährfahrten über den Ärmelkanal und die klaustrophobisch kleinen, fensterlosen Kabinen zurück. Fünf Tage in so einem Raum zu verbringen war keine besonders behagliche Vorstellung, aber auf einem Schiff wie diesem ging es sicher viel geräumiger zu.
Ich hoffte, auf der nächsten Seite die Innenansicht einer der Kabinen zu finden, die mir meine Sorgen nehmen würde, doch stattdessen blickte ich auf die Aufnahme einer spektakulären, auf weißem Leinen dargebotenen Auswahl skandinavischer Spezialitäten. Der Schiffskoch hatte sein Handwerk anscheinend im Noma und im El Bulli gelernt. Ich rieb mir die Augen und gähnte. Die Müdigkeit und die Ereignisse der vergangenen Nacht hingen wie Blei an mir.
Judahs Gesicht bei unserem Abschied kam mir wieder in den Sinn, die große, vernähte Wunde. Ich seufzte. Was war da eigentlich zwischen uns geschehen? Hatten wir uns getrennt? Hatte ich ihn verlassen? Wann immer ich versuchte, unser Gespräch zu rekonstruieren, machte sich mein Gehirn selbstständig und fügte Dinge hinzu, die ich nie gesagt hatte, und Antworten, die ich gerne gegeben hätte. Im einen Moment ließ es Judah viel begriffsstutziger und beleidigender erscheinen, als er war, um mein eigenes Verhalten zu rechtfertigen. Im nächsten Moment zeichnete es mir ein Bild seiner großen, bedingungslosen Liebe, als wollte es mir versichern, dass sich schon alles wieder einrenken würde. Ich hatte ihn nicht darum gebeten, den Job abzulehnen. Warum also sollte ich mich nun dankbar zeigen?