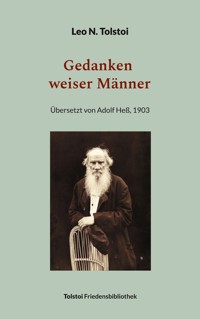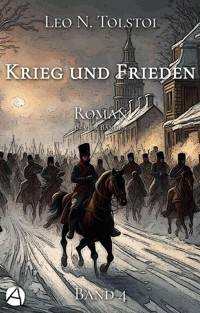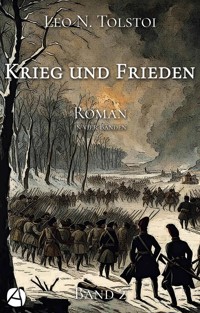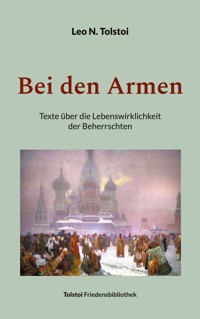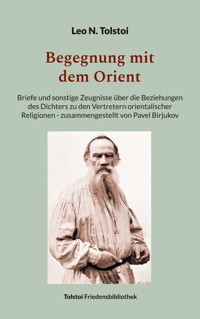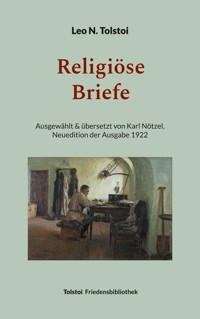Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Tolstoi-Friedensbibliothek A
- Sprache: Deutsch
Die vorliegende Neuedition enthält den abschließenden vierten Teil eines Schriftenkreises, den Leo N. Tolstoi nach seiner Hinwendung zu "Christi Lehre" geschrieben hat. Dargeboten werden die früheste und die späteste Ganzübersetzung des Werkes ins Deutsche (Sophie Behr - Moskau 1885; Raphael Löwenfeld - Diederichs Verlag 1902) sowie ein dokumentarisches Kapitel aus dem Werk des Biographen Pavel Birjukov. Eugen Drewermann erhellt in seiner Einleitung zu diesem Band die Botschaft des russischen Dichters: "Es gibt aus der Feder Tolstois keinen Text, der die Lehre Christi derart deutlich als eine im Grunde selbstverständliche Ethik in humanistischer Vernunft darstellen möchte, wie seine Schrift: 'Worin besteht mein Glaube' aus dem Jahre 1884. ... In Matthäus 5,39 spricht Jesus die umstürzenden Worte: 'Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen.' - 'Plötzlich,' schreibt Tolstoi dazu, 'faßte ich zum ersten Mal diesen Vers direkt und einfach auf. Ich verstand, daß Christus gerade das sagt, was er sagt. ...' ... Im Kampf gegen das Böse wird das vormals (oder nur vorgeblich) Gute allemale selber böse, und das in jeweils gesteigerter Form: es wird von eben der Pest infiziert, die es auszurotten gedachte. - Vom Faustkeil bis zur Atombombe zeigt sich entlang der gesamten Menschheitsgeschichte die ungeheuerliche Auswirkung dieses Teufelskreises. Der zivilisatorische Fortschritt in Wissenschaft, Technik und Verwaltung hat die Welt nicht gütiger und menschlicher gemacht, sondern sie in einen schier unentrinnbaren Schlachthof verwandelt. Daraus befreien kann allein jene komplette Umkehrung unseres gewohnten Denkens und Handelns, die Jesus in der Bergpredigt ermöglicht und fordert; sie allein deckt die horrende Unmenschlichkeit auf, die sich unter dem Galakostüm bürgerlicher Normalität verbirgt." Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe A, Band 6 (Signatur TFb_A006) Herausgegeben von Peter Bürger Korrektorat: Ingrid von Heiseler
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 803
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tolstoi-Friedensbibliothek Reihe A | Band 6
Herausgegeben von Peter Bürger
Korrektorat der Neuedition: Ingrid von Heiseler
Inhalt
EINLEITUNG
Von Eugen Drewermann
Leo Tolstoi
WORIN BESTEHT MEIN GLAUBE?
(
V čem moja vera?
, 1883/84)
Aus dem russischen Manuskriptübersetzt von Sophie Behr (1885)
Leo N. Tolstoi
MEIN GLAUBE
(
V čem moja vera?
, 1883/84)
Von dem Verfasser genehmigte Ausgabe von Raphael Löwenfeld (1902/1911)
_____
Anhang
„WORIN BESTEHT MEIN GLAUBE?“
Ein Kapitel aus dem dokumentarischen Werk „Tolstois Biographie und Memoiren“ (1909)
Von Pavel Birjukov
Kommentiertes Verzeichnis der Übersetzungen von Tolstois Schrift
V čem moja vera?
(1883/84)
Ausgewählte Literatur zu Leo N. Tolstois religiösen Schriften
Leo N. Tolstoi (1828-1910) Fotograf: Konstantin Alexandrowitsch Shapiro Aufnahme des Jahres 1877 | commons.wikimedia.org
Einleitung
Von Eugen Drewermann
Es gibt aus der Feder TOLSTOIs keinen Text, der die Lehre Christi derart deutlich als eine im Grunde selbstverständliche Ethik in humanistischer Vernunft darstellen möchte, wie seine Schrift: „Worin besteht mein Glaube“ aus dem Jahre 1884. Die ganze Größe ebenso wie auch die Grenze beziehungsweise die Ergänzungswürdigkeit seiner Gedanken zeigt sich zentral in dieser Schrift, mit der er Christi ursprüngliche Botschaft für sich persönlich wiederzufinden meinte und gegen alle kirchentheologischen und staatlichen Verformungen als verbindlich für die gesamte Menschheit wiederherzustellen suchte.
Die Größe TOLSTOIscher Gewissensethik
Insbesondere eine Stelle in der Bergpredigt ist es, die TOLSTOI „zum Schlüssel“1 seines gesamten Denkens ward; inmitten dieser Welt nicht endender Gewalt und Grausamkeit leuchtete sie ihm so hell, wie der Polarstern am Himmel in der Nacht, wenn er auf hoher See mitten im Sturm dem Steuermann die Peilung für den rechten Kurs ermöglicht und damit auch das Ausmaß der Verdriftung seines Schiffs ermessen hilft. An dieser Stelle, in Mt 5, 39 spricht Jesus die umstürzenden Worte: „Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen.“ – „Plötzlich,“ schreibt TOLSTOI dazu, „faßte ich zum ersten Mal diesen Vers direkt und einfach auf. Ich verstand, daß Christus gerade das sagt, was er sagt. Und sofort war es mir, nicht als sei etwas Neues erstanden, sondern als sei alles abgefallen, was die Wahrheit verdunkelt hatte, und die Wahrheit stand vor mir in ihrer ganzen Bedeutung.“2 „Ich begriff jetzt, was Christus sagt …: Es ist euch eingeprägt und ihr seid gewohnt, für gut und vernünftig anzusehen, daß man sich mit Gewalt gegen das Übel wehre und Auge um Auge ausreiße, daß man Strafgerichte, Polizei und Armeen einsetze, um sich gegen den Feind zu schützen. Ich aber sage euch: Braucht keine Gewalt, nehmt nicht teil an Gewalttaten, tut niemandem Böses, selbst denen nicht, die ihr eure Feinde nennt.“3 Er sagt: „Ihr glaubt, daß Eure Gesetze das Übel verbessern, sie aber steigern es nur. Es gibt nur einen Weg, das Übel zu verhindern, – der ist: Böses mit Gutem zu vergelten.“4
Anders formuliert: Wer dem sogenannten Bösen im Kampfmodus entgegentreten will, muß zu dessen Zerstörung gerade diejenigen Mittel einsetzen, in deren Destruktivität das Böse selbst gerade besteht; indem er das Böse mit den Mitteln des Bösen bekämpft, übernimmt er die Praktik des Gegners in sein eigenes Handeln, ja, er muß selber, um im Kampf gegen das Böse siegreich zu sein, immer noch ärgere Formen von Tod und Zerstörung erfinden und handhaben, als sein Gegner es bereits tut; auf diese Weise wird das Böse in einer unseligen Konkurrenz um das jeweils Schlimmere niemals verringert oder überwunden, vielmehr eskaliert es zu nie geahnten Höhen. Die Logik dieser Gegenfinalität ist unausweichlich. Im Sieg auf dem Schlachtfeld triumphiert das Böse stets über das zum Töten weniger taugliche Gute, das angeblich auszieht, das Böse zu besiegen. Im Kampf gegen das Böse wird das vormals (oder nur vorgeblich) Gute allemale selber böse, und das in jeweils gesteigerter Form: es wird von eben der Pest infiziert, die es auszurotten gedachte.
Vom Faustkeil bis zur Atombombe zeigt sich entlang der gesamten Menschheitsgeschichte die ungeheuerliche Auswirkung dieses Teufelskreises. Der zivilisatorische Fortschritt in Wissenschaft, Technik und Verwaltung hat die Welt nicht gütiger und menschlicher gemacht, sondern sie in einen schier unentrinnbaren Schlachthof verwandelt. Daraus befreien kann allein jene komplette Umkehrung unseres gewohnten Denkens und Handelns, die Jesus in der Bergpredigt ermöglicht und fordert; sie allein deckt die horrende Unmenschlichkeit auf, die sich unter dem Galakostüm bürgerlicher Normalität verbirgt.
Ein gleiches gilt für den Kampf, den alle Staaten der Welt gegen das Unrecht in ihrem Inneren mit Hilfe des Strafrechts führen. Der Krieg gegen einen äußeren Gegner ist so viel wie die Exekution des Hinrichtungsurteils, das man mit der Bereitschaft zum Töten über den Feind als Verkörperung des Bösen verhängt hat, und alle Verbrechen meint man zu diesem Zweck selber begehen zu müssen, um sie auf seiten des Gegners verhindern zu können. Dasselbe Prinzip: Gewalt gegen Gewalt, Böses für Böses, Aug‘ um Auge spricht sich ganz entsprechend aus im staatlichen Strafrecht. Einer „unbegreiflichen Stumpfheit“5 zeiht TOLSTOI sich, daß er den Satz am Ende der Bergpredigt „Richtet nicht“ in Mt 7, 1 all die Zeit nur als ein verbales, nie aber als ein richterliches Verurteilen verstanden habe: „Die Institution der Gerichte,“ gesteht er, „an denen ich teilnahm und die mein Eigentum und meine persönliche Sicherheit schützten, war mir als etwas so zweifellos Heiliges, Gottes Gesetze nicht Beeinträchtigendes erschienen, daß mir nie der Gedanke gekommen war, dieser Ausspruch könne etwas anderes bedeuten als das, daß man seinen Nächsten nicht mit Worten verdammen solle. Es kam mir gar nicht in den Sinn, daß Christus diese Worte auf die Gerichte beziehen könne: auf das Landgericht, das Kriminalgericht, das Kreis- und Friedensgericht und auf die verschiedenen Senate und Departements … Bei Lukas Kap. 6, Vers 37-49, stehen diese Worte (sc. richtet nicht, d. V.) unmittelbar nach der Lehre über das Nichtwiderstreben und über die Vergeltung des Bösen mit Gutem. Unmittelbar nach den Worten: ‚Seid barmherzig wie euer Vater im Himmel‘ heißt es: ‚Richtet nicht, so werdet ihr nicht gerichtet, verdammt nicht, so werdet ihr nicht verdammet.‘ Heißt das nicht außer der Verdammung des Nächsten auch, daß wir keine Gerichte schaffen und in ihnen nicht unseren Nächsten richten sollen?“6
Indem TOLSTOI diese seine Frage entschieden bejaht, kann er nur aussprechen, was offensichtlich ist: „Gerichte … widersprechen … der ganzen Lehre“ Jesu. Denn: „Christus schreibt vor, man solle Böses mit Gutem vergelten. Die Gerichte vergelten Böses mit Bösem. Christus sagt, man solle keinen Unterschied machen zwischen Guten und Bösen. Die Gerichte haben keine andere Bestimmung, als den Unterschied zwischen Guten und Bösen festzustellen. Christus sagt, man solle allen vergeben: nicht einmal, nicht siebenmal, sondern vergeben ohne Ende; die Feinde lieben, Gutes tun denen, die uns hassen: Die Gerichte vergeben nicht, sondern sie strafen, sie tun nicht Gutes, sondern Böses denen, die sie Feinde der Gesellschaft nennen.“7 „Wie kann … ein Mensch, der seinem Glauben nach allen stets vergeben muß, andere richten und verdammen? … daraus erkenne ich, daß es, nach Christi Lehre, einen christlichen strafenden Richter nicht geben kann.“8
Nach Jesu Lehre von der Überwindung des Bösen durch das Gute ist es ein kardinaler Fehler des gesellschaftlichen Verhaltens aller kulturellen Einrichtungen im Verlauf der menschlichen Geschichte, „daß unser ganzes Leben auf Gewalt beruht, daß jede unserer Freuden durch Gewalt errungen und beschirmt wird, … daß jeder von uns von Kindheit an bis ins Greisenalter hinein entweder der Bestrafte oder der Strafende ist.“9 Und wie soll sich dieser gräßliche Zustand ändern? Folgend der Botschaft Jesu von einem Reich Gottes auf Erden, stellt TOLSTOI sich vor, „daß anstatt jenes Völkerhasses, der uns unter dem Scheine der Vaterlandsliebe eingeflößt wird, anstatt jener Lobpreisungen des Totschlags, der Kriege, die uns von Kindheit an als die heldenmütigsten Taten geschildert werden, – uns Grauen und Verachtung gegenüber allen Tätigkeiten im staatlichen, diplomatischen und militärischen Bereich eingeflößt würde, die der Entzweiung der Menschen dienen; daß uns ferner eingeprägt würde, daß die Anerkennung von Staaten, besonderen Gesetzen, Grenzen und Ländern ein Zeichen der gröbsten Unwissenheit ist; daß der Krieg, d. h. das Töten fremder, unbekannter Menschen ohne jede (sc. persönliche, d. V.) Veranlassung, das schrecklichste Verbrechen ist, zu dem sich nur ein verirrter und verderbter Mensch verleiten lassen kann, der zum Tier herabgesunken ist.“10
Unter den Augen Gottes, der nach Jesu Worten „seine Sonne aufgehen läßt über Böse und Gute und regnen läßt über Gerechte und Ungerechte“ (Mt 5, 45), kann es nicht richtig sein, Menschen nach Gesetzen und Staatsgrenzen von einander zu trennen und sie als die Vertreter von Recht und Ordnung beziehungsweise als deren Verräter in Kriegs- und Strafrecht mit befohlener Gewalt auf einander loszulassen. Bereits die Polarisierung und Isolierung von Menschen nach richtig und falsch verkehrt die zwischenmenschlichen Beziehungen zu Heuchelei und Selbstgerechtigkeit und lügt sie um in einseitige Schuldzuweisungen und strafbewehrte Anklagen; wie projektiv dabei die eigenen Verhaltensfehler und Motive dem Gegner unterstellt zu werden pflegen, hat Jesus eindringlich mit dem Bildwort von dem Balken und dem Splitter im eigenen und fremden Auge ausgesprochen, mit dem er seine Mahnung, niemanden zu verurteilen und zu bekämpfen, untermalte (Mt 7, 3-5). Wie soll es christlich jemals akzeptabel sein, unter diesen Umständen in der üblichen politischen Praxis den Kampf gegen Menschen, die man in Kriegsrecht und Strafrecht für Feinde und Verbrecher erklärt, auf den Schlachtfeldern und in den Gerichtssälen mit gutem Gewissen weiterhin fortzusetzen und sich dabei noch vorzumachen, Gottes Willen zu erfüllen?
Fünf „Gebote“ sind es, die TOLSTOI entgegen der üblichen Selbstbetäubung in Täuschung und Trägheit aus den „Antithesen“ der Bergpredigt ableitet, um den Weg Jesu zu einem Reich Gottes des Friedens und der Versöhnung hier auf Erden aufzuzeigen: „Das erste Gebot lautet: Halte Frieden mit allen … der Dienst Gottes ist Vernichtung der Feindschaft.“ (Mt 5, 21-26) Meidet entsprechend auch die mögliche Verführung zu Ehebruch und Ehescheidung (Mt 5, 27-32); ferner: leiste keinerlei Gelübde (Mt 5, 33-37); sodann: „übe nicht Rache und Vergeltung, die da menschliche Gerechtigkeit genannt wird … vergelte … nicht Böses mit Bösem“ (Mt 5, 38-42); und schließlich: „Wisse, daß alle Menschen Brüder und Kinder eines Gottes sind, und brich mit niemand den Frieden im Namen der Vorteile des Volks“; verweigere also „die Unterscheidung der Nationen, die Feindschaft der Völker und Staaten“ (Mt 5, 43-48)11.
„Sobald die Menschen eines dieser Gebote nicht erfüllen,“ ist TOLSTOI sich sicher, „wird der Friede gestört. Erfüllen aber die Menschen alle Gebote, so wird das Reich des Friedens auf Erden herrschen.“ Denn: „Diese Gebote schließen alles Böse aus dem Leben der Menschen aus.“12 Sie allein überwinden das Böse durch das Gute. Sie enthalten die unmittelbare Anweisung, „keinen Unterschied zu machen zwischen dem eigenen und dem fremden Volke und nichts von alledem zu tun, was aus diesem Unterschied entspringt: fremde Völker nicht anfeinden, keinen Krieg führen, nicht teilnehmen an Kriegen, uns nicht waffnen zum Krieg, sondern uns zu allen Menschen, welcher Nation sie auch angehören mögen, ebenso verhalten, wie wir es zu der eigenen tun.“13 Sie zeigen damit zugleich auch überdeutlich, „daß das, was in unserem Leben nicht nur für unentbehrlich und natürlich, sondern auch für das Herrlichste und Heldenmütigste gilt – die Liebe zum Vaterlande, seine Verteidigung und Vergrößerung, der Kampf mit dem Feinde u. dergl. –, nicht nur eine Übertretung des Gesetzes Christi, sondern ein vollständiges Sichlossagen von ihm ist.“14 In der frühen Kirche hat man denn auch genau so gedacht und gehandelt.
„Und jetzt? Jetzt ist gar keine Frage mehr, ob der Christ am Krieg teilnehmen dürfe. Alle jungen Leute, die nach dem kirchlichen, sogenannten christlichen Gesetz erzogen worden sind, gehen jeden Herbst, sobald der Termin eintritt, zu den Rekrutierungsstellen und sagen sich mit Hilfe kirchlicher Priester vom Gesetze Christi los.“15 Der entscheidende Fehler, der diesen Zustand zuläßt, besteht nach TOLSTOI in der kirchlichen Behauptung, „daß die christliche Lehre nur die Erlösung des einzelnen im Auge habe und sich nicht auf allgemeine, auf Staatsangelegenheiten beziehe … ich muß notwendig die Frage lösen: worin besteht der Dienst Gottes und worin der Dienst des ‚tohu‘ (sc. des Götzen, d. V.)? Soll ich in den Krieg ziehen oder nicht? … Kein einziger Mensch kann der Entscheidung dieser Frage entgehen. Ich spreche schon gar nicht von unserem Stande, dessen ganze Tätigkeit darin besteht, daß wir den Übeltätern widerstreben: Militär und Gerichtspersonen, Administratoren. Aber es gibt auch nicht den einfachen Privatmann, dem nicht die Entscheidung zwischen dem Dienste Gottes und der Erfüllung seiner Gebote und dem Dienste des ‚tohu‘, d. i. den Staatseinrichtungen, bevorstände. Mein persönliches Leben ist mit dem allgemeinen Staatsleben verflochten; das Staatsleben aber fordert von mir eine nichtchristliche Tätigkeit, die dem Gebote Christi direkt zuwiderläuft. Jetzt, bei der allgemeinen Wehrpflicht und der Beteiligung aller am Gerichte als Geschworene, tritt dieses Dilemma mit augenfälliger Deutlichkeit vor uns alle hin. Jeder Mensch muß tödliche Waffen zur Hand nehmen, ein Gewehr, ein Messer, und wenn auch nicht töten, so doch das Gewehr laden und das Messer schärfen, d. h. zum Totschlag bereit sein. Jeder Bürger soll im Gerichte erscheinen und sich am Richten und Strafen beteiligen, d. h. jeder soll das Gebot Christi vom Nichtwiderstreben in Wort und Tat verleugnen. – Die Frage …: Evangelium oder militärische Dienstvorschrift? Gesetz Gottes oder Gesetz des Menschen? – steht jetzt und stand zu Samuels Zeiten vor der Menschheit. Sie stand auch vor Christus und vor seinen Jüngern. Sie steht auch vor denen, die jetzt Christen sein wollen, und stand auch vor mir.“16
Mithin: Man muß sich entscheiden zwischen dem Gesetz des Staates und dem Gesetz Christi; Christsein ist nicht anders möglich als in Ablehnung der Basis, auf welcher alle Staaten dieser Welt beruhen: auf Gewalt, Gerichtswesen und Geldgewinn, und es ist nach Lage der Dinge sonnenklar, daß die jeweilige Regierung nicht zugeben kann, „daß ein Glied der Gesellschaft die Grundlage der Staatsordnung nicht anerkennt und sich der Erfüllung der Pflichten aller Bürger entzieht. Die Regierung wird vom Christen den Eid, die Beteiligung am Gericht und am Kriegsdienst verlangen und wird ihn für seine Weigerung der Strafe der Verbannung, der Gefängnishaft und selbst der Todesstrafe unterwerfen … (Aber:) Für den Christen ist die Forderung der Regierung nur eine Forderung von Menschen, die die Wahrheit nicht kennen. Und darum kann der Christ, der die Wahrheit kennt, nicht umhin, diese Wahrheit allen denen zu bezeugen, die sie nicht kennen … Alle Gewalttaten – Krieg, Plünderung, Hinrichtungen – entstehen nicht infolge unvernünftiger Naturkräfte, sondern werden durch verirrte Menschen hervorgebracht.“17
Was aber bewirkte diese „Verirrung“? Sie geht unmittelbar zurück auf den Einfluß von „tierischen Instinkten“18, deren Forderungen auch die staatlichen Einrichtungen Folge leisten, indem sie dem Egoismus der Bürger, ihrer Gewaltbereitschaft zu Selbstdurchsetzung und Vergeltung sowie ihrem Streben nach Besitz und Macht mit eigenen Trainings- und Ausbildungsprogrammen nebst dem Gebot ihrer Gesetze schützend und stützend zur Seite stehen. Die Entscheidung zwischen dem Gesetz des Staates und dem Gesetz Christi ist im letzten eine Entscheidung zwischen Trieb und Vernunft. Im Grunde nämlich entspricht die Lehre Christi gänzlich dem Gesetz, das in dem Herzen, im Gewissen und in der Vernunft eines jeden Menschen sich zu Wort meldet. Insofern lehrt die Botschaft Jesu durchaus nichts Wesensfremdes und die Menschen Überforderndes, sie erhebt sie vielmehr zu dem „Licht der Vernunft“19, das sie glücklicherweise hindert, Dinge zu tun, die in ihrer Unvernunft nur Leid und Schaden stiften können. „Christi Lehre,“ sagt daher TOLSTOI, „muß von den Menschen unbedingt angenommen werden, … weil sie allein jene Regeln des Lebens gibt, ohne welche die Menschheit weder gelebt hat, noch leben kann, ohne die kein einziger Mensch gelebt hat, noch zu leben vermag, wenn er als Mensch, d. h. mit Vernunft, leben will … Die metaphysische Lehre Christi ist nicht neu. Es ist immer ein und dieselbe Lehre der Menschheit, die in den Herzen der Menschen geschrieben steht und die von allen wahrhaften Weisen der Welt verkündet worden ist. Aber die Macht der Lehre Christi liegt in der Anwendung dieser metaphysischen Lehre auf das Leben.“20 Daraus folgt: Anstatt wie das Judentum nach dem Gesetz des Moses „das Leben in der Erfüllung von 613 oft sinnlosen, grausamen Geboten“ zu gründen, „die sich sämtlich auf die Autorität der Schrift stützten, … ist die auf derselben metaphysischen Grundlage (sc. des Monotheismus, d. V.) entstandene Lehre (sc. des Gesetzes Christi, d. V.) in nur fünf vernünftigen, heilbringenden Geboten ausgedrückt, die in sich selbst ihre Rechtfertigung tragen und das ganze Leben des Menschen umfassen.“21
So verstanden, ist die Lehre Jesu letztlich eine humane Vernunftethik, die ausformuliert, was eigentlich „jedes Menschen Herz … sucht und wünscht.“22 „Die ganze Vernunfttätigkeit des Menschen bestand immer und konnte nur bestehen in der Aufklärung des Strebens zum Guten durch die Vernunft … Der Vernunft zu folgen zur Erreichung der Glückseligkeit – darin bestand stets die Lehre aller wahrhaften Lehrer der Menschheit, darin besteht die ganze Lehre Christi, und sie, d. i. die Vernunft, durch Vernunft abzuleugnen, das ist nun gar nicht möglich.“23
Mit diesen Worten bekennt TOLSTOI sich eindeutig zu der Auffassung der KANTschen Aufklärung, daß die Religion ihren Ort in der praktischen Vernunft habe, und dementsprechend interpretiert er die Lehre Jesu wesentlich als einen Leitfaden der Vernunft zu einem glückseligen Leben; als ein solches deutet er die Verheißung Jesu von der Ankunft der Gottesherrschaft, und in ihm selber als dem Menschensohn sieht er die Gestalt dessen, „der mit allen Menschen identisch ist,“ d. h. „die Verkörperung von dem allen Menschen innewohnenden Suchen nach dem Guten und der allen Menschen eigenen Vernunft, die den Menschen in jenem Streben erleuchtet.“24 Wer daher sich der Lehre Christi anschließt, folgt nicht einer weltanschaulichen Doktrin, sondern seiner eigenen inneren Überzeugung, die ihn als Menschen zum Bruder des „Menschensohnes“ macht. Von der Kirche, die mit ihrer eigenen Macht- und Kriegspolitik die Lehre Jesu nicht sowohl verkündet als verrät, muß man sich genau so lossagen wie vom Staat. Wer versteht, was Jesus zu sagen hat, findet zurück zum Wesen seiner Menschlichkeit, und er vernimmt, was die Vernunft seinem eigenen Herzen zu tun und zu denken heißt.
Damit ist für TOLSTOI der alte Konflikt von Glauben und Wissen, von Sakral und Profan, von Ethik und Politik, von Individuum und Gesellschaft, von Religion und Philosophie „aufgehoben“; doch steht er zugleich vor einer Frage, die sich nur lösen läßt, wenn die absolute Berechtigung seiner Auffassung von Religion und Christentum in zwei wichtigen Punkten eine gewisse Berichtigung durch eine notwendige Weiterführung erfährt.
Die Grenzen der TOLSTOIschen Ethik und ihre christliche Erweiterung
Zum einen: Die Frage, die von TOLSTOI her als nicht beantwortbar erscheinen muß, ist ebenso dringlich wie einfach: warum, wenn doch die Lehre Jesu vom Nichtwiderstehn des Bösen genau das sagt, was die Vernunft dem Herzen eines jeden Mensch aufträgt, warum verweigert man ihr dann in Politik, Gesellschaft und Geschichte die Gefolgschaft? Was führt dazu, daß man den ständigen Selbstwiderspruch zwischen Verhalten und Vernunft, zwischen Wirken und Wesen, zwischen Schein und Sein fast schon als etwas Naturgegebenes betrachtet und durch die Bank, wie gerade jetzt in der vermeintlichen „Zeitenwende“ mit ihrer verhängnisvollen Remilitarisierung des Bewußtseins der staatstreuen Bürger, behauptet, mit der Bergpredigt könne man keine Politik machen und Friede sei zu schaffen nur mit Waffen? Irgend etwas ist mit der „Natur“ des Menschen wirklich nicht in Ordnung; es bedarf der Heilung, und gerade eine solche Seelentherapie, nicht nur ein ethisch zu verordnendes Gesetz, war Ziel und Mittelpunkt von allem, was die Evangelien an Worten und an Taten Jesu überliefern. Und ein zweites: Neben dem Gedanken der Erlösung von der Daseinsschuld des Menschen verwahrte TOLSTOI sich auch gegen die neutestamentliche Hoffnung auf Auferstehung, mithin auf ein ewiges Leben der persönlichen Existenz. Beides, die Erlösungslehre der Kirche ebenso wie ihre Lehre von der Erweckung der Toten, hielt TOLSTOI für einen „Aberglauben“25 beziehungsweise für einen „epidemischen Wahnsinn“26, den er bekämpfte, ohne den symbolischen Sinngehalt dieser Glaubensinhalte jenseits der historisierenden Außengestalt der kirchlichen Dogmen wahrzunehmen oder freizulegen. – Doch der Reihe nach.
Die sogenannte Erbsündenlehre der Kirche ist in der Tat das Musterbeispiel einer falschen Diagnose mit der Folge einer falschen Therapie, und dies im Mittelpunkt christlichen Selbstverständnisses als einer Erlösungslehre, eben nicht als einer bloßen Ethik. – Das Urmenschenpaar, Adam und Eva, soll laut Bibel gesündigt haben und deswegen von Gott aus dem Garten Eden verbannt worden sein. Doch wie interpretiert man diese Geschichte? Liest man die Texte von Gen 2, 4b-25; 3, 1-24 als Informationen über historische Tatsachen und Begebenheiten, entsteht unausweichlich jenes phantastische Bild, das TOLSTOI so bekämpfte und mit Recht für den Ursprung einer Fülle von kirchlichen und bürgerlichen Fehlentscheidungen hielt. Da hätte die Welt sich ursprünglich in einem leidfreien, paradiesischen Zustand befunden, in dem die Menschen von Natur aus unsterblich gewesen wären und des Glücks ihrer Liebe und ihrer Einheit mit der umgebenden Natur ungestört genossen hätten. Dann aber, auf Einflüsterung der Schlange, hätten sie werden wollen wie Gott und seien dafür mit dem Tode bestraft worden; die Welt, wie wir sie heute haben, gilt in ihren natürlichen Einrichtungen bei dieser Sicht als belegt mit einem leidvollen Fluch zur Bestrafung der menschlichen Schuld, deren Abtragung erst am Ende der Tage mit der Ankunft des Menschensohnes enden wird.
Eine derartige Doktrin steht, wie TOLSTOI geltend machte, nicht nur im Widerspruch zu „Philosophie“ und „Wissenschaft“, sie erklärt vor allem das irdische Leben für etwas „eitel Böses“, das sich nur ertragen läßt durch die „Einbildung“ „an ein zukünftiges, seliges, ewiges Leben“27. In absichtlicher Blindheit gegenüber der Aufklärung fordert die Kirche konsequenterweise mit ihrer Lehre dazu auf, sich von der Welt zurückzuziehen und durch Leiden und Askese die eigene Seele für das zukünftige Leben zu retten28. Daß es gälte, hier auf Erden glücklich in Gott zu leben, ist dieser Lehre einer „Erlösung durch den Glauben … oder das freiwillige Märtyrertum in diesem Leben“ völlig fremd29.
Was an diesem Konzept am meisten störte, war die Verführung zur Passivität. Die „Erlösung“ der „Welt“ ist nicht in das menschliche Handeln gelegt, monierte er, sondern sie soll bewirkt worden sein durch die „zweite Person der Dreieinigkeit, Christus, … dadurch, daß die Menschen ihn getötet haben“ und er dadurch „die Sünde Adams abgebüßt“ hat30. Die Wirklichkeit hat sich indessen nicht geändert, – „das wahre Leben“ wird erst „nach diesem Leben … beginnen“31; bis dahin kommt es zur rechten Vorbereitung darauf an, im Glauben die Erlösung von Sünde und Schuld durch Christi Opfertod am Kreuz festzuhalten und durch den Empfang der kirchlichen Sakramente daran teilzunehmen. Aus all dem folgt, daß „das Leben hier auf Erden … ein schlechtes, durch menschliche Bemühung nicht zu verbesserndes Leben“ ist32 und die kirchlichen Einrichtungen nur dazu da sind, ein zukünftiges Leben vorwegzunehmen, das über die unerträgliche Gegenwart hinwegtröstet, indem sie diese als Realität akzeptiert und als gottgewollt absegnet. Nur so läßt sich das widersinnige Nebeneinander von christlicher Friedensbotschaft und militärischer Politik im „christlichen“ Abendland begreifen.
Was sich da seit 1800 Jahren in kirchlicher Obhut aufführt, ist in der Tat eine einzige Verdrehung und Lüge, – TOLSTOI hat recht. Aber: ist es richtig, die zentrale christliche Lehre von „Erbsünde“ und „Erlösung“ als Ideologie und Idolatrie abzutun, nur weil sie in der Theologiegeschichte derart miserabel und mißverständlich ausgelegt wurde, und schließlich nichts weiter übrig zu behalten als eine bloße Morallehre, gestützt auf die vernünftige Erkenntnis der sittlichen Weisheit der Bergpredigt? Die Menschen müssen wirklich „erlöst“ werden, um allererst zum moralisch Guten fähig zu werden; doch um das zu begreifen, müßte man die Geschichte von der Erbsünde anders verstehen, als es in der Kirchendogmatik geschieht.
Warum eigentlich tuen die Menschen, für deren Urbilder Adam und Eva wesentlich (nicht historisch) stehen, „böses“, indem sie Gottes Gebot übertreten? Weil sie „ungehorsam“ sind, wie die Kirche sagt? So kann es nicht sein, – ein Hauptproblem des Militärs ist gerade die Erziehung zum Gehorsam33. Oder weil sie in prometheischem Hochmut Gottähnlichkeit begehren? Das gerade auch nicht! Es läßt sich zeigen, daß allein die Angst vor der eigenen kreatürlichen Nichtigkeit und Nichtnotwendigkeit, dargestellt im Symbol der Schlange, die Menschen dahin treibt, sich eine absolute Daseinsberechtigung und Seinsnotwendigkeit nach Gottes Art selber verschaffen zu wollen, – mit dem Ergebnis, daß sie ihre Unvollkommenheit und Mängelhaftigkeit mit um so größerer Pein und Scham empfinden müssen. Wenn Menschen im Entdecken ihrer eigenen Kontingenz (im Gespräch mit der „Schlange“) aus lauter Angst Gott aus den Augen verlieren und sich verzweifelt in eine unmögliche Seinsbegründung aus sich selbst heraus entwerfen, verlieren sie sich selber; sie verlieren ihre Geborgenheit inmitten dieser Welt, sie verlieren das Empfinden der Wertschätzung und Dankbarkeit für die Tatsache ihrer Existenz, sie verlieren sogar die Fähigkeit, sich gegenseitig ohne Scheu und Vorwurf anzuschauen; selbst die Fruchtbarkeit des Ackers, selbst die Fruchtbarkeit eigener Kinder ist in einem solchen Selbsterleben überschattet von Mühsal, Leid und Plage, und über allem liegt der Tod, jederzeit bereit, das Leben in den Staub rückzuverwandeln, aus dem es gebildet ward. Nicht von einer phantastischen physischen Unsterblichkeit erzählt, so verstanden, die Sündenfallgeschichte, wohl aber von der Unerträglichkeit eines Daseins, das nur den Sinn zu haben scheint, dem Tod als Beutematerial zu dienen.
Und so, im Kampf gegen die Unbedeutendheit, geht es denn weiter. Wer bin ich, verglichen mit dem Menschen neben mir? – Der Tod läßt sich instrumentalisieren als Waffe, uns in Konkurrenz mit anderen als überlegen und als siegreich dazustellen. Insbesondere das Problem der Gewalt, auf das TOLSTOI mit Recht so großes Gewicht legte, hat, wie in der Kain-und-Abel-Geschichte erzählt wird, hier seine eigentliche Ursache: wie gewinnt man Ansehen, Beachtung und Bestätigung?
Es ist sehr wichtig, daß TOLSTOI sich im Namen Jesu entschieden dem Kampf gegen das Böse widersetzt und an die Stelle des Verurteilens und Strafens das Verstehen und Vergeben gestellt hat; doch eben deshalb langt es an dieser Stelle nicht aus, die Botschaft Jesu rein moralisch auszulegen. Wer in dem Bösen, das geschieht, die Symptomatik seelischer Konflikte und Erkrankungen erkennt, der ist gehalten, diesen Ursachen im Hintergrunde nachzugehen und sie in Bewußtmachung und Durcharbeitung aufzulösen. Nicht ethisch, – psychotherapeutisch in Richtung auf die Grundnöte des Menschseins ist die Botschaft des Mannes zu lesen, der programmatisch schon am Anfang seines öffentlichen Wirkens von sich sagen konnte: „Nicht die Gesunden bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder.“ (Mk 2, 17) Das Böse, die Sünde, ist demnach zu betrachten als eine Krankheit der Seele, die es im Vertrauen auf Gott von ihrer Angst zu erlösen gilt. Alles, was Jesus gesagt und getan hat, gewinnt von diesem therapeutischen Anliegen einer Krankenheilung her seinen inneren Zusammenhang und seine Folgerichtigkeit.
Insbesondere die Neigung, die Angst vor einem potentiellen Gegner mit Angstverbreitung und „Abschreckung“ zu beantworten, findet in der Nachfolge Kains ihren Ausdruck in dem Lied Lamechs an seine Frauen Ada und Zilla (Gen 4, 23-24): „Siebenmal wird Kain (von Gott) gerächt, doch siebenundsiebzigmal Lamech.“ Diese Haltung bildet im Hintergrund von Rüstung und Kriegsvorbereitung die Ursache für die Tragödie der militärischen Gewalt in der menschlich-unmenschlichen Geschichte. Jesus tritt ihr entgegen, wenn er in Mt 18, 21-22 Petrus gebietet, genau dieses Maß an Rache und Gewalt durch ein Gleichmaß an Rücksichtnahme und an Güte aufzuwiegen. Vollkommen richtig betont TOLSTOI: das ist die wahre Lehre Jesu zur Überwindung des Bösen, nicht aber das ständige Training zum Töten. Freilich: gerade diese Einsicht läßt sich nicht mit moralischen Mitteln herbeikommandieren, sie kann nur durch ein Vertrauen ermöglicht werden, das den Menschen ihre Sicherheit in Gott zurückgibt und sie davor bewahrt, ihre Sicherheit vor einander in der Bedrohung mit nicht endender Gewalt zu suchen.
Im rechten Verständnis ist die „Erbsündenlehre“ der Kirche daher nicht nur in der Bibel wohlbegründet34 und durchaus kein „epidemisches Wahngebilde“, sie bietet auch ein stabiles Fundament, der menschlichen Not therapeutisch, statt moralisierend, zu begegnen35. Was TOLSTOI selber als Dichter so virtuos vermochte: die Ehebrecherin und Selbstmörderin Anna Karenina z. B. als eine Frau zu zeichnen, die an der Lieblosigkeit der immer Richtigen zerbricht, – gerade ein solches heilendes Verstehen würde in einer lebendig gelebten Praxis im Namen Jesu sich fortsetzen. Der russische Dichter müßte nicht, wie er es schließlich tat, „Romane, Gedichte, Musik, Theater“ als „Begierden … entzündende Vergnügungen“ verwerfen36. Er könnte mit seiner enormen Fähigkeit, sich in das Leben Einzelner einzufühlen, die Dichtkunst selber handhaben wie Jesus seine Gleichnisse oder wie ein Psychoanalytiker die Träume: therapeutisch.
Allerdings, er müßte dann den Einzelnen so ernstnehmen, wie es allein die Lehre von der Auferstehung tut, indem sie einem jeden Menschen Ewigkeitsbedeutung zuspricht. Schon als Bedingung, überhaupt moralisch sein zu können, ist diese Lehre unerläßlich. Denn: wie sonst wohl sollte ein Einzelner angesichts der Ungerechtigkeit der Welt, wie angesichts der sicher zu erwartenden Erfolglosigkeit auch nur des quälenden Bemühens, eine Friedenslösung entgegen der politischen Propaganda der Gewalt als Option offen zu halten, der Stimme seines eigenen Gewissens treu bleiben ohne die Hoffnung auf ein endgültiges Urteil Gottes über sein Leben und die Verworrenheit der Menschenwelt? Wie soll jemand an Jesu Seite für die Güte und Vergebung gegen Strafrecht und Gewalt sich engagieren, ohne daß er selbst, wie Christus im Lukas-Evangelium, sterbend sagen könnte: „Lieber Vater, in deine Hände gebe ich mich ganz“ (Lk 23, 46; Ps 31, 6)? Das Engagement eines Einzelnen auf Leben und Tod ist möglich nur durch eine absolute Festigung seiner Person im Gegenüber der absoluten Person Gottes. Gerade die Jesuanische Moral, die TOLSTOI einfordert, läßt sich nur in Verbindung mit dem Auferstehungsglauben Jesu halten.
Nun hat aber TOLSTOI gerade gegen diese existentiell notwendige Glaubensvoraussetzung einer ethischen Jesus-Nachfolge sich entschieden verwahrt, um seinen an sich berechtigten Protest gegen die in sich verdrehte kirchliche Erbsünden- und Erlösungslehre zu Ende zu führen; und er wußte dafür gute Gründe. Denn nach dieser Lehre ist der Mensch nicht nur mit einer unsterblichen Seele ausgestattet, sondern er war im Paradies auch leiblich durch eine übernatürliche Gnade Gottes von der Sterblichkeit befreit: erst durch seine Sünde zog er sich den Tod als Strafe zu. – Für TOLSTOI liegt darin eine unerhörte Verfälschung der natürlichen Gegebenheiten und eine unerträgliche Belastung der irdischen Existenz mit den Vorstellungen von Fluch und Strafe. Wie aber kann man leben mit den „natürlichen Gegebenheiten“? In der Natur gibt es nichts, das ewig leben dürfte. Für TOLSTOI war klar: „das ewige Leben ist … einzig die Eigenschaft Gottes.“37 Und er folgerte daraus: „Um an einem solchen Leben teilzuhaben, muß der Mensch sich von seinem Willen lossagen, um den Willen des Vaters des Lebens zu erfüllen.“38 Um das aber zu tun, sah TOLSTOI es geradewegs als ein Hindernis an, den Glauben an die Unsterblichkeit der individuellen Person aufrecht zu erhalten, schon deshalb, weil ihm damit unauflöslich die Erwartung von ewigem Lohn und ewiger Strafe verbunden zu sein schien; „so denken,“ schrieb er, „trägt nicht zum Verständnis der Lehre Christi bei; so denken heißt im Gegenteil die Lehre Christi ihrer Hauptgrundlage berauben. – Die ganze Lehre Christi besteht darin, daß seine Schüler, wenn sie das Trügerische des persönlichen Lebens erkannt haben, sich von ihm lossagen und es in das Leben der ganzen Menschheit übertragen. Die Lehre dagegen von der Unsterblichkeit der persönlichen Seele führt nicht nur nicht zur Lossagung vom persönlichen Leben, sie befestigt vielmehr dieses Persönliche für alle Zeiten.“39 Und eben darin sah TOLSTOI die Ursache für die Verfälschung des Christentums im ganzen; dabei sah er nicht (oder nahm es in Kauf), daß er mit dieser Auffassung der Weisheitslehre des Buddhismus bedeutend näher kam als der Person und Botschaft Jesu.
Was TOLSTOI bei dem Begriff Person und Einzelner vor Augen steht, ist offenbar die Vorstellung von einem Menschen, der als Subjekt die ganze Welt mit seinen höchst persönlichen Bedürfnissen, Erwartungen und Forderungen überzieht, – ein Egomane oder Egozentriker, der andere gleich einem Vampir für die eigenen Interessen aussaugt, doch dem es äußerst schwer fällt, aus der Perspektive anderer sein eigenes Leben zu betrachten und entsprechend einzurichten. Es leidet keinen Zweifel, daß es solche Menschen gibt, doch verwechselt TOLSTOI in seiner Theorie Sein und Bewußtsein, wenn er die Existenz eines Subjekts identisch setzt mit Subjektivismus, des Egos mit Egoismus, des Individuums mit Individualismus. Gewiß kann es sein, daß Menschen nur um sich selber kreisen, doch nicht weil sie sich als Subjekte und als Individuen mit einem eigenen Ich wahrnehmen, sondern weil Angst und Schmerz sie derart an sich selber leiden lassen, daß ihr Bewußtsein einzig auf sich selber fokussiert ist. Ihr Ich ist nicht zu groß, es ist zu schwach und es braucht Stärkung. Das Unverständnis oder Mißverständnis der kirchlichen Erbsündenlehre hingegen läßt TOLSTOI die Psychodynamik der Angst als den entscheidenden Faktor der Verformung des gesamten Existenzaufbaus einer Person schlicht ausgeklammert halten, und so beharrt er zur Lösung des Problems einer ichsüchtigen Amoralität mit aller Energie darauf, die Annahme einer Person für ebenso falsch zu erklären wie den Glauben an eine persönliche Unsterblichkeit. Damit beschreitet er freilich den Weg zur Erlösung der tragischen Lage des Menschen inmitten von Welt und Geschichte in genau der entgegengesetzten Richtung wie Christus selbst.
Der Unterschied ist eklatant: Alle Heilsgeschichten des Neuen Testaments bieten ein beredtes Zeugnis dafür, wie intensiv Jesus der individuellen Not eines Gelähmten, Erblindeten, Aussätzigen oder Besessenen sich zugewandt hat; er handelte genau so, wie ein Psychotherapeut es tut: er erklärte das Ich des Kranken nicht für eine Illusion, von der man sich befreien sollte, er nahm vielmehr das Ich des anderen für eine nicht weiter reduzierbare Realität, der er zu ihrer Heilung sich mit allen Kräften seiner Seele widmete. Nicht durch Verleugnung, – durch Verstärkung und Bestätigung des Ichgefühls des Patienten wirkte er die Heilungswunder seiner Güte. Es verhält sich also gerade umgekehrt, wie TOLSTOI es vermeinte, wenn er schrieb: „Deshalb eben können diejenigen, die an die Glückseligkeit eines persönlichen Lebens glauben, nicht an die Lehre Christi glauben.“40
Daß es sich so, wie TOLSTOI diesbezüglich dachte, nicht verhalten kann, wird vollends deutlich, wenn er seine Anschauung in gleichem Sinne auch auf die Person des Christus selbst bezieht. Wohl zählt er all die Stellen in den Evangelien auf, die gewöhnlich als „Weissagung seiner Auferstehung ausgelegt“ werden41, doch versteht er diese Aussagen allsamt als „Wiederherstellung des ewigen Lebens in Gott“, als Aufhebung der individuellen Person in das Eine, das er Gott nennt, eben nicht als persönliche Unsterblichkeit42. So gelangt er zu der erstaunlichen Aussage, daß „Christus nie und nirgends“ über „seine persönliche Auferstehung“ gesprochen habe43. Das läßt sich nur behaupten, wenn, wie TOLSTOI meint, „der Christus“ in sich selbst nichts weiter ist als die Personifikation des „Menschen, der seine Gottessohnschaft erkannt hat.“44 Doch „Gottessohn“ und „Christus“ sind bekanntlich bloße Titel, keine wirklichen Personen. Titel können nicht auferstehen; Personen aber, die, wie Jesus, für Gott in einen tödlichen Konflikt mit der gesamten Weltordnung eintreten, brauchen unbedingt die Zuversicht, daß Gott im Tod sie nicht allein läßt.
Bezeichnenderweise erwuchs der Glaube an Auferstehung denn auch im Kreis der Pharisäer, denen Jesus selber nahe stand, und er wurde geboren aus den Erfahrungen des „leidenden Gerechten“, der gerade wegen seiner Treue zu Gott von den Machthabern dieser Welt in den Tod getrieben wird. Wenn Jesus in Mk 8, 31; 9, 31; 10, 3334 dreimal den Jüngern die Tatsache und die Art seines Leidens voraussagt und regelmäßig hinzufügt, nach drei Tagen werde er auferstehen, so mag man darin einen nachösterlichen Ausdruck des Auferstehungsglaubens der Jünger Jesu (statt einer historisch echten Prophezeiung) sehen; doch auch und gerade dann darf man nicht überhören, was das Markus-Evangelium sich selber und seinen Lesern sagen will: Es wäre Jesus niemals als Person zum Zeugnis Gottes und zugunsten unserer Menschlichkeit sehenden Auges in den Tod gegangen, ohne die zuversichtliche Erwartung seines ewigen persönlichen Lebens in den Händen Gottes.
Und gerade so gilt es für jeden Christen. Der Glaube an die Auferstehung schmälert nicht den Einsatz für die Wahrheit Jesu, im Gegenteil, er ist dessen Bedingung und Ermöglichung. Dem Massenmord auf den Schlachtfeldern in der Todesangst der Kombattanten, die sich wie Wahnsinnige wechselseitig umbringen, um im Töten anderer ein bißchen Leben für sich selber hier auf Erden zu gewinnen, läßt sich wirklich nur Widerstand entgegensetzen in dem Glauben an ein anderes, von Angst befreites, unsterbliches Leben in den Händen Gottes, aus denen jeder kommt und zu denen ein jeder zurückkehrt – von Ewigkeit zu Ewigkeit. Selbst die gefeierten Helden auf den Schlachtfeldern werden wie im indischen Mahabharata-Epos einander wieder begegnen, und es wird ihr „Gericht“: ihre Läuterung und Reifung sein, droben zu tun, was sie hienieden verweigerten oder zu tun nicht vermochten: alle Kriegsgründe in Angst und in Haß endlich hinter sich zu lassen und unter Gottes Augen als zusammengehörige Partner einander zu begreifen, bereit, sich auf ewig miteinander zu versöhnen. – Den ewigen Totensonntag und Karfreitag widerlegt allein der Ostermorgen.
Leo N. Tolstoi (1828-1910), Porträt des Jahres 1873
Gemälde von Iwan Nikolajewitsch Kramskoi, 1837-1887 (commons.wikimedia.org)
1 LEO N. TOLSTOI: Mein Glaube, aus dem Russischen von Raphael Löwenfeld (Sämtliche Werke, I. Serie. Sozial-ethische Schriften, Leipzig [1902]), durchgesehene Neuausgabe mit Anmerkungen von Evelies Schmidt, München 1990, Kap. I, S. 25. [Die 2. Auflage von 1911 im vorliegenden Band auf →S. 223-420.]
2 A. a. O.; vgl. I 28.
3 IV 62.
4 IV 63.
5 III 43.
6 III 44-45.
7 III 46.
8 III 48.
9 VI 143.
10 VI 144.
11 VI 146-147; vgl. VI 110-136; XII 316-328.
12 VI 147.
13 VI 136-137.
14 VI 137.
15 VI 140.
16 III 41-42.
17 XII 334-335.
18 III 43.
19 XI 307.
20 XI 309.
21 XI 309-310.
22 VI 148.
23 VII 164.
24 VII 165.
25 VII 159.
26 VII 169.
27 VII 170.
28 X 232.
29 X 237.
30 VII 154.
31 VIII 205.
32 VII 161.
33 E. DREWERMANN: Nur durch Frieden bewahren wir uns selber. Die Bergpredigt als Zeitenwende, Ostfildern 2023, 119-124: Der desaströse Drill soldatischen Gehorsams.
34 Vgl. E. DREWERMANN: Strukturen des Bösen. Die jahwistische Urgeschichte in exegetischer, psychoanalytischer und philosophischer Sicht, 3 Bde., Paderborn 1977-1978.
35 Vgl. E. DREWERMANN: Wendepunkte oder: Was eigentlich besagt das Christentum, Ostfildern 2014, 101-169: Soteriologie (Erlösungslehre) oder: Woher das Böse?
36 LEO TOLSTOI: Mein Glaube, XII 323.
37 VIII 197.
38 VIII 187.
39 VIII 303-304.
40 IX 219.
41 VIII 194.
42 VIII 189.
43 VIII 192.
44 VIII 193.
Leo Tolstoi Worin besteht mein Glaube?
V čem moja vera? (1883/84)
Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Sophie Behr 451885
„Mein Buch hat man, anstatt es zu verbrennen, wie sich das nach ihren Gesetzen so gehört, nach Petersburg gebracht, und dort haben die hohen Herren alle Exemplare unter sich aufgeteilt. Das freut mich ungemein. Vielleicht versteht es ja der eine oder andere sogar.“
Briefkommentar von Leo N. Tolstoi zur Beschlagnahmung seines Werkes ‚Worin mein Glaube besteht?‘ im Februar 188446
45 Textquelle | [Leo TOLSTOI:] Worin besteht mein Glaube? Eine Studie von Graf Leo Tolstoi. Aus dem russischen Manuskript übersetzt von Sophie Behr. Leipzig: Verlag von Duncker & Humblot 1885. [Kapitelüberschriften nach der Digitalen Gutenberg-Bibliothek].
46 Hier zitiert nach: Martin George / Jens Herlth / Christian Münch / Ulrich Schmid (Hg.): Tolstoj als theologischer Denker und Kirchenkritiker. Zweite Auflage. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2015, S. 102.
[EINFÜHRUNG]
Ich habe 55 Jahre in der Welt gelebt, und von diesen habe ich, mit Ausnahme der ersten 14-15 Jugendjahre, 35 Jahre als Nihilist gelebt und zwar in der wahren Bedeutung des Wortes, d. h. nicht als Sozialist und Revolutionär, wie dieses Wort gewöhnlich verstanden wird, sondern als Nihilist in dem Sinne einer vollständigen Abwesenheit jeglichen Glaubens.
Vor 5 Jahren kam mir der Glaube an die Lehre Christi – und mein Leben ward plötzlich ein anderes: ich wünschte nicht mehr, was ich bisher gewünscht, und was ich bisher nicht gewünscht, das wünschte ich jetzt. Was ich früher für gut gehalten, erschien mir schlecht, und was ich früher für schlecht gehalten, erschien mir gut. Es ging mir wie einem Menschen, der ausgeht um eine wichtige Sache zu erledigen und plötzlich unterwegs zu der Ueberzeugung kommt, die Sache sei ganz unnütz, und – umkehrt. Und alles, was rechts war – ward links, und alles, was links war – ward rechts. Das frühere Verlangen möglichst fern vom Hause zu sein ward zum Wunsche ihm möglichst nahe zu bleiben. Die Richtung meines Lebens, meine Wünsche wurden andere, und das Böse und das Gute wechselten ihre Plätze. Alles dies geschah, weil ich Christi Lehre anders verstand, als ich sie bisher aufgefasst hatte.
Nicht erläutern will ich Christi Lehre: ich will nur erzählen, wie ich das, was in ihr einfach, klar, verständlich, unzweifelhaft und an alle Menschen gerichtet ist, verstanden habe, und wie das, was ich verstanden, meine Seele umgewandelt und mir Ruhe und Glück gegeben hat.
Nicht erläutern will ich Christi Lehre. Eins aber möchte ich: die Erläuterung derselben verbieten.
Alle christlichen Kirchen haben stets anerkannt, dass alle Menschen, die unter einander ungleich an Gelehrsamkeit und Verstand – kluge und dumme – vor Gott gleich sind; dass Gottes Wahrheit allen zugänglich ist. Christus hat sogar gesagt, es läge in Gottes Willen, dass den Einfältigen das offenbart werde, was den Verständigen verborgen bleibt.
Nicht alle können in die tiefsten Geheimnisse der Dogmatik, Homiletik, Patristik, Liturgik, Hermeneutik, Apologetik u. a. eingeweiht sein; alle aber können und müssen das verstehn, was Christus allen Millionen einfacher, unbedeutender, jetzt und einst lebender Menschen gesagt hat. Das alles also, was Christus allen diesen einfachen Leuten gesagt hat, denen noch nicht die Möglichkeit geboten war sich nach Erläuterungen seiner Lehre an Paulus, Clemens, Johannes Chrysostomus zu wenden, dasselbe hatte ich bisher nicht verstanden, jetzt aber verstehe ich es, und das ist es, was ich allen mittheilen will.
Der Räuber am Kreuze glaubte an Christus und ward erlöst. Wäre es wirklich schlecht und für irgend jemand schädlich gewesen, wenn der Missethäter nicht am Kreuze gestorben, sondern herabgestiegen wäre und den Menschen erzählt hätte, auf welche Weise er zu dem Glauben an Christus gelangt sei?
Auch ich habe, gleich dem Räuber am Kreuze, an Christi Lehre geglaubt und bin gleich ihm gerettet worden.
Und dieser Vergleich liegt nicht fern; er ist im Gegentheil der am nächsten liegende Ausdruck jenes Seelenzustandes der Verzweiflung und des Grauens vor dem Leben und vor dem Tode, in dem ich mich einst befand, und des Zustandes der Ruhe und des Glückes, in dem ich mich jetzt befinde.
Wie jener Missethäter, so war auch ich mir bewusst, dass ich schlecht gelebt und noch schlecht lebte, und ich sah, dass die Mehrzahl der Menschen um mich her ebenso lebte. Wie jener Räuber wusste auch ich, dass ich unglücklich sei und leide, und dass die Menschen um mich her auch unglücklich seien und litten; und ich sah keinen andern Ausweg in meiner Lage als den Tod. Wie jener Räuber an das Kreuz, so war auch ich durch eine gewisse Macht angenagelt an dies Leben des Leidens und des Bösen. Und wie nach allen sinnlosen Qualen und nach allem Bösen dieses Lebens die entsetzliche Finsterniss des Todes jenes Räubers harrte, so harrte dieselbe auch meiner.
In alledem war ich dem Missethäter vollkommen gleich; der Unterschied jedoch zwischen ihm und mir bestand darin, dass er starb, ich aber noch lebte.
Der Missethäter konnte glauben, dass er dort, jenseits des Grabes, erlöst werde; ich aber konnte solches nicht glauben, da mir ausser dem Leben jenseits des Grabes noch das Leben hier bevorstand. Ich aber verstand dieses Leben nicht – mir graute davor. Da plötzlich vernahm ich das Wort Christi: ich begriff es, und Leben und Tod hörten auf mir als ein Böses zu erscheinen, und anstatt der Verzweiflung empfand ich die Freude und das Glück des Lebens, die der Tod nicht vernichten kann.
Könnte es wirklich jemand zum Schaden gereichen, wenn ich erzähle, wie solches in mir vor sich gegangen?
I.
[Entwicklungsgang des Verfassers im Glauben.]
Darüber, weshalb ich früher Christi Lehre nicht verstanden und wie und warum ich sie später begriffen, habe ich zwei grosse Abhandlungen geschrieben: eine Kritik der dogmatischen Theologie und eine neue Uebersetzung nebst einer Harmonie der 4 Evangelien mit Erläuterungen. In diesen Schriften bemühe ich mich, methodisch, Schritt vor Schritt, alles zu untersuchen, was den Menschen die Wahrheit verhüllt, und übersetze von neuem die 4 Evangelien, Vers für Vers vergleiche ich sie mit einander und vereinige sie zu einem Ganzen.
Diese Arbeit dauert bereits das sechste Jahr. Jedes Jahr, jeden Monat finde ich neue und immer neue Erklärungen und Bestätigungen des Grundgedankens; ich verbessere die theils durch Eile, theils durch ein Michhinreissenlassen in meine Arbeit eingeschlichenen Fehler, und indem ich sie verbessere, vervollständige ich das, was bereits gemacht ist. Wahrscheinlich wird mein Leben, dessen Dauer nur noch beschränkt ist, früher zu Ende gehen als diese Arbeit. Doch bin ich überzeugt, dass diese Arbeit eine nothwendige ist, und thue deshalb, so lange ich lebe, was ich zu thun im Stande bin.
Solcherart ist meine langwierige äussere Arbeit an der Theologie und den Evangelien. Meine innere Arbeit jedoch, über die ich hier sprechen will, war eine ganz andere. Es war nicht ein methodisches Ergründen der Theologie und der Texte der Evangelien, – nein, es war ein momentanes Ausschliessen alles dessen, was den Sinn der Lehre verbarg, und eine plötzliche Erleuchtung der Wahrheit. Es war ein Ereigniss, ähnlich dem, das einem Menschen widerfahren wäre, der nach der Bedeutung einer Masse kleiner, untereinandergeworfener Marmorstücke durch mühsames Zusammensetzen nach einer falschen Zeichnung suchen würde, wenn er dann plötzlich aus einem grösseren Stücke errathen würde, dass es eine ganz andere Bildsäule sei und, ein neues Bildwerk zusammenzustellen beginnend, anstatt der früheren Unzusammenhängigkeit der einzelnen Theile, an jedem Stücke, das durch alle Krümmungen seiner Brüche sich an andere Stücke schliessen und ein Ganzes bilden würde, die Bestätigung seines Gedankens sehen würde. Solches geschah mit mir. Und das ist es, was ich erzählen will.
Ich will erzählen, auf welche Weise ich zu der Erkenntniss der Lehre Christi den Schlüssel gefunden, der mir die Wahrheit eröffnet hat, so klar und einleuchtend, dass jeder Zweifel ausgeschlossen blieb.
Diese Entdeckung geschah folgendermaassen: Seit der frühesten Zeit, seit meiner Kindheit fast, als ich anfing das Evangelium allein zu lesen, hat mich in dem ganzen Evangelium am meisten jene Lehre Christi bewegt und gerührt, in welcher er Liebe, Demuth, Erniedrigung seiner Selbst, Selbstaufopferung und Vergeltung des Bösen mit Gutem predigt – Dies blieb auch für mich stets der Inbegriff des christlichen Glaubens, das, was ich in ihm von Herzen liebte, das, um deswillen ich, nach Verzweiflung und Unglauben, jene Bedeutung als wahr erkannte, die das christliche Arbeitsvolk dem Leben giebt, und um deswillen ich mich demselben Glauben unterwarf, zu dem jenes Volk sich bekennt, d. h. der sogenannten orthodoxen Kirche. – Doch nachdem ich mich der Kirche unterworfen, erkannte ich bald, dass ich in den Lehren derselben nicht die Bestätigung der Erklärung jener Grundsätze des Christenthums finden würde, die mir als das Wichtigste erschien; ich erkannte, dass dieses mir theure Wesen des Christenthums in der Lehre der Kirche nicht die Hauptsache sei. Ich erkannte, dass das, was mir in Christi Lehre als das Wichtigste erschien, von der Kirche nicht als solches anerkannt wird. Die Kirche erkennt etwas anderes als das Wichtigste an. Anfangs legte ich dieser Eigentümlichkeit der kirchlichen Lehre keine Bedeutung bei. – „Was ist's weiter? – dachte ich – die Kirche erkennt einfach, ausser dem Sinne der Liebe, der Demuth und Selbstaufopferung, noch einen anderen, dogmatischen, äusseren Sinn an. Mir ist dieser Sinn fremd; er stösst mich sogar ab; doch thut er weiter keinen Schaden.“
Jedoch, je länger ich lebte, mich der Lehre der Kirche unterwerfend, um so bemerkbarer ward es mir, dass diese Eigentümlichkeit der kirchlichen Lehre nicht so gleichgültig sei, wie sie mir anfangs erschien. Mich stiess die Kirche auch durch die Sonderbarkeiten ihrer Glaubenslehren ab, auch durch ihr Anerkennen und Gutheissen der Verfolgungen, der Verurtheilungen und Kriege und auch durch das gegenseitige Verleugnen der Anhänger der verschiedenen Glaubenslehren; am meisten aber ward mein Zutrauen zu ihr erschüttert gerade durch ihre Gleichgültigkeit gegen das, was mir als der Kern der christlichen Lehre erschien, und dagegen ihre Vorliebe für das, was ich für Nebensache hielt. Ich fühlte, dass hier etwas nicht richtig sei. Was aber nicht richtig war, konnte ich durchaus nicht finden; ich konnte es nicht finden, weil die kirchliche Lehre nicht nur das nicht leugnete, was mir die Hauptsache in der Lehre Christi schien, sondern es vielmehr vollkommen anerkannte, jedoch so, dass diese „Hauptsache“ in der Lehre Christi nicht mehr Hauptsache blieb. Ich konnte der Kirche nicht den Vorwurf machen, dass sie das Wichtigste verleugne; ihre Anerkennung jedoch dieses Wichtigsten war für mich eine unbefriedigende. Die Kirche gab mir nicht das, was ich von ihr erwartete.
Ich bin vom Nihilismus zur Kirche nur deshalb übergegangen, weil ich die Unmöglichkeit eines Lebens ohne Glauben und ohne Erkenntniss dessen, was, ausserhalb, meiner thierischen Instinkte, gut oder böse sei, einsah. Diese Erkenntniss glaubte ich im christlichen Glauben zu finden. Der christliche Glaube aber, wie er mir damals erschien, war nur eine gewisse, sehr unklare Stimmung, aus der keine bestimmten Pflichten und Regeln des Lebens entsprossen. Nach diesen Regeln also wandte ich mich an die Kirche. Die Kirche jedoch gab mir Regeln, die mich nicht im geringsten jener mir theuren christlichen Stimmung näher brachten, ja mich vielmehr von derselben entfernten. Und ich konnte ihnen nicht folgen. Ich bedurfte eines Lebens, das auf christliche Wahrheiten gegründet war, und nur ein solches war mir werth; die Kirche aber gab mir Lebensregeln, die den mir theuren Wahrheiten vollständig fremd waren. Die Regeln, die mir die Kirche gab: über den Glauben an die Dogmen, über die Erfüllung ihrer Gesetze, das Einhalten der Fasten und Gebete – die brauchte ich nicht; Regeln aber, die auf christliche Wahrheit gegründet gewesen wären, die gab sie mir nicht. Mehr als das: die kirchlichen Regeln schwächten, ja vernichteten sogar manchmal geradezu jene christliche Stimmung, die allein meinem Leben Werth verlieh. Am meisten verwirrte es mich, dass alles Böse der Menschen – die Verdammung des Einzelnen, die Verdammung ganzer Völker, die Verdammung anderer Glaubenslehren und die aus solchen Verdammungen entstehenden Verfolgungen und Kriege – alles das von der Kirche gerechtfertigt wurde. Christi Lehre von der Demuth, der Nachsicht, der Vergebung aller Kränkungen, der Selbstverleugnung und Liebe wurde von der Kirche in Worten hochgepriesen und zugleich wurde in der That das gutgeheissen, was mit dieser Lehre nicht im Einklange stehen konnte.
War denn Christi Lehre eine solche, dass dergleichen Widersprüche bestehen mussten? Ich konnte das nicht glauben. Ueberdies war es mir stets sonderbar erschienen, dass die Kirche mit ihren Regeln über die Lehre Christi sich gerade auf solche Stellen stützte, die die undeutlichsten des Evangeliums waren, soweit mir dasselbe bekannt. Während die Dogmen und die aus denselben entstehenden Pflichten der Christen in einer vollkommen klaren und bestimmten Weise in dem Evangelium ausgesprochen waren, äusserte sich die Kirche in unklaren, mystischen, nebelhaften Ausdrücken über die Anwendung der Lehre. War es wirklich das, was Christus gewollt, als er uns seine Lehre predigte? Die Lösung meiner Zweifel konnte ich nur in den Evangelien finden. Und ich las sie und las sie immer wieder. Aus allen Evangelien trat mir stets als etwas Besonderes die Bergpredigt entgegen. Und sie war es, die ich am häufigsten las. Nirgends spricht Christus mit solcher Feierlichkeit wie hier, nirgends giebt er so viele sittliche, klare, verständliche, jedem gerade zum Herzen redende Regeln, nirgends spricht er zu einer grösseren Masse allerhand gewöhnlicher Leute. Wenn es überhaupt klare, bestimmte christliche Gesetze giebt, so müssen sie hier ausgesprochen worden sein. In diesen drei Kapiteln Matthäi habe ich die Lösung meiner Zweifel gesucht.
Viele, viele Male habe ich die Bergpredigt durchgelesen und jedesmal dasselbe dabei empfunden: Bewunderung und Rührung beim Lesen jener Verse – über das Hinhalten des Backens, das Weggeben des Hemdes, die Friedfertigkeit gegen alle, die Liebe zum Feinde – und stets dasselbe Gefühl der Unbefriedigung. Die an alle gerichteten Worte Gottes waren unbegreiflich. Es wurde eine geradezu unmögliche Entsagung verlangt, die das Leben selbst, wie ich es auffasste, zerstörte, und deshalb schien es mir, als könne ein vollständiges Entsagen nicht eine unumgängliche Bedingung zur Rettung sein. Sobald es aber eine notwendige Bedingung zur Rettung war, so gab es wiederum nichts Bestimmtes und Klares. Ich habe nicht allein die Bergpredigt gelesen, sondern auch alle Evangelien und alle theologischen Kommentare zu denselben. Die theologischen Erläuterungen des Inhalts, dass die Aussprüche der Bergpredigt Hinweise seien auf jene Vollkommenheit, nach welcher der Mensch streben solle, dass aber der gefallene Mensch durchaus sündhaft sei und nicht durch eigne Kraft jene Vollkommenheit zu erreichen vermöge, dass des Menschen Rettung im Glauben, im Gebete und in der Gnade läge – diese Erläuterungen befriedigten mich nicht.
Ich war damit nicht einverstanden, weil es mir immer sonderbar erschienen war, weshalb Christus, im voraus wissend, dass die Erfüllung seiner Lehre durch des Menschen eigene Kraft unmöglich sei, so klare und schöne Regeln aufgestellt habe, die sich geradezu auf jeden einzelnen Menschen bezogen? Wenn ich diese Regeln las, hat es mir stets geschienen, sie bezögen sich direkt auf mich und von mir allein werde deren Befolgung verlangt.
Wenn ich diese Regeln las, überkam mich stets eine freudige Gewissheit, ich könne sogleich, von dieser Stunde an, alles das thun, was verlangt wird. Und ich wollte es thun und versuchte es; kaum aber fühlte ich einen Kampf bei der Ausführung, so erinnerte ich mich unwillkürlich der kirchlichen Lehre darüber, dass der Mensch schwach sei und das nicht aus eignen Kräften vollbringen könne – und ich wurde schwach.
Man sagte mir, ich müsse glauben und beten. Ich aber fühlte, dass mein Glaube gering sei und dass ich deshalb nicht beten könne. Man sagte mir, ich müsse beten, Gott möge mir den Glauben geben, den Glauben, der das Beten lehrt, welches jenen Glauben giebt, welcher jenes Beten lehrt u. s. w. ohne Ende.
Aber Vernunft und Erfahrung zeigten mir die Unzulänglichkeit dieses Mittels. Mir schien stets, dass nur meine Bemühungen die Lehre Christi zu befolgen wirklich von Nutzen sein könnten.
Und nun, nach vielem, vielem vergeblichen Suchen und Erforschen dessen, was darüber geschrieben worden war zum Beweise der Göttlichkeit dieser Lehre und zum Beweise ihrer Nichtgöttlichkeit, nach vielen Zweifeln und Leiden war ich wieder allein geblieben mit meinem Herzen und mit dem geheimnissvollen Buche vor mir. Ich konnte diesem Buche nicht die Bedeutung geben, die andere ihm gaben, und vermochte ihm weder eine andere beizulegen noch mich von ihm loszusagen. Und erst nachdem ich alles Zutrauen verloren in alle Erklärungen der gelehrten Kritik sowohl wie in alle Erläuterungen der gelehrten Theologie, und sie alle von mir geworfen nach dem Ausspruche Christi: so Ihr mich nicht aufnehmet wie die Kinder, kommt ihr nicht ins Himmelreich …, da erst begriff ich plötzlich das, was ich bisher nicht begreifen konnte. Und ich begriff es nicht durch künstliches, scharfsinniges Zersetzen, Vergleichen, Erklären; im Gegenteil, es wurde mir alles offenbar dadurch, dass ich alle Erklärungen vergass. Die Stelle, die für mich zum Schlüssel des Ganzen wurde, war die Stelle aus dem 5. Kapitel Matthäi, Vers 38, 89: „Ihr habt gehöret, dass da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. – Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel“ … Plötzlich, zum erstenmal verstand ich diesen Vers gerade und einfach. Ich verstand, dass Christus gerade das sagt, was er sagt. Und sofort war es mir, nicht als sei etwas Neues entstanden, sondern als sei alles abgefallen, was die Wahrheit verdunkelt, und die Wahrheit erstand vor mir in ihrer ganzen Bedeutung. „Ihr habt gehöret, dass da gesagt ist: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel.“ Diese Worte erschienen mir plötzlich ganz neu, als hätte ich sie nie vorher gelesen.
Wenn ich früher diese Worte las, liess ich stets, wie in einer eigentümlichen Befangenheit, die Worte: „Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstreben sollt dem Uebel“, unbeachtet – ganz als ob diese Worte gar nicht da wären, oder als hätten sie gar keine bestimmte Bedeutung.
Später, in meinen Gesprächen mit vielen, vielen Christen, denen das Evangelium bekannt war, habe ich oft Gelegenheit gehabt bezüglich dieser Worte dieselbe Bemerkung zu machen. Dieser Worte erinnerte sich niemand, und oft geschah es, wenn die Rede auf diese Stelle kam, dass die Christen das Evangelium zur Hand nahmen um nachzuschlagen, ob auch diese Worte darin ständen. So hatte auch ich diese Worte übersehen und erst von den folgenden Worten zu begreifen begonnen: „So dir jemand einen Streich giebt auf deinen rechten Backen, dem biete den andern auch dar“… u.s.w. Und immer sah ich in diesen Worten eine Forderung, zu leiden und zu entsagen, wie es der menschlichen Natur gar nicht eigen ist. Dennoch rührten mich diese Worte. Ich fühlte, es müsse herrlich sein sie zu befolgen. Ich fühlte aber auch, dass ich nie im Stande sein würde sie zu befolgen nur um sie zu befolgen, d. h. um zu leiden. Ich sagte mir: Gut, ich biete den Backen, – man wird mich ein zweites Mal schlagen; ich werde alles weggeben, – man wird alles von mir nehmen. Ich werde kein Leben haben. Mir ist aber das Leben gegeben; warum soll ich es denn verlieren? Das kann Christus nicht gewollt haben. Früher sagte ich mir das, weil ich voraussetzte, dass Christus mit diesen Worten die Leiden und Entbehrungen preist und sie preisend übertreibt und deshalb nicht genau und klar spricht; jetzt aber, nachdem ich die Worte „widerstrebet nicht dem Uebel“ verstanden, ist es mir klar geworden, dass Christus nichts übertreibt und keine Leiden fordert um der Leiden willen; dass er das, was er sagt, nur sehr bestimmt und klar ausspricht. Er sagt: Widerstrebet nicht dem Uebel; und indem ihr so thut, wisset im voraus, dass sich Menschen finden können, die, nachdem sie euch einen Streich auf den rechten Backen gegeben, euch, wenn sie auf keinen Widerstand stossen, auch auf den linken schlagen werden; die nachdem sie euch das Hemd genommen, euch auch den Mantel nehmen werden; die, nachdem sie eure Arbeit ausgenützt, euch zwingen werden noch mehr zu arbeiten; die immer nehmen werden ohne je zurückzugeben … Und nun, wenn das so sein wird, selbst dann sollt ihr nicht widerstreben dem Uebel. Denen, die euch schlagen und beleidigen werden, sollt ihr dennoch Gutes erweisen. – Und nachdem ich diese Worte so verstanden hatte wie sie gesagt waren, ward mir sofort alles klar, was mir bis dahin dunkel gewesen, und was mir übertrieben erschienen, erschien mir jetzt vollkommen genau. Ich begriff zum erstenmal, dass der Schwerpunkt des ganzen Gedankens in den Worten liegt: „widerstrebet nicht dem Uebel“, und dass das Nachfolgende nur eine Erklärung des ersten Satzes ist. Ich begriff, dass Christus durchaus nicht verlangt, dass man den Backen biete und den Mantel hergäbe nur um des Leidens willen; dass er aber verlangt, dass wir dem Uebel nicht widerstreben, und sagt, dass wir dabei vielleicht auch zu leiden haben werden. Gleichwie ein Vater, der seinen Sohn auf eine weite Reise schickt, ihm nicht befiehlt die Nächte zu wachen, zu hungern, zu frieren, durchnässt zu werden, wenn er zu ihm sagt: „Geh' deines Weges, und wenn du auch Kälte und Nässe ertragen solltest, so gehe dennoch.“ – Christus sagt nicht: bietet den Backen, leidet; sondern er sagt: widerstrebet nicht dem Uebel und was euch auch zustossen möge, widerstrebet nicht dem Uebel. Diese Worte: widerstrebet nicht dem Uebel – oder dem Bösen –, in ihrem geraden Sinne aufgefasst, wurden für mich zum wirklichen Schlüssel, der mir alles erschloss. Und ich wunderte mich, wie ich so einfache, bestimmte Worte so verkehrt hatte auffassen können. Euch ist gesagt: Zahn um Zahn; ich aber sage: widerstrebe nicht dem Uebel oder dem Bösen, und was dir auch die Bösen anthun sollten, ertrage, gieb, aber widerstrebe nicht dem Uebel oder dem Bösen. Was kann klarer, verständlicher und unzweifelhafter sein als dies? Und ich brauchte diese Worte nur einfach und gerade aufzufassen wie sie gesagt waren, und sofort wurde mir in der ganzen Lehre Christi, nicht nur in der Bergpredigt, sondern auch in allen Evangelien, alles verständlich, was verworren gewesen, und alles einig, was bisher widersprechend war; und die Hauptsache, die unnütz erschienen, ward zur Notwendigkeit. Alles verschmolz in ein Ganzes und das eine bestätigte unzweifelhaft das andere, wie die Stücke einer zerschlagenen Bildsäule, die so zusammengefügt worden, wie sie es sein mussten.
In dieser Predigt und in allen Evangelien, von allen Seiten wird dieselbe Lehre bestätigt: widerstrebet nicht dem Uebel.
In dieser Predigt, wie an allen andern Stellen, überall stellt sich Christus seine Jünger, d. h. diejenigen Menschen, die seine Lehre über das Nichtwiderstreben dem Uebel befolgen, als solche vor, die den Backen hinhalten und den Mantel hergeben: als Verfolgte, Geschlagene und Arme.