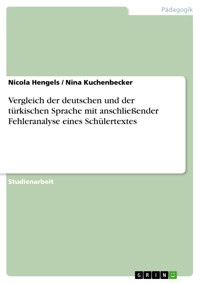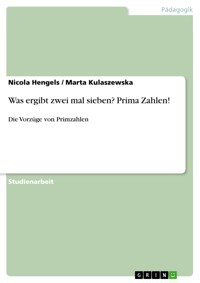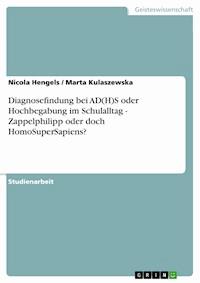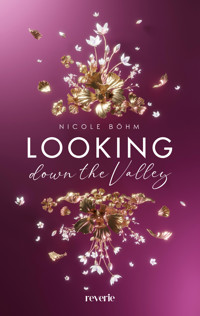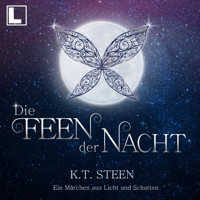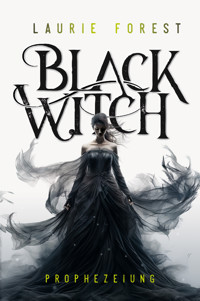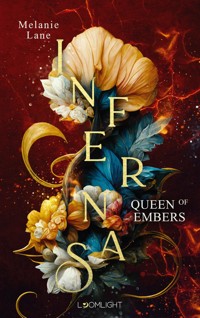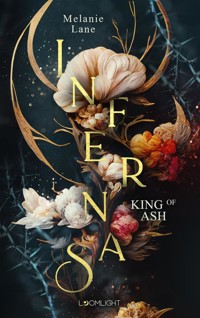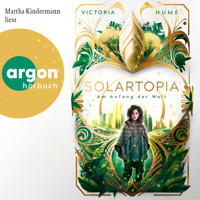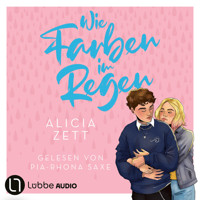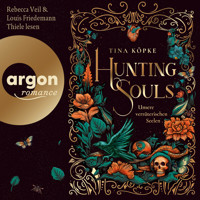Wortschatzerwerb und Wortschatzarbeit in der Grundschule. Gegenwärtiger Forschungsstand E-Book
Nicola Hengels
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Masterarbeit aus dem Jahr 2012 im Fachbereich Didaktik für das Fach Deutsch - Pädagogik, Sprachwissenschaft, Note: 1,0, Leuphana Universität Lüneburg (Institut für Deutsche Sprache und Literatur), Sprache: Deutsch, Abstract: Immer wieder liefern internationale Vergleichsstudien wie PISA oder DESI nicht von der Hand zu weisende Belege dafür, dass deutsche Schüler eine nur unzureichende Lesekompetenz aufweisen, woraus resultiert, dass sie mitunter massive Schwierigkeiten dabei haben, Texte verstehen und/oder schreiben zu können. Die Erweiterung des Wortschatzes wird in der Zweitsprachen- sowie Fremdsprachendidaktik schon immer als wichtigstes Ziel angesehen. Wortschatzarbeit muss daher auch im muttersprachlichen Deutschunterricht über alle Schuljahre hinweg zentraler Bestandteil sein, denn ein erfolgreiches Sprachhandeln ist ohne quantitativ umfangreichen und qualitativ differenzierten Wortschatz undenkbar. Um im späteren Berufsleben als Deutschlehrkraft einen für jeden einzelnen Schüler lehrreichen und effektiven Unterricht gestalten zu können, ist es von essentieller Bedeutung, dass umfassendes Wissen über den aktuellen Status Quo bezüglich der Forschung zum Wortschatzerwerb und der Wortschatzdidaktik vorhanden ist. Aus diesem Grund wird nun im Folgenden in dieser Ausarbeitung zunächst der Begriff Wortschatz mit seinen verschiedenen Teilbereichen definiert. Im Anschluss daran soll ein Überblick über die Rolle des Gehirns beim Wortschatzerwerb geliefert werden, um daraufhin die unterschiedlichen Formen der Wortschatzerweiterung betrachten zu können. Den Mittelpunkt der Arbeit bildet dann eine Untersuchung des aktuellen Standes der didaktischen Forschung zu Wortschatzerwerb, Wortschatzarbeit und Wortschatzvertiefung in der Schule.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Impressum:
Copyright (c) 2015 GRIN Verlag / Open Publishing GmbH, alle Inhalte urheberrechtlich geschützt. Kopieren und verbreiten nur mit Genehmigung des Verlags.
Bei GRIN macht sich Ihr Wissen bezahlt! Wir veröffentlichen kostenlos Ihre Haus-, Bachelor- und Masterarbeiten.
Jetzt beiwww.grin.com
INHALT
Einleitung
1 Der Wortschatz - ein Schatz mit Struktur
1.1 Erweiterung des Wortschatzes der Deutschen Sprache
1.1.1 Wortbildung
1.1.2 Bedeutungsveränderung
1.1.3 Entlehnung
1.1.4 Phraseologierung
1.1.5 Urschöpfung
1.2 Gliederung des Wortschatzes
1.3 Die Rolle des Gehirns
1.4 Der Wortschatzerwerb / Spracherwerb
1.5 Die Wortschatzerweiterung
2 Gegenwärtiger Forschungsstand bezüglich der Wortschatzarbeit
2.1 Die Geschichte der Wortschatzarbeit
2.2 Wortschatzarbeit in den Bildungsstandards und Kerncurricula
2.3 Wortschatzdidaktischer Dreischritt
2.4 Eine Anwendungsidee zum wortschatzdidaktischen Dreischritt im Unterricht
3 Fazit und Ausblick
LITERATURVERZEICHNIS
ABBILDUNGS- UND TABELLENNACHWEIS
Einleitung
„A word is a microcosm
of human consciousness.“
Lev Vygotsky[1]
Immer wieder liefern internationale Vergleichsstudien wie PISA oder DESI nicht von der Hand zu weisende Belege dafür, dass deutsche Schüler[2] eine nur unzureichende Lesekompetenz aufweisen,[3] woraus resultiert, dass sie mitunter massive Schwierigkeiten dabei haben, Texte verstehen und/oder schreiben zu können. Auch in der Kommunikation mit Mitmenschen schlägt sich diese Tatsache nieder, so behindert sie das Verständnis von Gesprächen ebenso stark, wie sie erschwert, dass sich die Schüler in Konversationen problemlos klar verständigen können.[4] Wie DESI unlängst erneut aufzeigte, liegt diese Problematik vor allem darin begründet, dass der Wortschatz der Schüler weder umfangreich genug, noch hinreichend ausdifferenziert ist, um sie zu befähigen, kommunikative und anspruchsvolle kognitive Aufgaben lösen zu können,[5] denn die sprachliche und kommunikative Kompetenz eines Menschen hängt grundsätzlich sehr direkt mit seinen Wortschatzkenntnissen zusammen,[6]„weil der Wortschatz als eine Art Schaltstelle des Spracherwerbs angesehen werden kann.“[7] Unzureichende Wortschatzkenntnisse wirken sich nachteilig auf den kompletten Spracherwerb aus. Daher liegt in seiner systematischen Förderung der Schlüssel zu einem integrativen und kompetenzorientierten Deutschunterricht,[8] dessen Aufgabe die Förderung
„sprachlich-kommunikativer Kompetenz und Handlungsfähigkeit als einer Schlüsselqualifikation zur Bewältigung vielfältiger Lebenssituationen, produktiv (Sprechen/Schreiben), rezeptiv (verstehendes Hören/ Lesen) und reflexiv (Sprachbewusstheit)“[9]
sein muss.
Jede Kultur produziert ein komplexes System an zusammenhängenden Dingen, welches festlegt, ob diese für die weitere Entwicklung und den Erhalt derselben von Bedeutung sind oder nicht. Um die Bedeutung dieser Elemente ausdrücken zu können, bedürfen die Mitglieder einer solchen Gesellschaft einer Vielzahl an Wörtern, was zur Folge hat, dass ein Sprecher der Sprachgemeinschaft auch viele davon kennen muss.[10]„Der Wortschatz einer Sprachgemeinschaft ist ein Ausweis ihrer Kultur“[11] und derjenige Sprachbenutzer, welcher die sprachlichen Mittel seiner Gesellschaft als kommunikative Werkzeuge zu verwenden weiß, kann als kompetent bezeichnet werden.[12]
Die Erweiterung des Wortschatzes wird in der Zweitsprachen- sowie Fremdsprachendidaktik schon immer als wichtigstes Ziel angesehen. Wortschatzarbeit muss daher auch im muttersprachlichen Deutschunterricht über alle Schuljahre hinweg zentraler Bestandteil sein,[13] denn ein erfolgreiches Sprachhandeln ist, wie bereits gesagt, ohne quantitativ umfangreichen und qualitativ differenzierten Wortschatz undenkbar.[14]
Schüler bedürfen, bezugnehmend auf Dannenbauer 2002 und Feilke 2009, zur gezielten Förderung ihrer lexikalischen und sprachlichen Kompetenzen Spracherfahrungen, welche ihnen deutlich mehr geben, als der normale Spracherwerb beiläufig anbietet. Als perfekte Lernumgebung für eben dieses kann der Deutschunterricht angesehen werden und daher sollten Lehrer ihn auch für diesen Zweck nutzen.[15] Ist jedoch dieser Deutschunterricht in den letzten Jahrzehnten, wie Winfried Ulrich in seinem Artikel ‚Geschichte der Wortschatzarbeit’ sagt „als eher ‚wortschatzarbeitsabgewandt’ zu bezeichnen“[16]?
Um im späteren Berufsleben als Deutschlehrkraft einen für jeden einzelnen Schüler lehrreichen und effektiven Unterricht gestalten zu können, ist es von essentieller Bedeutung, dass umfassendes Wissen über den aktuellen Status Quo bezüglich der Forschung zum Wortschatzerwerb und der Wortschatzdidaktik vorhanden ist. Aus diesem Grund wird nun im Folgenden in dieser Ausarbeitung zunächst der Begriff Wortschatz mit seinen verschiedenen Teilbereichen definiert. Im Anschluss daran soll ein Überblick über die Rolle des Gehirns beim Wortschatzerwerb geliefert werden, um daraufhin die unterschiedlichen Formen der Wortschatzerweiterung betrachten zu können. Den Mittelpunkt der Arbeit bildet dann eine Untersuchung des aktuellen Standes der didaktischen Forschung zu Wortschatzerwerb, Wortschatzarbeit und Wortschatzvertiefung in der Schule.
„Words, words, words, in songs and stories...
If I only understood them...
Would not this world be changed?
Pete Seeger[17]
1 Der Wortschatz - ein Schatz mit Struktur
Schader 2010 sieht im Kompositum ‚Wortschatz’ eine besonders treffende Bildung der deutschen Sprache, denn wer über viele Wörter verfüge, der sei auch im Besitz eines Schatzes von besonders hohem Werte, da er
„ihm Türen öffne[...] und Möglichkeiten erschließe[…] beim Argumentieren, beim Zugang zu Geschriebenem, bei der Darstellung von Gedanken und Gefühlen, bei der Vertretung eigener Anliegen und bei vielem mehr.“[18]
Wer dahingegen an jenem Schatz nicht teilhabe, der sei benachteiligt und eingeschränkt in einer Sprachgemeinschaft und leide somit an sprichwörtlicher Spracharmut.[19] Im deutschen Wörterbuch von Knaur wird der Wortschatz definiert als Gesamtheit der Wörter einer Sprache oder derjenigen, über welche ein Individuum verfüge.[20] Hierbei wird der Wortschatz der deutschen Alltagssprache auf etwa 500.000, der zentrale Wortschatz auf circa 70.000 Wörter geschätzt.[21] Nimmt man Fachsprachen, wie sie zum Beispiel in der Medizin gebraucht werden, hinzu, so kann man mit Gewissheit davon ausgehen, dass der Wortschatz sich um ein Vielfaches vergrößert.[22]