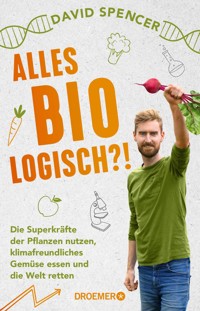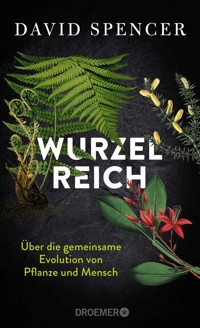
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Die Evolutionsgeschichte der Pflanze, und was sie mit uns Menschen zu tun hat Mensch und Pflanze – zwei vermeintlich konkurrierende Mega-Lebewesen. Dabei blickt die Pflanze auf eine bewegte Geschichte zurück, die der menschlichen gar nicht so unähnlich ist. Der bekannte Wissenschaftskommunikator und Biologe Dr. David Spencer macht sich auf unterhaltsame Art daran, die Entwicklung der Pflanzen über Jahrmillionen hinweg nachzuerzählen: angefangen bei ihrem nomadischen Dasein in den Weltmeeren, dem eine Zeit folgte, in der sich die ersten Pflanzen aus den Ozeanen der noch jungen Erde erhoben, um das Land zu besiedeln und sesshaft zu werden. Wir erfahren, welche Herausforderungen dieses Leben in vermeintlicher Bewegungslosigkeit mit sich brachte, den Launen der Witterung schutzlos ausgeliefert, und wie die Pflanze durch Aufgabenteilung und kollektives Arbeiten ganze Landschaften formt. Und wir erkunden, wie sie sich bis in die entlegensten Winkel unseres Planeten ausbreiten konnte, schließlich vom Menschen gezähmt wurde – und dennoch immer widerspenstig blieb. Diese faszinierende Reise führt zunächst zu den Anfängen zurück und endet in der Gegenwart. Wir wandeln auf den Spuren der pflanzlichen Erfolgsgeschichte und entdecken zugleich die wunderbare Welt der heutigen Pflanzen. - Wie kommunizieren Pflanzen eigentlich miteinander? - Warum bekämpfen sie sich manchmal? - Wann führt die Ausbreitung einer bestimmten Art zum Aussterben einer anderen Population? - Wussten Sie, dass es Pflanzen gibt, die mehrere tausend Jahre alt werden? Oder ihre Konkurrenten gezielt durch Waldbrände ausmerzen? David Spencer macht nicht zuletzt klar, welches Potenzial wir verschenken, wenn wir die Intelligenz der Pflanze nicht anerkennen und unser Ökosystem weiter ausbeuten, anstatt es partnerschaftlich und respektvoll gemeinsam zu gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 318
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
David Spencer
Wurzelreich
Über die gemeinsame Evolution von Pflanze und Mensch
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Mensch und Pflanze – zwei vermeintlich konkurrierende Mega-Lebewesen. Dabei blickt die Pflanze auf eine bewegte Geschichte zurück, die der menschlichen gar nicht so unähnlich ist. Der bekannte Wissenschaftskommunikator und Biologe Dr. David Spencer macht sich auf unterhaltsame Art daran, die Entwicklung der Pflanzen über Jahrmillionen hinweg nachzuerzählen: angefangen bei ihrem nomadischen Dasein in den Weltmeeren, dem eine Zeit folgte, in der sich die ersten Pflanzen aus den Ozeanen der noch jungen Erde erhoben, um das Land zu besiedeln und sesshaft zu werden. Wir erfahren, welche Herausforderungen dieses Leben in vermeintlicher Bewegungslosigkeit mit sich brachte, den Launen der Witterung schutzlos ausgeliefert, und wie die Pflanze durch Aufgabenteilung und kollektives Arbeiten ganze Landschaften formt. Und wir erkunden, wie sie sich bis in die entlegensten Winkel unseres Planeten ausbreiten konnte, schließlich vom Menschen gezähmt wurde – und dennoch immer eigensinnig blieb.
Diese faszinierende Reise führt zunächst zu den Anfängen zurück und endet in der Gegenwart. Wir wandeln auf den Spuren der pflanzlichen Erfolgsgeschichte und entdecken zugleich die wunderbare Welt der heutigen Pflanzen. David Spencer macht nicht zuletzt klar, welches Potenzial wir verschenken, wenn wir die Intelligenz der Pflanze nicht anerkennen und unser Ökosystem weiter ausbeuten, anstatt es partnerschaftlich und respektvoll gemeinsam zu gestalten.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de
Inhaltsübersicht
Motto
Vorwort
1 | Keimung – Smells like green spirit
Ein mikroskopisches Trainingslager
Heiße Luft und Apokalypse
Lebensrettende Treibhausgase
Ohne Moos nix los
2 | Wurzeln schlagen – These roots aren’t made for walking
Kein Hirn, kein Problem
Die ewige Efeutute
Die Müllhaufen-Hypothese
Die Zähmung der wilden Kräuter
Von Genscheren und Piraten
3 | Der Sonne entgegen – Here comes the sunflower
Sandwich oder Bagel, das ist hier die Frage
Ein Schwarm von umgekehrten Tieren
Uralte Rituale und Auberginen-Emojis
4 | Zusammen wachsen – Dill the messenger
Der Krautgeflüster-Schnupperkurs
Laber, Rhabarber!
Vom Rasenmähen und dem Code der Blumen
Die gute Art von Masochismus
Infokrise im World Wide Wurzelwerk
Das Mikrobiom: Gerüch(t)eküche und Bauchgefühl
5 | Gedeih und Verderb – The lord of the weed
Holoparasiten und Zombie-Raupen-Apokalypse
Stachelröschen und Dornbeere
Brandstiftung und Teufelsgärten
Drama im Wilden Westen
There’s something in the Badewasser
Neophyten: Das Imperium schlägt zurück
6 | Blütezeit – Fifty shades of hay
Der Schatz am Ende des Regenbogens
Diversifizierung des Portfolios
Nieder mit der deutschen Kartoffel!
Im Wald vor lauter Bäumen säen
Saure Zungen und süße Träume
7 | Saat setzen – Gardeners of the galaxy
Öffentlich-rechtlicher Buschfunk
Information, die hängen bleibt
Von Spiderman und unerfüllbaren Erwartungen
Auenland und Büffelmozzarella
Wunschzettel eines Wissenschaftlers
Epilog – Eine globale Symbiose
Dank
Denn die Welt ändert sich: Ich spüre es im Wasser, ich spüre es in der Erde, und ich rieche es in der Luft.
Baumbart in Die Rückkehr des Königsvon J. R. R. Tolkien1
Vorwort
Auf den ersten Blick könnte das Leben von Pflanzen und Menschen kaum unterschiedlicher sein: Die einen ernähren sich von Sonnenlicht, die anderen sind auf Nahrungssuche und -aufnahme angewiesen. Die einen sind im Boden verwurzelt, die anderen ständig in Bewegung. In der Welt der Pflanzen lebt es sich – so macht es den Anschein – wie in Zeitlupe, ohne jede Möglichkeit der sinnlichen Wahrnehmung, während für uns ein reges Treiben voller Eindrücke und Kurswechsel die Realität ist. Was aber, wenn die Evolutionsgeschichte von Pflanzen und Menschen eigentlich gar nicht so unähnlich ist? Wenn wir nicht nur denselben Planeten teilen, sondern auch in unserem Verhalten, unseren Gewohnheiten und Vorzügen mehr gemeinsam haben, als wir denken? Was, wenn uns die mit dem Pflanzenreich geteilte Evolution zu einer fast symbiotischen Wohngemeinschaft auf der Erde gemacht hat, in der gegenseitiges Vertrauen und die gemeinsame Bewältigung kniffliger Aufgaben erforderlich sind? Die Lebensgeschichte der Pflanzen erzählt uns an vielen Stellen auch von unserer eigenen Entwicklung. Unsere Kulturpflanzen sind Ausdruck einer gewachsenen Verbindung, während die Wildpflanzen uns daran erinnern, wo wir herkommen. Wir sind mal auf spirituelle, dann wieder auf ganz praktische Weise miteinander verwoben, wenn es um unsere Ernährung oder den Schutz unserer Umwelt geht. Und die Wissenschaft liefert fast täglich spannende Neuigkeiten, die uns helfen, das Leben unserer krautigen Mitbewohnerinnen noch besser zu verstehen.
Dieses Buch soll dazu anregen, nicht nach den Unterschieden zwischen den vermeintlich konkurrierenden Mega-Lebewesen Mensch und Pflanze zu suchen. Vielmehr möchte es zeigen, was für eine Chance es sein kann, sich in die Pflanzenwelt hineinzuversetzen, uns ihre Sorgen und Nöte, ihre Ideen und Erfindungen einmal genauer anzuschauen. Dazu braucht man nicht einmal Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler von Beruf zu sein: Alle Menschen sind permanent mit Pflanzen und den Produkten, die wir aus ihnen herstellen, in Kontakt. Das Gemüse im Kühlfach, der Rattanschaukelstuhl in der Ecke, der Biodiesel im Tank, ja sogar die Seiten dieses Buchs sind aus Pflanzen hervorgegangen. Vielleicht lohnt es sich ja, der unbeteiligten Zimmerpflanze in der Ecke einmal unser Gehör zu schenken. Denn wenn sie sprechen könnte, würde sie eine bewegte Geschichte erzählen, die der Menschheitsgeschichte gar nicht so unähnlich ist.
Am Anfang der Reise wäre von unbequemen Zeiten die Rede, in denen die ersten Pflanzen sich mühselig aus den Ozeanen der noch jungen Erde kämpften und das Land besiedelten. Nach einem nomadischen Dasein in den Weltmeeren folgte bald eine Zeit, in der unsere Pflanzen sesshaft wurden. Das brachte wiederum neue Herausforderungen mit sich: Sie lebten nun ein Leben in (scheinbarer) Bewegungslosigkeit, den Launen der Witterung ohne Schutz ausgeliefert. Unsere Pflanzen mussten gänzlich neue Fähigkeiten erwerben, um an grundlegendste Dinge wie Wasser oder Nährstoffe zu gelangen. Dann wieder: Aufgabenteilung. Durch die Vielfalt der Arten besetzten verschiedene Gewächse die diversen ökologischen Nischen, stützten und unterstützten sich gegenseitig. Sie formten ganze Landschaften, gestalteten Ökosysteme um und breiteten sich bis in die entlegensten Winkel unseres Planeten aus. Eine permanente Migration von Arten führte mal hier zu neu erschlossenem Territorium, mal dort zum Aussterben einer ganzen Population.
Schließlich lernten sie sogar, miteinander zu sprechen. Permanent quatschen Pflanzen untereinander, aber auch mit den sie umgebenden Organismen, warnen sich gegenseitig vor Fressfeinden oder rufen Waffenbrüder und -schwestern auf den Plan. Im Kleinen, im Unsichtbaren, finden seit jeher erbitterte, molekulare Kriege statt: zwischen Pilzen und Pflanzen, zwischen Krankheitserregern und unserem geliebten Gemüse, zwischen Kraut und »Unkraut«. Dabei werden die abgefahrensten Mittelchen erfunden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt! Tödliche Stoffe, halluzinogene Substanzen oder wilde Chemikalien, die die Keimung von Artgenossen hemmen, bestäubende Insekten fremdsteuern oder nachweislich Verhaltensänderungen in höheren Säugetieren auslösen – auch in uns. Wenn man der Zimmerpflanze zuhören könnte, würde man auch von der Zähmung der Natur hören. Davon, wie der Mensch wilde Kräuter in brave Nutzpflanzen verwandelte und so den Grundstein für Zivilisationen, Pyramiden, selbstfahrende Autos und dergleichen legte. Unsere eng verwobene Koevolution und die Abhängigkeit der Menschheit von Pflanzenprodukten wirft auch die wohl berechtigte Frage auf, wer hier eigentlich wen domestiziert hat.
Die Details stecken oft im Verborgenen, etwa im Wurzelreich des Bodens. Erst jetzt beginnen wir so langsam zu verstehen, dass das Leben einer Pflanze nur zur Hälfte durch das oberirdische Grün bestimmt ist. Direkt unter unseren Füßen finden irrsinnig interessante und gleichzeitig so wichtige Prozesse statt, die für die Gesundheit der Pflanzen genauso essenziell sind wie für die des gesamten Planeten. Organisches Material wird in seine kleinsten Teile zersetzt, Treibhausgase werden für eine lange Zeit gebunden, chemische Kommunikation ermöglicht ein friedliches Wachstum unterschiedlicher Arten, die sich in ihrer Vielfalt gegenseitig stärken. Außerdem sind Pflanzen ungemein kreativ, wenn es um die Produktion von maßgeschneiderten Wirkstoffen geht. Seit jeher nutzen wir Menschen die Botanik, um Beschwerden zu lindern. Die Naturheilkunde ist fast so alt wie die Landwirtschaft und zeigt einmal mehr die eng verwobene Liebesgeschichte, die wir mit dem Pflanzenreich schreiben. Bei genauerem Hinsehen sind auch in der modernen Welt Inspirationen aus der Pflanzenwelt allgegenwärtig. Allein auf dem Cover dieses Buchs sind drei fantastische Superheldinnen zu finden, die nicht nur schön anzusehen sind, sondern uns auch schon ganz praktisch genützt haben: Extrakte des Wurmfarns Dryopteris filix-mas wurden zur Herstellung von Wurmkuren verwendet, die Bitterstoffe des rot blühenden Quassiabaums helfen bei der natürlichen Insektenbekämpfung, und die dornige Akazie ist sowieso ein wunderbares Beispiel für die Wehrhaftigkeit von Pflanzen – nicht zuletzt aufgrund ihrer Symbiose mit der Tierwelt, die in diesem Buch noch zum Thema werden soll.
Auch wenn das pflanzliche Leben zumeist unter dem Radar unserer Aufmerksamkeit stattfindet und die Botanik oft als eingestaubtes Forschungsfeld angesehen wird: Die Blütezeit der Pflanzen ist jetzt. Wir brauchen Pflanzen mehr denn je, nicht nur für Nahrung, Energie und Häuser, sondern auch als Inspiration, als Teamkolleginnen, als Verbündete im Kampf gegen eine ungemütlich klingende Zukunftswelt, in der Klima, Artenschwund und begrenzte Fläche enormen Einfallsreichtum erfordern. Und wer könnte uns da besser beraten als die wehrhaften Gewächse selbst, die schon mehrere Beinahe-Weltuntergänge überlebt haben? Um ihre Ratschläge für uns hörbar zu machen, müssen die neusten Erkenntnisse aus Wissenschaft und Forschung in eine für alle verständliche Sprache übersetzt werden. Eine Beschäftigung mit der abenteuerlichen Koevolution von Pflanze und Mensch kann Balsam für unsere weltschmerzgeplagten Seelen sein – gerade in Zeiten von Kriegen, Krisen und Kollaps. Dieses Buch ist eine Einladung in eine krautige Welt, die nicht weniger real, aber unfassbar spannend ist. Täten wir nicht gut daran, statt unsere Daumen weiter zum zeitfressenden Scrollen zu nutzen, lieber den »grünen Daumen« zu trainieren? Erdverbundenheit und Bodenständigkeit sind zwei Worte, die praktisch dasselbe bedeuten. Ob wir nun spirituell unterwegs sind oder ganz pragmatisch in die Zukunft navigieren wollen, ist eigentlich schnuppe. Die Welt der Pflanzen hält für alle Menschen etwas bereit.
Holen wir also gemeinsam tief Luft und tauchen ein in die krautige Story. Einen halbwegs langen Atem werden wir brauchen, denn es soll uns ja nicht gleich zu Beginn die Puste ausgehen – wobei die Luft zum Atmen für die allerersten Pflanzen ziemlich knapp war.
1 | Keimung – Smells like green spirit
Zu Beginn bestanden die Gewächse aus mikroskopisch kleinen Lebenseinheiten, die ihre großartige Evolution erst noch vor sich hatten. Pflanzen sind, wie wir Menschen, wie jedes Tier, jeder Pilz und alle Bakterien, aus Zellen aufgebaut. Trotzdem sind unsere Lebensweisen sehr anders, Pflanzen sind »unbekannte Wesen«, die uns als Raumschmuck oder in der Zutatenliste des Lieblingsrezepts eher beiläufig begegnen. Dabei hat ihre dramatische Geschichte unsere Welt schon einige Male auf den Kopf gestellt. Pflanzen haben unseren Planeten vorgekaut, bearbeitet und geformt, bevor er überhaupt für uns bewohnbar wurde. Als Tiere und Menschen dann auf der globalen Bildfläche erschienen, fanden sie ein gemachtes Bett vor, vorgewärmt und ausgestaltet in Millionen Jahre langer Feinarbeit durch die Urahnen unserer heutigen Yucca-Palme.
Wie und wann sind die unscheinbaren Gewächse überhaupt zu dem geworden, was sie sind? Welche Fähigkeiten brauchten sie dafür? Und welche dieser neu erworbenen Skills des Lebens teilen wir mit ihnen?
Ein mikroskopisches Trainingslager
Okay, ein bisschen Biologiegrundkurs. Nur zur Auffrischung, versprochen. Es wird auch nicht wehtun! Zunächst bestehen beide – Pflanzen und Tiere – aus Zellen (im Übrigen gibt es noch mehr sogenannte Königreiche des Lebens, zu denen zum Beispiel Pilze und Amöben zählen, aber hier geht es eben um den direkten Vergleich von Kraut und Tier). Schaut man sich die kleinste lebensfähige Einheit beider Organismen einmal unter dem Mikroskop an, sieht man im Großen und Ganzen das Gleiche: einen amorphen Sack, gefüllt mit einem Zellkern, mit Zellsaft und allerlei kleineren, ebenso sackartigen Strukturen (den »Organellen«). Bei den Tieren sieht die Zelle auf den ersten Blick eher rundlich aus, bei den Pflanzen eckig. Letzteres führt auch direkt zum ersten großen Unterschied, denn Pflanzenzellen sind von einer stabilen Zellwand umgeben, Tierzellen nicht. Zusammen mit einem weiteren großen Sack, der »Vakuole«, die es nur in Pflanzenzellen gibt, sorgt die Mauer um die Zelle für Schutz und Stabilität.
Beide Kandidatinnen, also sowohl Tier- als auch Pflanzenzellen, enthalten spezielle Organellen, die für die Energiegewinnung zuständig sind: Diese Mitochondrien sind die Kraftwerke der Zelle und machen, vereinfacht gesagt, aus Zucker Energie. In allen »höheren Lebensformen« (wir kommen noch dazu, wieso diese Bezeichnung irgendwie überheblich ist) sind es diese kleinen Supersäcke, die aus Spaltprodukten von Kohlenhydraten und unter Verbrauch von Sauerstoff (deshalb müssen wir atmen) kleine Energienuggets zaubern und dem Körper bereitstellen. Aber: Die Quelle für den Ausgangsstoff Zucker unterscheidet sich wiederum zwischen Pflanze und Tier. Während Leoparden, Bisamratten, der Schabrackentapir und wir Menschen essen müssen, können Kastanie und Brennnessel sich den Zucker dank Fotosynthese selbst herstellen. Wir sind auf externe Futterquellen angewiesen, sind heterotroph, während die meisten autotrophen Gewächse nur Licht, Wasser, Luft und Liebe zur Energiegewinnung brauchen.
Diese erste Superkraft der Pflanzen war nicht nur der Jackpot für ihre Evolution, sondern auch die wohl dramatischste Erfindung in der Erdgeschichte, die das Gesicht des Planeten für immer verändern sollte und ein nie gesehenes Massensterben zur Folge hatte. Angefixt? Keep reading.
Schauen wir uns zunächst weitere Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Mensch – beziehungsweise Tier – und Pflanze an. Lange glaubte man, dass nur Pflanzen dazu imstande sind, sich ständig zu erneuern, abhandengekommene Organe zu ersetzen und somit praktisch unsterblich zu sein. Neueste Erkenntnisse aus der Stammzellforschung zeigen allerdings, dass das so nicht stimmt!2 Sowohl Pflanzen als auch Tiere besitzen sogenannte Stammzellnischen, die auf Abruf sind und jederzeit sowohl neue Stammzellen oder eben Zellen mit bestimmten Funktionen ausbilden können. »Jederzeit« stimmt nach jetzigem Wissensstand vor allem im Pflanzenreich: Man kann von einer 100-jährigen Buche ein Blatt abschneiden und aus dem Gewebe neue, pluripotente Stammzellen züchten (also quasi auf Reset drücken und das Buchenleben von vorn beginnen lassen). Bei Tieren und Menschen beschränken sich diese Verjüngungsaktionen auf Zellen im Embryo, aber na ja, immerhin. An der Fruchtfliege Drosophila wurde gezeigt, dass eine im Labor mit der Schrotflinte abgeschossene Stammzellnische (es war eine sehr kleine Schrotflinte) von umgebenden Zellen neu kolonisiert und schlussendlich vollständig regeneriert wurde!3 Da sich die Zellerneuerung in der Evolution von Pflanzen und Tieren unabhängig voneinander entwickelt hat, gehen Forschende nun davon aus, dass die Stammzellnischen eine zwingend notwendige Innovation auf dem Weg zur Mehrzelligkeit darstellten, die womöglich schon früh in der Erdgeschichte erfunden wurde.
Die Aufgabe der Stammzellen ist im Grunde vergleichbar mit der einer guten Fußballtrainerin oder eines guten Fußballtrainers: Es wird ständig analysiert, überprüft, Rücksprache gehalten, zurückgepfiffen, ausgewechselt, delegiert. Jedes Teammitglied kennt seine Aufgabe und gibt alles. Wenn mal jemand verletzt ist oder sich danebenbenimmt, wird getauscht. Und das Wichtigste: Eine gute Führung kümmert sich früh genug um die eigene Nachfolge. Denn die Kiste kann nur geschmeidig weiterlaufen, wenn auch an die nächste Generation gedacht wird. Genauso ist es bei Stammzellen. Es ist essenziell für die Funktion eines regenerativen Gewebes, dass sowohl spezialisierte Zellen mit einigen wenigen Aufgaben gebildet als auch die Stammzellen selbst erneuert werden (sich also teilen). Nur durch ein ausgewogenes, oft durch Hormone und Umwelteinflüsse reguliertes Geben und Nehmen bleibt der Gesamtorganismus intakt und anpassungsfähig. Und wenn es an der Zeit ist, tritt die Spitze ab und macht einer neuen, jüngeren Nachfolge Platz, nicht ohne ihr gute Tipps und Tricks mit auf den Weg zu geben. Schöne Vorstellung, oder?
Trotzdem sollten wir uns nicht allzu viel Hoffnung machen, dass wir in naher Zukunft ganze Gliedmaßen nachwachsen lassen können. Um beim obigen Bild zu bleiben: Unsere körpereigenen Fußballtrainer*innen gehen schon kurz nach der Embryonalentwicklung in Rente und sind nur schwer zu motivieren, doch auch mal auf ehrenamtlicher Basis die lokalen Kicker zu trainieren. Bei Pflanzen sieht das anders aus. Mindestens zwei Trainingslager gibt es auch im hohen Alter noch: Das shoot-apical meristem (SAM) und das root-apical meristem (RAM). Wie der Name schon sagt, befinden sie sich maximal weit voneinander entfernt: das eine in der Spitze des Sprosses, das andere an der Wurzelspitze (da können, wie beim Riesenmammutbaum Sequoiadendron giganteum, gut und gern mal hundert Meter dazwischenliegen). Während SAM für die Ausbildung von Seitenästen und Blättern zuständig ist, betreibt RAM bei ganz und gar unterirdischen Bedingungen das Survivalcamp für zukünftige Wurzelhärchen und aufstrebende Wasserleitungen. Die Ausgangslagen für beide Lager könnten verschiedener nicht sein: Die einen trainieren bei Wind und Wetter, werden regelmäßig von doofen Heterotrophen angeknabbert, die anderen pumpen sich in völliger Dunkelheit und mit knapper Atemluft durch dichtes Erdreich und Gestein. Und trotzdem: Stellt man eine Pflanze auf den Kopf, können aus den SAM-Sprösslingen mit wenigen genetischen Tricks4RAM-Azubis werden – und umgekehrt! Eine Pflanze kann also unter bestimmten Bedingungen ganze Organfunktionen umkrempeln, an den Wurzeln Blattwerk ausbilden und an den Blättern Wurzeln. Ich finde das äußerst abgefahren. Hätten wir also ein Szenario wie beim Blockbuster Upside Down mit Kirsten Dunst von 2012, in dem zwei Zwillingserden bedenklich nah aneinander im All herumschweben, könnte der Mammutbaum theoretisch in beiden Welten wurzeln! Ebenfalls eine tolle Vorstellung.
Zurück auf dem irdischen Boden der Tatsachen, können wir zumindest das von den Pflanzen lernen: Es gibt Mittel und Wege, um Stammzellen zu triezen und sie auch bei uns Menschen nach jahrelanger Inaktivität dazu zu bewegen, wenigstens einmal von der gemütlich-fleischigen Couch der Darmwand oder des Knochenmarks aufzustehen und doch noch etwas Gutes zu tun. Für die Altersforschung sind auch noch ein paar Erkenntnisse drin (aber mal ehrlich, wer will schon ewig leben?) – wir werden uns diesem Thema im nächsten Kapitel widmen. Bis hierhin soll es erst einmal ausreichen, wenn wir die Unterschiede – aber eben auch die Gemeinsamkeiten – zwischen uns und der krautigen Welt grob vor Augen haben, bevor wir auf die eigentliche, evolutionäre Reise gehen.
Es gibt neben der zellulären Ebene noch unzählige, offensichtliche Beispiele für den doch sehr anderen Lifestyle der Pflanzen, die wir zu gegebener Zeit durchgehen werden. Zuallererst bin ich euch noch ein letztes, mikroskopisches Merkmal schuldig, das in Pflanzenzellen erkennbar ist, jedoch nicht in Tieren. Wie es aussieht? Na ja, eben wieder wie ein kleines Säckchen. Nur diesmal ist etwas anders: Das Säckchen ist grün. Die sogenannten Chloroplasten enthalten das Blattgrün oder Chlorophyll, das wir auch mit bloßem Auge erkennen und mit wohligem Gefühl begehren, wenn wir »ins Grüne« fahren. Ohne Chlorophyll keine Fotosynthese. Ohne Fotosynthese keine Pflanzen. Ohne Pflanzen keine Tiere, somit auch keine Menschen, so einfach ist die Rechnung.
Aber woher kommt diese wundersame Kraft, die es dem Kraut ermöglicht, Sonnenlicht in Essen umzuwandeln? Um uns da reinzuwuseln (reinzunerden, wie meine Kollegin Mai Thi sagen würde), müssen wir ein paar Jahre in der Erdgeschichte zurückreisen. Ein paar Milliarden Jahre, um genau zu sein. In eine Zeit, in der »Grün wählen« ein wirklicher Game Changer war, der ein Überleben auf einer sich gerade abkühlenden Erdkugel wahrscheinlicher machte. Übrigens: Das Blattgrün erscheint uns nur aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften grün. Es absorbiert für seine chemische Superpower vor allem Licht in den Wellenlängen Rot und Blau, während Grün weniger geeignet ist und reflektiert wird, weshalb wir Blätter in Grün sehen, obwohl sie es eigentlich nicht sind. Reisen wir also in der Zeit zurück bis an die Stelle, als die Fotosynthese das erste Mal auf den Plan trat. Was wir hier finden werden, ist eine farbenfrohe Geschichte mit spannenden biologischen Erfindungen auf einem noch jungen und formbaren Planeten Erde. Was wir außerdem finden werden, ist eine schleichende Vergiftung. Ein langsames Ersticken. Und die Auslöschung allen Lebens auf der Welt.
Heiße Luft und Apokalypse
Herzlich willkommen im Archaikum (etwa 4000 bis 2500 Millionen Jahre vor heute)! Hey, na, warum das lange Gesicht? Wir sind doch hier, um Spaß zu haben! Wenn wir das Leben unserer Topfpflanzen (und allen anderen fotosynthetisch aktiven Lebewesen) wirklich verstehen wollen, müssen wir mitten in das Erdzeitalter springen, in dem sich die Erde etwa so verhalten hat wie eine Discokugel. Vor etwa drei Milliarden Jahren war unser Planet nämlich hauptsächlich eine heiße, wild flackernde grüne Ozeansuppe, die die etwa drei Prozent Landfläche umgab. Die grüne Farbe kam nicht etwa durch Algen, sie wurde vielmehr durch rostendes Eisen ausgelöst. Grünrost entsteht im Gegensatz zu dem uns bekannten rötlich braunen Rost vor allem bei Mangel eines bestimmten Gases – Sauerstoff (O2) –, und der war damals wirklich schwer zu finden. Heute mag dieses Molekül für uns selbstverständlich sein, doch über die Hälfte der Erdgeschichte kam die Welt sehr gut ohne oder mit nur geringer O2-Konzentration zurande.15 Die Atmosphäre bestand zu großen Teilen aus Stickstoff (N2), daneben gab es Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid (CO2). Die Meere waren im Archaikum bereits von Mikroorganismen bevölkert, die sehr gut ohne »Luft zum Atmen« auskamen. Diese »Anaerobier« (altgriechisch für »ohne Luft lebend«) gehörten wohl zu den ersten Lebensformen überhaupt, die das ständige Umrühren und Nachwürzen der Ursuppe so hervorgebracht hat.
Das Problem mit Erdzeitaltern, die acht oder neun Nullen auf dem Buckel haben, ist leider, dass Daten und Fakten aus erster Hand nur spärlich verfügbar sind. Das Archaikum ist so verdammt lang her, es gibt kaum Fossilien, viele Indizien wurden in der Feuer spuckenden jungen Erde kurz nach ihrer Entstehung sofort verflüssigt. Der Wissensstand von heute stützt sich daher auf einige wenige Anhaltspunkte wie Eisenformationen in der Geologie oder auf die Erbinformation von Cyanobakterien, die mutmaßlich zu den ersten »Lichtessern« gehörten. Viele Fragen (zum Beispiel auch danach, wie die Fotosynthese letztlich evolutionär entstanden ist) bleiben bis heute unbeantwortet. Dennoch gibt es einige Eckdaten, bei denen sich Forschende einigermaßen einig sind. Sie betreffen den großen Auftritt von Sauerstoff auf der Tanzfläche der Disco-Erde, der als Great Oxidation Event bekannt geworden ist. Doppelpunkt.6
Vor etwa 2,7 Milliarden Jahren (ganz ehrlich, mit solchen Zahlen kann ich als Pflanzenbiologe auch nicht viel anfangen) kamen die ersten Photosynthesizers auf den Markt. Was klingt wie ein digitales Klavier, das mit Schlaghosen und Vokuhila-Frisur bedient werden muss, war in Wahrheit noch viel schillernder: Mikroskopisch kleine Bakterien, allen voran die erwähnten Cyanobacteria, stürmten die Charts mit einem Stoffwechsel, der Licht in Essen umwandelte und Sauerstoff als Abfallprodukt freigab. Wieso Abfall? Die kleinen Stars waren so schlau, einen schon damals im Überfluss vorhandenen Ausgangsstoff (Wasser! H2O!) zu spalten, um ihren Motor am Laufen zu halten. Als kleiner Pups kam dabei am Ende eben Sauerstoff aus dem Auspuff. 200 Millionen Jahre lang schrieben die Cyanobakterien so ihre Erfolgsstory, ihre Population wuchs rasant, und der steigende O2-Gehalt der Ozeane ließ sich auch vom Weltall aus beobachten: Das Eisen im Meer reagierte mit dem neuartigen Gasgemisch, der dominierende Grünrost wurde von rötlich braunen Eisenoxiden abgelöst, kurzum: Unsere Erde verfärbte sich aller Wahrscheinlichkeit nach in dieser Zeit blutrot. (Ich kann nicht anders und höre hier immer direkt den aufmunternden Soundtrack von Guardians of the Galaxy, sehe ein Raumschiff mit dem Baumhelden Groot an der Erde vorbeirasen, während sich der Planet im Hintergrund wabernd von Giftgrün in Rostrot verwandelt. Falls ihr die Marvel-Reihe noch nicht gesehen habt, dürft ihr jetzt das Buch beiseitelegen und euer Leben überdenken.) So haben die allerersten, mikroskopisch kleinen Pflanzen das Gesicht der Erde bereits früh von Grund auf verändert.
Streng genommen sind Cyanobakterien natürlich keine richtigen Pflanzen. Sie besitzen weder einen Zellkern noch eines der anderen coolen Werkzeuge, die Pflanzenzellen klassischerweise im Koffer haben. Vielmehr sollten die kleinen Wundermikroben bald selbst in diesen Werkzeugkoffer gepackt werden und fortan im Körper der Pflanze als praktische Symbiosepartner mitreisen!7 Damit die Evolution ihren Lauf nehmen konnte, musste aber zunächst das Problem mit dem Sauerstoff gelöst werden.
Die Heavy-Metal-Erde sah vor 2,5 Milliarden Jahren zwar echt fesch aus, aber der steigende Gehalt an Sauerstoff brachte zunehmend Probleme mit sich. Wie sich herausstellte, waren die hohen O2-Konzentrationen für die meisten Anaerobier – wir erinnern uns: die bis dahin häufigste und erfolgreichste Lebensform auf dem Globus – leider hochgiftig. Schade Schokolade, es kam zum ersten großen Massensterben. Viele dieser bemitleidenswerten Bazillen flüchteten sich in »sauerstoffarme Nischen«, in denen sie bis heute (!) ein Schattendasein fristen (zum Beispiel in Schlammsedimenten, in komischen Schwefelschloten am Meeresgrund oder, ironischerweise, in unserem Darm). Nachdem die Meere vollgepumpt waren, entkam das schicksalhafte Gas auch noch in die Atmosphäre und sorgte dort ebenfalls für wirklich dramatische Klimaveränderungen. Nicht nur entzogen die Cyanobakterien dem Erdsystem einiges an CO2 zur Konstruktion ihrer Zellwände, ihr ach so tolles Pupsgas verdrängte zudem das atmosphärische Methan.
Da sowohl CO2 als auch Methan Treibhausgase sind, was passierte dann wohl, als beide deutlich abnahmen? Genau, die Erde kühlte ab. Und das war die eigentliche Katastrophe, die das Great Oxidation Event mit sich brachte: Durch die Anreicherung von Sauerstoff in den Ozeanen des Archaikums, seinem Entfliehen in die Atmosphäre und die Reaktion mit den damals nur allzu präsenten Klimagasen sank die globale Temperatur so tief wie nie zuvor. Eine Reihe von Eiszeiten war die Folge, alles fror zu, von den Polen bis zum Äquator. Und so begab es sich, dass sogar die mächtigen Cyanobakterien von ihrer Innovation bedroht waren: Das erste fotosynthetisch aktive Leben erstickte an seinem eigenen Abfall. Und dieser Abfall war Sauerstoff.
Tja, so können sich die Zeiten ändern, oder? Der heutige Inbegriff von frischer, klarer Atemluft ist der Plastikmüll vergangener Äonen. Und genau wie wir heute große Probleme mit der Rückholung unserer Kunststoffe aus den Meeren und Küstenregionen haben, rang die vermeintlich erfolgreichste Bakterienspezies selbst verschuldet um ihre Existenz. Wie beim Plastik (bei dem ehrlicherweise jedes bisschen Müll in der Umwelt bereits zu viel ist) kommt auch beim Sauerstoff ein ganz besonderer Satz zum Tragen, den ich nicht müde werde zu zitieren: »Die Dosis macht das Gift!« Er geht zurück auf den Schweizer Arzt und Naturmystiker Paracelsus, der diese Daumenregel der Toxikologie schon vor einem halben Jahrtausend erkannt hat. (Wer Texte und Interviews von mir kennt, wird die Phrase im Zusammenhang mit Pflanzenschutzmitteln, Heilpflanzen oder Lebensmittelchemie kennen. Auch in diesem Buch wird sie an der ein oder anderen Stelle wichtig werden. Sollte ich über ein Tattoo nachdenken?) Auf jeden Fall gibt es für einen bewohnbaren Planeten Erde so etwas wie »zu wenig« und »zu viel« Sauerstoff – vor allem dann, wenn das Leben bisher nicht viel Kontakt mit diesem reaktionsfreudigen Gas hatte. Wie oben angedeutet, gibt es durchaus handfeste Beweise für das Oxidationsfestival im Sedimentgestein unter unseren Füßen: Sogenanntes Bändereisenerz zeugt von abgelagerten Eisenoxiden vergangener Millennien, ist vor allem in den Schichten des ausgehenden Archaikums zu finden und sieht ein bisschen aus wie meterdicker Bacon. Und in ebendieser Baconzeit wurden vor allem die Anaerobier gnadenlos dahingerafft oder in isolierte Refugien verdrängt.
Mindestens ein Gutes hatte die Sache mit der Vergiftung der gesamten Welt aber. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass der Aufstieg der Cyanobakterien den Weg für die Mehrzelligkeit geebnet hat: Zellen rotteten sich zusammen und mussten notgedrungen Kolonien bilden, in deren Zentren relativ sauerstoffarme Bedingungen herrschten, was für einige Mitglieder des Zellhaufens von Vorteil war. Die Randbereiche hingegen wurden von aeroben Cyanobakterien oder dergleichen besiedelt. Anders gesagt, zwang der überschüssige Sauerstoff das frühe Leben möglicherweise dazu, komplexere Gesellschaften auszubilden, die die Urversionen unserer heutigen Vielfalt darstellen. Biodiversität als Survivalstrategie! Ganz genau weiß man das allerdings nicht, und mangels fossiler Erinnerungsfotos aus jener Zeit wird man es wohl auch nie vollständig beweisen können. Plausibel klingt es aber doch, dass das Leben durch Anpassung und Gemeinschaftsarbeit einen Weg gefunden hat, mit dem Giftgasdesaster umzugehen.
Fest steht außerdem: An einem Punkt vor etwa 2,5 Milliarden Jahren wachten die urzeitlichen Pflanzenwinzlinge aus dem Winterschlaf einer Eiszeit auf, die gute 300 Millionen Jahre angedauert hatte. Und sie fanden eine in ihren Grundstrukturen komplett veränderte Welt vor.
Lebensrettende Treibhausgase
Nachdem O2 (nicht der Mobilfunkanbieter) beinahe das gesamte Leben auf der Welt ausgelöscht und die Erde von einer zart schmelzenden Praline in eine Eiskugel verwandelt hatte, stellte sich bald wieder eine Art Gleichgewicht ein. Die Überlebenden der Eiszeiten blickten auf eine Welt, die buchstäblich cool war und einige Vorteile bot: Es gab Sauerstoff in der Luft (aber nicht zu viel), Sauerstoff im Wasser (nicht zu wenig), und die Temperatur- und Druckverhältnisse ließen weiterhin Wasser in flüssiger Form zu. Nice! Das ist in unserer Galaxie gar nicht mal so selbstverständlich. Auch spannend: Inzwischen hatte sich O2 aus Langeweile sogar an sich selbst vergangen und O3 hervorgebracht. Ozon war geboren! Zum ersten Mal seit der Geburt des Planeten konnte sich so etwas wie eine stabile Atmosphäre etablieren, in der (unter anderem) dank Ozonschicht ein Großteil der schädlichen UV-Strahlung der Sonne abgeschirmt wurde. Es war also prinzipiell nicht mehr tödlich, an der Wasseroberfläche herumzudümpeln oder gar an Land zu gehen, juhu! Das wird später noch wichtig werden. Die riesige Flasche Sonnenmilch auf der Atmosphäre unserer Erde ermöglichte es den verbliebenen Lebewesen, kreativ zu werden – und genau das taten sie dann auch.
Um nicht unnötig weit auszuholen: Der nächste große Hit in der Radioplaylist des Lebens hieß »Endosymbiose«. Eine Mikrobe hatte eine andere aufgefressen, sie jedoch nicht verdaut. Und genau das war die Innovation: Durch Einverleibung schützte die Fresserin die Gefressene und wurde gleichzeitig mit interner Energieproduktion belohnt – eine Symbiose eben. Viele dieser blinden Passagiere lassen sich noch heute im Inneren von anderen Zellen finden (auch in unseren), die Chloroplasten wie auch die Mitochondrien (siehe oben) sind zwei prominente Beispiele. Sie sind Endosymbionten, und die Endosymbiontentheorie gilt heute als beste Erklärung für die Evolution von Pflanzen- und Tierzellen in all ihrer Komplexität, wie wir sie heute kennen.8
Für die Pflanzen war die Internalisierung von (höchstwahrscheinlich) Cyanobakterien und damit das Kapern der Fotosynthese der erste große Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Fortan mussten sie gut auf ihre mitreisenden Powerriegel aufpassen und ihnen perfekte Lebensbedingungen in ihrem neuen Zuhause schaffen. Der gegenseitige Nutzen dieser Symbiose ist vergleichbar mit dem unserer Darmflora (»Flora« ist hier übrigens wirklich unpassend; ich hoffe, es wachsen keine Pflanzen in euren Innereien): Während wir den Darmbakterien ein sicheres Zuhause (mit geringer O2-Konzentration!) in unserem Inneren bieten, sie ab und zu füttern und nicht zu viele Pillen schlucken, belohnen sie uns mit einer ordentlichen Verdauung, einem guten Immunsystem und guter Laune. Der Vergleich hinkt insofern, als dass auch die Pflanzenwelt ein waschechtes Mikrobiom hat, das das eigentliche Pendant zu unseren Darmbakterien ist: Mikroorganismen bevölkern sowohl das überirdische Blattwerk als auch das Wurzelreich und sind an unzähligen Prozessen wie Nährstoffaufnahme oder Krankheitsresistenz beteiligt … aber so weit sind wir ja noch gar nicht, bisher bestehen unsere Gewächse erst aus einer einzigen Zelle (die soeben eine andere gefressen und nicht verdaut hat, ihr erinnert euch).
Ach so, übrigens waren auch die Vorläufer der Tierzellen schlau genug, sich die Fotosynthese in ihren evolutionären Reisekoffer zu packen: Bis heute finden wir Endosymbionten auch beispielsweise in Korallen (die zu den Nesseltieren gehören). Mikroskopisch kleine Einzeller mit dem wundervollen Namen »Dinoflagellaten« leben im Mantelgewebe der Riffbildner und versorgen sie mit bis zu achtzig Prozent ihres Energiebedarfs. Da dazu Sonnenlicht nötig ist, leben Korallenriffe nur in den lichtdurchfluteten Wasserschichten bis etwa dreißig Meter Tiefe. Wie wir alle wissen, ist diese Symbiose derzeit bedroht: Bei Stress (wie etwa zu starker Erwärmung der Meere) stoßen die Korallen ihre kleinen Superdinos aus, was zur Korallenbleiche und zum Absterben der Rifforganismen führen kann.
Das ist insofern fatal, als dass Korallenriffe ähnlich wie tropische Regenwälder zu den artenreichsten Ökosystemen unserer Erde gehören und wichtige Funktionen zur Integrität unserer Welt beitragen. Denn so stabil ist das postarchaische Gemisch aus klimarelevanten Gasen dann doch nicht: Wir Menschen haben es in kürzester Zeit geschafft – in nur einem Wimpernschlag, verglichen mit den Millionen von Jahren der Evolution –, das Gleichgewicht der Klimagase wieder durcheinanderzubringen. Seit der industriellen Revolution (also in weniger als 200 Jahren!) haben menschliche Aktivitäten – hauptsächlich durch die Emission von Treibhausgasen – zweifelsfrei eine globale Erwärmung verursacht, die sich in allen Sphären des Lebens und der Umwelt bemerkbar macht.9 Dass diese Aussage auf einem überwältigenden wissenschaftlichen Konsens fußt, wird in diesem Buch weder diskutiert noch infrage gestellt – die Faktenlage spricht da ganz einfach für sich.
Wie dem auch sei, als die Pflanzen sich selbst erfanden und im frühen Ordovizium (knapp 500 Millionen Jahre vor heute) langsam in Richtung Festland aufbrachen, war die Zusammensetzung der Atmosphäre sowieso eine etwas andere. Während die Tiere noch hinterherhinkten, noch ganz benommen vom Partyknüller der Endosymbiose, tüftelte die Urzeitflora bereits an ihrer Funktionskleidung für eine erste Expedition an Land. Durch die Endosymbiose entstanden die ersten Algen, die sich in kugeligen Kolonien oder langen Fäden zusammentaten. Die Fauna war indes so angefixt von den schier unendlichen Möglichkeiten mehrzelligen Lebens, dass sie in einer kreativen Phase namens Kambrische Explosion (ebenfalls vor gut 500 Millionen Jahren) so gut wie alle Urversionen der heutigen Tierwelt in vergleichsweise kurzer Zeit hervorbrachte. Diese waren jedoch zunächst nur Prototypen, die sich auf ein Leben im Wasser beschränkten.
Der Landgang der Pflanzen bedeutete die Bewältigung neuer, nie gesehener Herausforderungen. Wie Wasser aufnehmen, wenn die Wurzeln noch nicht erfunden waren? Wie sich gegen Wind und Wetter wehren, wie Überhitzung und Vertrocknung vermeiden? Auf welche Weise lassen sich lebenswichtige Mineralien aus nacktem Stein saugen, weil ja so etwas wie »feinkrümelige Blumenerde« noch nicht existierte? Die Antworten ließen nicht lange auf sich warten. Und als sich die Urpflanze an Land zog, streckte jemand ihr völlig überraschend eine helfende Hand entgegen – und die war weder tierischer noch krautiger Natur.
Ohne Moos nix los
Die Kurzfassung des derzeitigen Forschungsstands zur Eroberung der Landflächen durch die Pflanzen lautet in etwa so: Vor rund 470 Millionen Jahren wurde eine Alge an Land geschwemmt und passte sich an. Dies hatte zur Folge, dass das karge Land saftig grün überwuchert wurde, die Chemie der Atmosphäre sich abermals drastisch änderte und neue Herbergen für das gesamte zukünftige Leben entstanden.10 Alle uns bekannten Landpflanzen – vom Gänseblümchen über den Kaktus bis hin zum Boskop-Apfel – haben eine gemeinsame Vorfahrin aus dem Reich der Grünalgen, die Erstaunliches durchlebt hat. Die gängigste Hypothese geht davon aus, dass eine Urgroßmutter der noch heute existenten Lebermoose (Marchantiophyta) die richtigen Skills für ein Leben an Land mit sich brachte. Denn wie schon angedeutet, war ein Leben außerhalb der Ozeane zur damaligen Zeit nicht wirklich angenehm. Die Welt war nach wie vor ein unwirtlicher Ort, überall spuckten Vulkane, das Land bestand ausnahmslos aus Gestein. Die Temperatur der Wasseroberfläche betrug trotz Abkühlung immer noch um die 45 °C. Die Ozonschicht war noch dünn, zu viel Zeit an der gar nicht so frischen Luft konnte wegen der schädlichen ultravioletten Strahlung weiterhin DNA-Schäden verursachen. Außerdem war Wasser (als Hauptantrieb für die nun in den Pflanzenzellen lebenden Cyanobakterien) außerhalb der Ozeane deutlich schwerer zu bekommen. Wieso also um alles in der Welt das Meer verlassen?!
Denkbar ist, dass die ersten Landpflanzen der Konkurrenz davonkommen wollten. Weniger Gedränge um den besten Platz an der Sonne, weniger Streit um Nährstoffe und Habitate. Es könnte also durchaus einen evolutionären Vorteil bedeutet haben, die Strapazen des Landlebens auf sich zu nehmen. Hilfe bekamen die ersten pflanzlichen Zellhaufen von einer nicht weniger faszinierenden Lebensform: den Pilzen. Pilze waren damals, vor knapp 500 Millionen Jahren, schon eine ganze Weile an Land unterwegs und haben sich in dieser unwirtlichen Gegend umgeschaut. Sie hatten die (physikalischen und chemischen) Tricks bereits drauf, mit denen man die nötigsten Minerale aus dem kargen Stein wringen konnte. Und sie reichten den ersten Pflanzen von Anfang an die Hand.
Heute wissen wir, dass über neunzig Prozent aller Landpflanzen in Symbiose mit Pilzen leben, die restlichen zehn Prozent haben diese Partnerschaft womöglich nachträglich gegen andere Deals eingetauscht. Kurzum (und das wird in Kapitel 4 wichtig, wenn wir über das World Wide Wurzelwerk sprechen): Pilze und Pflanzen waren wahrscheinlich seit Tag eins des »Landlebens« unzertrennlich, und ganze Stammbäume im Pilzreich werden diesem viel zu lange unbeforschten Bündnis zugeschrieben, das unter dem Namen Mykorrhiza zusammengefasst wird. Wenn wir unsere Gewächse also als Superheldinnen verstehen wollen, müssen wir dabei ihre pilzlichen Sidekicks immer mitdenken! Pflanzen ohne Mykorrhiza sind wie Batman ohne Robin, wie Frodo Beutlin ohne Samweis Gamdschie, wie Harry Potter ohne Ron Weasley und Hermine Granger.
Übrigens ging die Anpassung des Lebens auf dem Land mit der Entstehung vieler spannender Pflanzeninhaltsstoffe einher (von denen einige sogar von den Pilzen abgekupfert wurden). Pflanzen entwickelten neue Substanzen, um mit den neuen Gegebenheiten klarzukommen: Flavonoide zur Abwehr schädlicher UV-Strahlung, Sporopollenin als schützende Beschichtung ihrer Pollen, die Wachsschicht der Cuticula, um Verdunstung über die Blätter zu verringern und damit der Dehydrierung vorzubeugen. Vor allem eine Stoffgruppe namens Lignine, die zu dieser Zeit entstand, ermöglichte es den Pflanzen auf dem urzeitlichen Spielplatz, im wahrsten Sinne des Wortes über sich hinauszuwachsen. Der »Holzstoff« Lignin ist enorm wichtig zur Stabilisierung des Pflanzenkörpers und damit Voraussetzung für ein vernünftiges Höhenwachstum. Außerdem spielt er bei den heutigen Gefäßpflanzen (Tracheophyta) eine entscheidende Rolle beim Langstreckentransport von Wasser und Nährstoffen durch die namensgebenden Gefäße.
Auch architektonisch gehen viele pflanzentypische Merkmale auf die Zeit des Landgangs zurück, wie beispielsweise die Stomata (oder Spaltöffnungen), die seit mindestens 400 Millionen Jahren nachgewiesen sind. Stomata erlauben es Pflanzen, zu atmen und zu schwitzen. »Atmen« deshalb, weil sie durch die winzigen Öffnungen Gasaustausch betreiben und CO2 gegen O2 eintauschen. »Schwitzen« tun sie insofern, als sie mittels Transpiration ihren Wasserhaushalt regulieren und durch die Stomata einen kontinuierlichen Wassersog von unten nach oben durch den Pflanzenkörper aufrechterhalten. Diese kleinen und großen Anpassungen traten lang vor den ersten Blättern und Wurzeln auf und sind bis heute in allen Landpflanzen (und auch in Wasserpflanzen, die wahrscheinlich irgendwann zurück ins Meer wanderten!) zu finden. Uralte Moosarten, wie das bescheidene Blasenmützenmoos Physcomitrella patens, tragen sie ebenso wie jede Kulturpflanze mit sich herum und erlauben es uns, Mechanismen der Pflanzenevolution zu erforschen und zu verstehen.11
Die Urzeitpflanzen gingen also höchstwahrscheinlich aus den fadenförmigen Algen der Meere hervor, die sich schicksalhafte Pilzpartnerschaften suchten und neue Tricks für das Leben an Land aneigneten. Zu den ersten »richtigen« Pflanzen gehörten die Moose; das älteste Moosfossil ist rund 350 Millionen Jahre alt. Fossilien aus den ersten Tagen der Pflanzen sind rar gesät, vor allem weil es Wasser und Sedimente braucht, um organische Substanz zu versteinern. Die Flora von damals kann man sich aber ähnlich beeindruckend vorstellen wie die kurze Zeit später entstehende Dino-Welt. Die Urzeitpflanzen waren groß und stämmig und vermehrten sich über Ausläufer oder Sporen (Samen und Früchte wurden erst später erfunden). Sie überzeugten durch robusten Wuchs und wehrhafte Stacheln oder brachten gleich einen Schnorchel mit, um regelmäßige Überflutung durch die noch sehr launischen Gezeiten durchzustehen. Heute können wir anhand sogenannter lebender Fossilien erahnen, wie die Dino-Pflanzenwelt ausgesehen haben könnte: Neben Baumfarnen und Lebermoosen zählen Stechpalmen, Mammutbäume, Araukarien und Schachtelhalme zu diesen Zeitzeugen des pflanzlichen Jurassic Park – nur dass die Schachtelhalme aus der Gattung Calamites damals so groß waren wie ein fünfstöckiges Gebäude.