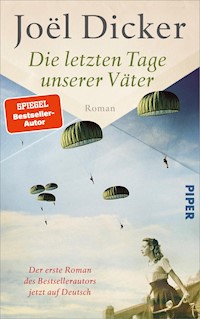0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Es ist der Aufmacher jeder Nachrichtensendung. Im Garten des hochangesehenen Schriftstellers Harry Quebert wurde eine Leiche entdeckt. Und in einer Ledertasche direkt daneben: das Originalmanuskript des Romans, mit dem er berühmt wurde. Als sich herausstellt, dass es sich bei der Leiche um die sterblichen Überreste der vor 33 Jahren verschollenen Nola handelt und Quebert auch noch zugibt, ein Verhältnis mit ihr gehabt zu haben, ist der Skandal perfekt. Quebert wird verhaftet und des Mordes angeklagt. Der einzige, der noch zu ihm hält, ist sein ehemaliger Schüler und Freund Marcus Goldman, inzwischen selbst ein erfolgreicher Schriftsteller. Überzeugt von der Unschuld seines Mentors - und auf der Suche nach einer Inspiration für seinen nächsten Roman - fährt Goldman nach Aurora und beginnt auf eigene Faust im Fall Nola zu ermitteln ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 156
Veröffentlichungsjahr: 2013
Sammlungen
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Für meine Eltern
Übersetzung aus dem Französischen von Carina von Enzenberg
Die Originalausgabe erschien 2012 unter dem Titel »La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert« bei Éditions de Fallois.
XXL-Leseprobe der vollständigen E-Book-Ausgabe der im Piper Verlag erschienenen Buchausgabe
2. Auflage 2013
ISBN 978-3-492-96460-9
© Éditions de Fallois/L’Age d’Homme, 2012 Deutschsprachige Ausgabe: © 2013 Piper Verlag GmbH, München Umschlaggestaltung: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung einer Abbildung von © corbis und eines Gemäldes von Edward Hopper, 1882–1967, Portrait of Orleans, 1950, Oil on canvas, 66 x 101,6 cm, The Fine Arts Museums of San Francisco, gift of Jerrold and June Kingsley, 1991. Datenkonvertierung: CPI – Clausen & Bosse, Leck
Der Tag des Verschwindens
Samstag, 30.August 1975
»Polizeizentrale! Sie möchten einen Notfall melden?«
»Hallo? Mein Name ist Deborah Cooper. Ich wohne in der Side Creek Lane. Ich glaube, ich habe gerade gesehen, wie ein Mädchen im Wald von einem Mann verfolgt wurde.«
»Was genau ist passiert?«
»Ich weiß es nicht! Ich habe am Fenster gestanden und in den Wald geschaut, und da habe ich dieses Mädchen gesehen, das zwischen den Bäumen entlanglief … Ein Mann war hinter der Kleinen her … Ich glaube, sie hat versucht, ihm zu entkommen.«
»Wo sind die beiden jetzt?«
»Ich … Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie sind im Wald.«
»Ich schicke sofort einen Streifenwagen zu Ihnen, Madam.«
Dieser Anruf war der Auftakt zu den Geschehnissen, die das Städtchen Aurora im Bundesstaat New Hampshire erschüttern sollten. Nola Kellergan, ein fünfzehnjähriges Mädchen aus der Gegend, verschwand an diesem Tag spurlos.
VORWORT
Oktober 2008
Dreiunddreißig Jahre nach dem Verschwinden
Das Buch war in aller Munde. Ich konnte in New York nicht mehr in Ruhe durch die Straßen schlendern oder durch den Central Park joggen, ohne dass Spaziergänger mich erkannten und ausriefen: »He, das ist Goldman! Der Schriftsteller!« Manche hefteten sich mir sogar im Laufschritt an die Fersen, um mir die Fragen zu stellen, die sie so beschäftigten: »Was Sie da in Ihrem Buch schreiben, ist das wahr? Hat Harry Quebert das wirklich getan?« In meinem Stammcafé im West Village schreckten manche Gäste nicht einmal davor zurück, sich an meinen Tisch zu setzen und mir ein Gespräch aufzudrängen: »Ich lese gerade Ihr Buch, MrGoldman. Ich kann es einfach nicht aus der Hand legen! Das erste war ja schon gut, aber das hier …! Hat man wirklich eine Million Dollar abgedrückt, damit Sie es schreiben? Wie alt sind Sie denn? Knapp dreißig? Dreißig Jahre und haben schon so viel Kohle gescheffelt!« Sogar meinen Doorman hatte ich dabei ertappt, wie er immer dann, wenn er nicht gerade die Tür aufhalten musste, die Nase in das Buch steckte, und kaum hatte er es ausgelesen, nagelte er mich vor dem Fahrstuhl fest, um mir sein Herz auszuschütten: »Das ist also mit Nola Kellergan passiert! Wie grauenhaft! Wie kann man nur so etwas tun? Sagen Sie, MrGoldman, wie ist so etwas möglich?«
Die New Yorker Society schwärmte von meinem Buch. Es war kaum zwei Wochen zuvor erschienen und versprach bereits der größte Verkaufserfolg des Jahres auf dem gesamten amerikanischen Kontinent zu werden. Alle wollten wissen, was sich im Jahr 1975 in Aurora zugetragen hatte. Überall wurde darüber berichtet: im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen. Ich war noch nicht einmal dreißig und durch dieses Buch, erst das zweite meines Lebens, zum gefragtesten Autor des Landes avanciert.
ERSTER TEIL
Die Schriftstellerkrankheit
Acht Monate vor Erscheinen des Buchs
31.
In den Abgründen des Gedächtnisses
»Das erste Kapitel, Marcus, ist entscheidend. Gefällt es den Lesern nicht, werden sie Ihr Buch nicht weiterlesen. Was für ein Einstieg schwebt Ihnen vor?«
»Keine Ahnung, Harry. Glauben Sie, ich schaffe es irgendwann?«
»Was?«
»Ein Buch zu schreiben.«
»Da bin ich mir sicher.«
Zu Beginn des Jahres 2008, also rund anderthalb Jahre nachdem ich dank meines ersten Romans zum neuen Hätschelkind der amerikanischen Literaturszene geworden war, ereilte mich eine fürchterliche Schaffenskrise, ein Syndrom, das bei Schriftstellern, die einen sofortigen, durchschlagenden Erfolg erlebt haben, offenbar nicht selten vorkommt. Die Krankheit befiel mich allerdings nicht schlagartig, sondern nistete sich ganz langsam ein. Es war, als würde mein Gehirn, einmal befallen, nach und nach einfrieren. Den ersten Symptomen schenkte ich noch keine Beachtung: Ich redete mir ein, meine Inspiration werde schon am nächsten Tag oder am übernächsten oder am überübernächsten wiederkommen. Aber die Tage, Wochen und Monate vergingen, und die Inspiration kehrte nicht zurück.
Mein Abstieg in die Hölle gliederte sich in drei Phasen. Die erste – unabdingbare Voraussetzung für jeden anständigen schwindelerregenden Fall – bestand in einem fulminanten Aufstieg: Mein erster Roman hatte sich zwei Millionen Mal verkauft und mich im Alter von achtundzwanzig Jahren auf den Rang eines Erfolgsautors katapultiert. Das war im Herbst 2006, und innerhalb weniger Wochen war ich wer. Überall war ich zu sehen: im Fernsehen, in den Zeitungen, auf den Titelseiten der Magazine. Mein Gesicht prangte in den U-Bahn-Stationen von riesigen Werbeplakaten. Selbst die gestrengsten Kritiker der großen Tageszeitungen der Ostküste waren sich einig: Der junge Marcus Goldman hatte das Zeug zum großen Schriftsteller.
Ein Buch nur, ein einziges Buch, und mir öffneten sich die Türen zu einem neuen Leben: dem der millionenschweren Jungstars. Ich zog bei meinen Eltern in Montclair, New Jersey, aus und richtete mich in einem schicken Apartment im Village ein. Ich tauschte meinen Ford aus dritter Hand gegen einen nagelneuen schwarzen Range Rover mit getönten Scheiben. Ich verkehrte fortan in feinen Restaurants und nahm die Dienste eines Literaturagenten in Anspruch, der sich um mein Zeitmanagement kümmerte und mit mir in meiner neuen Bleibe auf einem riesigen Flachbildschirm Baseball schaute. Außerdem mietete ich einen Steinwurf vom Central Park entfernt ein Büro an, in dem eine Sekretärin, die ein bisschen in mich verliebt war und auf den Vornamen Denise hörte, meine Post sichtete, mir Kaffee machte und alle wichtigen Unterlagen ablegte.
In den ersten sechs Monaten nach der Veröffentlichung des Buchs genügte es mir vollauf, die angenehmen Seiten meines neuen Daseins auszukosten. Ich schaute morgens im Büro vorbei, um die jüngsten Artikel über mich zu überfliegen und die Fanbriefe zu lesen, die täglich zu Dutzenden ins Haus flatterten und die Denise danach in dicken Ordnern abheftete. Anschließend bummelte ich selbstzufrieden und in dem Gefühl, bereits genug gearbeitet zu haben, durch die Straßen von Manhattan, in denen die Passanten zu tuscheln anfingen, wenn ich an ihnen vorbeiging. Die restliche Zeit des Tages nutzte ich, um die neuen Rechte zu genießen, die der Ruhm mir gewährte: das Recht, mir alles zu kaufen, worauf ich Lust hatte; das Recht auf eine VIP-Loge im Madison Square Garden, wenn ich mir ein Spiel der Rangers ansehen wollte; das Recht, mit Musikstars, von denen ich in jüngeren Jahren sämtliche Platten gekauft hatte, über den roten Teppich zu schreiten; das Recht, mit Lydia Gloor, der umschwärmten Hauptdarstellerin aus der derzeit angesagtesten Fernsehserie, auszugehen. Ich war ein berühmter Schriftsteller und hatte das Gefühl, den schönsten Beruf der Welt auszuüben. In der Gewissheit, dass mein Erfolg ewig währte, hatte ich die ersten Warnungen meines Agenten und meines Verlegers in den Wind geschlagen, die mich drängten, mich wieder an die Arbeit zu machen und mit meinem zweiten Roman zu beginnen.
In den nächsten sechs Monaten merkte ich, dass sich der Wind zu drehen begann: Die Fanbriefe wurden immer spärlicher, auf der Straße wurde ich immer seltener angesprochen. Schon bald konfrontierten mich die wenigen Passanten, die mich überhaupt noch erkannten, mit Fragen wie: »MrGoldman, worum geht es in Ihrem nächsten Buch? Und wann erscheint es?« Mir wurde klar, dass ich loslegen musste, und das tat ich. Ich hatte bereits Ideen auf lose Blätter notiert und Exposés in den Computer getippt, aber sie taugten nichts. Ich brachte neue Ideen hervor und verfasste neue Exposés. Wieder ohne Erfolg. Schließlich legte ich mir einen neuen Computer zu in der Hoffnung, dass er zusammen mit guten Ideen und hervorragenden Exposés verkauft würde. Fehlanzeige. Also änderte ich die Methode: Ich nahm Denise bis spätnachts in Beschlag, um ihr zu diktieren, was ich für große Sätze, Bonmots und Vorstöße zu außergewöhnlichen Romanen hielt. Doch am nächsten Tag kamen mir die Wörter abgeschmackt, die Sätze holprig und meine Vorstöße wie Rückschläge vor. Phase zwei der Krankheit hatte begonnen.
Im Herbst 2007 war seit der Herausgabe meines ersten Buchs ein Jahr vergangen, und ich hatte noch keine einzige Zeile des nächsten zu Papier gebracht. Als es keine Briefe mehr abzulegen gab, man mich in der Öffentlichkeit nicht mehr erkannte und die Plakate mit meinem Konterfei aus den großen Buchhandlungen verschwunden waren, begriff ich, dass Ruhm vergänglich ist. Er ist eine ausgehungerte Gorgo, und wer sie nicht füttert, wird rasch ersetzt: Angesagte Politiker, das Sternchen aus der jüngsten Reality-Show, eine Rockband, der gerade der Durchbruch gelungen war – sie beanspruchten nun meine Portion des öffentlichen Interesses. Dabei waren seit Erscheinen meines Buchs erst zwölf Monate vergangen, eine in meinen Augen lächerlich kurze Zeitspanne, für den Rest der Menschheit jedoch eine Ewigkeit. Im selben Jahr war allein in den USA eine Million Kinder geboren worden, eine Million Menschen war gestorben, auf gut zehntausend war geschossen worden, eine halbe Million waren drogensüchtig, eine Million zu Millionären geworden, siebzehn Millionen hatten sich ein neues Handy angeschafft, fünfzigtausend waren bei Autounfällen ums Leben gekommen und zwei Millionen bei selbigen mehr oder weniger schwer verletzt worden. Und ich, ich hatte nur ein Buch geschrieben.
Schmid & Hanson, der einflussreiche New Yorker Verlag, der mir für den ersten Roman ein hübsches Sümmchen offeriert hatte und große Hoffnungen in mich setzte, machte meinem Agenten Douglas Claren Druck, und der wiederum lag mir in den Ohren. Er sagte, die Zeit dränge, ich müsse unbedingt ein neues Manuskript vorlegen. Ich bemühte mich, ihn und damit auch mich selbst zu beruhigen, und beteuerte, dass es mit dem zweiten Roman gut voranginge und er sich keine Sorgen zu machen brauche. Doch trotz der vielen Stunden, die ich mich in meinem Büro verkroch, blieben die Seiten leer: Meine Inspiration hatte sich sang- und klanglos davongemacht, und ich fand sie beim besten Willen nicht wieder. Wenn ich abends schlaflos im Bett lag, überlegte ich mir, dass es den großen Marcus Goldman schon bald, noch vor seinem dreißigsten Geburtstag, nicht mehr geben würde. Diese Vorstellung erschreckte mich dermaßen, dass ich, um auf andere Gedanken zu kommen, Urlaub zu machen beschloss: Ich gönnte mir einen Monat in einem Luxushotel in Miami, sozusagen, um wiederaufzutanken, weil ich zutiefst davon überzeugt war, dass mir die Entspannung unter Palmen zur Wiedererlangung meines vollen kreativen Potenzials verhelfen würde. Doch Florida war natürlich nur ein herrlicher Fluchtversuch, und schon zweitausend Jahre vor mir hatte der Philosoph Seneca dieselbe leidvolle Erfahrung gemacht: Wohin man auch flieht – die Probleme mogeln sich ins Gepäck und folgen einem überallhin. Es war, als wäre mir nach der Landung in Miami ein freundlicher kubanischer Gepäckträger zum Ausgang nachgelaufen und hätte zu mir gesagt: »Sind Sie MrGoldman?«
»Ja.«
»Dann gehört das hier Ihnen.«
Und er hätte mir einen Umschlag mit einem Papierstoß darin hingehalten.
»Sind das meine leeren Seiten?«
»Ja, MrGoldman. Sie wollten New York doch wohl nicht ohne sie verlassen?«
Ich verbrachte also einen Monat allein, elend und verdrossen mit meinen Dämonen in einer Hotelsuite in Florida. Das mit »NeuerRoman.doc« benannte Dokument auf meinem Computer, der Tag und Nacht lief, blieb zu meiner Verzweiflung blank. Dass ich mir eine in Künstlerkreisen weitverbreitete Krankheit eingefangen hatte, wurde mir an dem Abend klar, an dem ich den Pianisten der Hotelbar auf eine Margarita einlud. Er erzählte mir an der Theke, dass er in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Song geschrieben habe, aber der war ein Bombenhit gewesen. Er war damit so erfolgreich gewesen, dass er nie wieder etwas hatte schreiben können, und jetzt war er total abgebrannt und unglücklich und hielt sich über Wasser, indem er für die Hotelgäste die Hits von anderen auf dem Klavier klimperte. »Früher habe ich Mordstourneen gemacht und bin in den größten Sälen des Landes aufgetreten«, erzählte er und packte mich am Hemdkragen. »Zehntausend Menschen haben meinen Namen geschrien, die Puppen sind reihenweise in Ohnmacht gefallen, und ein paar haben mir sogar ihr Höschen zugeworfen. Das war was!« Nachdem er wie ein kleiner Hund das Salz rund um sein Glas abgeleckt hatte, fügte er hinzu: »Ich schwör dir, das ist die Wahrheit.« Und das war ja gerade das Schlimme: Ich wusste, dass es stimmte.
Phase drei meines Unglücks begann mit meiner Rückkehr nach New York. Auf dem Heimflug von Miami las ich an Bord einen Artikel über einen Nachwuchsautor, von dem soeben ein von der Kritik beweihräucherter Roman erschienen war, und bei meiner Ankunft am Flughafen LaGuardia starrte mir in der Gepäckhalle von großen Plakaten sein Gesicht entgegen. Das Leben verhöhnte mich: Man vergaß mich nicht nur, sondern, schlimmer noch, man war dabei, mich zu ersetzen. Douglas, der mich am Flughafen abholte, war außer sich: Bei Schmid & Hanson war man am Ende der Geduld, man wollte einen Beweis, dass ich vorankam und imstande war, ihnen bald das fertige Manuskript zu präsentieren.
»Es sieht schlecht aus für uns«, sagte er im Auto auf der Fahrt nach Manhattan. »Sag mir, dass du in Florida Kraft getankt hast und mit deinem Buch ein gutes Stück vorangekommen bist! Da ist dieser Kerl, von dem jetzt alle reden … Sein Buch wird der große Weihnachtsknaller. Und du, Marcus? Was hast du für Weihnachten zu bieten?«
»Ich knie mich rein!«, rief ich in Panik. »Ich krieg das hin! Wir starten eine große Werbekampagne, dann klappt das schon! Die Leute haben mein erstes Buch gemocht, dann werden sie auch das nächste mögen!«
»Marc, du begreifst es nicht: Vor ein paar Monaten hätten wir das noch tun können. Das war ja gerade unsere Strategie: auf der Welle deines Erfolgs reiten, das Publikum bei Laune halten und ihm geben, was es will. Das Publikum wollte Marcus Goldman, aber da Marcus Goldman sich in Florida auf die faule Haut gelegt hat, haben die Leser sich das Buch von einem anderen gekauft. Verstehst du was von Wirtschaft, Marc? Bücher sind ein austauschbares Produkt geworden. Die Leute wollen ein Buch, das ihnen gefällt, sie ablenkt und unterhält. Und wenn du ihnen das nicht lieferst, tut es dein Nachbar, und du bist abgemeldet.«
Douglas’ Orakelsprüche hatten mir einen gehörigen Schrecken eingejagt, und ich stürzte mich in die Arbeit: Ich fing um sechs Uhr morgens an und hörte nicht vor neun oder zehn Uhr abends auf. Im Rausch der Verzweiflung verbrachte ich ganze Tage in meinem Büro, schrieb ohne Unterlass, saugte mir Wörter aus den Fingern, reihte Satz um Satz aneinander und sammelte Einfälle für meinen Roman. Doch zu meinem größten Leidwesen kam nichts Brauchbares dabei heraus. Denise verbrachte ihrerseits die Tage damit, sich Sorgen um meinen Zustand zu machen. Da sie nichts mehr zu tun hatte – kein Diktat, das sie aufnehmen, keine Post, die sie durchsehen, keinen Kaffee, den sie kochen musste –, tigerte sie im Gang auf und ab, und wenn sie es nicht mehr aushielt, trommelte sie an meine Tür.
»Ich flehe Sie an, Marcus, machen Sie auf!«, jammerte sie. »Kommen Sie aus Ihrem Büro, und gehen Sie ein bisschen im Park spazieren. Sie haben heute noch nichts gegessen!«
Ich schrie zurück: »Ich habe keinen Hunger! Kein Buch, kein Essen!«
Sie fing fast an zu schluchzen. »Sagen Sie nicht so schreckliche Sachen, Marcus. Ich gehe zum Deli an der Ecke und hole Ihnen Roastbeefsandwiches, die mögen Sie doch. Ich beeile mich! Bin gleich wieder da!«
Ich hörte, wie sie sich ihre Handtasche schnappte, zur Wohnungstür lief und gleich darauf die Treppe hinunterstürmte, als könnte ihre Eile etwas an meiner Situation ändern. Ich hatte endlich erkannt, woran ich so litt: Aus dem Nichts heraus ein Buch zu schreiben war mir leichtgefallen. Aber jetzt, wo ich mich auf dem Gipfel des Ruhms befand, jetzt, wo ich meinem Talent gerecht werden und noch einmal den beschwerlichen Marsch zum Erfolg antreten sollte – denn nichts anderes ist das Verfassen eines guten Romans –, fühlte ich mich der Sache nicht mehr gewachsen. Die Schriftstellerkrankheit hatte mich erwischt, und niemand konnte mir helfen: Alle, mit denen ich darüber redete, meinten, das sei Kinderkram und bestimmt normal, und wenn ich mein Buch nicht heute schriebe, dann eben morgen. Ich versuchte, bei meinen Eltern in Montclair zwei Tage am Stück in meinem alten Zimmer zu arbeiten, in demselben Zimmer, in dem ich zu meinem ersten Roman inspiriert worden war. Aber dieser Versuch scheiterte kläglich, woran meine Mutter vielleicht nicht unschuldig war, denn sie saß beide Tage neben mir und wiederholte, den Blick fest auf den Bildschirm meines Notebooks geheftet, immer wieder: »Das ist sehr gut, Markie.«
»Mama, ich habe nicht eine Zeile geschrieben«, sagte ich irgendwann.
»Aber ich spüre, dass es gut wird.«
»Mama, wenn du mich eine Weile allein lassen könntest …«
»Allein lassen? Warum? Hast du Blähungen? Musst du furzen? Du kannst in meiner Gegenwart furzen, mein Schatz. Ich bin deine Mutter.«
»Nein, ich muss nicht furzen, Mama.«
»Bist du hungrig? Hast du Lust auf Pancakes? Waffeln? Etwas Herzhaftes? Eier vielleicht?«
»Nein, ich bin nicht hungrig.«
»Warum soll ich dich dann allein lassen? Willst du damit sagen, dass dich die Anwesenheit der Frau stört, die dir das Leben geschenkt hat?«
»Nein, du störst mich nicht, aber …«
»Aber was?«
»Nichts, Mama.«
»Was du brauchst, ist eine Freundin, Markie. Glaubst du etwa, ich wüsste nicht, dass du dich von dieser Schauspielerin aus dem Fernsehen getrennt hast? Wie hieß sie noch?«
»Lydia Gloor. Wir waren nicht richtig zusammen, Mama. Ich meine, es war nur eine Affäre.«
»Nur eine Affäre, nur eine Affäre! So halten das die jungen Leute heutzutage: immer nur Affären, und mit fünfzig haben sie eine Glatze und stehen ohne Familie da!«
»Was hat die Glatze damit zu tun, Mama?«
Ende der Leseprobe