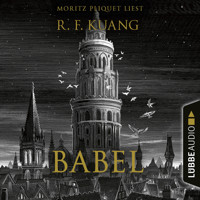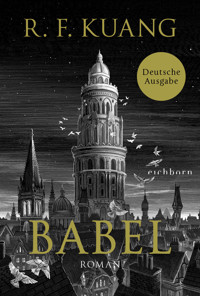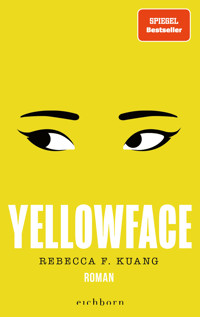
13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Eichborn
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Krimi, Satire, Paranoia, heiße Debatten. Vor allem aber eine absolut großartige Geschichte.« STEPHEN KING
»Ich habe dieses Buch wahrscheinlich schneller verschlungen als alles, was ich in diesem Jahr gelesen habe.« ANTHONY CUMMINS, THE GUARDIAN
June Hayward und Athena Liu könnten beide aufstrebende Stars der Literaturszene sein. Doch während die chinesisch-amerikanische Autorin Athena für ihre Romane gefeiert wird, fristet June ein Dasein im Abseits. Niemand interessiert sich für Geschichten "ganz normaler" weißer Mädchen, so sieht es June zumindest.
Als June Zeugin wird, wie Athena bei einem Unfall stirbt, stiehlt sie im Affekt Athenas neuestes, gerade vollendetes Manuskript, einen Roman über die Heldentaten chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs.
June überarbeitet das Werk und veröffentlicht es unter ihrem neuen Künstlernamen Juniper Song. Denn verdient es dieses Stück Geschichte nicht, erzählt zu werden, und zwar egal von wem? Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten. Und herausfinden, wie weit sie dafür gehen will.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 448
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Inhalt
CoverÜber dieses BuchÜber die AutorinTitelImpressumWidmungEINSZWEIDREIVIERFÜNFSECHSSIEBENACHTNEUNZEHNELFZWÖLFDREIZEHNVIERZEHNFÜNFZEHNSECHZEHNSIEBZEHNACHTZEHNNEUNZEHNZWANZIGEINUNDZWANZIGZWEIUNDZWANZIGDREIUNDZWANZIGVIERUNDZWANZIGDANKSAGUNGÜber dieses Buch
June Hayward und Athena Liu könnten beide aufstrebende Stars der Literaturszene sein. Doch während die chinesisch-amerikanische Autorin Athena für ihre Romane gefeiert wird, fristet June ein Dasein im Abseits. Niemand interessiert sich für Geschichten »ganz normaler« weißer Mädchen, so sieht es June zumindest. Als June Zeugin wird, wie Athena bei einem Unfall stirbt, stiehlt sie im Affekt Athenas neuestes, gerade vollendetes Manuskript, einen Roman über die Heldentaten chinesischer Arbeiter während des Ersten Weltkriegs. June überarbeitet das Werk und veröffentlicht es unter ihrem neuen Künstlernamen Juniper Song. Denn verdient es dieses Stück Geschichte nicht, erzählt zu werden, und zwar egal von wem? Aber nun muss June ihr Geheimnis hüten. Und herausfinden, wie weit sie dafür gehen will.
Über die Autorin
Rebecca F. Kuang ist New York Times-Bestsellerautorin und für den Hugo, Nebula, Locus und World Fantasy Award nominierte Autorin. Sie ist Marshall-Stipendiatin, Übersetzerin und hat einen Philologie-Master in Chinastudien der Universität Cambridge und einen Soziologie-Master in zeitgenössischen Chinastudien der Universität Oxford. Zurzeit promoviert sie in Yale in ostasiatischen Sprachen und Literatur.
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Eichborn Verlag
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »Yellowface«
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2023 by Rebecca Kuang
Published by arrangement with Rebecca F. Kuang
Dieses Werk wurde vermittelt durch dieLiterarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2024 by Bastei Lübbe AG,Schanzenstraße 6 – 20, 51063 Köln
Vervielfältigungen dieses Werkes für dasText- und Data-Mining bleiben vorbehalten.
Textredaktion: Helen Heidkamp
Umschlaggestaltung: Manuela Staedele-Monverde nach einem Originalentwurf von Ellie Game © HarperCollinsPublishers Ltd
Covermotiv: Elena Abrazhevich / Shutterstock.com
Herstellung: Theresa von Zepelin
eBook-Produktion: hanseatenSatz-bremen, Bremen
ISBN 978-3-7517-5563-4
eichborn.de
Für Eric und Janette
EINS
In der Nacht, in der ich Athena Liu sterben sehe, feiern wir ihren Vertrag mit Netflix.
Bevor ich beginne, solltet ihr zwei Dinge über Athena wissen, damit diese Geschichte Sinn ergibt.
Erstens hat sie alles: einen Mehrbuchvertrag mit einem großen Verlag, den sie unmittelbar nach dem College unterschrieb, einen Master of Fine Arts von einem berühmten Schreibprogramm, einen Lebenslauf voller namhafter Künstlerresidenzen und eine Liste mit Preisnominierungen, die länger ist als mein Einkaufszettel. Mit siebenundzwanzig Jahren hat sie drei Romane veröffentlicht, von denen jeder erfolgreicher war als der vorherige. Für Athena war der Deal mit Netflix kein lebensveränderndes Ereignis, sondern bloß eine weitere Trophäe für ihre Sammlung, einer der vielen netten Nebeneffekte auf ihrer rasanten Reise zu literarischem Weltruhm.
Zweitens, und womöglich als Folge von Punkt eins, will kaum jemand mit ihr befreundet sein. Schreibende in unserem Alter – junge, ambitionierte Talente Anfang dreißig – treten oft im Rudel auf. In den sozialen Medien kann man sie gut beobachten – sie schwärmen von den unveröffentlichten Manuskripten der anderen (DIESEGESCHICHTEMACHTMICHFERTIG!), kreischen beim Anblick neuer Buchcover (ESISTSOWUNDERSCHÖN, ICHSTERBE!!!) und posten Selfies von literarischen Gruppentreffen, die rund um den Erdball stattfinden. Doch auf Athenas Instagram-Fotos ist niemand anderes zu sehen. Sie twittert regelmäßige Updates zu ihrer Karriere und teilt schräge Witze mit ihren siebzigtausend Follower:innen, aber sie erwähnt nur selten andere Leute in ihren Posts. Sie betreibt kein Namedropping, schreibt keine Blurbs, empfiehlt nie Bücher von Kolleg:innen und zeigt sich nicht öffentlich in Begleitung, wie es viele junge Autor:innen zu Beginn ihrer Karriere auf so demonstrative, verzweifelte Art tun. Seit ich sie kenne, hat sie nie auf irgendwelche engen Freund:innen Bezug genommen, außer auf mich.
Lange dachte ich, sie wäre einfach unnahbar. Athena ist so irrsinnig erfolgreich, da leuchtet es ein, dass sie sich nicht mit Normalsterblichen umgeben will. Athena chattet vermutlich nur mit Leuten, die ein blaues Häkchen haben und mit anderen Bestseller-Autor:innen, die sie mit ihren abgehobenen Beobachtungen zur modernen Gesellschaft bei Laune halten können. Athena hat keine Zeit, um sich mit dem Proletariat anzufreunden.
Doch in den letzten Jahren habe ich eine weitere Theorie entwickelt, nämlich dass alle anderen sie genauso unerträglich finden wie ich. Schließlich ist es schwer, mit jemandem befreundet zu sein, der dich bei jeder Gelegenheit aussticht. Vermutlich mag niemand Athena, weil niemand das Gefühl mag, im Vergleich mit ihr ständig den Kürzeren zu ziehen. Vermutlich stehe ich zu ihr, weil ich so armselig bin.
An diesem Abend ist Athena also nur mit mir in einer lauten, überteuerten Rooftop-Bar in Georgetown. Sie kippt die Cocktails in sich rein, als müsse sie beweisen, dass sie Spaß hat, und ich trinke, um die Bitch in mir zu betäuben, die sich wünscht, sie wäre tot.
Athena und ich sind lediglich aufgrund von äußeren Umständen Freundinnen geworden. Während unseres ersten Studienjahrs in Yale wohnten wir auf derselben Etage, und da wir beide schon immer wussten, dass wir Schriftstellerinnen werden wollten, fanden wir uns in denselben Schreibseminaren wieder. Anfangs veröffentlichten wir beide Kurzgeschichten in denselben Literaturzeitschriften, und einige Jahre nach dem Abschluss zogen wir in dieselbe Stadt – Athena wegen einer renommierten Stelle an der Georgetown University, wo man Gerüchten zufolge so beeindruckt von einer Gastvorlesung war, die sie an der American University gehalten hatte, dass das Englisch-Institut eigens für sie eine Stelle im Bereich Kreatives Schreiben schuf, und ich, weil der Cousine meiner Mutter eine Eigentumswohnung in Rosslyn gehörte, die sie mir zum Preis der Nebenkosten vermietete, solange ich die Pflanzen goss. Wir hatten nie so etwas wie eine Seelenverwandtschaft oder irgendein tiefgreifendes, verbindendes Trauma erlebt – wir machten bloß immer dieselben Sachen an demselben Ort, sodass es praktisch schien, miteinander befreundet zu sein.
Doch obwohl für uns alles am selben Ort begann – im Einführungsseminar zu Kurzprosa von Professorin Natalia Gaines –, entwickelten sich unsere Karrieren nach dem Abschluss in vollkommen unterschiedliche Richtungen.
Ich schrieb meinen ersten Roman in einem Anflug von Inspiration, während ich mich in meinem Job als Aushilfslehrerin fast zu Tode langweilte. Ich kam jeden Abend von der Arbeit nach Hause und feilte sorgfältig an der Geschichte, die ich seit meiner Kindheit hatte erzählen wollen: Es war ein detailreicher und dezent magischer Coming-of-Age-Roman über Trauer, Verlust und Schwesternschaft mit dem Titel Jenseits der Bäume. Nachdem ich erfolglos bei knapp fünfzig Literaturagenturen angefragt hatte, wurde das Buch von einem kleinen Verlag namens Evermoreeingekauft, der öffentlich zur Einsendung von Manuskripten aufgerufen hatte. Der Vorschuss kam mir damals absurd hoch vor – zehntausend Dollar im Voraus und die Chance auf Tantiemen, sobald der Roman genügend Geld einspielte –, doch das war, bevor ich erfuhr, dass Athena eine sechsstellige Summe für ihr Debüt bei Penguin Random House bekam.
Drei Monate bevor mein Buch in den Druck gehen sollte, meldete Evermore Insolvenz an. Die Rechte fielen an mich zurück. Wie durch ein Wunder verkaufte meine Agentin – die mich nach Evermores Angebot unter Vertrag genommen hatte – die Rechte für einen Vorschuss von zwanzigtausend Dollar an eines der fünf großen Verlagshäuser – ein »netter Deal«, wie es in der Bekanntgabe auf Publishers Marketplace hieß. Es sah so aus, als hätte ich es endlich geschafft, als würden all meine Träume von Ruhm und Erfolg bald Wirklichkeit werden, bis der Erscheinungstermin immer näher rückte und die erste Auflage von zehntausend Exemplaren auf fünftausend reduziert wurde, man meine Lesereise von sechs Städten auf drei Städte in der Region Washington, D. C., Maryland und Virginia einstampfte und die versprochenen Zitate von berühmten Autor:innen ausblieben. Es gab keine zweite Auflage. Ich verkaufte insgesamt zwei-, vielleicht dreitausend Bücher. Meine Lektorin wurde entlassen, weil es einen dieser Engpässe im Verlagswesen gab, die immer entstehen, wenn es mit der Wirtschaft abwärtsgeht, und ich wurde an einen Typen namens Garrett weitergereicht, der bisher so wenig Interesse an meinem Roman gezeigt hat, dass ich mich oft frage, ob er mich womöglich schon komplett vergessen hat.
Aber das ist ganz normal, habe ich mir sagen lassen. Jeder hat eine beschissene Debüt-Erfahrung. Die Verlage sind eben so. Es herrscht immer Chaos in New York, die Lektorate und Presseabteilungen sind überarbeitet und unterbezahlt, und es wird ständig Mist gebaut. Das Gras auf der anderen Seite ist nie grüner. Alle Autor:innen hassen ihre Verlage. Es gibt keine Cinderella-Geschichten, nur harte Arbeit, Durchhaltevermögen und das ewige Streben nach dem goldenen Ticket.
Warum also werden einige Leute beim ersten Versuch gleich in die Welt der Stars katapultiert? Sechs Monate bevor Athenas Debütroman erschien, bekam sie eine große, sexy Fotostrecke in einer viel gelesenen Branchenzeitschrift mit der Überschrift »Literarisches Wunderkind erzählt wichtige Geschichten des asiatisch-amerikanischen Erbes«. Sie verkaufte die Rechte in dreißig Länder. Ihr Debüt wurde von Kritiker:innen des New Yorker und der New York Times mit großem Tamtam gefeiert, und es hielt sich wochenlang in den oberen Rängen jeder Bestsellerliste. Die kommende Saison der Literaturpreise war ein Selbstläufer. Athenas Debüt Stimme und Echo – über ein chinesisch-amerikanisches Mädchen, das die Geister aller verstorbenen Frauen in ihrer Familie heraufbeschwören kann – ist einer dieser seltenen Romane, der fantastische Elemente auf vollkommene Weise mit Unterhaltungsliteratur verbindet, weshalb sie Nominierungen für den Booker Prize, den Nebula Award, den Hugo Award und den World Fantasy Award erhielt und letztendlich zwei davon gewann. Und das ist erst drei Jahre her. Seitdem hat sie zwei weitere Bücher veröffentlicht und die Kritiker:innen sind sich einig, dass sie von Roman zu Roman besser wird.
Es ist nicht so, als hätte Athena kein Talent. Sie ist eine verdammt gute Autorin – ich habe alles von ihr gelesen, und ich bin nicht zu verblendet, um gute Prosa zu erkennen, wenn ich sie sehe. Doch Athenas Star-Power hat ganz offensichtlich nichts mit ihrem Schreibtalent zu tun. Es geht um sie. Athena Liu ist, kurz gesagt, fucking cool. Sogar ihr Name – Athena Ling En Liu – klingt cool. Gut gemacht Mr und Mrs Liu, eine perfekte Kombination aus klassisch und exotisch. Geboren in Hongkong, aufgewachsen zwischen Sydney und New York, ausgebildet in britischen Internaten, wo sie sich einen vornehmen, undefinierbaren Akzent aneignete; groß und feingliedrig, anmutig wie es alle ehemaligen Balletttänzerinnen sind, mit einer zarten Blässe und riesigen, von langen Wimpern eingerahmten braunen Augen, mit denen sie aussieht wie eine chinesische Anne Hathaway (es ist nicht rassistisch, wenn ich das sage – Athena hat selbst einmal ein Selfie mit »Annie« von einem roten Teppich gepostet, die großen Rehaugen der beiden dicht nebeneinander, mit der schlichten Bildunterschrift Zwillinge!).
Sie ist unglaublich. Sie ist im wahrsten Sinne unglaublich.
Natürlich fliegen Athena alle guten Dinge zu, denn so läuft es in dieser Branche. Der Literaturbetrieb sucht sich einen Gewinner oder eine Gewinnerin aus – attraktiv genug, cool und jung und, mal ehrlich, wir denken es doch alle, also sprechen wir es doch aus, »divers« genug – und überschüttet diese Person mit Geld und Unterstützung. Es ist so verdammt willkürlich. Oder vielleicht nicht willkürlich, aber es hängt von Faktoren ab, die nichts mit der Qualität des eigenen Schreibens zu tun haben. Athena – eine wunderschöne, internationale, potenziell queere Woman of Color mit Yale-Abschluss – wurde von der höheren Macht auserwählt. Ich hingegen bin nur June Hayward aus Philly, braune Augen, braune Haare – und ganz egal wie hart ich arbeite oder wie gut ich schreibe, ich werde niemals Athena Liu sein.
Ich hatte erwartet, dass sie inzwischen in ganz anderen Sphären unterwegs sein würde. Aber sie schickt immer noch freundliche Textnachrichten – Wie läuft’s heute mit dem Schreiben? Tagesziel schon erreicht? Viel Glück mit der Deadline! – und Einladungen: Margaritas zur Happy Hour im El Centro, Brunch im Zaytinya, ein Poetry Slam in der U Street. Uns verbindet eine dieser oberflächlichen Freundschaften, in denen man es schafft, viel Zeit miteinander zu verbringen, ohne sich wirklich kennenzulernen. Ich weiß immer noch nicht, ob sie Geschwister hat. Sie wollte nie etwas über meine Partner wissen. Aber wir hängen trotzdem zusammen rum, weil es so praktisch ist, dass wir beide in Washington, D. C. wohnen, und weil es sich immer schwieriger gestaltet, neue Freundschaften zu schließen, je älter man wird.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum Athena mich mag. Sie umarmt mich immer, wenn wir uns sehen. Sie likt pro Woche mindestens zwei meiner Beiträge in den sozialen Medien. Wir gehen mindestens alle zwei Monate etwas trinken, und meistens ist sie diejenige, die fragt. Doch ich habe keine Ahnung, was sie sich davon erhofft, ich habe nicht annähernd genug Einfluss, bin nicht beliebt oder vernetzt genug, damit sich die Zeit mit mir lohnen würde.
Tief im Innern habe ich immer vermutet, dass Athena mich gern um sich hat, gerade weil ich keine Konkurrenz für sie darstelle. Ich verstehe ihre Welt, aber ich bin keine Bedrohung, und ihre Erfolge sind so unerreichbar für mich, dass sie sich nicht schlecht fühlen muss, wenn sie mir freudestrahlend von ihrem Glück erzählt. Hätten wir nicht alle gern eine Freundin, die unsere Überlegenheit niemals in Frage stellen würde, weil sie weiß, dass sie damit auf verlorenem Posten stünde? Brauchen wir nicht alle jemanden, den wir als Blitzableiter benutzen können?
»So schlimm kann es doch nicht sein«, sagt Athena. »Die wollen das Taschenbuch bestimmt nur ein paar Monate nach hinten verschieben.«
»Es wird nicht verschoben«, sage ich. »Es wird gestrichen. Brett sagt, dass sie einfach … keinen freien Termin für den Druck gefunden haben.«
Sie tätschelt meine Schulter. »Ach, mach dir keine Sorgen. Für das Hardcover bekommt man eh mehr Tantiemen. Hat auch alles sein Gutes, oder?«
Ganz schön frech einfach anzunehmen, dass ich überhaupt Tantiemen bekomme. Das spreche ich nicht laut aus. Wenn man Athena darauf hinweist, dass sie taktlos war, fängt sie an, sich auf übertriebene Weise zu entschuldigen, und es fällt mir schwerer, damit umzugehen, als meine Gereiztheit einfach runterzuschlucken.
Wir sind in der Graham’s Rooftop-Bar, sitzen auf einem kleinen Sofa und schauen in den Sonnenuntergang. Athena schlürft ihren zweiten Whiskey Sour, und ich trinke mein drittes Glas Pinot noir. Wir sind inzwischen bei dem leidigen Thema meiner Verlagsprobleme angekommen, und ich bereue es schon jetzt, denn mit jedem Wort, das Athena für tröstlich oder hilfreich hält, streut sie eigentlich bloß Salz in die Wunde.
»Ich will es mir mit Garrett nicht verscherzen«, sage ich. »Na ja, wenn ich ehrlich bin, glaube ich, dass er sich schon darauf freut, das Vorkaufsrecht abzulehnen, damit die mich los sind.«
»Ach was, stell dein Licht nicht unter den Scheffel«, sagt Athena. »Er hat dein Debüt eingekauft, oder etwa nicht?«
»Hat er eben nicht«, sage ich. Ich muss Athena jedes Mal wieder daran erinnern. Sie hat ein Gedächtnis wie ein Sieb, wenn es um meine Probleme geht – man muss alles zwei oder drei Mal wiederholen, damit irgendetwas hängenbleibt. »Die Lektorin, die es eingekauft hat, wurde entlassen, und dann wurde es auf ihn abgewälzt, und immer wenn wir darüber sprechen, wirkt er total desinteressiert.«
»Tja, dann scheiß auf ihn«, sagt Athena fröhlich. »Noch eine Runde?«
Die Drinks sind übertrieben teuer in diesem Laden, aber das ist okay, denn Athena zahlt. Athena zahlt immer; mittlerweile biete ich es gar nicht mehr an. Ich glaube, Athena hat das Konzept von »teuer« und »günstig« nie richtig verstanden. Für sie ging es von Yale zu einem komplett finanzierten Masterstudium zu mehreren hunderttausend Dollar auf dem Konto. Als ich ihr einmal erzählte, dass das Einstiegsgehalt für Verlagsjobs in New York nur etwa fünfunddreißigtausend Dollar im Jahr beträgt, schaute sie mich mit großen Augen an und fragte, »Ist das viel?«.
»Ich nehme einen Malbec«, sage ich. Ein Glas kostet neunzehn Dollar.
»Alles klar, Süße.« Athena steht auf und flaniert zur Bar. Der Barkeeper lächelt sie an, und sie macht ein überraschtes Gesicht, ehe sie sich die Hände vor den Mund schlägt, als wäre sie Shirley Temple. Offenbar hat ein Mann am Tresen ihr ein Glas Champagner zukommen lassen. »Ja, wir feiern tatsächlich.« Ihr zartes, entzücktes Lachen schwebt über der Musik. »Aber kann ich bitte auch ein Glas für meine Freundin bekommen? Das zahle ich.«
Mir spendiert hier niemand Champagner. Aber das ist typisch. Athena wird mit Aufmerksamkeit überschüttet, wenn wir ausgehen – wenn nicht von eifrigen Leser:innen, die ein Selfie oder ein Autogramm wollen, dann sowohl von Männern als auch von Frauen, die sie hinreißend finden. Ich hingegen bin unsichtbar.
»Also.« Athena macht es sich wieder neben mir bequem und reicht mir mein Glas. »Willst du wissen, wie das Meeting mit Netflix lief? Oh mein Gott, Junie, es war der Wahnsinn. Ich habe den Typen kennengelernt, der Tiger King produziert hat. Tiger King!«
Freu dich für sie, sage ich zu mir selbst. Freu dich einfach für sie, und lass ihr diesen Abend.
Neid wird immer als dieses spitze, grüne, giftige Ding beschrieben. Unbegründet, essigsauer, gemein. Aber ich habe festgestellt, dass sich Neid für Autor:innen eher anfühlt wie Angst. Neid ist mein rasender Herzschlag, wenn ich Neuigkeiten über Athenas Erfolg auf Twitter sehe – ein weiterer Buchvertrag, Preisnominierungen, Sonderausgaben, Lizenzverträge. Neid bedeutet, mich ständig mit ihr zu vergleichen und dabei schlecht wegzukommen; Panik, dass ich nicht gut genug oder schnell genug schreibe, dass ich nicht genug bin und es nie sein werde. Neid bedeutet von Athenas sechsstelligem Optionsvertrag mit Netflix zu erfahren und deswegen tagelang kopflos durch die Gegend zu laufen, unfähig mich auf meine eigene Arbeit zu konzentrieren, eingefroren in Scham und Selbstekel, wann immer ich eines ihrer Bücher im Schaufenster einer Buchhandlung stehen sehe.
Alle Autor:innen, die ich kenne, sind mit dem Gefühl vertraut. Schreiben ist so eine einsame Tätigkeit. Du hast keine Gewissheit, ob deine Arbeit irgendeinen Wert hat, und jedes Indiz dafür, dass du den Anschluss verlierst, stürzt dich in den Abgrund der Verzweiflung. Augen auf das eigene Blatt, sagen sie. Aber das ist schwer, wenn die Blätter aller anderen dir ständig vor der Nase herumflattern. Allerdings spüre ich auch die bösartige Variante des Neids, wenn ich höre, wie sehr Athena ihre Lektorin vergöttert, ein literarisches Kraftpaket namens Marlena Ng, die »mich aus der Anonymität befreit hat« und die »wirklich versteht, was ich auf künstlerischer Ebene zu schaffen versuche, weißt du?«. Ich starre in Athenas braune Augen, eingerahmt von diesen aberwitzig langen Wimpern, die mich an Waldtiere in Disneyfilmen erinnern, und ich frage mich, Wie fühlt es sich an, du zu sein? Wie fühlt es sich an, so unglaublich perfekt zu sein und alle guten Dinge dieser Welt zu haben? Und vielleicht ist es der Alkohol, oder es ist meine wilde Autorinnen-Fantasie, aber ich spüre einen glühenden Knoten im Magen, den bizarren Drang, meine Finger in ihren himbeerrot bemalten Mund zu stecken und ihr Gesicht zu zerreißen, ihr die Haut vom Körper zu schälen, wie von einer Orange und sie mir selbst überzustreifen.
»Und sie versteht mich einfach, es ist, als würde sie Sex mit meinen Worten haben. Sowas wie Gedankensex.« Athena kichert und zieht dann niedlich die Nase kraus. Ich unterdrücke den Impuls, ihr eine zu verpassen. »Hast du dir die Überarbeitung schon mal als Sex mit deinem Lektor vorgestellt? So als würde man gemeinsam ein großes, literarisches Baby zeugen?«
Sie ist betrunken, das wird mir jetzt klar. Zweieinhalb Drinks, und sie ist voll; sie hat schon wieder vergessen, dass ich meinen Lektor hasse.
Athena verträgt nicht viel. Das habe ich eine Woche nach Studienbeginn auf einer Hausparty eines älteren Studenten in East Rock gemerkt, bei der ich ihre Haare hochhielt, während sie in eine Toilette kotzte. Sie hat einen ausgefallenen Geschmack; sie liebt es, mit ihrem Wissen über Scotch anzugeben (sie sagt dazu immer nur »Whisky« und manchmal »Whisky aus den Highlands«), aber kaum hat sie etwas getrunken, sind ihre Wangen schon knallrot, und die Sätze werden immer länger. Athena liebt es, sich zu betrinken, und die betrunkene Athena ist jedes Mal selbstherrlich und dramatisch.
Dieses Verhalten ist mir zum ersten Mal bei der Comic-Con in San Diego aufgefallen. Wir saßen an einem großen Tisch in der Hotelbar, und sie lachte zu laut, ihre Wangen leuchteten rot, während die Typen neben ihr, von denen einer wenig später auf Twitter als notorisch übergriffig geoutet wurde, begeistert auf ihre Brüste glotzten. »Oh mein Gott«, sagte sie immer wieder. »Ich bin noch nicht bereit dafür. Das wird mir alles um die Ohren fliegen. Ich bin noch nicht so weit. Glaubt ihr, die hassen mich? Glaubt ihr, alle hassen mich insgeheim und es sagt mir bloß keiner? Würdet ihr es mir sagen, wenn ihr mich hassen würdet?«
»Ach was«, versicherten die Männer und tätschelten ihr die Hand. »Niemand könnte dich jemals hassen.«
Ich war immer davon ausgegangen, dass das eine Masche war, um Aufmerksamkeit zu bekommen, aber sie benimmt sich auch so, wenn wir nur zu zweit sind. Sie wird dann so verletzlich. Sie hört sich an, als könnte sie jeden Moment in Tränen ausbrechen oder als würde sie tapfer Geheimnisse offenbaren, die sie noch keiner Menschenseele anvertraut hat. Das Ganze ist schwer zu ertragen. Es hat etwas Verzweifeltes, und ich weiß nicht, welche Vorstellung mir mehr Angst macht – dass sie manipulativ genug ist, um so eine Nummer abzuziehen, oder dass alles, was sie sagt, wahr sein könnte.
Trotz der lauten Musik und der vibrierenden Bässe ist es im Graham wie ausgestorben – kein Wunder, es ist Mittwochabend. Zwei Männer wollen Athena ihre Nummer geben, doch sie winkt ab. Wir sind die einzigen Frauen hier. Die Dachterrasse kommt uns plötzlich beklemmend vor, also trinken wir aus und gehen. Einigermaßen erleichtert denke ich, dass der Abend jetzt endet – aber dann lädt Athena mich zu sich ein, ihre Wohnung liegt nur eine kurze Fahrt mit dem Uber entfernt, in der Nähe von Dupont Circle.
»Komm schon«, sagt sie. »Ich habe einen fabelhaften Whisky für genau diesen Abend aufgehoben – den musst du probieren.«
Ich bin müde, und ich habe schlechte Laune – Neid fühlt sich noch schlimmer an, wenn man betrunken ist –, aber ich will sehen, wie sie wohnt, also sage ich ja.
Ihre Wohnung ist wirklich verdammt schön. Ich wusste, dass Athena reich ist – Bestseller lohnen sich eben –, mir war jedoch nicht klar, wie reich, bis wir ihre Wohnung mit zwei Schlafzimmern – ein Zimmer zum Schlafen, eines zum Schreiben – im neunten Stock betreten, in der sie allein lebt. Ich sehe hohe Decken, glänzendes Parkett, bodentiefe Fenster und einen Eckbalkon. Sie hat die Zimmer in dem allgegenwärtigen Influencer:innen-Stil dekoriert, der minimalistisch ist, aber nach viel Geld aussieht: glatte Holzmöbel, sparsam bestückte Bücherregale und saubere, einfarbige Teppiche. Sogar die Zimmerpflanzen sehen teuer aus. Ein Luftbefeuchter zischt unter ihren Calatheas.
»Also, Whisky? Oder was weniger Starkes?« Athena zeigt auf ihren Weinkühlschrank. Sie hat einen verdammten Weinkühlschrank. »Riesling? Ich habe auch einen herrlichen Sauvignon blanc, außer du willst lieber bei Rotwein bleiben –«
»Whisky«, sage ich, weil ich diesen Abend nur überstehe, wenn ich so betrunken wie möglich bin.
»Pur, on the rocks oder als Old Fashioned?«
Ich habe keine Ahnung, wie man Whisky trinkt. »Ähm, ich nehm dasselbe wie du.«
»Dann also Old Fashioned.« Sie flitzt in die Küche. Einen Moment später höre ich Schranktüren und Geschirrgeklapper. Wer hätte gedacht, dass ein Old Fashioned so aufwendig ist?
»Ich habe diesen großartigen, achtzehn Jahre alten WhistlePig«, ruft sie. »Der ist total geschmeidig, wie eine Mischung aus Toffee und schwarzem Pfeffer – du wirst gleich sehen, was ich meine.«
»Okay«, rufe ich zurück. »Klingt toll.«
Es dauert eine Weile, und ich muss dringend aufs Klo, also mache ich mich auf die Suche nach dem Badezimmer. Ich frage mich, was mich dort erwartet. Vielleicht ein schicker Aroma-Diffuser. Vielleicht ein Korb voller Vagina-Jadesteine.
Ich bemerke, dass die Tür zu ihrem Schreibzimmer weit offen steht. Es ist ein wunderschöner Raum; ich kann nicht anders als einen Blick hineinzuwerfen. Ich erinnere mich, ihn schon auf ihren Fotos bei Instagram gesehen zu haben – ihren »Palast der Kreativität«, wie sie ihn nennt. Sie hat einen großen Mahagoni-Schreibtisch mit geschwungenen Beinen vor einem Fenster, das mit Spitzenvorhängen im viktorianischen Stil eingerahmt ist. Auf dem Tisch steht ihre geliebte schwarze Schreibmaschine.
Richtig. Athena benutzt eine Schreibmaschine. Keine gespeicherten Word-Dokumente, kein Google Docs, kein Scrivener: nur Kritzeleien in Moleskine-Notizbüchern, die zu Kurzfassungen auf Klebezetteln und dann zu vollständigen Entwürfen auf ihrer Remington werden. Es zwinge sie, sich auf die Satzebene zu konzentrieren, behauptet sie. (Sie hat diese Antwort in so vielen Interviews gegeben, dass ich sie quasi auswendig kann.) Sonst verarbeite sie ganze Absätze auf einmal und könne die Bäume vor lauter Wald nicht mehr sehen.
Jetzt mal ehrlich. Wer redet denn so? Wer denkt denn so?
Es gibt diese hässlichen, überteuerten elektrischen Schreibmaschinen für Autor:innen, die keinen Absatz schreiben können, ohne die Konzentration zu verlieren und Twitter zu öffnen. Aber die hasst Athena; sie benutzt eine klassische Schreibmaschine, ein klobiges Ding, für das sie ein spezielles Farbband und dickes, robustes Papier kaufen muss. »Ich kann einfach nicht auf einem Bildschirm schreiben«, erzählte sie mir. »Ich muss es gedruckt vor mir sehen. Diese beruhigende Stabilität der Worte. Es fühlt sich beständig an, es verleiht allem, was ich verfasse, Gewicht. Es hält mich fest; es klärt meine Gedanken und zwingt mich, konkret zu werden.«
Ich streife weiter durch ihr Schreibzimmer, weil ich gerade betrunken genug bin, um zu vergessen, dass sich das eigentlich nicht gehört. Es klemmt ein Blatt Papier in der Halterolle, auf dem nur ein Wort steht: ENDE. Neben der Maschine liegt ein etwa dreißig Zentimeter hoher Papierstapel.
Plötzlich steht Athena neben mir, in jeder Hand ein Glas. »Ah, das ist das Projekt zum Ersten Weltkrieg. Es ist endlich fertig.«
Athena spricht bekanntlich nicht gern über ihre Schreibprojekte, bevor sie vollendet sind. Keine Testleser:innen. Keine Interviews, keine Auszüge in den sozialen Medien. Selbst ihre Agent:innen und Lektor:innen bekommen nicht mehr als einen Abriss zu sehen, bevor das ganze Dinge fertig ist. »Ich muss es in mir reifen lassen, bis es lebensfähig ist«, hat sie mir einmal erzählt. »Wenn ich es unterentwickelt zur Welt bringe, stirbt es.« (Es schockiert mich, dass sich bisher niemand an dieser grotesken Metapher gestoßen hat, aber Athena darf offensichtlich alles sagen.) In den letzten zwei Jahren hat sie lediglich preisgegeben, dass der neue Roman etwas mit Militärgeschichte im 20. Jahrhundert zu tun habe und dass er eine »große künstlerische Herausforderung« für sie darstelle.
»Wow«, sage ich. »Glückwunsch.«
»Hab die letzte Seite heute Morgen abgetippt«, zwitschert sie. »Bis jetzt hat niemand das Manuskript gelesen.«
»Nicht mal dein Agent?«
Sie schnaubt. »Jared kümmert sich um die Papiere und unterschreibt Schecks.«
»Es hat so viele Seiten.« Ich gehe zum Schreibtisch, will nach dem ersten Blatt Papier greifen, ziehe meine Hand dann aber schnell zurück. Unüberlegt, betrunken – ich kann hier nicht einfach herumlaufen und alles anfassen.
Aber anstatt mich anzufahren, nickt Athena ermutigend. »Was sagst du dazu?«
»Du willst, dass ich es lese?«
»Na ja, natürlich nicht gleich alles.« Sie lacht. »Es ist sehr lang. Ich bin nur … Ich bin so froh, dass es fertig ist. Sieht der Stapel nicht hübsch aus? So mächtig. Er … hat etwas Bedeutendes.«
Ihre Gedanken schweifen ab; sie ist so betrunken wie ich, aber ich weiß genau, was sie meint. Dieses Buch hat Format, in mehrfacher Hinsicht. Es ist ein Buch, das Spuren hinterlässt.
Mein Finger schwebt über dem Papierstapel. »Darf ich …?«
»Ja, sicher …« Sie nickt begeistert. »Ich muss mich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es gesehen wird. Ich muss es zur Welt bringen.«
Sie hält an dieser bizarren Metapher fest. Ich weiß, dass die Lektüre meinen Neid nur befeuern wird, aber ich kann nicht anders. Ich nehme zehn, fünfzehn Seiten vom Stapel und überfliege sie.
Himmel, sind die gut.
Angetrunken fällt mir das Lesen etwas schwer, und mein Blick gleitet immer wieder zum Ende des Absatzes, aber selbst nach kurzem Überfliegen weiß ich, dass dieses Buch glänzen wird. Der Schreibstil ist dicht und selbstsicher. Keine Spur von den jugendlichen Ausrutschern ihres Debüts. Ihre Stimme ist reifer und schärfer geworden. Jede Beschreibung, jeder Ausdruck – alles singt.
Es ist besser als alles, was ich vermutlich jemals schreiben könnte.
»Gefällt es dir?«, fragt sie.
Sie ist nervös. Sie sieht mich mit großen, beinahe ängstlichen Augen an, während sie an ihrer Halskette herumzupft. Wie oft zieht sie diese Show ab? Mit wie viel Lob überschütten die Leute sie, wenn sie es tut?
Es ist lächerlich, aber ich will sie nicht loben. Ihr Spielchen funktioniert bei bewundernden Kritiker:innen und Fans, aber nicht bei mir.
»Ich weiß nicht«, sage ich ausdruckslos. »Ich kann nicht richtig lesen, wenn ich betrunken bin.«
Sie sieht geknickt aus, jedoch nur für einen Moment. Dann setzt sie hastig ein Lächeln auf. »Na klar, logisch, das war dumm, natürlich willst du nicht …« Ihr Blick wandert von ihrem Glas zu mir und dann in Richtung Wohnzimmer. »Tja, wollen wir dann einfach … abhängen?«
Ich hänge also einfach mit Athena Liu ab.
Wie sich herausstellt, ist sie schockierend gewöhnlich, wenn sie besoffen ist. Sie stellt mir keine Quizfragen zu Heidegger oder Arendt oder den vielen anderen Philosoph:innen, deren Namen sie so gern in Interviews fallen lässt. Sie schwärmt nicht davon, wie toll es war, dieses eine Mal Model für Prada in Paris gewesen zu sein (was ein totaler Zufall war; der Casting-Direktor hatte sie vor einem Café sitzen sehen und sie gebeten einzuspringen). Wir lachen über berühmte Leute. Wir behaupten beide, dass wir dem neuesten Twink mit dem Hundeblick nichts abgewinnen können, dass wir Cate Blanchett jedoch jederzeit die Füße küssen würden. Sie sagt etwas Nettes über mein Outfit. Sie will wissen, wo ich meine Schuhe, meine Brosche, meine Ohrringe gekauft habe. Sie bewundert mein Gespür für Secondhand-Schnäppchen – »Ich kaufe immer noch die Hälfte meiner Klamotten bei Talbots, ich bin so eine alte Lady.« Ich bringe sie mit Geschichten über meine Schüler:innen zum Lachen, einer Reihe verpickelter, geistloser Teenies, die durch das Netzwerk ihrer Eltern in die besten Unis des Landes spazieren könnten, wenn sie nur zweihundert Punkte mehr im Zulassungstest erreichen würden, und die sich in ihren von Ghostwriter:innen verfassten Bewerbungsessays persönliches Leid andichten lassen, das sie offensichtlich nie selbst erlebt haben. Wir tauschen uns über schlechte Dates aus, über Leute aus dem Studium, über die Tatsache, dass wir beide etwas mit denselben zwei Typen von Princeton hatten.
Schließlich liegen wir auf ihrer Couch und lachen, bis wir Bauchschmerzen haben. Mir war nicht klar, wie viel Spaß man mit Athena haben kann. Ich war noch nie so sehr ich selbst mit ihr. Wir kennen uns jetzt seit mehr als neun Jahren, aber in ihrer Gegenwart war ich immer zurückhaltend – weil sie nicht merken sollte, dass ich nur halb so brillant oder interessant bin, wie sie denkt, und auch wegen der Sache, die im ersten Jahr am College passierte.
Aber heute Abend habe ich zum ersten Mal seit Langem das Gefühl, nicht jedes meiner Worte filtern zu müssen. Ich gebe mir keine Mühe, Athena Fucking Liu zu beeindrucken. Ich hänge nur mit Athena ab.
»Wir sollten das öfter machen«, sagt sie zum wiederholten Mal. »Junie, ehrlich, warum haben wir das noch nie gemacht?«
»Ich weiß nicht«, sage ich und dann in einem Versuch, tiefgründig zu klingen, »vielleicht hatten wir Angst davor, wie sehr wir uns mögen würden.«
Es ist dumm, und es ist nichts Wahres dran, aber offensichtlich gefällt ihr meine Antwort.
»Vielleicht«, sagt sie. »Vielleicht. Ach, Junie. Das Leben ist kurz. Warum errichten wir Mauern um uns herum?«
Ihre Augen glänzen. Ihr Mund ist feucht. Wir sitzen nebeneinander auf ihrem Futon, unsere Knie berühren sich fast. Ganz kurz denke ich, sie wird sich vorbeugen und mich küssen – was das für eine Story wäre, denke ich; was für eine überraschende Wendung – aber dann springt sie kreischend zurück, denn ich habe mein Glas so schief gehalten, dass Whisky auf den Boden getropft ist. Zum Glück nur auf das Parkett, denn wenn ich einen von Athenas teuren Läufern ruiniert hätte, wäre ich vom Balkon gesprungen. Sie lacht und rennt in die Küche, um ein Tuch zu holen, und ich nehme noch einen Schluck zur Beruhigung, während ich verwundert feststelle, dass mein Herz rast.
Dann ist es plötzlich Mitternacht, und wir machen Pancakes – selbstgemacht, keine Fertigmischung, und verfeinert mit einigen Spritzern Pandan-Extrakt, die den Teig neongrün färben, denn Athena Liu macht keine normalen Pancakes. »Wie Vanille, nur besser«, erklärt sie. »Es ist duftend und würzig, als würdest du den Wald einatmen. Kaum zu glauben, dass weiße Leute noch nichts von Pandan gehört haben.« Sie befördert die Pancakes von der Pfanne auf meinen Teller. Sie sind angebrannt und unförmig, aber sie riechen fantastisch, und ich merke, wie hungrig ich bin. Gierig verschlinge ich den ersten und bemerke dann, dass Athena mich anstarrt. Ich wische mir die Finger ab und habe plötzlich Angst, sie könnte mich abstoßend finden, doch dann lacht sie und fordert mich zu einem Wettessen heraus. Die Stoppuhr läuft, und wir stopfen uns die schmierigen, halbgaren Pancakes in den Mund, so schnell wir können, gefolgt von großen Schlucken Milch, um die dicken Klumpen hinunterzuspülen.
»Sieben«, keuche ich und schnappe nach Luft. »Sieben, wie viele …«
Aber Athena sieht mich nicht an. Sie blinzelt wie verrückt, runzelt die Stirn. Sie legt sich eine Hand an den Hals. Die andere schlägt hektisch auf meinen Arm. Ihre Lippen öffnen sich, und es kommt ein gedämpftes, scheußliches Krächzen heraus.
Sie erstickt.
Heimlich, ich kenne das Heimlich-Manöver – oder? Ich habe seit der Grundschule nicht mehr daran gedacht. Aber ich stelle mich hinter sie, schlinge meine Arme um ihre Mitte und drücke meine Hände ruckartig gegen ihren Bauch, damit sich der Pancake löst – heilige Scheiße, sie ist so dünn –, doch sie schüttelt immer noch den Kopf und schlägt auf meinen Arm. Es kommt nichts raus. Ich drücke nochmal. Und nochmal. Es funktioniert nicht. Kurz überlege ich, »Heimlich« zu googeln, vielleicht gibt es ein YouTube-Video. Aber dafür bleibt keine Zeit, das würde ewig dauern.
Athena schlägt mit den Händen auf den Küchentresen. Ihr Gesicht hat sich inzwischen violett verfärbt.
Mir fällt ein Zeitungsartikel von vor ein paar Jahren ein, über eine Studentin, die bei einem Pancake-Wettessen erstickt ist. Ich weiß noch, wie ich auf der Toilette saß und mich von grausamer Faszination gepackt durch die Details scrollte, weil es so ein plötzlicher, lächerlicher und fürchterlicher Tod gewesen war. Die Pancakes saßen wie ein Zementklumpen in ihrem Hals, hatte der Rettungssanitäter gesagt. Ein Zementklumpen.
Athena zerrt an meinem Arm, zeigt auf mein Telefon. Hilfe, sagt sie tonlos. Hilfe, Hilfe –
Meine Finger hören nicht auf zu zittern; erst beim dritten Versuch schaffe ich es, mein Handy zu entsperren, um den Notruf zu wählen. Ich werde gefragt, was passiert ist.
»Meine Freundin«, keuche ich. »Sie erstickt. Ich habe es mit dem Heimlich-Griff versucht; es kommt nicht raus –«
Neben mir beugt Athena sich über einen Stuhl, rammt ihr Brustbein gegen die Rückenlehne, versucht das Heimlich-Manöver an sich selbst anzuwenden. Ihre Bewegungen werden immer verzweifelter – Sie sieht aus, als würde sie den Stuhl vögeln, denke ich dümmlich –, aber es scheint nicht zu klappen; nichts fliegt aus ihrem Mund.
»Ma’am, wo befinden Sie sich?«
Oh, verdammte Scheiße, ich kenne Athenas Adresse nicht. »Ich weiß es nicht, bei meiner Freundin.« Ich versuche mich zu konzentrieren. »Ähm, gegenüber sind ein Taco-Laden und eine Buchhandlung, ich weiß es nicht …«
»Können Sie es genauer sagen?«
»Dupont! Dupont Circle. Ähm – ein Block von der Metrostation entfernt, mit so einer schicken Drehtür –«
»Ist es ein Apartmentgebäude?«
»Ja –«
»Das Independent? Das Madison?«
»Ja! Madison. Das ist es.«
»Welche Apartmentnummer?«
Ich weiß es nicht. Ich drehe mich zu Athena um, aber sie liegt auf dem Boden, und es ist schrecklich, ihren zuckenden Körper zu sehen. Ich zögere, weiß nicht, ob ich ihr helfen oder erst die Nummer an der Tür ablesen soll – aber dann fällt es mir ein, neunter Stock, so weit oben, dass man den ganzen Dupont Circle vom Balkon aus überblicken kann. »Neun-Null-Sieben«, stoße ich hervor. »Bitte kommen Sie schnell, oh mein Gott –«
»Wir schicken einen Krankenwagen zu Ihnen, Ma’am. Ist die Patientin bei Bewusstsein?«
Ich werfe einen Blick über meine Schulter. Athena hat aufgehört zu treten. Jetzt bewegen sich nur noch ihre Schultern, sie zucken ruckartig, als wäre sie besessen.
Dann hört auch das auf.
»Ma’am?«
Ich nehme das Handy vom Ohr. Meine Sicht ist verschwommen. Ich strecke meine Hand aus und rüttele an ihrer Schulter: nichts. Athenas hervorgetretene Augen sind weit geöffnet; ich kann nicht hinsehen. Ich berühre ihren Hals, um nach dem Puls zu suchen. Nichts. Die Frau von der Notrufzentrale sagt noch etwas, aber ich kann sie nicht verstehen; ich kann meine eigenen Gedanken nicht verstehen. Alles, was danach passiert, das laute Klopfen an der Tür und die hereinstürmenden Rettungssanitäter:innen, ist ein einziger dunkler, verwirrender Nebel.
Ich komme erst in den frühen Morgenstunden nach Hause.
Einen Todesfall zu dokumentieren, dauert offenbar sehr lange. Die Sanitäter:innen müssen jedes verdammte Detail überprüfen, bevor sie offiziell auf ihr Klemmbrett schreiben dürfen: Athena Liu, siebenundzwanzig, weiblich, ist tot, weil sie an einem beschissenen Pancake erstickt ist.
Ich muss eine Aussage machen. Ich blicke der Sanitäterin vor mir fest in die Augen, um mich abzulenken – sie sind hellblau und am äußeren Wimpernrand kleben dicke, schwarze Mascara-Klümpchen –, während in der Küche hinter mir eine Trage liegt und uniformierte Menschen ein Plastiklaken über Athenas Körper ziehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist ein Leichensack. Das ist wirklich passiert. Athena ist tot.
»Name?«
»June – Entschuldigung, Juniper Hayward.«
»Alter?«
»Siebenundzwanzig.«
»In welcher Beziehung stehen Sie zu der Verstorbenen?«
»Sie ist – sie war – meine Freundin. Wir waren seit dem College befreundet.«
»Und was haben Sie heute hier gemacht?«
»Wir haben gefeiert.« Tränen steigen in mir hoch. »Wir haben gefeiert, weil sie gerade einen Vertrag mit Neflix unterschrieben hatte, und sie war so verdammt glücklich.«
Ich habe komischerweise entsetzliche Angst, dass sie mich wegen Mordes verhaften werden. Aber das ist Unsinn – Athena ist erstickt, und der Fremdkörper (sie haben es immer »Fremdkörper« genannt – was ist das für ein Wort?) steckt dort in ihrem Hals. Es gibt keine Spuren eines Kampfes. Sie hat mich reingelassen, Gäste in der Bar können unseren freundschaftlichen Umgang bezeugen – Ruft den Typen aus dem Graham an, will ich sagen, der wird das bestätigen.
Aber warum versuche ich überhaupt, mich zu verteidigen? Diese Details sind unwichtig. Ich habe nichts getan. Ich habe sie nicht umgebracht. Das ist lächerlich; es ist lächerlich, dass ich mir deswegen überhaupt Sorgen mache. Keine Jury würde mich je verurteilen.
Schließlich lassen sie mich gehen. Es ist vier Uhr morgens. Ein Polizist – irgendwann kam die Polizei, was wohl üblich ist, wenn es eine Leiche gibt – bietet mir an, mich zu meiner Wohnung nach Rosslyn zu fahren. Den Großteil der Fahrt bleiben wir stumm, und als wir bei mir anhalten, spricht er mir sein Beileid aus, was ich zwar hören, aber nicht verarbeiten kann. Ich stolpere in meine Wohnung, reiße mir die Schuhe und den BH vom Leib, gurgele mit Mundwasser und lasse mich auf mein Bett fallen. Ich weine eine Weile, heule und schluchze, um die furchtbare Anspannung aus meinem Körper zu vertreiben, und eine Melatonin- und zwei Schlaftabletten später schlafe ich ein.
In meiner Tasche, die ich achtlos auf den Boden geworfen habe, steckt Athenas Manuskript wie ein glühendes Stück Kohle.
ZWEI
Trauern ist etwas Sonderbares. Athena war nur eine Freundin, keine gute Freundin. Ich komme mir mies vor, wenn ich das sage, aber sie war mir einfach nicht so wichtig, und sie hinterlässt kein Loch in meinem Leben, um das ich jetzt einen Bogen machen müsste. Ich spüre nicht dieselbe schwarze, erdrückende Trauer, die ich spürte, als mein Vater starb. Es schnürt mir nicht die Luft ab. Ich liege nicht morgens im Bett und frage mich, ob es sich lohnt aufzustehen. Ich nehme es nicht allen unbekannten Menschen übel, dass sie weitermachen wie bisher, als hätte die Erde nicht aufgehört, sich zu drehen.
Athenas Tod hat meine Welt nicht zerstört, er hat sie nur … eigenartiger gemacht. Ich lebe mein gewohntes Leben. Meistens, wenn ich nicht zu viel darüber nachdenke, wenn ich nicht bei den Erinnerungen hängenbleibe, geht es mir gut.
Aber ich war dabei. Ich habe Athena sterben sehen. Die Gefühle in den ersten Wochen sind weniger von Trauer bestimmt als von völligem Schock. Das ist wirklich passiert. Ich habe wirklich gesehen, wie ihre Füße auf das Parkett trommelten, wie sie mit den Fingern ihren Hals umklammerte. Ich habe wirklich ganze zehn Minuten neben ihrem toten Körper gesessen, bevor der Krankenwagen kam. Ich habe wirklich ihre offenen, hervorquellenden Augen gesehen, starr, blind. Wenn ich daran denke, muss ich nicht weinen – ich würde dieses Gefühl nicht als Schmerz beschreiben –, aber ich starre mehrmals am Tag die Wand an und murmele, »What thefuck?«
Die Meldung von Athenas Tod muss inzwischen die Runde gemacht haben, denn ich bekomme jede Menge Nachrichten von Freund:innen, die ihre Besorgnis zum Ausdruck bringen wollen (Hey, ich wollte mich mal melden, wie geht es dir?), und von Bekannten, die es auf pikante Details abgesehen haben (OMG, ich hab’s auf Twitter gesehen, warst du echt DABEI?). Ich habe nicht genug Energie, um zu antworten. Fasziniert und gleichzeitig angewidert beobachte ich, wie die roten Zahlen an den Ecken meiner Nachrichten-Apps immer weiter steigen.
Auf den Rat meiner Schwester Rory hin gehe ich zu einer Selbsthilfegruppe und mache einen Termin bei einer Trauertherapeutin. Danach fühle ich mich noch schlechter, denn alle gehen von einer Art Freundschaft aus, die es nicht gab, und es ist zu anstrengend, zu erklären, warum ich nicht komplett am Boden bin, also gehe ich nicht wieder hin. Ich will nicht darüber reden, wie sehr ich sie vermisse oder wie leer sich mein Leben ohne sie anfühlt. Das Problem ist, dass sich mein Leben vollkommen normal anfühlt, bis auf die eine verblüffende Tatsache, dass Athena verdammt nochmal tot ist, einfach weg, und ich überhaupt nicht weiß, wie ich mich fühlen soll. Deswegen fange ich an zu trinken und habe Fressattacken, sobald sich abends der Trübsinn einstellt, und ein paar Wochen lang bin ich ziemlich aufgedunsen von all dem Eis und der Lasagne, aber schlimmer wird es nicht.
Meine Resilienz erstaunt mich tatsächlich selbst.
Ich breche nur einmal zusammen, eine Woche nachdem es passiert ist. Ich weiß nicht, was es auslöst, aber in dieser Nacht gucke ich stundenlang Videos über das Heimlich-Manöver auf YouTube, vergleiche sie mit dem, was ich gemacht habe, versuche mich daran zu erinnern, ob ich meine Hände genauso positioniert habe, ob ich kraftvoll genug gedrückt habe. Ich hätte sie retten können. Ich spreche es immer wieder laut aus, wie Lady Macbeth, die wegen des verdammten Flecks rumheult. Ich hätte Ruhe bewahren, mich auf den korrekten Handgriff konzentrieren, meine Fäuste über ihren Bauchnabel legen, die Blockade lösen und Athena wieder atmen lassen können.
Wegen mir ist sie gestorben.
»Nein«, sagt Rory, als ich sie um vier Uhr morgens anrufe und so heftig weine, dass ich kaum sprechen kann. »Nein, nein, nein, das darfst du nicht eine Sekunde lang denken, hast du verstanden? Es ist nicht deine Schuld. Du hast diese Frau nicht umgebracht. Du bist unschuldig. Hast du mich verstanden?«
Ich fühle mich wie ein Kleinkind, als ich nuschelnd antworte, »Ja. Okay. Na gut.«
Aber das brauche ich jetzt: wie ein Kind daran glauben, dass die Welt so einfach ist und dass mich keine Schuld trifft, wenn ich es doch nicht mit Absicht getan habe.
»Bist du okay?«, hakt Rory nach. »Soll ich Dr. Gaily anrufen?«
»Nein – auf keinen Fall, nein, mir geht’s gut. Ruf nicht Dr. Gaily an.«
»Okay, aber sie hat uns gesagt, wenn du rückfällig wirst–«
»Ich werde nicht rückfällig.« Ich hole tief Luft. »So schlimm ist es nicht. Es geht mir gut, Rory. Ich kannte Athena doch gar nicht so gut. Ist schon in Ordnung.«
Wenige Tage nachdem es bekannt wird, erzähle ich in einem langen Thread auf Twitter, was passiert ist. Es kommt mir vor, als würde ich einem Muster folgen, mich bei zahllosen Kondolenz-Beiträgen bedienen, durch die ich mich in der Vergangenheit lüstern gescrollt hatte. Ich benutze Formulierungen wie »tragischer Unfall« und »unbegreiflich« und »fühlt sich noch unwirklich an«. Ich gehe nicht weiter auf die Details ein – das wäre vulgär. Ich schreibe darüber, wie mitgenommen ich bin, was Athena mir bedeutet hat und wie sehr sie mir fehlen wird.
Unbekannte bekunden mir ihr Beileid, schreiben, dass ich auf mich aufpassen solle, dass es total verständlich sei, von einem traumatischen Erlebnis wie diesem aus der Bahn geworfen zu werden. Sie sagen, ich sei ein guter Mensch. Sie senden Umarmungen und Genesungswünsche. Sie fragen, ob sie ein Crowdfunding für meine Therapie starten dürfen, und das Geld reizt mich, aber es ist mir zu unangenehm, ja zu sagen. Jemand bietet sogar an, mir einen Monat lang selbstgekochtes Essen vorbeizubringen. Aber ich ignoriere das Angebot, weil man niemandem im Internet trauen kann, und wer weiß, ob die Person mich nicht eigentlich vergiften will?
Nach einem Tag hat mein Tweet dreißigtausend Likes. Ich habe noch nie so viel Aufmerksamkeit auf Twitter bekommen, noch dazu von Literaturstars und Internet-Berühmtheiten mit blauen Häkchen. Es ist auf seltsame Weise aufregend, zu sehen, wie meine Follower:innenzahlen sekündlich steigen. Doch dann fühle ich mich schlecht, wie nach dem Masturbieren aus Langeweile, also lösche ich Twitter auf all meinen Geräten (Ich mache eine Pause für meine mentale Gesundheit, aber vielen Dank für euer Mitgefühl) und gelobe, mich mindestens eine Woche lang nicht wieder einzuloggen.
Ich gehe zu Athenas Beerdigung, wo ich auf den Wunsch ihrer Mutter hin ein paar Worte sage. Sie rief mich einige Tage nach dem Unfall an, und mir wäre fast das Telefon aus der Hand gefallen, als sie sich vorstellte. Ich hatte plötzlich Angst, sie könnte mich verhören oder mir vorwerfen, ihre Tochter umgebracht zu haben – aber stattdessen entschuldigte sie sich immer wieder, als wäre es sehr unhöflich von Athena gewesen, in meiner Gegenwart zu sterben.
Die Beerdigung findet in einer koreanischen Kirche draußen in Rockville statt, was mich wundert, weil ich dachte, Athena sei Chinesin gewesen, aber egal. Ich bin erstaunt, dass so wenige Gäste in meinem Alter da sind. Es sind überwiegend alte Asiat:innen, vermutlich der Freundeskreis ihrer Mutter. Nicht ein Autor oder eine Autorin, die ich kenne, niemand vom College. Vielleicht ist diese Beerdigung nur für die Gemeinde gedacht – wahrscheinlich hat Athenas Bekanntenkreis an der virtuellen Trauerfeier des asiatisch-amerikanischen Schreibkollektivs teilgenommen.
Der Sarg ist geschlossen, Gott sei Dank.
Viele der Trauerreden sind auf Chinesisch, also sitze ich hilflos da und versuche im richtigen Moment zu lächeln oder den Kopf zu schütteln oder zu weinen. Als ich an der Reihe bin, stellt Athenas Mutter mich als eine der engsten Freundinnen ihrer Tochter vor.
»Junie war bei meiner Athena, in der Nacht als sie starb«, sagt Mrs Liu. »Sie gab ihr Bestes, um sie retten.«
Schon kommen mir die Tränen. Aber das macht sich gut, sagt eine schrecklich zynische Stimme in meinem Kopf. Wenn ich weine, sieht mein Kummer echt aus. Es lenkt von der Tatsache ab, dass ich nicht weiß, was zur Hölle ich hier zu suchen habe.
»Athena war außergewöhnlich«, sage ich, und ich meine es ernst. »Sie war imposant. Unerreichbar. Sie anzusehen war wie in die Sonne zu schauen. Sie strahlte so hell, dass es wehtat, wenn man zu lange hinsah.«
Ich halte es eine halbe Stunde auf der Trauerfeier aus, bevor ich mir eine Ausrede einfallen lasse, um zu gehen – ich habe genug von dem streng riechenden chinesischen Essen und den alten Leuten, die kein Englisch sprechen können oder wollen. Mrs Liu drückt sich schniefend an mich, als ich mich verabschiede. Ich muss versprechen, mich zu melden, sie wissen zu lassen, wie es mir geht. Ihre verschmierte Wimperntusche hinterlässt Flecken auf meiner Samtbluse, die ich selbst nach einem Dutzend Mal Waschen nicht rausbekommen werde, also entsorge ich schließlich das ganze Outfit.
Ich sage meine Nachhilfestunden für den restlichen Monat ab. (Ich arbeite stundenweise am Veritas College Institute, wo ich Vorbereitungskurse für Zulassungstests gebe und Bewerbungsessays als Ghostwriterin schreibe, ein klassischer Job für alle Eliteuni-Absolvent:innen ohne Perspektiven.) Mein Chef ist genervt, und die Eltern, die mich gebucht haben, sind verständlicherweise sauer, aber ich kann jetzt nicht in einem fensterlosen Raum sitzen und mich um die Lesekompetenz von Kaugummi kauenden, Zahnspangen tragenden Gören kümmern. Ich kann es einfach nicht. »Letzte Woche habe ich mit angesehen, wie sich eine Freundin auf dem Boden gewälzt hat, bis sie tot war«, fahre ich eine Mutter an, die sich am Telefon beschweren will. »Da werde ich wohl Sonderurlaub nehmen dürfen, oder?«
In den folgenden Wochen gehe ich nicht aus. Ich bleibe in meiner Wohnung, laufe den ganzen Tag im Schlafanzug herum. Ich bestelle ein Dutzend Mal Essen von Chipotle. Ich schaue alte Folgen von The Office, bis ich sie Wort für Wort mitsprechen kann, nur um meine Nerven zu beruhigen.
Außerdem lese ich.
Athena hatte allen Grund zur Vorfreude. Die letzte Front ist schlicht ein Meisterwerk.
Ich muss eine Weile im Wikipedia-Tunnel verschwinden, um mich zurechtzufinden. Es geht in dem Roman um die unbesungenen Taten und Erfahrungen von 140 000 Arbeitern des Chinesischen Arbeitskorps, die von der britischen Armee rekrutiert und während des Ersten Weltkrieges an die alliierte Front geschickt wurden. Viele von ihnen kamen durch Bombenangriffe, Unfälle und Krankheiten ums Leben. Die meisten wurden schlecht behandelt, sobald sie in Frankreich ankamen, um ihren Lohn betrogen, in schmutzigen, beengten Behausungen untergebracht, nicht von Dolmetschern unterstützt und von anderen Arbeitern attackiert. Viele kehrten nie wieder nach Hause zurück.
Es ist eine Art Running Gag, dass alle ernstzunehmenden Schriftsteller:innen irgendwann einen großen, ambitionierten Kriegsroman schreiben, und wie es aussieht, ist das hier Athenas. Sie hat das nötige Selbstvertrauen und den unaufdringlichen und poetischen Schreibstil, den es braucht, um eine so schwere Geschichte zu erzählen, ohne dabei überheblich, infantil oder scheinheilig rüberzukommen. Die meisten großen Kriegsepen von jungen Autor:innen lesen sich wie bloße Nachbildungen anderer großer Kriegsepen; die Verfasser:innen wirken wie Kleinkinder auf Steckenpferden. Doch Athenas Kriegsepos klingt wie ein Echo des Schlachtfeldes. Es klingt wahr.
Mir wird klar, was sie meinte, als sie es eine Evolution ihres Schaffens nannte. Ihre bisherigen Romane bestanden aus linearen Narrativen, alle in der Vergangenheitsform, der dritten Person und aus der Sicht einer einzelnen Hauptfigur erzählt. Aber hier macht Athena etwas, das an Christopher Nolans Film Dunkirk erinnert: Anstatt einem bestimmten Erzählstrang zu folgen, legt sie verschiedene Narrative und Perspektiven zu einem berührenden Mosaik zusammen, der solidarische Aufschrei einer Gemeinschaft. Das Ergebnis hat etwas Filmisches; fast wie ein Dokumentarfilm im Kopf: eine Vielzahl von Stimmen, die die Vergangenheit offenlegen.
Eine Erzählung ohne echte Hauptfigur dürfte eigentlich nicht so fesselnd sein. Aber Athenas Sätze sind so einnehmend, dass ich mich in der Geschichte verliere und immer weiter lese, anstatt sie auf meinen Laptop zu übertragen. Es ist eine als Kriegsgeschichte getarnte Liebesgeschichte, und die Details sind so schockierend lebendig, so besonders, dass man kaum glauben kann, dass es sich nicht um einen Erfahrungsbericht handelt und sie nicht bloß die geflüsterten Worte von Geistern zu Papier gebracht hat. Ich verstehe jetzt, warum der Schreibprozess so lange gedauert hat – jeder Absatz lässt auf akribische Recherche schließen, von den Standardmützen mit Pelzfutter bis zu den Emaille-Bechern, aus denen die Arbeiter ihren verwässerten Tee tranken.
Sie hat die magische Fähigkeit, den Blick der Lesenden auf die Seite zu heften. Ich muss wissen, wie es mit A Geng, dem spindeldürren Studenten und Dolmetscher, und Xiao Li, dem ungewollten siebten Sohn, weitergeht. Am Ende bin ich in Tränen aufgelöst, als sich herausstellt, dass Liu Dong es nie zurück nach Hause zu seiner wartenden Braut schafft.
Doch es gibt noch viel zu tun. Es ist noch lange kein Erstentwurf – eigentlich ist es noch überhaupt kein Entwurf; es ist eher eine Ansammlung von erstaunlich schönen Sätzen, unverblümten Motiven und dem gelegentlichen »[und dann reisen sie – später ausführen]«. Aber sie hat genug Brotkrumen ausgestreut, sodass ich dem Pfad folgen kann. Ich sehe, wohin er führt, und es ist wunderschön. Es ist einfach atemberaubend schön.
So schön, dass ich mich gezwungen sehe, es zu vollenden.
Anfangs ist es bloß eine Spielerei. Eine Schreibübung. Ich wollte das Manuskript nicht umschreiben, sondern vielmehr testen, ob ich die Lücken füllen kann; ob ich genügend technisches Know-how habe, um so lange zu schraffieren, zu glätten und auszumalen, bis das Bild fertig ist. Ich wollte lediglich mit einem der mittleren Kapitel experimentieren – hier gab es so viele unvollendete Szenen, dass man den Inhalt nur verstand, wenn man eng mit dem Text und der Autorin vertraut war.
Aber dann machte ich einfach weiter. Ich konnte nicht aufhören. Man sagt, es sei viel einfacher, einen schlechten Entwurf zu überarbeiten, als eine leere Seite zu füllen, und es stimmt – ich bin in diesem Moment so überzeugt von meiner Arbeit. Immer wieder fallen mir Formulierungen ein, die viel besser zu dem Text passen als Athenas fantasielose Beschreibungen. Ich erkenne, wo das Tempo nachlässt und streiche die abschweifenden Lückenfüller gnadenlos raus. Ich ziehe den roten Faden der Handlung in die Länge, wie einen hellen, kraftvollen Ton. Ich räume auf; ich stutze und verschönere; ich lasse den Text singen.
Ich weiß, ihr werdet es mir nicht glauben, aber zu keinem Zeitpunkt dachte ich, Ich nehme mir den Text und mache ihn mir zu eigen. Es ist nicht so, als hätte ich mich hingesetzt und einen bösen Plan geschmiedet, um von der Arbeit meiner toten Freundin zu profitieren. Nein, ehrlich – es fühlte sich ganz natürlich an, als wäre es meine Berufung, als wäre es gottgewollt. Als ich erst einmal angefangen hatte, war es die offensichtlichste Sache der Welt, dass ich Athenas Geschichte vervollständigen und dann auf Hochglanz bringen sollte.
Und danach – wer weiß? Vielleicht könnte ich den Text auch für sie veröffentlichen.
Ich arbeite so hart daran. Ich schreibe jeden Tag vom Morgengrauen bis nach Mitternacht. Ich habe noch nie zuvor so hart an einem Buchprojekt gearbeitet, nicht einmal an meinem Debüt. Die Worte glühen wie Kohlen in meiner Brust, sie treiben mich an, und ich muss sie alle auf einmal ausschütten, bevor sie mich verzehren.
Ich beende den Erstentwurf innerhalb von drei Wochen. Ich nehme mir eine Woche frei, in der ich lange Spaziergänge mache und Bücher lese, um Abstand zu gewinnen, und dann lasse ich das Ganze im Office Depot drucken, damit ich es mit dem Rotstift bearbeiten kann. Ich blättere die Seiten langsam um, lese mir jeden Satz laut vor, um ein Gefühl für den Klang, für die Form der Worte zu bekommen. Ich bleibe die ganze Nacht wach, um die Änderungen in das Word-Dokument zu übertragen.