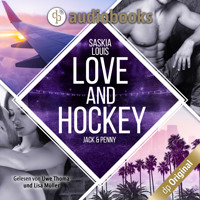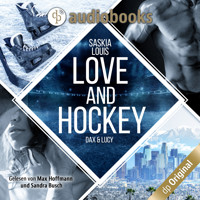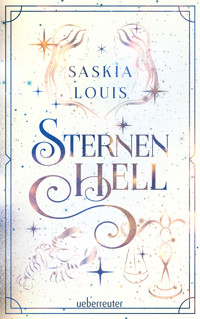4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie viele Leben musst du berühren, um dein eigenes guten Gewissens beenden zu können? Das Jahr hat 365 Tage. Niemand weiß das so gut wie Zoe, denn an Silvester möchte sie sich das Leben nehmen. Sie hat 365 Tage, in denen sie drei Menschen glücklich machen und ihre Schuld abarbeiten will, um ohne Reue zu sterben. Doch die exzentrische alte Dame, das krebskranke Mädchen und der arrogante Banker nehmen ihre Hilfe nicht so dankend an wie geplant. Sophia behandelt sie wie eine Verbrecherin, die ihr Gebiss auf eBay verhökern will. Mia hält ihren Stoffdelfin für kompetenter als alle Pfleger und dann ist da noch Alex Ferra. Alex, der das eine sagt, aber das andere tut und sie Dinge fühlen lässt, an die sie nie wieder erinnert werden wollte. Und während sie ihre Zeit stur weiter damit verbringt, sich auf den Tod vorzubereiten, bemerkt sie gar nicht, wie sie das Leben wieder einholt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SASKIA LOUIS
ZÄHL NICHT MEINE TAGE
ROMAN
Impressum
Copyright © 2020 by Saskia Louis
Erstausgabe Mai 2020
Lektorat: Klaudia Szabo
Korrektorat: Marie Weißdorn
Coverdesign: Sarah Buhr - www.covermanufaktur.de
unter Verwendung von Bildmaterial von CARACOLLA; banyat jantamas; Anfisa Borodich /Shutterstock
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung der Autorin wiedergegeben werden.
Handlungen und Personen dieses Werks sind frei erfunden. Etwaige Ähnlichkeiten mit real existierenden Personen, ob lebend oder tot, wären rein zufällig.
Saskia Louis
Wegemanns Feld 16
45527 Hattingen
www.saskialouis.com
Abonniert meinen Newsletter und verpasst keine Veröffentlichung mehr!
Besucht mich auf Facebook oder werdet Teil meiner Lesergruppe und diskutiert gemeinsam über die Bücher:
www.facebook.com/Louis.Saskia
https://www.facebook.com/groups/1785939628135145/
Impressum
Prolog
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
TRIGGERWARNUNG
Zähl nicht meine Tage enthält Elemente, die triggern können.
Diese sind:
Suizidalität, Krankheit (Leukämie), Depression, Tod, Verlust, Trauer und Trauerbewältigung.
Für Clara,
weil sie mit mir ihre Gummibärchen, ihr Leid, ihre Freude und ihr Leben teilt.
Prolog
Montag
31. Dezember
Der Anfang
Claire,
es gibt Dinge in meinem Leben, auf die ich stolz bin.
Zum Beispiel meine Idee, Schokolade in einen Strohhalm zu quetschen, ihn in die Mikrowelle zu legen und dadurch Milch mit dir zu trinken.
Mein Studium abzubrechen, um Kinderbuchautorin zu werden. Meine Barbie bei dem Nachbarskind gegen rote Gummibärchen einzutauschen, weil du sie so gern mochtest. Jede Woche mein Zimmer zu staubsaugen, nur damit du dich nicht darüber aufregen konntest, dass meine Zeichnungen und Geschichten die einzigen Dinge in meinem Leben wären, bei denen ich Ordnung hielt.
Aber weißt du, Claire, dann sind da Dinge in meinem Leben, auf die ich nicht so stolz bin.
Entscheidungen, die ich bereue, die mich an Augenblicke erinnern, die ich vergessen möchte. Die meisten davon kennst du. Denn du kennst mich.
Aber von meiner heutigen Entscheidung weißt du nichts. Ich bin nicht stolz auf diesen Abend und du wärst es auch nicht. Aber wir fanden das, was der andere gemacht hat, nicht immer gut.
Erinnerst du dich an unseren ersten Grundschultag? Als ich deine Schultüte gegen meine ausgetauscht habe, weil ich meine Süßigkeiten schon aufgegessen hatte? Oder in der siebten Klasse, als ich wusste, dass du Jana nicht mochtest, und ich trotzdem mit ihr Eis essen gegangen bin. Oder an der Uni, als ich bei meiner ersten Prüfung geschummelt habe und du mir so lange ein schlechtes Gewissen eingeredet hast, bis ich zum Dekan gegangen bin, um die Prüfung zu wiederholen.
Auch heute, an Silvester, wärst du wohl nicht stolz auf mich. Du weißt schon: Weil heute der Tag ist, an dem ich beschlossen habe, mich umzubringen. Der Tag, an dem ich die Schlaftabletten in die oberste Schublade meines Kleiderschrankes zwischen meine Unterwäsche gelegt und mir vorgenommen habe, das Jahr zu nutzen, um alles wiedergutzumachen, was ich je bereut habe.
Ich habe einen Plan, Claire – und zum ersten Mal seit Langem gibt es wieder etwas, auf das ich hinarbeiten kann.
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
Januar
Dienstag
Januar
noch 364 Tage
Claire,
der Tod ist hässlich. Egal, von welcher Seite man ihn betrachtet.
Verurteilst du mich?
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
Essen – alles, was ich schon immer essen wollte!
Filme – alle, die ich schon immer sehen wollte!
Bücher – alle, die ich schon immer lesen wollte!
…
Essen kam an erster Stelle.
Ich starrte auf das Blatt Papier zwischen meinen Fingern und schüttelte den Kopf. Achtundzwanzig Jahre auf dieser Erde und von den Dingen, die ich vor meinem Tod noch tun wollte, stand Essen an erster Stelle? Das war tragisch. Ich würde mir innerhalb des nächsten Jahres bessere Dinge einfallen lassen müssen.
Ich steckte die Liste in meine Hosentasche und sah aus dem Fenster. Die an mir vorbeifliegenden Backsteingebäude sahen kalt und trostlos aus. Wie Legobauklötze waren sie lieblos neben den Bürgersteig gesetzt worden. Gelb neben Braun. Alt zwischen Neu. Effizienz vor Schönheit. Niemanden interessierte es. Meine Sitznachbarn hielten die Augen geschlossen, sahen auf ihre Smartphones, hörten zu laut Musik oder schauten das neuste Katzenvideo. Alles, um sich nicht mit der grauen Realität konfrontieren zu müssen. Vielleicht war das mein Fehler. Vielleicht sah ich zu genau hin.
Ich stieg aus der Straßenbahn und schlug den Mantelkragen gegen den kalten Wind auf. Versuchte, all die Menschen zu ignorieren, die an mir vorbeihetzten und mich nicht sahen. Die nichts wirklich sahen. Ich versuchte, das Rauschen der Züge auszublenden, die ein und aus, von einem Ort zum nächsten, stetig im Kreis fuhren. Doch ich blieb erfolglos.
Seufzend strich ich mir die Haare aus der Stirn. Manche Dinge blieben gleich. So weit ich auch wegzog, auf das trostlose Treiben und die Hektik der Stadt konnte ich mich immer verlassen. Heute, am Neujahrsmorgen, noch mehr als sonst. Verkaterte Teenager stiegen aus den Bahnen und suchten ihren Weg nach Hause. Noch betrunkene Väter versuchten bei einem Spaziergang auszunüchtern und genervte Müllmänner kehrten die Gehwege von Raketen und leeren Bierflaschen frei.
Ja. Die Menschen blieben gleich.
Sie suchten, ohne zu wissen wonach. Liefen ohne genaues Ziel. Wie Pac-Man-Figuren, die in einem Labyrinth herumirrten – und ich allein hatte den Ausgang gefunden.
Meine gestrige Entscheidung gab mir ein gutes Gefühl. Ein Teil der Schuld war von mir abgefallen. Ich fühlte mich leichter. Als hätte ich Helium geschluckt. Das würde ein gutes letztes Jahr werden.
Ich schob die Handtasche höher auf meine Schulter, wandte mich von der Haltestelle ab und versuchte, mich zu orientieren. Ich war erst zweimal hier gewesen. Das erste Mal, um die Wohnung zu besichtigen, das zweite Mal, um einzuziehen. Ich kannte mich in Köln also genauso gut aus wie in George Clooneys Westentasche. Und George Clooney fand ich scheiße. Er lächelte immer, als wüsste er mehr als ich.
Wieder verrenkte ich den Hals, auf der Suche nach einem Punkt, an den ich mich erinnerte, als ich erleichtert eine mit pinkem Graffito besprühte Wand erkannte. Fuck You Very Much. Ja, da wohnte ich.
Zielstrebig ging ich auf das breite Backsteingebäude zu, das mit seinen kackbraunen Ziegeln genauso deprimierend aussah wie der Rest dieser Straße. Wahrscheinlich sogar wie der Rest dieser Stadt. Ich schloss die Tür auf und fühlte mich leicht betrogen. Ich war bisher nur in der Abenddämmerung hier gewesen und hatte alles in schlechtem, aber schmeichelhaftem Licht gesehen. Außerdem war in keinem Stadtführer auch nur einmal vermerkt worden, wie schlecht es um die Straßen und die Infrastruktur Kölns stand. Dort war nur die Monumentalität des Doms besungen und die kulturelle Vielfalt der Bewohner beklatscht worden.
Andererseits, wenn man einen Hund verkaufte, erklärte man ja auch nicht als erstes, dass ihm ein wichtiges Körperteil fehlte und er biss. Ich versuchte, es Marco Polo nicht allzu übel zu nehmen.
»Hallo.«
Eine dünne Stimme riss mich aus den Gedanken. Ich blieb auf den Treppenstufen zum vierten Stock stehen und drehte mich um.
»Hallo«, antwortete ich und lächelte die alte Frau, die ein paar Stufen unter mir aus ihrer Wohnungstür lugte, unsicher an.
Ich hatte mir noch nicht allzu viele Gedanken dazu gemacht, wie ich mit dem Thema soziale Kontakte umgehen wollte. Die Realität war leider nicht wie Facebook. Ich konnte mich nicht von meinem Leben abmelden, all meine Freunde und losen Bekanntschaften löschen und hoffen, dass nicht allzu viele peinliche Bilder von mir zurückblieben. Ich könnte Fremden natürlich meine Hand ins Gesicht drücken und sie so auf Abstand halten – aber seien wir ehrlich, jemanden virtuell zu blockieren, war sehr viel einfacher und weniger auffällig. Ja, ich würde nicht darum herumkommen, Menschen zu begegnen. Ich musste schließlich arbeiten, einkaufen, die Telekom beschimpfen und den Gasmann in meine Wohnung lassen. Aber ich konnte es verhindern, echte Freunde zu finden. Alles andere wäre unfair und herzlos. Dann mochte mich jemand und im nächsten Moment war ich tot.
»Sie sind wohl die neue Nachbarin?« Die Alte hatte ihr graugesträhntes Haar in einem Dutt zusammengefasst. Sie lächelte, und mir fiel auf, dass sie ihr oberes Gebiss wohl in irgendeinem Wasserglas hatte liegen lassen.
Ich nickte und hob die Schultern, unsicher, wie viel ich über mich preisgeben sollte. Ich war nach Köln gezogen, weil mir das Internet versichert hatte, dass die Nachbarn sich einen Dreck für einen interessierten, nicht um Königin des Smalltalks zu werden. »Ja. Ich bin Zoe Obito.«
»Mojito, sagen Sie?«
»Obito«, wiederholte ich. »Ohne den Alkohol.«
»Ach so.« Wieder lächelte sie so warm und freundlich, dass sich ein Kloß in meinem Hals bildete. »Mein Name ist Regine Peters. Herzlich willkommen.«
»Danke«, sagte ich hastig und wandte mich ab. Ihr vertrauensvoller Gesichtsausdruck sog das Helium aus meinem Körper und drückte mich in die kalten Granitstufen unter meinen Füßen. Ich wollte weitergehen, doch Frau Peters räusperte sich.
»Sie sehen noch sehr jung aus.«
Du hast das Gesicht einer Zwölfjährigen, Zoe, niemand wird dir Alkohol verkaufen! Lass mich das machen.
Ich blinzelte, drängte die Worte aus meinem Kopf, schluckte den Kloß herunter und hob eine Schulter. »Ich würde achtundzwanzig nicht als sehr jung bezeichnen.«
»Nun, ich wollte Ihnen nur sagen, dass die Wände hier sehr dünn sind und ich alles höre, was ein Stockwerk über mir passiert.«
Das war gut zu wissen. Wenn auch ein wenig verstörend. »Keine Angst. Ich steppe nicht und bin auch keine Opernsängerin.« Freunde oder gar ein Privatleben hatte ich auch nicht. Sie hatte wirklich nichts zu befürchten.
»Haustiere?«
»Ein paar Stubenfliegen und Hausspinnen, glaube ich.«
Meine Nachbarin riss überrascht die Augen auf. »Die verkaufen sie jetzt auch schon in Zoohandlungen?«
Keine schlechten Witze mit der Nachbarin reißen, vermerkte ich. Schade, dass ich keine guten zu bieten hatte. »Nein, Frau Peters. Tun sie nicht«, beruhigte ich sie freundlich.
Sie blinzelte, dann lachte sie kurz. »Okay. Noch einmal: Herzlich willkommen.«
Im nächsten Moment schloss sie die Tür. Erleichtert entspannte ich mich. Früher waren mir solch oberflächliche, unschuldige Interaktionen leichtgefallen. Ich hatte sie sogar genossen. Doch mittlerweile ließen sie nichts als ein Gefühl der Beklemmung in meiner Brust zurück – und von dem hatte ich in meinem Leben schon genug.
Frau Peters wirkte sympathisch und offen. Als würde sie liebend gern meine Pakete annehmen und mir Zucker leihen. Scheiße. Ich hätte ihr den Mittelfinger zeigen und sie anspucken sollen.
Seufzend schloss ich die Augen, bevor ich meine Schultern straffte, die restlichen Stufen meisterte und meine Wohnungstür öffnete. Mich begrüßte eine Armee von Kisten, die ich nicht ausräumen würde, und ich musste eine mit dem Fuß beiseiteschieben, um zur Garderobe zu gelangen und meine Jacke aufzuhängen. Ich hatte nicht den übermäßigen Drang, es mir gemütlich zu machen. Die Küche war betretbar, der Fernseher stand vor einem alten Sofa, es gab einen Schrank im Schlafzimmer und das Bad konnte ich risikofrei benutzen. Was wollte ein Mensch, der in einem Jahr sterben würde, mehr?
Ach, Gott. Wie theatralisch.
Ich musste wirklich an meiner Stimmung arbeiten, sonst würde Viola mich wieder zum Psychotherapeuten schicken. Noch einmal hielt ich eine Reihe sinnloser Sitzungen nicht durch.
Ich wollte mir nicht immer wieder anhören, dass ich durch den Schmerz hindurcharbeiten und mein Leben weiterleben musste, egal was passiert war. Das erklärte mir auch eine sehr viel günstigere Selbsthilfekassette. Als ob ich nicht wüsste, dass ich nach vorn sehen musste. Als ob ich es nicht versucht hätte. Als ob irgendwer auch nur die leiseste Ahnung hatte, wie viel Mühe ich mir gegeben hatte, mein Leben wertzuschätzen und die schrecklichen Bilder hinter mir zu lassen. Als ob irgendwer verstand, wie unmöglich das war.
Ich sank aufs Sofa und ließ den Kopf in meine Arme fallen.
Als ob ich je vergessen könnte.
Es machte mich so wütend, dass jeder glaubte, mir helfen zu können. Dass jeder meinte, ich müsse mich nur mehr anstrengen. Ich hatte nicht aufgegeben, weil ich zu faul war oder keine Lust hatte, mich besser zu fühlen. Ich hatte aufgegeben, weil es keine andere Möglichkeit mehr gab!
Das Helium, das mich hatte schweben lassen, verflüchtigte sich endgültig aus meinem Körper. Ich schluckte, doch der Kloß in meinem Hals wurde größer anstatt kleiner. Also saß ich die nächsten zehn Minuten bewegungslos da und konzentrierte mich einzig auf den Gedanken, dass bald alles vorbei war. Denn es ließ mich leichter atmen.
Ein Jahr. Ein Jahr, und ich konnte es mir erlauben, feige zu sein und diese Welt zu verlassen.
Ein Jahr, und ich würde frei sein.
Etwas in meiner Tasche vibrierte. Ich fischte mein Handy hervor und sah auf die blinkende Meldung am Display, die mir eine neue Mailboxnachricht versprach.
»Hey, Zoe. Ich bin’s, Philip. Ich wollte nur sichergehen, dass es dir gut geht und du heil angekommen bist. Ich finde es übrigens toll, dass du einen Neuanfang wagst. Nach allem, was passiert ist, hast du es verdient, ein neues Leben zu beginnen. Meld dich mal.«
Seine Stimme und die Wärme darin versetzten mir einen kleinen Stich. Ich fühlte mich schuldig, weil ich erleichtert war, nicht mehr in derselben Stadt wie er zu wohnen. Aber genau das hatte ich gewollt. Ich würde mich vor keinem Menschen mehr rechtfertigen müssen.
Es blieb nur noch eine Frage offen: Wie viele Menschenleben musste ich retten, damit ich mein eigenes guten Gewissens beenden konnte?
Mittwoch
2. Januar
noch 363 Tage
Claire,
Großstädte sind wie Kleinstädte.
Nur dass du überall zu jeder Zeit hinkommst, niemand dich kennt, keiner dir glaubt, wenn du etwas Gutes tun willst, keiner anhält, wenn du eine Panne hast, und die Menschen aussehen wie ihre Hunde.
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
»Habe ich das richtig verstanden?« Die Frau in Weiß lehnte sich vor und beäugte mich misstrauisch über ihren Brillenrand hinweg. »Sie wollen hier arbeiten, aber kein Gehalt beziehen?«
Ich nickte und faltete die Hände in meinem Schoß. Eigentlich hatte ich geglaubt, in meiner Bewerbungsmail ziemlich deutlich gewesen zu sein. »Das ist korrekt.«
»Arbeiten Sie für eine gemeinnützige Organisation?«
»Nein.«
»Oh.« Die Pflegerin rückte ihren Kittel zurecht und sah sichtlich verwirrt aus. Ihr dicklicher Kopf lief puterrot an und mehrere bläulich schimmernde Adern traten hervor. Wie ein Basketball mit Atemnot. »Das ist aber … ungewöhnlich. Ich dachte, Sie hätten in Ihrer Mail versucht, witzig zu sein.«
Ich schüttelte den Kopf und hielt ein Seufzen zurück. Mir hätte klar sein müssen, dass dieses Gespräch seltsam werden würde. Es half auch nicht, dass ich eigentlich gar nicht hier sein wollte. Alles an diesem Ort, vom Geruch nach Desinfektionsmittel bis zu den weißen, kalten Gängen, führte dazu, dass sich mir die Nackenhaare aufstellten. Krankenhäuser machten mich nervös. Doch das war egal. Ich würde etwas Gutes tun! Und wenn es mich umbring… na ja, unglücklicher machen würde.
»Habe ich nicht«, sagte ich und nickte fest. »Glauben Sie mir, ich bin zurzeit nicht sonderlich lustig.«
»Aber wie genau stellen Sie sich das denn vor?« Verblüfft öffnete sie den Mund. »Sie haben sich auf eine Teilzeitstelle beworben …«
»… die ich gerne antreten würde.«
»Ohne bezahlt zu werden!«
Ich nickte und knetete die Hände in meinem Schoß. »Richtig.«
»Frau Obito, das geht nicht. Ich habe Sie eingeladen, weil mich Ihr Lebenslauf überzeugt hat. Sie haben ein tolles Abitur und die Empfehlungen der Pfleger und Ärzte aus Ihrem freiwilligen sozialen Jahr im Krankenhaus sind wirklich bemerkenswert. Ich bin überzeugt davon, dass Ihre Fähigkeiten mehr als ausreichend für die nichtigen Arbeiten wären, die Sie bei uns übernehmen würden, aber …«
»Frau Wenders«, unterbrach ich sie hastig. »Dieser Job ist mir wirklich wichtig.« Eindringlich beugte ich mich zu ihr vor und wischte meine feuchten Handflächen an meiner Jeans ab. Mein gesamter Plan für das nächste Jahr beruhte auf der Idee, dass ich etwas Gutes ohne eine Gegenleistung tat. Wenn ich diese Stelle nicht bekam … »Sie können mich als Praktikantin einstellen«, schlug ich zögerlich vor und gab mir Mühe, das verzweifelte Zittern in meiner Stimme zu reduzieren. »Als Praktikantin auf unbestimmte Zeit. Das Krankenhaus hat doch ohnehin zu wenig Geld. Erachten Sie mich einfach als … Geschenk Gottes?« Diese Institution war schließlich katholisch! Frau Wenders sollte wirklich offener gegenüber der Vorstellung eines Wunders sein.
Die kleinen Rädchen im Kopf der Personalleiterin ratterten angestrengt, aber nachvollziehen konnte sie meine Worte offenbar immer noch nicht. »Das wäre eine Möglichkeit«, stellte sie bedröppelt fest. »Aber dennoch …«
»Es gibt kein dennoch«, kam ich ihr dazwischen. »Wirklich! Ich gehöre weder einer religiösen Sekte noch einem ehrenamtlichen Zusammenschluss an. Ich möchte einfach etwas Gutes tun. Das ist alles.«
Ihrem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, war der Pflegerin dieses Konzept fremd. Sie wartete vergeblich auf einen Haken.
»Warum versuchen wir es nicht einfach?«, schlug ich vor. »Geben Sie mir ein paar Wochen. Wenn ich meine Arbeit nicht vernünftig mache, können Sie mich immer noch rauswerfen.«
Einige endlose Momente lang starrte Frau Wenders mich an. Schließlich nickte sie. Ich vermutete, weil sie mich loswerden wollte und ohnehin nicht damit rechnete, dass ich am nächsten Tag zum Dienst erschien. »Schön, Frau Obito. Auch wenn ich das alles sehr merkwürdig finde … unser Budget ist tatsächlich knapp und wenn Sie darauf bestehen, dann …« Sie lachte trocken auf. »Bevorzugen Sie denn irgendwelche Arbeitszeiten? Stationen?«
»Morgens von sechs bis neun oder abends von sechs bis neun, und ich würde gerne auf die Kinderstation.«
Kopfschüttelnd sah mich mein Gegenüber an. »Gut, dann melden Sie sich morgen früh um sechs Uhr bei Viktoria im dritten Stock. Sie wird Sie dann … einweisen.«
Mir war unklar, ob sie in die geschlossene Abteilung oder in den Arbeitsplan meinte, aber ich wollte mein Glück nicht herausfordern. Deshalb nickte ich dankbar und erhob mich.
Die Personalleiterin folgte meinem Beispiel und schüttelte mir die Hand. »Tja … Ich würde Sie jetzt zur Pünktlichkeit ermahnen, aber Sie haben ja nichts zu befürchten, falls sie nicht zeitig hier erscheinen. Also …«
»Das wird nicht passieren«, versicherte ich ihr. Die Aussicht darauf, jeden Tag meines restlichen Lebens mit kranken Menschen zu verbringen, war zwar nicht sonderlich erfreulich, aber ich tat das hier auch nicht, um Spaß zu haben. »Vielen Dank für den Job.«
»Ich … danke Ihnen.« Wenn sie nicht aufpasste, würde sich ihr Blinzeln noch zu einem chronischen Augenzucken entwickeln. Ich hob die Hand zum Abschied und verließ den Raum. Erleichterung durchflutete mich und tief atmete ich durch. Noch war mein Plan nicht gescheitert. Einen Job hatte ich schon, zwei brauchte ich noch. Mein nächstes Vorstellungsgespräch fand in einer Stunde statt, ich musste mich also beeilen, wenn ich mit Bus und Bahn noch rechtzeitig ankommen wollte.
Ich rief den Fahrstuhl, stieg ein und drückte den Knopf für das Erdgeschoss.
»Drei, bitte.«
Vor Schreck stolperte ich mit dem Rücken gegen die hintere Fahrstuhlwand. Ich hatte gar nicht gesehen, dass noch jemand im Aufzug war, doch als ich jetzt nach unten blickte, entdeckte ich ein kleines Mädchen. Es hatte ein buntes Tuch um den Kopf gebunden und einen kleinen blauen Stoffdelfin an seine Brust gedrückt. Sein Lächeln reichte von einem Ohr zum anderen. Der Joker wäre beeindruckt gewesen. »Ich komm da nicht ran. Bitte?«
Peinlich berührt richtete ich mich wieder auf. Das Mädchen konnte höchstens sechs sein. »Ähm … solltest du nicht bei deinen Eltern sein?«
Sie schüttelte den Kopf und sah mich weiter mit großen braunen Augen an. »Nein. Die sind zu Hause. Aber die kommen gleich.«
Ich drückte auf die Drei und schluckte den Drang hinunter, meine Handtasche schützend vor meine Brust zu halten. Dabei versuchte ich, ein freundliches Lächeln aufzusetzen. Ich wollte auf der Kinderstation helfen. Ich würde mich daran gewöhnen müssen, andere Menschen nicht mit Kruzifix und Weihrauch von mir fernhalten zu wollen. Die Kinder könnten das persönlich nehmen. »Ähm … Bist du denn ganz allein hier?«
Augenverdrehend schüttelte sie den Kopf. »Nein. Ich hab doch Herrn Konrad dabei.«
»Herrn …?«
Sie sah zu ihrem Delfin. »Herr Konrad fand die Luft in meinem Zimmer zu dreckig, da hab ich einen Spaziergang gemacht«, erklärte sie. »Aber jetzt ist wieder alles gut.«
Der Fahrstuhl hielt an und das kleine Mädchen hüpfte hinaus, grinste mich an und verschwand in einem Zimmer am Ende des Gangs. Die Türen schlossen sich und ich fragte mich unwillkürlich, wie Herr Konrad dreckige Luft definierte.
»Sie sind überqualifiziert.«
Ich nickte.
»Sie haben ein erstklassiges Abitur.«
Wieder nickte ich.
»Sie könnten Ihr Studium weiterführen.«
Ich hob und senkte den Kopf.
»Warum wollen Sie diesen Job?«
»Ich brauche das Geld, Herr Tersdorf.«
Der Anzugträger vor mir sah mich belustigt über seinen teuren Schreibtisch hinweg an. »Das tun alle, die sich hier bewerben. Es ist bekannt, dass wir gut zahlen.« Er lehnte sich zurück und schob seine Brille auf die Nasenspitze, um mich zu mustern. »Warum sollte ich Sie einstellen, obwohl ich genau weiß, dass Sie etwas Besseres machen könnten?«
Leider eine gute Frage. Ich zuckte die Achseln. »Gerade deswegen. Weil ich etwas Besseres machen könnte, aber das hier machen will.«
»Sie wollen Post ordnen und in einem Karren herumschieben?«
Ja. Ich hielt es für meine Berufung. Meine Güte. »Das möchte ich«, sagte ich möglichst ernst.
Herr Tersdorf schob meine Unterlagen zusammen und reichte sie mir. »Schön. Sie fangen morgen um zehn an. Jemand Besseren als Sie können wir wohl kaum bekommen. Für diese Stelle verlangen wir ja nicht einmal Abitur.«
Ich war auch nicht auf der Suche nach einer Herausforderung. Ich brauchte nur einen gut bezahlten Job, mit dem ich noch 363 Tage überleben und gleichzeitig abarbeiten konnte, was ich zu begleichen hatte. Post zu verteilen, war perfekt.
Mein neuer Arbeitgeber reichte mir die Hand und ich schüttelte sie, bevor ich meine Jacke überzog. »Vielen Dank«, sagte ich höflich und verließ den Raum.
Als ich die Tür leise hinter mir schloss und in den vor mir liegenden Flur sah, flatterte ein Gefühl durch meine Adern, das mich entfernt an Euphorie erinnerte. Mein Vorhaben verlief gut. Mehr als gut.
Ich ließ meinen Blick schweifen … und die anfänglichen positiven Emotionen wurden im Keim erstickt. Dunkle Tischreihen, weiße Plastikwände, grauer Linoleumboden, gehetzte Stimmen, wütende Rufe, unaufhörliches Rascheln von Papier … Das Treiben in einem Bankgebäude war wie ein Kindergeburtstag mit der dunklen Fee. Einfach nur traurig und falsch. Ich roch den Stress der Mitarbeiter förmlich.
An einem Ort wie diesem konnte man nicht euphorisch sein. Mit jedem Schritt durch den Flur erinnerte ich mich wieder daran, warum ich mein Studium abgebrochen hatte: Diese Menschen waren furchtbar!
Sie verbrachten den Rest ihres Lebens in winzigen Büros und ließen sich Kaffee an den Tisch bringen. Aus Tassen, die mehr kosteten, als eine Erzieherin am Tag verdiente.
Wie viele hier hatten wohl ein Schweizer Konto? Mein Blick schweifte zur Decke und ich erkannte mein Spiegelbild darin. Das war ja wie bei Hugh Hefner in der Playboyvilla. Nur dass man sich nicht beim Sex, sondern beim Arbeiten beobachten konnte.
Ich blickte rechts und links in die Reihen der abgetrennten, kleinen Bürokabuffs und fragte mich, wie viele der arbeitenden Bankangestellten sich morgen wohl noch an mich erinnern würden.
Wahrscheinlich kein einziger. Mich störte das nicht, ich blieb ohnehin lieber unsichtbar, wütend wurde ich trotzdem. Die gestrigen Aktienkurse würden sie noch eine Woche lang im Kopf behalten, aber das Lieblingsbuch ihrer Kinder interessierte sie wahrscheinlich nicht. So wurden die Prioritäten gesetzt. Niemand würde mein Gesicht … Arrgh!
Mein Fuß stieß gegen etwas Hartes und mein Gleichgewichtssinn setzte für einen Moment aus. Ich kippte vornüber und schlug mit einem gewaltigen Knall der Länge nach auf dem Boden auf. Ein scharfer Schmerz schoss mir in Knie, Handflächen und Schläfen, Wasser überflutete meine Beine und Zitronengeruch stieg mir in die Nase. Ich war über einen Putzeimer gestolpert.
»Oh mein Gott, alles in Ordnung?«
»Scheiße, das sah schmerzhaft aus.«
»Holt jemand bitte ein Handtuch? Der Boden ist nass!«
Okay. Jetzt würden sich vielleicht doch ein paar Leute an mich erinnern.
Die fremden Stimmen riefen weiter wild durcheinander. Hastig rappelte ich mich auf, bevor die blonde Frau, die aus einem der Kabuffs gestürmt war, mich hochziehen konnte.
»Alles okay, mir geht es gut«, sagte ich knapp und senkte den Blick. Mein Kopf lief glutrot an und ich stellte überrascht fest, dass die Entscheidung, mir bald das Leben zu nehmen, keine Immunität gegen Peinlichkeit miteinschloss. Eine gesunde Portion Stolz allerdings schon. Ich hustete leise, lächelte der skeptisch dreinblickenden Mitarbeiterin peinlich berührt zu und eilte in den naheliegenden Aufzug, ohne einen Blick zurückzuwerfen.
Als ich nach der kurzen Fahrstuhlfahrt atemlos auf offener Straße stand, kramte ich die Liste aus meiner hinteren Hosentasche. Ich hatte einen wichtigen Punkt vergessen:
Einmal so richtig blamieren – und vollkommen darüber stehen!
Bei meinem dritten Vorstellungsgespräch reagierte meine Vorgesetzte nicht anders als die vorherigen. Ich ließ mich schon gar nicht mehr von der sichtlichen Irritation ablenken und gab mir auch keine Mühe, ihr zu erklären, dass ich keine Kriminelle war, die das Altenheim innerhalb der nächsten drei Tage ausrauben wollte.
Mich interessierte weniger ihre Reaktion, sondern vielmehr die offengelegte Frage, was zum Teufel in diesem Heim wertvoll genug sein könnte, um sich hier zum Stehlen einzuschleusen. Frau Gärtner, die das Vorstellungsgespräch führte, kam im Endeffekt zu demselben Schluss. Man kam hierher, wenn man kein Geld hatte.
Nach der Frage, ob ich ein potenzieller Träger ansteckender Krankheiten sei, und der Bitte, morgen um drei Uhr nachmittags anzufangen, entließ sie mich schließlich kopfschüttelnd.
In der Bahn lehnte ich mich erschöpft nach hinten und schloss die Augen. Heute war ein anstrengender, aber guter Tag gewesen. Ich hatte mir Sorgen darum gemacht, keinen der Jobs zu bekommen, doch jetzt fiel der Druck von mir ab und ein neuer Hoffnungsschimmer keimte in mir auf. Ich würde mich unwohl bei der Arbeit im Krankenhaus fühlen. Zu viele Erinnerungen, zu viele traurige Gesichter, zu viel von … allem. Aber ich würde etwas Gutes tun. Etwas Selbstloses. Das war alles, was ich wollte.
Das Klingeln meines Handys zog mich aus den Gedanken und ohne darüber nachzudenken, dass ich den Kontakt zu meiner alten Welt eigentlich so minimal wie möglich halten wollte, hob ich ab.
»Hallo?« Das Rattern der Bahn auf den Schienen machte es mir schwer, die andere Stimme vollständig zu verstehen, doch ich erkannte sie sofort. Augenblicklich streckte ich den Rücken durch und spannte den Kiefer an.
»Viola, tut mir leid. Ich habe das Letzte nicht verstanden, es ist so laut hier«, rief ich. Meine Stimme hörte sich merkwürdig gepresst an. Als würde mein amboss-schweres Herz auf meine Stimmbänder drücken.
»Liebes, ich bin froh, dich zu erreichen!«, antwortete sie und die Vertrautheit, die in ihrem Tonfall mitschwang, zog strohhalmgroße Risse durch mein Herz. »Ich wollte wissen, ob du noch Hilfe brauchst. So allein in einer neuen Stadt … Ich könnte vorbeikommen und mit dir die Wohnung einrichten. Philip würde bestimmt gern dabei sein.«
Meine Hände fingen an zu zittern. Ich hatte nicht an Viola gedacht. In meinem ganzen Plan, mich am Ende dieses Jahres umzubringen, hatte ich nicht an sie gedacht! Die Frau, die mir meine ersten Tampons gekauft und meine Sorgen als pubertierender Teenager ernst genommen hatte, war nicht einmal am Rand meiner Überlegung aufgetaucht. Würde ich mich von ihr verabschieden? Sollte ich sie doch öfter besuchen?
Nein. Nein, nichts von beidem. Es wäre zu schwer. Nur … scheiße, es würde sie fertigmachen.
»Zoe?«
»Oh nein, danke. Das …« Meine Stimme zitterte, brach und ich hustete. »Das ist wirklich lieb von dir, Viola, aber nicht nötig. Mir geht es gut. Ich habe schon einen Job.« Drei Jobs. Zwei davon unbezahlt. »Und mit Philip habe ich schon gesprochen.« Er hatte mit meiner Mailbox gesprochen. »Ich muss mich hier nur ein bisschen einleben.«
Die Lügen lagen so schwer auf meiner Zunge, dass ich Angst hatte, an ihnen zu ersticken. Viola hatte etwas Besseres verdient.
»Natürlich, Liebes. Ich vermisse dich hier nur. Wer isst denn jetzt meine Lasagne?« Die Zuneigung in ihrer warmen Stimme trieb mir die Tränen in die Augen. Ich kannte Viola mein Leben lang – so wie ich Claire mein Leben lang gekannt hatte. Sie war eigentlich Claires Mutter, aber irgendwie … irgendwie war sie auch meine gewesen. Doch genau deswegen konnte ich sie nicht in meinem Leben gebrauchen. Es war zu schwer.
»Ich … werde mir wohl meine eigene Lasagne machen müssen«, sagte ich mit noch immer zitternder Stimme, während der Amboss von meinem Herzen in meinen Magen rutschte.
»Großer Gott, nein!«, sagte Viola sofort. »Das Gericht, das du nicht verbrennst, muss erst noch erfunden werden … und wie ich dich kenne, hast du dich nicht um eine Hausratsversicherung gekümmert, die deine geschmorte Küche abdecken würde?«
Unfreiwillig musste ich lachen – denn natürlich hatte sie recht –, doch jeder Ton brannte auf meinen Lippen. »Du hast recht. Ich kaufe die Lasagne lieber.«
»Das wollte ich hören«, sagte Viola zufrieden. »Okay, Liebes. Ich schätze, du bist schwer damit beschäftigt, die Stadt unsicher zu machen, also lass ich dich mal wieder in Ruhe. Aber melde dich, sobald du Zeit hast, ja? Achim und ich würden gern deine neue Wohnung sehen.«
»Natürlich. Ich melde mich«, wisperte ich, die falschen Worte so bitter in meinem Mund, dass mir übel wurde. »Macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es super. Die Stadt ist bemerkenswert …« … hässlich.
»Okay, Zoe. Viel Spaß. Wir freuen uns so, dass du den Mut hast, endlich ein neues Leben anzufangen! Ich konnte es ehrlich gesagt kaum glauben, als du die neue Wohnung gesucht hast, aber ich bin froh, dass du dein Vorhaben wirklich umgesetzt hast. Das hast du verdient.«
Sie legte auf und ich starrte den Hörer an.
Der Amboss fiel aus meinem Magen, die Übelkeit flaute ab, meine Hände hörten auf zu zittern und jede Emotion verebbte. Immer weiter, bis ich wieder leer war. Gefüllt mit hässlichem, betäubendem Nichts.
Ich hatte keine Ahnung, welches Gefühl von beiden schlimmer war.
Donnerstag
03. Januar
noch 362 Tage
Claire,
was soll das Ganze hier?
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
»Die meisten Kinder schlafen noch, seien Sie also möglichst leise.«
Es war sechs Uhr zehn und eine kleine rundliche Frau Mitte dreißig, die sich als Viktoria vorgestellt hatte, führte mich den weißen Krankenhausgang auf Etage drei hinunter. »Ihre Aufgabe ist heute erst einmal, genau zu beobachten, was ich tue, dann können Sie morgen selbst die Bettpfannen leeren und die Akten zuordnen. Um acht bringen Sie den Kindern das Frühstück – achten Sie darauf, dass sie wirklich essen. Einige haben keinen Appetit, weil ihnen von der Chemo übel ist, aber es ist wichtig, dass sie die nötigen Nährstoffe bekommen.«
Ich nickte und folgte ihr. Der Gestank nach Desinfektionsmittel war auf den Gängen schlimmer als in den Zimmern. Als Jugendliche hatte ich den Geruch beruhigend gefunden, mittlerweile machte er mich nur nervös. Er bedeutete, dass es hier Menschen gab, denen das kleinste Bakterium zum Verhängnis werden konnte. Er erinnerte mich daran, wie viele Menschen bereits in diesen Hallen gestorben waren. Ich holte tief Luft, schüttelte den beunruhigenden Gedanken ab und murmelte: »Darf ich Sie etwas fragen?«
»Natürlich.«
»Diese Kinder hier, auf dieser Station. Haben sie alle Krebs?«
Die kleine Frau nickte. »Ja. Die dritte Etage ist ausschließlich für Krebspatienten bestimmt.«
Krebspatienten starben nicht plötzlich. Die meisten zumindest nicht. Ich hasste mich dafür, aber dieser Gedanke erleichterte mich. »Okay.«
Skeptisch musterte mich mein Gegenüber. »Haben Sie ein Problem damit?«
»Nein«, sagte ich betont freundlich. »Wo hole ich das Essen ab?«
Um Punkt acht teilte ich die Frühstückstabletts aus.
Ich hatte fest damit gerechnet, dass die Arbeit auf einer Kinderkrebsstation ein ziemlich trostloses Unterfangen war, aber ich hätte mich nicht mehr täuschen können. Die Kinder jauchzten nur so vor Lebenslust. Sie kicherten bei allem, was ich tat und sagte, obwohl sich meine Worte auf »Du solltest wirklich etwas essen« und »Kann ich sonst noch etwas für dich tun?« beschränkten. Sie rannten in ihren Zimmern umher, warfen mit Kuscheltieren nach mir und fragten mich andauernd, ob ich Kontaktlinsen trug oder ob meine Augen wirklich so blau wären.
Ich erwischte mich sogar einmal dabei, wie meine Mundwinkel zuckten, als ein Kind seinen Haferschleim ansah und »Wabbel, wabbel« flüsterte.
Mein Karren war beinahe leer und ich betrat das letzte Krankenzimmer, in das warmes Licht durch die geöffneten rot-orangenen Vorhänge fiel. Nur ein Bett stand hier und das war zerwühlt, aber leer. Verwirrt sah ich mich um, bis ich bemerkte, dass kleine Füße unter dem Gestell hervorlugten.
Unsicher sank ich auf die Knie und blickte unter den Lattenrost. »Hallo?«, fragte ich leise ins Halbdunkel. »Es gibt Frühstück.«
»Kein Hunger«, kam es fröhlich zurück.
»Du solltest aber wirklich was essen.«
»Iss doch selbst was!«
Ich hob einen Mundwinkel und legte mich im nächsten Moment flach auf den Bauch, mit dem Gesicht zum Bett. Diese Patientin besaß offenbar einiges an Charisma.
»Ich habe schon was gegessen«, erklärte ich freundlich, erkannte aber noch immer nicht mehr als ein paar unförmige Konturen. »Ich bin übrigens Zoe. Wie heißt du?«
»Mia«, antwortete das Mädchen. »Und das …«, sagte sie und schob einen blauen Stoffdelfin in mein Blickfeld. »… ist Herr Konrad.«
Herr Konrad. Der kam mir bekannt vor. »Herr Konrad ist aber süß«, bemerkte ich und streichelte den Delfin.
Ruckartig verschwand Herr Konrad wieder unter dem Bett und anstelle des Stofftiers erschien ein Gesicht. »Nein!«, meinte Mia entschlossen und zog eine Grimasse. »Herr Konrad ist nicht süß. Er ist staaark wie ein Löwe.« Sie benutzte ihre Hände, um das Wort stark zu unterstreichen. »Und furchteinflößend. Er hat vor nichts Angst. Außer manchmal vor Schwester Viktoria, weil sie ihn dauernd waschen will. Aber sonst vor nichts!«
Ihre Augen waren so weit aufgerissen, dass nicht einmal Hannibal Lecter es gewagt hätte, ihr zu widersprechen, und ihr kleines, unschuldiges Gesicht trug denselben Ausdruck der verwirrten Ernsthaftigkeit wie gestern im Fahrstuhl. So als verstehe sie nicht, wie ich die Erwachsene im Raum sein und trotzdem keine Ahnung haben konnte.
Deswegen nickte ich pflichtbewusst und sagte: »Du hast recht. Tut mir leid, der erste Blick hat getäuscht. Er sieht ziemlich beeindruckend aus. Ich wette, er kann dich gut beschützen. Schwester Viktoria muss verrückt sein, dass sie sich traut, ihn freiwillig anzufassen.«
Jetzt lächelte Mia breit und kroch ein paar Zentimeter unter dem Bett hervor, sodass ihr Gesicht beinahe meines berührte. »Ja. Die ist verrückt. Die versteht gar nichts.«
Der Rest ihres dünnen Körpers kam zum Vorschein und mit Herrn Konrad unter dem Arm sprang sie auf. Ich folgte ihrem Beispiel und stellte das Tablett auf den dafür gedachten Tisch.
Mia schürzte die Lippen. »Du bist die nette Frau mit dem traurigen Mund«, sagte sie geradeheraus und deutete mit dem Finger auf mich.
Perplex sah ich sie an. Ihr Blick war so eindringlich und aufmerksam, dass ich meinte, ihn auf meiner Haut zu spüren. Sie sprach nicht wie die anderen Kinder auf der Station, die nur herumblödelten. Sie redete, als würde sie verstehen und meinen, was sie da sagte. »Aber keine Angst«, fuhr sie im Flüsterton fort, als wolle sie mich nicht erschrecken. »Herr Konrad mag dich. Du musst gar nicht traurig sein. Er ist eigentlich sehr wählerisch, aber er findet deine Augen toll. Die sehen aus wie das Meer, aus dem er kommt.« Sie lächelte noch breiter und ließ sich im Schneidersitz auf dem Bett nieder. »Hast du auch einen Delfin zu Hause?«
»Ähm, nein. Leider nicht.«
»Mhm«, machte sie missbilligend. »Dann solltest du einen kaufen.«
Meine Mundwinkel zuckten. »Ganz bestimmt. Ich schäme mich sehr dafür, dass ich keinen habe.«
»Versteh ich«, sagte sie altklug. »Hast du denn schon mal einen gesehen?«
»Ja, habe ich. Im Zoo.«
Sie strahlte über das ganze Gesicht, als habe sie eine Glühbirne verschluckt. »Sind sie schön?«
Dank ihrer Begeisterung wurde mir unangenehm warm in der Brust und ich nickte steif, während ich den Tisch mit dem Tablett an ihr Bett rollte. »Wunderschön. Hast du denn noch keinen echten gesehen?«
Niedergeschlagen schüttelte sie den Kopf. »Neee … Ich bin zu krank, um in einen vollen Zoo zu gehen, meint meine Mama immer. Dabei würde Herr Konrad mir ja helfen, das zu schaffen!«
Bei dem Gedanken, dass Mia ihr Traum möglicherweise nie erfüllt werden würde, sank mir das Herz in die Hose. Ich hatte mich innerhalb der letzten Jahre erfolgreich von den Emotionen anderer abgeschottet … aber das traurige Lächeln des kleinen, viel zu erwachsen wirkenden Mädchens traf mich tiefer als erwartet und definitiv tiefer als gewollt. Ich sollte mich nicht direkt am ersten Tag so emotional involvieren. Aber wie herzlos wäre es, kalt und abweisend zu einem jungen, krebskranken Mädchen zu sein?
Wenn ich meine Schuld abarbeiten wollte, musste ich mich zusammenreißen. Ich konnte mich nicht ewig vor meinen Gefühlen schützen. Nicht, wenn ich helfen wollte.
»Keine Sorge«, sagte ich deshalb aufmunternd. »Bald kannst du bestimmt mal einen besuchen.«
»Echt?« Ihre Augen leuchteten auf. »Versprochen?«
Ich nickte einfach, weil ich sie lächeln sehen wollte.
Eigentlich hatte ich kein Recht dazu, ihr falsche Hoffnungen zu machen, aber ich konnte nicht anders. Wenn ich ihr keine gab, wer tat es denn dann? Die verrückte Schwester Viktoria etwa, die Herrn Konrad waschen wollte? Wohl kaum. »Versprochen.«
Ihr Lächeln wurde noch breiter. »Du bist nett.«
»Du auch. Willst du jetzt was essen?«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein. Ich hab gar keinen Hunger.«
Meine Brust zog sich enger zusammen. Sie war so dünn, dass ich das Bedürfnis verspürte, sie mit Butterblöcken vollzustopfen. Sie musste doch irgendetwas zu sich nehmen! »Aber Essen ist so lecker«, versuchte ich sie ungelenk zu überzeugen.
Sie rümpfte die Nase. »Nein. Herr Konrad findet das auch.«
»Nicht mal einen Bissen?«
»Nö.«
»Bist du sicher?«
»Ja.«
»Aber …«
»Nein!«, sagte sie lauter und schob die Unterlippe vor. »Nein, nein und nein. Ich will nicht und ich werde nicht und hör auf, zu fragen.«
Ich seufzte. Ich konnte ihr das Essen schlecht mit einem Trichter einflößen, also gab ich auf. Ich würde Viktoria fragen, ob es einen Trick gab, den ich das nächste Mal anwenden konnte. »Na gut. Ich lass dir das Tablett trotzdem stehen, falls du dich umentscheidest.«
»Werde ich nicht.« Die Entschlossenheit in Mias Stimme sprach für sich. Sie würde nichts essen. In einem früheren Leben musste sie mit eiserner Hand einen mittelgroßen Staat geführt haben.
»Okay. Ich muss dann mal weiter.«
Mia nickte. »Kommst du zum Mittagessen wieder?«
»Nein. Dann bin ich nicht mehr hier.«
Verdrießlich verzog sie den Mund. »Ihh … dann kommt wieder die verrückte Viktoria!«
Liebe Güte, sie musste die Gefühle von Mias Stoffdelfin wirklich sehr verletzt haben. »Ich fürchte schon. Aber ich kann ihr ja sagen, dass sie Herrn Konrad in Ruhe lassen soll.«
Mia nickte heftig und wiederholte ernst: »Die ist verrückt!«
»Ich werde mich vor ihr in Acht nehmen.«
Gerade als ich aus dem Zimmer trat, tauchte die verrückte Viktoria aus dem Stationszimmer auf. »Alles in Ordnung?«, fragte sie und besah sich meinen leeren Karren. »Haben alle Kinder gegessen?«
Ich schob den Wagen vor mir her und nickte. »Fast alle. Nur Mia nicht.«
Eine Sorgenfalte erschien auf der Stirn der Pflegerin und sie seufzte. »Das dachte ich mir schon. Sie isst seit Tagen kaum noch etwas. Wenn das so weitergeht, müssen wir sie künstlich ernähren und das ist keine schöne Angelegenheit.«
Bei der Vorstellung zog sich mein Magen unangenehm zusammen. »Können die Eltern ihr nicht gut zureden?«
Sie schüttelte den Kopf. »Wir haben schon alles versucht. Sie hat einfach keinen Hunger. Das kommt natürlich größtenteils von der Chemo, aber sie muss essen. Damit ihre Abwehrkräfte nicht noch weiter geschwächt werden.«
Ich nickte und stellte den silbernen Wagen zu den anderen leeren in eine Kammer neben dem Stationszimmer. »Was hat Mia denn?«
Viktoria warf mir einen bedauernden Blick zu. »Leukämie, außerdem einen Tumor in der Wirbelsäule.«
Mein Hals wurde eng. »Oh«, sagte ich tonlos.
Es ist eine Kinderkrebsstation, Zoe, was hast du erwartet?, warf ich mir vor … trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass mein Herz schwerer wurde und eine unsichtbare Last mir auf die Brust drückte. »Besteht denn Chance auf Heilung?«, fragte ich leise. Ich hatte Angst vor der Antwort.
»Eine kleine Chance besteht immer. Wir haben schon eine intensive Chemo eingeleitet und den Tumor in einer Operation verkleinert, aber Mia ist sehr klein und dünn. Deswegen darf sie nicht nach Hause. Das Problem ist eher, dass sie zurzeit zu schwach ist, um eine größere Operation zu überstehen.« Sie seufzte. »Wir brauchen unbedingt einen kompatiblen Knochenmarkspender, bevor wir den Tumor komplett entfernen können. Und die sind furchtbar schwer zu finden. Ihre Eltern haben sich natürlich direkt testen lassen, aber sie stimmen nicht überein. Geschwister hat Mia nicht und viel zu wenige Menschen registrieren sich als Spender.«
Ich nickte steif. Es bestand eine Chance. Das würde ich mir merken. Mia war dickköpfig. Sie würde kämpfen. Mehr als zu hoffen, konnte ich auch nicht. »Okay«, sagte ich deshalb und streckte den Rücken durch. »Gibt es noch irgendetwas für mich zu tun?«
Viktoria sah auf ihre Armbanduhr. »Warten Sie eine halbe Stunde, dann können Sie die leeren Tabletts wieder abholen. Bis dahin bleiben Sie einfach im Stationszimmer und schauen mal bei den Kindern vorbei, falls eines um Hilfe bittet. Das System der leuchtenden Knöpfe habe ich Ihnen ja schon erklärt.«
Ich steckte die Hände in den weißen Mantel und nickte. Schwester Viktoria wollte sich schon von mir abwenden, als mir wieder einfiel, was ich Mia versprochen hatte. »Ach, Viktoria.« Sie drehte sich noch einmal zu mir um. »Sagen Sie Mia lieber nicht mehr, dass Sie ihren Stoffdelfin waschen wollen. Das mag sie überhaupt nicht.«
Irritiert sah die Stationsleiterin mich an, schließlich nickte sie jedoch. »Okay.«
Ich zog Mantel, Schal und Handschuhe aus und verfrachtete sie mitsamt Tasche in einen Spind, den ich mit meinem Mitarbeiterausweis abschloss. In dem Bankgebäude fühlte ich mich noch unwohler als im Krankenhaus – der Geruch nach Geldgier und Größenwahn machte mich nervöser als der nach Desinfektionsmittel –, aber was tat man nicht alles für vierzehn Euro die Stunde. Zwar hatte ich einiges gespart, aber davon ein Jahr in einer Kölner Wohnung leben, die nicht aus Pappe bestand, konnte ich auch nicht.
Der Postraum war gerade groß genug, damit sich zwei Personen und an die siebenhundert Briefe darin aufhalten konnten. Ein braunhaariger Mann sortierte bereits die ersten Umschläge vor, sah aber grinsend auf, als ich die Tür hinter mir schloss.
»Na, endlich bekomme ich Gesellschaft!«, bemerkte er erleichtert. Er trug eine knallenge Jeans, glänzende Lackschuhe, ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift Wanna dance? und ein kariertes, offenes Hemd darüber. Die Haare hingen ihm in die Stirn und eine schwarz umrandete Brille verdeckte seine braunen Augen. Er sah aus wie ein Werbeposter für die Kleidermarke Party-Nerd.
»Hallo, ich bin Lennart.« Er reichte mir enthusiastisch die Hand. »Nur, damit du nicht auf falsche Ideen kommst: Ich bin nicht interessiert.« Er grinste mir breit zu und fuhr damit fort, Briefe in verschiedenfarbige Boxen zu werfen.
»Wow. Ich habe meine Magie wohl verloren«, rutschte es mir raus.
Lennart lachte laut. »Nein. Sorry. Ich habe nur keine Lust auf Stress am Arbeitsplatz. Wie heißt du?«
»Zoe. Beziehungsphobikerin.«
»Schicker Nachname, Zoe Beziehungsphobikerin«, meinte er anerkennend und zog weitere Briefe zu uns heran. »Dann sind wir ja auf derselben Seite.«
Das bezweifelte ich.
»Gut, hilf mir einfach gleich beim Sortieren«, fuhr Lennart fort und deutete auf die riesigen Stapel. »Das Management liegt im zweiten Stock, dafür ist die gelbe Box. Schließfächernachrichten kommen in die blaue. Briefe, die keine bestimmte Person ansprechen, kommen in die rote Box. Danach sortieren wir die Briefe noch alphabetisch.«
Ich nickte und machte mich an die Arbeit.
Es stellte sich heraus, dass Lennart ein Schauspieler war, der auf seinen Durchbruch wartete, und diesen Job genauso wie ich als Mittel zum Zweck sah. Natürlich verriet ich Lennart nicht die ganze Wahrheit. Ich beließ es bei der Aussage, dass ich mir nicht sicher war, was ich vom Leben wollte, und bis ich es wusste, musste ich eben Geld verdienen.
Lennart war ein sehr angenehmer Mitarbeiter. Er fragte nicht zu viel nach und es wurde nicht langweilig mit ihm. Er war lustig, nicht auf den Kopf gefallen und dachte genauso wie ich, dass reiche Leute ihre Hunde nicht wie ihre Kinder anziehen sollten.
Fürs Vorordnen der Post allein brauchten wir bereits zwei Stunden. Um viertel nach eins hatten wir den letzten Brief einsortiert und begannen, sie an die Angestellten zu verteilen. Lennart erklärte mir, wo die Schließfächer waren und wie ich im zweiten Stock vorgehen sollte. Da er schon länger angestellt war als ich, hatte er die Freude, die Personalabteilung zu bedienen.
Nachdem ich die Briefe in die Schließfächer eingeworfen hatte, begab ich mich in den zweiten Stock, den ich sofort wiedererkannte. Hier war ich gestern eingestellt und bis auf die Knochen blamiert worden. So etwas vergaß man nicht über Nacht.
Ich fing mit den kleinen Kabuffs im Großraumbüro an und arbeitete mich zu den hinter Glastüren verborgenen Einzelbüros vor. Auf meinem Weg dorthin machte ich eine sehr interessante Beobachtung: Mit jeder weiteren Ziffer auf dem monatlichen Gehaltscheck wurden die Menschen unhöflicher.
In den Kabuffs bedankten sich die Mitarbeiter noch und lächelten mir zu. In den kleinen, aber mit Türen vom Gemeinschaftsraum getrennten Büros winkten mich die Manager fahrig herein und fuchtelten mit der Hand in Richtung irgendeines Platzes, auf dem ich die Post ablegen sollte. In den größeren Einzelbüros wurde ich überhaupt nicht beachtet. Stattdessen wurden nur irgendwelche Zahlen und Bilanzen herumgeschrien.
Mhm. Ich war zwar kein Racheengel, doch meine Abneigung gegen diese Menschen, die mit ihrem Jahresgehalt fünf Kleinfamilien unterhalten könnten, führte dazu, dass ich kleinere Fehler beging. Merkwürdigerweise fiel es mir immer schwerer, die Namen auf der Post zu lesen. Und bevor ich unnötig Zeit damit verschwendete, jeden einzelnen Buchstaben genau anzusehen, lud ich die Briefe eben einfach irgendwo ab.
Sollten die egoistischen Anzuggötter doch sehen, was sie davon hatten, und ihrer Post nachjagen.
Gerade als ich die letzten Briefe abgeladen hatte – Frau Meisner bekam heute die Post von Herrn Gaup (zu meiner Verteidigung: sie hatte wirklich männliche Züge, während sie ins Telefon blaffte, und es war eben keine andere Post übrig geblieben!) –, zerriss eine plötzliche Schimpftirade die Stille des Büros.
»Wie unfähig sind Sie eigentlich? Wer hat Sie als Sandwichboten eingestellt, wenn Sie eine Tomate nicht von einer Gurke unterscheiden können? Eine Tomate ist rot und rund, eine Gurke grün und länglich. Herrgott! Ich wollte Tomaten, keine Gurken! Muss ich jetzt auch damit rechnen, dass auf dem Brot kein Hühnchen, sondern Schinken ist?«
»Es … Es tut mir wirklich leid …«
Ich zuckte unwillkürlich zusammen und konnte mich nicht davon abhalten, in dieselbe Richtung zu glotzen wie vierzig andere Leute in diesem Raum.
Die durchdringende dunkle Stimme kam von einem großen Mann mit schwarzen Haaren und teurem Anzug. Ich hätte ihn zwischen Anfang dreißig und Ende Arschloch geschätzt.
Die andere, unterwürfige Stimme drängte sich aus der Kehle eines vielleicht 25-jährigen Sandwichboten, der ein Wägelchen vor sich herschob.
Ich warf nur einen Blick auf den wütenden Anzugträger und verstand sofort, warum der Junge eingeschüchtert war. Der Banker überragte ihn um einen Kopf und seine dunklen Augen versprühten Funken. Mit seiner düsteren Ausstrahlung könnte er jeden Baum fällen.
»Mir tut es auch leid, dass Sie kein Sandwich machen können!«, brüllte der Mann.
»Ich … Ich mache die gar nicht. Ich verteile sie nur. Wenn Sie wollen, kann ich Beschwerde einreichen, aber ich fürchte, sie werden nicht wissen, wer den Fehler gemacht …«
»Es ist mir vollkommen egal, wer den Fehler gemacht hat. Ich verlange sofort ein neues Sandwich!«
Was für ein Mistkerl! Der Bote sollte das Sandwich nehmen, die Gurken runterschmeißen, draufspucken und es zurückgeben.
Aber das tat er natürlich nicht. In sich zusammengesunken nahm er das verpackte Brot zurück und schob mit eingezogenem Kopf das Wägelchen weiter. Der Mann stürmte zurück in sein Büro.
Was stimmte nur mit manchen Menschen nicht? Sexuelle Frustration, keine Zukunftsaussichten und Depressionen waren keine Entschuldigung. Ich war ja schließlich auch noch nett.
Diese Frage würde wohl unbeantwortet bleiben. Aber die Antwort auf die Frage, wessen Post der laute Anzugträger morgen wohl bekommen würde, war einfach: Nicht seine.
Samstag
05. Januar
noch 360 Tage
Claire,
wann sind alte Frauen so verrückt geworden?
Seit zwei Tagen arbeite ich in dem Altenheim und bis jetzt wurden mir nur giftige Blicke und Zahnprothesen hinterhergeworfen. Die alten Leute in diesem Haus sind noch so voller Energie, dass ich mich frage, ob sie aus Langeweile ins Heim gegangen sind.
Gestern hat Sophia mich beschuldigt, ich würde ihr Karl ausspannen wollen. Ich solle mir mein eigenes Revier abstecken. Der Mann ist 84! Sehe ich etwa aus wie ein Playmate, das reich erben will?
Auf jeden Fall hat Sophia im Speisesaal eine Szene veranstaltet, sich absichtlich fallen lassen und mir vorgeworfen, ich hätte sie nicht richtig festgehalten. Karl hat mich angesehen, als hätte ich persönlich den Bau der Atombombe vorangetrieben. Sophia hat mir die Zunge rausgestreckt. Das ist kein Altenheim, das ist ein Affenhaus! Mia will immer noch nichts essen und ernährt sich von drei M&Ms am Tag. Wenn das in zwei Wochen nicht besser wird, muss sie künstlich ernährt werden und es gibt nichts, was ich tun könnte, um ihr zu helfen.
In der Bank verteile ich weiterhin fröhlich die falsche Post. Bis jetzt hat mich noch niemand darauf angesprochen, aber das ist nur eine Frage der Zeit.
Bin gespannt, wer als Erstes am Rad dreht.
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
Montag
07. Januar
noch 358 Tage
Claire,
mir ist eingefallen, was noch auf die Liste muss: Einmal so richtig betrinken! In Gedenken an unser Abi.
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
Es schneite. Schon den ganzen Morgen über.
Grundsätzlich hatte ich nichts gegen Schnee, wäre er nicht so kalt und so nass und so furchtbar grell weiß. In der Eingangshalle des Bankgebäudes wischte ich den Matsch von meinen Schuhen und verstaute meine Sachen. Als ich kurz darauf in den Postraum trat, war Lennart schon fröhlich pfeifend an der Arbeit. Er schien nie schlechte Laune zu haben und nicht einmal ich, das Anti-Honigkuchenpferd, konnte ihm einen Dämpfer verpassen.
»Hey, Zoe«, begrüßte er mich überschwänglich und umarmte mich, als würden wir uns bereits monatelang und nicht erst seit ein paar Tagen kennen. »Meine Güte, mein Wochenende war vielleicht anstrengend. Aber auf die gute Art und Weise! Ich habe so viel getrunken, dass ich mich nur an die Hälfte meiner peinlichen Aktionen erinnere. Ist vielleicht auch besser so. Wenn die Polizei mich befragt, kann ich ihnen aufrichtig verklickern, dass ich keine Ahnung habe, worüber sie reden!«
Die nächste halbe Stunde fuhr er damit fort, mir von einem heißen spanischen Feger mit den Haaren von Gisele Bündchen zu erzählen, und zu meiner Erleichterung nahmen seine Geschichten auch danach kein Ende. Das bedeutete nämlich, dass ich nichts sagen musste. Aber gerade, als wir die Post fast aufgeteilt hatten und ich dachte, ich sei aus dem Schneider, hielt Lennart inne und schloss den Mund.
»Tut mir leid«, sagte er seufzend, aber immer noch grinsend. »Ich wollte dich nicht so zutexten. Aber manchmal vergesse ich mich einfach und höre nicht auf zu reden! Kennst du das?«
Mein Herz stolperte und ich schluckte.
Hatte ich mal gekannt. Vor drei Jahren. Damals hatte Claire mich hinterrücks angegriffen und ihre Hand auf meinen Mund gepresst, weil es ihrer Meinung nach keine andere Möglichkeit gab, mich zum Schweigen zu bringen. Ich hatte kindischerweise ihre Hand angeleckt, sie war mit einem lauten Ihh! aufgesprungen und hatte sie an Philips T-Shirt abgewischt. Den Ausdruck auf seinem Gesicht würde ich nie vergessen.
»Klar, kenne ich«, sagte ich knapp und wandte den Blick ab, damit er nicht sah, dass meine Augen feucht wurden. Manchmal tat die Erinnerung an die guten Zeiten mehr weh als die an die schlechten. »Ist kein Problem. Ich höre dir gern zu.«
»Nein, nein, nein«, wehrte Lennart ab und fuchtelte mit mehreren Briefen vor meiner Nase herum. »Das ist nicht okay. Du hast mir überhaupt nichts von deinem Wochenende erzählt. Leg los: Irgendwelche peinlichen Stories? Hast du nackt auf der Theke getanzt? Das machen manche Leute. Habe ich gehört.«
»Nein«, sagte ich defensiv. »Nichts dergleichen.« Obwohl es schon peinlich war, dass ich am Wochenende nichts anderes gemacht hatte als zu lesen, fernzusehen und zu essen. Ich hatte schließlich eine Liste abzuarbeiten.
»Mhm.« Offenbar waren meine Antworten nicht zu Lennarts Zufriedenheit. Na ja, andererseits hätten diese Informationen wohl auch nur einen Golden Retriever glücklich gemacht.
»Betrunken?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Kerl?«
»Nein.«
»Striplokal? Bar? Spielcasino?«
»Nein, nein, nein.«
»Was führst du bloß für ein Leben, Mutter Teresa?« Schockiert sah er mich an. »Versuchst du, deinen Platz im Himmel zu reservieren?«
Ja. Genau das. Ich wollte einen verdammten Fensterplatz!
Ich zuckte die Achseln. »Ich brauchte eben ein ruhiges Wochenende.«
»Ohh … das kommt aber nicht mehr oft vor! Ich adoptiere dich.« Warnend richtete er seinen Zeigefinger auf mich. »Nächste Woche kommst du mit mir und meinen Freunden mit. Du bist neu hier, du brauchst frische Kontakte!«
Nein. Frische Kontakte waren gerade das, was ich vermeiden wollte. Ich wollte keine neuen Freunde, keine Liebe und keine Vertrautheit. Und das wollte sicherlich auch keiner von mir. Ich war eine Limited Edition.
Was wäre ich für ein Produkt, das sich neue Freunde suchte, ihre Zuneigung gewann und dann nach 358 Tagen auf ewig ausverkauft war? Ein schlechtes. Die Leute würden mir reihenweise schlechte Rezensionen auf Amazon hinterlassen und mit einer Ein-Sterne-Bewertung wollte ich nicht sterben.
»Tut mir leid. Nächste Woche bin ich schon verabredet«, log ich und hob entschuldigend die Schulter.
Lennart verengte die Augen zu Schlitzen. »Mit wem? Was machst du?«
Gott sei Dank war ich schon immer äußerst talentiert im Improvisieren gewesen. »Mit Johnnie, wir gehen Samstag ins Kino. Titanic wurde neu aufgelegt. Und Sonntag habe ich Besuch von alten Freunden.«
In den Film wollte ich wirklich gehen. Er stand auf meiner Liste und ein Kinobesuch war weniger trostlos als eine Filmsession zu Hause. Mein Freund Johnnie Walker hatte ein gemütliches Plätzchen in meinem Schrank.
Die Antwort schien Lennart zu genügen, denn er nickte und bemerkte: »Gut, dann aber irgendwann anders. Ich vergesse das nicht, glaub mir.«
Leider tat ich das. Sein Blick verströmte eine Willenskraft, mit der er einen Löffel verbiegen könnte.
»Abgemacht«, sagte ich und legte den letzten Brief an seinen Platz. Ich suizidgefährdete Lügnerin.
Heute war ein besonderer Tag.
Ich hatte mich am Morgen dazu entschlossen, die Post richtig zu verteilen. Nach längerer Überlegung war mir aufgegangen, dass ich – falls alle Mitarbeiter ihre Unzufriedenheit äußern würden – tatsächlich gefeuert werden würde. Schließlich war dieser Job für jeden Idioten geeignet. Deshalb musste ich wohl oder übel den Kürzeren ziehen.
Das hieß, einige Ausnahmen machte ich natürlich. Manche Menschen mussten für ihr Verhalten bestraft werden und darin sah ich zurzeit meine Berufung. Also abgesehen von der Wiedergutmachen-und-dann-umbringen-Sache.
Der schwarzhaarige Anzugtyp mit der dunklen Stimme und den düsteren Augen hatte an drei von fünf der letzten Tage irgendwen angeschrien. Er stand also mit ziemlicher Sicherheit auf der Liste der Personen, die den Tag damit verbringen würden, ihrer Post nachzujagen. Er schien allerdings nicht besonders glücklich über seine Sonderstellung zu sein.
Ich schob gerade den Postwagen an seinem Büro vorbei, als ich feste Schritte und den Knall einer zugeworfenen Tür hörte.
»Fräulein«, knurrte er hinter mir. »Ich weiß ja, dass Ihr Job scheiße ist, aber würden Sie ihn wenigstens vernünftig machen? Ist Ihnen das Alphabet geläufig? Diese Anordnung von Buchstaben, die eine bestimmte Reihenfolge haben? Grundschule?«
Okay. Ich wollte zwar sterben, aber ich hatte meine Prinzipien.
Niemand nannte mich Fräulein!
Wütend wandte ich mich um … und musste erst einmal schlucken. Ich sah nicht in sein Gesicht, sondern gegen eine Brust. Eine im weißen Hemd verpackte, scheinbar sehr muskulöse Brust. Hastig hob ich den Blick und betrachtete den Sandwichhasser etwas genauer. Schwarze Strähnen hingen ihm ins Gesicht, als hätte er sich gerade die Haare gerauft, und ein Dreitagebart zierte seinen Kiefer. Seine dunklen Augen wirkten müde – das machte seine Wut allerdings wieder wett.
»Sie schon wieder«, stieß ich genervt aus. »Haben Sie keine wichtigen Telefonate zu erledigen? Oder müssen Sie unbedingt erneut beweisen, dass Sie ein furchtbarer Mensch sind?«
Seine Augenbrauen flogen in die Höhe. »Ich schon wieder?« Alle anderen Aspekte meiner Beschuldigung überging er völlig. »Wenn Sie den Mann meinen, der seit Tagen die falsche Post zugeteilt bekommt, dann ja. Sie liegen richtig. Ich schon wieder.«
Ich zog meine Wangen ein und atmete aus. War das, was ich als Nächstes sagen wollte, klug? Andere Frage: Lohnte es sich, in meinem restlichen Leben klug zu sein?
Ich räusperte mich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Nein, ich spreche von einem erneuten Wiedersehen mit dem Arschloch der Etage. Kein Wunder, dass ich Ihnen die falsche Post gebracht habe. Sie ist nicht an Vollidiot Nummer 1 adressiert.«
Der Kiefermuskel des Sandwichhassers zuckte und für eine Zehntelsekunde war ich überzeugt davon, dass er gleich lachen würde. Doch dann presste er die Lippen aufeinander. »Tatsächlich? Was verschafft mir die Ehre dieses Titels?«
Ich verengte die Augen. »Welchen? Den des Arschlochs oder den des Vollidioten Nummer 1? Sie müssen schon spezifischer sein.«
»Fangen wir doch mit dem Arschloch an.«
Ich zuckte die Achseln. »Sie haben keinen Respekt. Vor niemandem. Innerhalb der paar Tage, in denen ich hier arbeite, haben Sie jeden Tag jemanden angebrüllt.« Nun gut. Drei von fünf. Aber ich war ja auch nicht den ganzen Tag hier oben.
Er zuckte nicht mit der Wimper. »Und der Vollidiot Nummer 1?«
»Ich dachte, die Erklärung dafür wäre in meiner letzten Aussage mitinbegriffen gewesen«, bemerkte ich schnippisch und stemmte die Hände in die Seiten. Er mochte groß sein, doch ich war … eine Frau! Und mit zwölf Jahren hatte ich eine Stunde Karate genommen. Ich war krass. »Außerdem sind Sie offenbar nicht dazu fähig, Gurken von einem Sandwich zu nehmen. Das zeugt doch von einem gewissen Grad an Dummheit, finden Sie nicht?«
Der Mann verschränkte die Arme vor der Brust. »Wie heißen Sie?«
»Wieso? Wollen Sie meinen Namen auf Ihre schwarze Liste schreiben?«
»Wie heißen Sie?«, wiederholte er schlicht, der Blick aus seinen schwarzen Augen berechnend.
»Zoe.« Warum sollte ich ihm meinen Namen nicht sagen? Der Kerl irritierte mich!
»Zoe. Gut. Ich bin Alex. Alex Ferra. Nicht Johann Meira.« Er schob einen Packen Post auf meinen Wagen und zog seinen Stapel herunter, dann drehte er sich um und lief die paar Meter zu seinem Büro.
»Hey«, rief ich ihm verwirrt hinterher. »Wozu brauchten Sie jetzt meinen Namen?«
Er wedelte mit der Post über seinem Kopf hin und her. »Damit ich weiß, wen ich jetzt besser respektieren sollte.«
Es dauerte drei Sekunden, bis ich bemerkte, dass meine Kinnlade hinuntergeklappt war.
Samstag
12. Januar
noch 353 Tage
Claire,
nur weil ein Film ein paar Oscars gewinnt, heißt das nicht, dass er gut ist!
Ich musste das auf die harte Tour lernen.
Ich vermisse dich.
In Liebe
Zoe
»Hey, hier ist noch mal Philip. Ich weiß von Viola, dass du viel um die Ohren hast, aber ich würde mich freuen, wenn du mal anrufst. Einfach nur, um zu reden. Bis dann.«
Ich starrte auf das Display, schloss kurz die Augen und löschte die Nachricht. Ich hatte sie zu Hause anhören wollen, aber ich vermisste Philip und … jetzt bereute ich, dass ich nicht gewartet hatte.
Ich wusste, dass er reden wollte. Ich wusste auch, worüber er reden wollte. Aber ebenso war mir bewusst, dass das nicht passieren würde. Mein Herz sank mir in die Hose und augenblicklich wurden meine Handflächen feucht. Allein an ein Gespräch zu denken, machte mich nervös. Ich hatte gewusst, dass es nicht unbedingt leicht werden würde, mein altes Leben komplett auszusperren. Aber wie sehr ich Philip und Viola gleichzeitig fürchten und vermissen würde, hatte ich nicht geahnt.
Ich schob das Handy zurück in meine Handtasche und zog den Einkaufswagen um die nächste Ecke. Ich würde sie beide im August wiedersehen. Spätestens.
Seufzend betrachtete ich das Meer aus Milchtüten vor mir. Laktosefreie, Soja-, Voll-, Halbfettarme-, Fettarme-, H- und Biomilch.
Bevor ich nach Köln gezogen war, hatte ich Einkaufen immer für eine simple Routine gehalten. Doch die Supermärkte in der Großstadt waren anders als die auf dem Dorf. Hier bestand Einkaufen aus einer anstrengenden Entscheidung nach der anderen. Die Auswahl war einfach zu groß! Kurzerhand schloss ich die Augen und schwang meinen Arm wahllos von einer Seite zur anderen, dann hielt ich an.
Sojamilch.
Ihh.
Noch mal.
Diesmal kam die Vollmilch heraus. Das war okay. Ich nahm zwei Liter und ging zum Joghurt weiter. Kirsche. Da gab es keine Verhandlung.
In Gedanken versunken beugte ich mich vor und spiegelte mich in den Leisten der Theke. Lauter Menschen standen hinter mir, liefen durch die Gänge und …