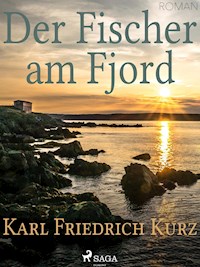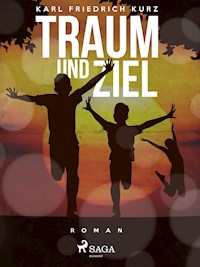Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein Dampfer fährt durchs Rote Meer nach Süden. In der Hölle der Hitze sind nur noch wenige an Deck. Omsky ist in Port Said an Bord gekommen – mit langen Schritten geht er auf dem obersten Deck hin und her. Über einem Rettungsboot im gespannten Segeltuch liegen Basil Nada, ein Kaufmann aus Damaskus, und der Forscher Nordau. Drei Jahre hat Nordau in Marib gelebt, verkleidet als armer Jude. Die Araber waren viel zu stolz, als dass sie einen unbewaffneten Juden angreifen würden, und so hat er überlebt. Aber die Schätze, die er angeblich dort vergraben hat, Inschriften, Kunstgegenstände ... interessieren Basil Nada nicht. Der will nach Aden fahren und weiterziehen ins unwegsame Persien bis nach Teheran, um Teppiche zu kaufen. Während er in der Hitze gelangweilt den Worten Nordaus lauscht, denkt er an sein Haus in Damaskuscham und die erst sechzehnjährige Ferideh, seit kurzem sein Weib und der Gipfel seines Wohlstands. Auch der Heizer Omar denkt an diese Stadt, an deren Rand seine Hütte steht. Als der große Krieg kam, hat man Omar von Hasne fortgehholt und ihm Waffen gegeben. Er versteht das alles auch heute noch nicht. Plötzlich explodiert der Dampfer wie ein elendes Spielzeug aus Pappe und die vier finden sich in einem Rettungsboot wieder. Einer Scheherazade gleich erzählt Karl Friedrich Kurz vom großen Zija, dem alten Abu Bekr und den verwirrenden Wegen dieser vier Menschen, deren Glück und Schicksal sich in der Weite Arabiens verlieren.Fantastisch-märchenhaft erzählter Roman über vier Männer und ihre Abenteuer in einem Arabien voller Gefahren und Geheimnisse.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karl Friedrich Kurz
Zijas Perlen
Roman
Dritte Auflage
Saga
Zijas Perlen
© 1929 Karl Friedrich Kurz
Alle Rechte der Ebookausgabe: © 2016 SAGA Egmont, an imprint of Lindhardt og Ringhof A/S Copenhagen
All rights reserved
ISBN: 9788711518465
1. Ebook-Auflage, 2017
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für andere als persönliche Nutzung ist nur nach Absprache mit Lindhardt und Ringhof und Autors nicht gestattet.
SAGA Egmont www.saga-books.com – a part of Egmont, www.egmont.com
Meiner lieben SchwägerinRosa Adelheid
Weggenossen
Ein Dampfer fährt durchs Rote Meer nach Süden.
Im tiefen Himmel steht der Mond als eine blanke Scheibe, grünlich schillernd und unglaubhaft nah. Er bildet keinen Kreis. Seine obere Seite ist eingedrückt und ein wenig zerzaust. Aber er scheint doch so hell, dass man die Löcher an den Blöcken der hochgezogenen Ladebäume deutlich erkennen kann. Die Blöcke umkränzen den Mast wie eine Reihe Totenschädel. Unter den Kolbenstössen der Maschine zittern sie unaufhörlich.
Südwärts streicht der Wind. Auf spitzen Wellen knistert der Schaum und glitzert fahl im Mondlicht. Der Rauch aus dem Schornstein steigt in gerader Linie zu Riesenhöhe empor, wächst als eine schwarze Säule in den leeren Nachthimmel und breitet sich hoch oben aus wie die Krone eines ungeheuren Baumes.
Schon zwei Tage lang stand dieser schwarze Baum über dem Dampfer und überschattete ihn. Zuweilen rieselt es wie feiner Regen aufs Deck herab. Das ist Russ und kein Wasser, denn der Himmel hat seit Wochen keine Wolken.
Der Dampfer steuert den Kurs auf Bab el Mandeb, das Tor der Tränen.
Qualvolle Hitze erfüllt ihn. Nicht der geringste Windzug kühlt seine Stahlwände. In den engen Räumen scheint die Luft zu kochen, und sie ist stickig und schwer, verdorben vom Kohlenstaub und den Dünsten aus dem Maschinenraum. An der Holzvertäfelung wölbt sich der Lack zu Blasen und springt ab. Zwischen den Planken quillt das Pech auf.
Die Menschen hat ein unruhiger Fiebertaumel erfasst. Sie gehen wie im Traum mit aufgedunsenen Gesichtern und bangen, stieren Augen. Das ist die Hölle.
Die Menschen haben sich lange gegen die Hitze gewehrt. Aber allmählich wurde ihr Wille gelähmt. Wenige sind nur noch, die sich nicht unterworfen haben.
Auf dem obersten Deck geht Omsky mit langen Schritten hin und her, vom schwarzen Schornstein bis zum niedern Bord, auf dem die Brandeimer stehen. An der einen Seite seines Weges hat er die Rettungsboote, an der andern die Luftschächte der Innenräume. Die Boote beben und zerren unablässig in ihren Tauen. Über den Schächten sind die Luckenfenster weit geöffnet. Sie gemahnen an mächtige Vögel, die ihre Schwingen zum Fluge breiten.
Omsky ist in Port Said auf den Dampfer gekommen. Er ist hoch und schmal mit verwittertem Gesicht und scharfen Zügen. Seine Augen sind grau und klar, manchmal scheinen sie zu brennen, so hell sind sie. Omsky hat noch mit keinem geredet. Man sieht ihn nur stets auf seiner Wanderung.
Hinter der langen Reihe der Luftschächte im gespannten Segeltuch über einem Rettungsboot liegen Basil Nada, ein Kaufmann aus Damaskus, und der Forscher Nordau.
„Warum haben Sie denn nicht ein Schiff bis nach Dschidda genommen?“ fragt Basil Nada schläfrig. „Von Dschidda geht doch eine grosse Karawanenstrasse nach Mekka. Und von dort haben Sie den alten Weg nach Sana.“
„Diesen Weg kenne ich,“ entgegnet der Forscher. „Er ist lang und teuer. Ich habe wenig Zeit. Ich verfüge auch nur über geringe Mittel. Deshalb werde ich den Kapitän überreden, dass er bei Hodeida unter die Küste geht.“ Plötzlich beugt er sich vor und flüstert: „Ich will nach Marib!“
„Nach Marib?“
„Dem alten Saba, der einstigen Hauptstadt des Sabäerreiches.“
Für einen Augenblick erwacht Basil Nada aus seiner müden Gleichgültigkeit.
„Oh — oh! Sie werden nie nach Marib kommen! Die Araber werden Sie umbringen.“
Es gibt eine Pause. Dann sagt Nordau in verändertem Tone: „Ich bin dort gewesen, fast drei Jahre lang ... Wie Halevy verkleidete ich mich als armen Juden. Die Araber sind viel zu stolz, als dass sie einen unbewaffneten Juden angreifen würden. Das liegt unter ihrer Würde ... Ja — ich war in Saba ... Und ich habe vieles gefunden und verborgen.“
Basil Nada ist in der Tat sehr schläfrig. Mitternacht muss vorüber sein. Man wird sich auch diese Nacht wieder hier auf dem schmutzigen Segeltuch zum Schlafen legen müssen, unter der Krone des Rauchbaumes, aus dem es Russ regnet.
„Was haben Sie denn gefunden?“
„Ungeheuere Schätze! Sagenhafte Reichtümer, Dinge, die von unermesslichem Werte sind ...“
Nordau wird eifrig. Er vergisst Hitze und Russ.
„Ich bin den Spuren Eduard Glasers gefolgt ... Wie hat man diesem Deutschen doch unrecht getan! Er war einer der kühnsten Forscher aller Zeiten. Jahrelang lebte er in Tunis und in Ägypten, um sich mit den Sitten und der Sprache der Araber vertraut zu machen. Als Moslem verkleidet drang er ins Innere Jemens vor. Und er erwarb sich die Freundschaft vieler Stämme. Noch heute redet man in den Lagern von ihm. Im zivilisierten Europa aber liessen die Gelehrten seine Entdeckung nicht gelten und missgönnten ihm seinen Erfolg.“
Basil Nada steht Nordaus Wissenschaft kühl gegenüber. Jedoch Schätze sind auch für ihn von Wichtigkeit. Er zündet sich eine Zigarette an.
„Welcher Art sind die Sachen, die Sie gefunden haben?“
„Inschriften, Kunstgegenstände — ganze im Sande versunkene Städte ...“
Enttäuscht sinkt der Kaufmann aus Damaskus wieder auf das Segeltuch zurück.
„Sie hätten Gold finden sollen, mein Bester, oder Edelsteine.“
„Gold?! Was ich fand, ist mehr wert als Gold. Ich habe alles im Sande vergraben. Viele Kamellasten ... Man muss eine Expedition ausrüsten. Der Weg ans Meer ist beschwerlich und lang. Das wird viel Geld kosten. Ich habe in meiner Heimat Hilfe für die grosse Sache gesucht. Vergebens. Man behandelte mich mit Misstrauen und Spott ... Aber jetzt werde ich es auf eigene Faust machen. Vielleicht geht es mir dabei, wie jenem Siegfried Langen, den die Beduinen beim Baden erschlugen ... Wissen Sie, was sein letztes Wort war?“
Nein, das weiss der Kaufmann aus Damaskus nicht.
„Amân — Gnade.“
So. Inwiefern man das denn überhaupt wissen kann?
Man kann das wissen, denn seine Mörder erzählten es.
Dann allerdings — aber Basil Nada meint, dass dieser Nordau von einer Idee besessen sein müsse. Es ist ihm wenig erwünscht, sich mit einem Besessenen einzulassen. Es scheint ihm auch ganz nutzlos, einem Besessenen zu widersprechen.
Basil Nada ist gewohnt mit realen Dingen zu rechnen, Handel zu treiben mit Muselman, Nazarener und Franke; für versunkene Städte hat er keinen Sinn. Nun lässt er den Forscher reden und raucht schweigend.
Basil Nada will nach Aden fahren. Er will von Aden hinaufziehen ins unwegsame Persien bis nach Teheran, um Teppiche zu kaufen. Übrigens passt es ihm nicht, dass das Schiff bei Hodeida unter die Küste gehen soll. Basil Nada kennt diese gottverlassene Küste ein wenig und weiss, dass sie gefährlich ist. Daher lauscht er den mit Erregung geflüsterten Worten Nordaus mit Unbehagen und stiller Ablehnung. Er hört sie wie ein unliebsames Geräusch und denkt dabei an sein neues prächtiges Haus in Damaskuscham. An die enge gelbe Gasse denkt er, an den zweimal gekrümmten Weg zur Gartenpforte. Hinter der Gartenpforte liegt es wie ein kleines Paradies. Orangenbäume blühen, eine Fontäne plätschert im runden Becken aus schwarzem Marmor. Die kleinen Wege sind mit roten Fliesen ausgelegt. Und Feridêh füttert die Tauben. Feridêh ist wie ein schmales Mädchenkind. Sie zählt nicht mehr als sechzehn Sommer. Sie ist vor kurzem sein Weib geworden und der Gipfel seines Wohlstands ...
Die Zigarette ist ausgeraucht und fliegt in kurzem Bogen über das Segeltuch in die Tiefe, aus der es rauscht und gurgelt und brodelt.
Auf Armeslänge vom Kaufmann funkeln zwei Augen. Eine heisere Stimme flüstert: „... grosse Städte liegen in der Wüste verschüttet — ich habe sie gesehen. Mächtige Wasseranlagen bis ins ferne Gebirge ... Einmal war es ein reiches Land, das gepriesene Land aus der Bibel ... Und über allem ruht noch das Geheimnis ...“
Von der Back her, aus dem Matrosenlogis kommen die Klänge einer Ziehharmonika, bald leiser, bald lauter, als ob die Tür, hinter der der Spieler sitzt, ohne Unterlass geschlossen und geöffnet werde.
Am Eisengeländer der Brüstung lehnt der Heizer Omar, der Freiwache hat und nun übers blinkende Meer hinausschaut.
Omar grübelt ... Hinter dem Meer liegt viel Land. Gebirge liegen da, Wüsten, Städte und Dörfer. Und dort, weit hinten, liegt eine Stadt, die heisst Damaskuscham. Ein kleines Stück hinter Damaskuscham ist eine Karawanserei, Feigen- und Mandelbäume werfen ihren Schatten über den Brunnen. Hinter dem Brunnen liegt ein Garten. Im Garten ganz verborgen steht eine Hütte. Das ist Omars Hütte ... Omar sieht sie so klar und deutlich im Dämmerschein, weit hinten ...
Als der grosse Krieg kam, hat man Omar von Hasne fortgeholt, man hat ihm Waffen gegeben, befahl ihm zu kämpfen. Er versteht das alles auch heute noch nicht. Aber da es gegen Ungläubige ging, kämpfte er gerne. Man hat ihm später die Waffen wieder abgenommen und gab ihm dafür die Freiheit zurück. Das war in einer fremden Stadt. Niemand kümmerte sich mehr um ihn. Nun kann er den Rückweg zu seiner Hütte nicht mehr finden. Aber, Inschallah — wenn es Gott gefällig ist, wird er Hasne wiedersehen. Alles steht doch in Allahs Hand. Aber es ist schwer, dieses Leben unter den Ungläubigen, die gottlos sind und in fremder Zunge reden und tun und essen und trinken, was der Koran verbietet.
Auch Omar ist müde. Bei Allah — sein Blut ist flüssiges Blei. Und hier auf diesem mächtigen schwarzen Schiff ist keine Ruhe. Omar geht über das Vordeck der Tür zu, aus deren Spalt zugleich mit der Musik ein gelber Lichtschein quillt.
In der Stickluft des Roof spielt der Däne Erikson und singt mit heiserer Stimme das endlose Lied von der roten Edith in Londonderry. Es liegt Verzweiflung und Sehnsucht in dieser brüchigen Stimme, eine Schwermut, die gar nicht zum üppigen Gesange passt. Selbst Omar greift der Gesang ans Herz, obgleich er von Eriksons Sprache kein Wort versteht.
Es ist eine Stunde nach Mitternacht, als sich dieses zuträgt:
Omar ist auf seinem Wege von der Reling zum Roof bei der grossen Lucke angelangt. Von der Brücke herunter kommen zwei dünne Glockenschläge. Ein Mann tritt irgendwo am Bug aus dem Schatten hervor, um auf der grossen Glocke über dem Matrosenlogis das Glockenschlagen zu wiederholen. Auf dem Bootsdeck steht Omsky auf seiner Wanderung still. Er steht bei den Feuereimern und schaut auf die fernen Berge, die als blaue Schatten aus der blauen Nacht auftauchen. Basil Nada liegt, die Hände unter dem Kopf verschränkt, unter dem Segeltuch. Er möchte sich eine Zigarette anstecken. Doch auch diese geringe Arbeit kostet Anstrengung. Der Forscher redet noch immer wie im Fieber von den Wundern des untergegangenen Sabäerreiches.
Der Offizier auf der Brücke setzt die Signalpfeife an die Lippen. Aber noch ehe ein Ton daraus dringt, erhebt sich im Bauche des Schiffes ein Schreien und Zischen und Poltern. Eine turmhohe Dampfsäule schiesst zum Himmel auf. Für wenige Sekunden ist Tumult und blendende Helle. Dann ist das Schiff verschwunden, und jähe Stille liegt auf dem Wasser.
Das grosse Schiff fiel auseinander. Seine Feuer und seine Lichter erloschen. Das Wasser gurgelt. Eine fahle Wolke schwebt über der Stelle, wo eben noch ein schwarzes Schiff fuhr. Der Wind erfasst die Wolke und treibt sie südwärts. Wellen rauschen.
Der Mond scheint grünlich.
Die Wellen schaukeln unförmige Trümmer auf und nieder.
Nicht viel blieb übrig von dem Dampfer, der so gross war wie sechs Häuser.
Zwischen den Trümmern bewegt sich ein Punkt. Es ist der Kopf Omars.
Es bewegt sich noch ein Punkt. Es ist der Kopf Omskys.
„Hieher!“ schreit Omsky.
Eine harte, knarrende Stimme. Eine Stimme, die viele Befehle gegeben hat. Sie gemahnt an Eichenholz oder zähes Leder.
Omsky hat zwischen all dem Zersplitterten und Formlosen, das ihn umgibt, ein Boot gefunden. Weiss Gott, ein Boot, das auf dem Kiel liegt und schwimmt und über die Wellen hüpft und unberührt ist vom Wahnsinn, der vor wenigen Sekunden ausgebrochen und alles in Fetzen riss.
Omsky bemerkt Omars Kopf. Darum ruft er.
Omar versteht diese Zunge nicht. Aber wie das Tier den Laut erfassen und deuten kann, so weiss Omar, was der Ruf sagen will.
Omsky schwingt sich ins Boot und streckt Omar die Hand entgegen.
„Rudere!“ befiehlt Omsky und zeigt auf die Riemen, die an den Bänken festgezurrt sind. Omar rudert. Damit ist das Verhältnis zwischen ihm und Omsky festgelegt. Es sind zwei Menschen im Boot. Einer von ihnen ist der Herr, der andere der Knecht. Ein Zustand der Ordnung.
Omar rudert langsam. Er zieht Kreise. Sein Hals streckt sich lang.
Die Wellen werfen Schiffstrümmer gegen die Bootsplanken.
Omsky steht aufrecht, versucht mit dem Ohr das Brausen des Wassers zu durchdringen und mit dem Auge das Mondlicht, das spukhaft ist und allen Dingen ein unwahres Ansehen gibt.
Und da schwimmt über zerbrochenen Bootsplanken ein Stück Segel. Holz und Tuch sind in ganz unbegreiflicher Weise verwickelt. Unbegreiflich ist auch, dass dieses seltsame Floss zwei Menschen tragen kann. Aber es trägt sie. Und die zwei Menschen liegen da und rühren sich nicht. Es kostet nicht geringe Mühe sie ins Boot zu ziehen.
Erst im Boot kommt der eine zu sich und stammelt: „Sie haben ihn niemals erschlagen ... Nein, er lebt noch ... Aber mich haben sie getötet ...“
Nordau, der Forscher, weilt noch immer im Lande Saba.
Der Kaufmann Basil Nada aber liegt mit schlappen Gliedern auf dem Bund des Bootes. Er gibt kein Lebenszeichen von sich. Man kümmert sich vorläufig nicht um ihn, denn man hat anderes und Wichtigeres zu tun.
Man rudert zwischen Trümmern hin und her und sucht nach Leben. Man findet kein Leben mehr.
Ganz kläglich sind die Überreste, die das Meer nicht verschlucken wollte.
Der Dampfer ist durch die Explosion auseinandergefallen wie ein elendes Spielzeug aus Pappe. Daran ist nichts Verwunderliches. Ein Dampfkessel platzte durch irgendeine lächerliche kleine Ursache. Ein Dampfer wird nicht an seinem Bestimmungsort eintreffen. Viele Schiffe bleiben auf dem Meer. Man vergisst sie bald.
Von diesem hier wird man nicht die geringste Spur finden. Der Wind treibt die wenigen Überreste an die Küste. Unfruchtbar und menschenleer ist diese Küste wie wenige auf dem Erdenrund. Vielleicht mag einmal ein Beduine Wrackstücke im Sande finden. Was ihm davon nützlich ist, wird er sich aneignen. Aber ganz sicher wird er niemals eine Nachricht senden in die Welt hinaus, die er nicht kennt und die ihn nichts angeht.
Nun sind also nur diese vier Menschen im Boot. Das Boot hat sich gleichsam losgelöst von dem grossen schwarzen Schiff, das unermüdlich von Meer zu Meer hastete, hat sich von ihm abgesondert, so, wie ein Kalb sich von der Kuh löst.
Dadurch ist eine neue kleine Welt entstanden.
Diesen vier Menschen war ein jähes Ende in der Flut nicht bestimmt. Das Schicksal hat für sie eine seltsame Wanderung vorgesehen.
Omsky ist ein aktiver Mensch. Er muss sich mit irgend etwas beschäftigen. Er will jetzt das Trümmerfeld absuchen.
Sie rudern eine Stunde zwischen den Wrackstücken und suchen. Sie rudern zwei Stunden und füllen das Boot. Holzteile, die vor kurzem noch als Notwendigkeit oder als Zierde im mächtigen Leib des Dampfers eingefügt waren, liegen jetzt zersplittert neben Basil Nada. Sie haben zum grössten Teil derart ihre Form verloren, dass nicht mehr zu bestimmen ist, wohin sie einmal gehörten. Aber man findet auch ein paar Eimer, eine grosse verlötete Blechbüchse, ein Wasserfass, das ganz leer ist und ein paar Flaschen, die zur Hälfte leer sind und deren glänzende Hälse wie grüne Kerzenflammen auf den Wellen tanzen.
Omsky fragt einmal, ohne den Kopf zu wenden: „Sind Sie verwundet.“
„Nein. Aber nun ist meine Expedition verloren. Alles, was ich besessen, ist mit dem Schiff in die Luft geflogen. Alles ist hin. Warum haben Sie mich nicht den Wellen überlassen?“
Omsky sagt: „Das Schiff hat jetzt wohl den Grund erreicht. Wir aber leben. Und wenn Sie Ihre Hände rühren können, dann fassen Sie mit an. Es handelt sich vorläufig nur darum, das Leben zu bergen.“
Basil Nada erwacht aus einem Dämmerzustand und erfasst sofort seine Lage. Sein Rücken liegt im Wasser. Aber da das Wasser warm ist, merkt er es kaum anders als eine angenehme Erfrischung. Auch der Wind, der über ihn hinstreicht, kühlt.
„Was wollen Sie?“ fragt Nordau mürrisch. „Wir werden es hier nicht lange aushalten. Morgen wird uns die Sonne ausgedörrt haben, denn es ist doch kein Tropfen Trinkwasser da ...“
Das stimmt. Soviel weiss Omsky auch. Es gab einmal eine Zeit, in der auch Omsky den Dingen ihren Lauf lassen wollte. Das ist vorbei. Er will jetzt wieder der Meister seines Schicksals sein.
Seine Meinung ist, dass man nicht weit von der Fahrstrasse der Dampfer abgetrieben sein könne. Und man werde voraussichtlich im Laufe des Tages aufgefischt werden, meint er.
„Das Wasser steigt im Boot!“ ruft Basil Nada.
Die Freude, dem Tode entgangen zu sein, hat den Kaufmann eine kurze Weile mit Gleichgültigkeit auf die Lage blicken lassen. Doch da er gewahr wird, dass ihm das Wasser in die Ohren läuft, fährt er erschreckt in die Höhe.
„Das Boot ist leck!“
Es kommt plötzlich eine grosse Beweglichkeit über Basil Nada. Er packt das Wasserfass, das ihm am nächsten liegt, und wirft es über Bord.
„Was plagt Sie, Mann?“ fragt Omsky.
Das Boot müsse erleichtert werden, behauptet der Kaufmann. Alles müsse hinausgeworfen werden, wenn man nicht ersaufen wolle.
Damit ist Omsky durchaus nicht einverstanden. Nein, im Gegenteil, es ist noch immer seine Ansicht, möglichst viel vom Untergang zu retten.
„Sie sagten doch selber, das wir hier nur auf den nächsten Dampfer warten,“ schreit der Kaufmann in weinerlichem, zänkischem Tone. „Wozu soll uns denn der ganze Kram hier dienen?“
Das hat ja ebenfalls seine Richtigkeit. Aber Omsky weiss, was er will.
„Dass im Laufe des Tages ein Dampfer in unsere Nähe kommen wird, ist wahrscheinlich. Ob er uns aber bemerkt oder auffischt, ist schon mehr zweifelhaft.“
„Und dann?“ fragt Basil Nada mit Ungeduld und Bekümmerung.
Omsky gibt keine Antwort. Er weist mit einer Kopfbewegung hinüber zu den Schattenbergen.
„Irgendwo müssen wir Menschen finden ...“
Hier mischt sich Nordau mit einer Art Schadenfreude in die Unterhaltung.
„Menschen?! Der Küstenstrich ist fast unbewohnt, nur Sand. Es gibt dort nahe dem Meere nicht einmal eine Karawanenstrasse. Wie aber sollen wir in Tuchschuhen und mit leeren Taschen den weiten Weg wagen?“
Auch das ist richtig. Omsky, der Händler, der Forscher — alle drei haben recht. Omar rudert.
Omar rudert und verflucht leise, aber voll Inbrunst das Schiff, die Erbauer des Schiffes, sämtliche Heizer und ihre Anverwandten bis ins fünfte Glied. Und ausserdem flucht er dem Dampfkessel und des Dampfkessels Glauben. Aber er rudert unverdrossen, weil es von ihm verlangt wird.
Vor der Rettung des Forschers und des Kaufmanns war ein Herr und ein Knecht im Boot. Die Lage war klar und übersichtlich. Jetzt aber sind drei Herren im Boot und drei Meinungen. Das verwirrt die Verhältnisse und birgt Gefahren.
Omsky hat als erster das Boot, das herrenlos war, erstiegen. Er hält sich für des Bootes Eigentümer und Herr. Er ist der Ansicht, dass sein Wort hier in erster Linie Geltung habe.
Man werde bis morgen mittag liegen und warten, so entscheidet er. Aber länger warten werde man nicht. Zeige sich bis dahin kein Dampfer, dann steuere man der Küste zu.
Und Omsky sagt noch: „Wem das nicht passt, der mag seinen eigenen Weg gehen.“
Nordau schaut Basil Nada an und macht mit den Augen ein Zeichen. Auch der Kaufmann macht ein deutliches Zeichen. Das verdriesst Omsky. Mit steifem Nacken wendet er sich herum.
„Es ist nützlich,“ erklärt er, „dass alle Zweifel zerstreut werden. Wo jeder redet, wird nichts getan. Und alles geht schief. Ich will nicht in diesem Boot liegen und warten, ob es mir vergönnt wird, gerettet zu werden oder zu verdursten. Ich will leben.“
Es wird nun über diese Sache nicht mehr geredet. Obschon sich noch vieles sagen liesse. Denn, wenn Leute verschiedener Meinung sind, brauchen sie nach Worten nicht lange zu suchen.
Die vier im Boot sind zu verschiedene Menschen, als dass sie derselben Meinung sein könnten. Ausserdem ist nach dem Erlebnis der Nacht der Wunsch nach Ruhe in ihnen. Der Forscher und der Kaufmann legen sich im Achterteil des Bootes nieder. Omsky macht sich im Bug ein Lager zurecht. Omar schöpft mit seinem Fes das Wasser aus. Dann streckt er sich auf der Ruderbank aus und schläft, bis ihn Basil Nada mit einem linden Fusstritte weckt und ihm befiehlt, das Boot von neuem leer zu schöpfen.
Der Führer
Alle vier schlafen noch, als über dem fernen Gebirge die Sonne aufgeht. Es ist keine rote Kugel, sondern ein ungeheurer Knäuel wirbelnden Feuers, das da über die dunklen Felsengipfel emporschiesst und unerschöpfliche Glutmassen auf das längst ausgedörrte Land und das allzu blaue Meer schleudert.
Der Wind weht immer noch aus Norden. Wellen hüpfen, Wellen rauschen. Sie singen das ewige Lied, das voll Schönheit, aber ohne Erbarmen ist.
Zuerst erwacht Omar. Laut gähnend streckt er sich und wischt die letzten Fetzen des Schlafes aus den Augen.
Das Boot hat sich über Nacht von den andern Überresten des Dampfers entfernt und schwimmt jetzt in friedlicher Einsamkeit.
Omar schöpft mit der hohlen Hand Wasser aus dem Meer und verrichtet die morgendlichen Waschungen, wie sie der Koran vorschreibt. Dann legt er die Hände wie Fächer hinter die Ohren und betet. Voller Inbrunst ist sein Gebet, denn seine Sehnsucht nach der Heimat ist grösser denn je zuvor.
Vom Bug und vom Heck des Bootes betrachten drei Augenpaare den andächtigen Beter. In diesen Blicken ist teils Gleichgültigkeit, teils Spott.
Die drei Herren beugen nicht ihre Knie in Demut. Ihre Gesichter sind stolz. Unmöglich kann man sich die einfältige Andacht des Arabers darein denken. In den zerknitterten und noch feuchten Anzügen haben sie aber schon viel von ihrer äusseren Würde verloren. Eine einzige Nacht hat ihnen vieles von ihrer Vornehmheit genommen.
An Omar ist keinerlei Veränderung wahrzunehmen. Seine weiten dunklen Hosen und sein blauer Kittel sehen heute nicht schmutziger und elender aus als gestern. Und seinem gelben Gesicht merkt man nicht das geringste an, dass er in dieser Nacht nur wenige Stunden auf der schmalen Ruderbank geschlafen hat.
„Allah ist gross,“ murmelt Omar. „Alle Dinge sind ihm möglich. Wenn es sein Wille ist, wird er mich wieder zurückführen in meine Hütte ...“
Omar sitzt wieder auf seinem Platz und wartet auf Befehle, gehorsam und zuverlässig. Unbeholfen lächelnd schaut er von einem zum andern.
Wo Omar zu Hause sei, möchte Basil Nada wissen.
Omar, verwundert, in seiner eigenen Zunge angeredet zu werden, starrt den Kaufmann mit offenem Munde an. Dann glänzt sein Gesicht auf in kindischer Freude.
„O Efendim — Allah möge deinen Tag segnen! Das ist ein froher Morgen. O Freude, deine Stimme zu hören! Wo meine Hütte steht, willst du wissen, Vater der Güte? Sie steht drei Meilen hinter Damaskuscham. Bei El Veit teilt sich die Strasse ... eine Karawanserei liegt dort ...“
Omar hätte noch lange geredet und dem grossen Herrn von seiner Heimat erzählt. Denn seit Jahren ist dies nun die erste Gelegenheit, sich einem andern in seiner eigenen Sprache mitzuteilen. Jedoch der Kaufmann fährt wie ein Keil dazwischen.
„Bei El Veit ... Bruder Kohlenschaufler, dann sind wir also Landsleute. Hast du vielleicht den Namen Basil Nada in Damaskuscham nennen hören?“
Ob Omar diesen Namen gehört hat? Wer kennt diesen Namen nicht? Omars Freude ist grenzenlos. Er meint, Allah selber habe ihn geführt. Allah selber habe ihn zu diesem mächtigen Herrn geschickt, der in einer grossen Stadt durch seinen Reichtum und sein Glück bekannt war. Sicherlich wird der grosse Mann sich des armen Bruders erbarmen und ihm aus der Not helfen. Omar beginnt von seinen Fahrten zu erzählen, von seinem langen Leidenswege. Viel Unglück ist über ihn gegangen seit man ihn fortholte in den grossen Krieg. Beim Koran, selbst der fromme Beduine Eyub hat nicht mehr gelitten. Möge Allah die Franken und Ungläubigen ganz und gar verderben, denn sie sind die Ursache von allem Bösen.
Omar meint auch, dass es einem so grossen und reichen Manne wie Basil Nada, dessen Name jedermann in der Stadt mit Ehrfurcht ausspreche, niemals übel ergehen könne und dass alle Dinge sich nach seinen Wünschen biegen müssen.
Nordau fühlt sich dazu berufen, des Arabers Jubel ein wenig zu dämpfen.
„Du irrst, o Omar,“ sagt er nicht ohne Spott. „Dem Kawadscha geht es bei deinem Barte heute nicht viel besser als dir selber. Wir stecken nämlich alle in der gleichen Falle.“
Omsky hat sich zum Führer der Schar aufgeworfen. Aber er versteht von dieser Unterhaltung kein Wort. Das trennt ihn noch mehr von den andern und macht ihn misstrauisch gegen sie.
Nun ist das so, dass die Wünsche eines jeden hier im Boot eine andere Richtung haben. Omar will in seine Heimat zurück, da er die Tücken der Fremde erfahren. Nordau verlangt nach nichts anderem, als nach der Expedition nach Marib. Der Kaufmann möchte so schnell als möglich nach Persien kommen, wo ein gutes Geschäft seiner wartet. Omskys Ziel ist Java.
Omsky war Offizier und hat seine Heimat aus ganz bestimmten Gründen verlassen.
Nur in einem stimmen alle vier überein. Sie alle sehnen sich aus dem Boote fort.
Omsky öffnet mit dem Taschenmesser die Blechbüchse. Sie ist mit Schiffszwieback gefüllt. In den aufgefischten Flaschen sind Wein und Branntwein. Da kein anderer Proviant vorhanden ist, macht es Omsky nicht grosse Schwierigkeiten, die Rationen auszuteilen. Die Rationen sind nicht gross.
Man widerspricht Omsky nicht. Doch man dankt ihm auch nicht. Es wäre unrichtig, zu behaupten, dass in diesem Boote Freundschaft und Liebe herrsche.
Das Boot schaukelt auf dem indigoblauen Wasser. Es wiegt in sanftem Schaukeln vier unzufriedene Menschen, die in ganz natürlicher Weise nur an sich selber denken.
„Wir sind in der Nacht ein gutes Stück dem Lande zugetrieben,“ stellt Nordau fest. „Die Fahrstrasse der Dampfer liegt aber weiter draussen.“
Omsky gibt auf diese Bemerkung keine Antwort. Omsky weiss, dass schweigende Entschlossenheit wertvoller ist als eine lange Auseinandersetzung. Es scheint ihm nicht von Wichtigkeit, ob das Boot einige Meilen abgetrieben ist oder nicht. Er hat scharfe Augen. Er entdeckt über den dunklen Wogen ein dünnes Rauchfähnlein. Ach, es ist noch, wie der Schatten eines Hauches, mehr zu ahnen als zu sehen. Es birgt vielleicht die einzige Möglichkeit zur Rettung.
Bald bemerken auch die andern den Rauch, und es packt sie eine zitternde Erregung.
Je näher der Rauch kommt, desto aufgeregter werden ihre Stimmen, desto gespannter der Ausdruck ihrer Gesichter.
Zwei Stunden nähert sich die Hoffnung. Aus dem dünnen Rauchfaden wird ein schwarzer Riesenbaum, unter dem ein Schiff heranfährt. Masten, Schornstein, ein grauer Rumpf steigen allmählich aus der Flut.
Im Boot rudern sie. Sie geben ihre ganze Kraft her. Sie keuchen und der Schweiss tropft von ihnen. Ein jeder weiss, um was es hier geht.
Aber ihre Anstrengung gleicht dem Lauf eines Träumenden, der sich in Ängsten müht und doch nicht vom Fleck kommt. Nein, ihre Kräfte sind zu gering zu einem Wettlauf mit dem fremden Schiff.
Das Schiff fährt vorbei. Es ist nicht mehr fern, aber es fährt vorbei und beachtet nicht die winkenden Tücher und hört nicht die heulenden Notrufe.
Ein zweiter Dampfer kommt übers Meer herauf und ein dritter. Alle fahren vorüber und kümmern sich nicht um das Boot, das als kleines Pünktlein im flimmernden Wasser liegt.
Alle drei Dampfer kamen von Norden her. Die Hitze erfüllte sie und machte sie zur Hölle. Es fuhren darauf Menschen, die in schwerem Fieber gingen, die stumpf und gleichgültig waren und die das einsame Boot im Sonnenglaste nicht bemerkten und auch nicht bemerken wollten.
Die Sonne ging in steilem Bogen in die Höhe. Jetzt ist es Mittag, und der Schatten verkriecht sich ängstlich unter allen Dingen.
„Heiss ist es — beim Koran!“ stöhnt Omar und lässt das Ruder sinken. In seinen braunen Augen flackert Angst auf. Aber bald besinnt er sich auf die fremden Herren, die das Schicksal mit ihm zusammengebunden hat. Er ist es gewöhnt, geführt zu werden und andern zu vertrauen. Er weiss auch, dass die Franken und die Ungläubigen vielerlei vermögen. Ja, sie sind die reinen Teufelskerle.
Sowie Omsky bemerkt, dass auch der dritte Dampfer nicht den Kurs ändert und seiner Wege fährt, verliert er keine Minute zu unnützen Betrachtungen. Er bindet zwei Ruder zusammen, breitet das Tuch aus, dem der Forscher und der Kaufmann ihre Rettung verdanken. Er trennt die dünnen Taue los, schneidet und knüpft —
Omar hat bald begriffen, was hier geschehen soll. Omar fasst überall geschickt mit an und versteht auch ohne Worte die Wünsche dieses hellen Herrn, den er allein als Führer anerkennt.
Nordau und Basil Nada sitzen niedergedrückt von Enttäuschung und schauen ohne Anteilnahme auf die fleissigen Hände ihrer Kameraden.
Bald wird der Mast gesetzt, und das Segel blafft im Winde. Das ist freilich ein elendes Segel von abenteuerlicher Form. Doch der Wind verachtet es nicht und füllt es. Da bekommt das Boot auch schon Fahrt.
Omsky steuert mit einem Ruder. Er steuert der Küste zu.
„Wenn man jetzt ordentlich essen und trinken könnte,“ meint der Forscher, „dann wäre diese Fahrt zu ertragen.“
Auch der Händler wird dadurch ermutigt, dass hier etwas getan wird. Er betrachtet Omsky jetzt mit versöhnlicheren Blicken.
Omsky erklärt: „Vor allem handelt es sich darum, dass wir Trinkwasser bekommen. Mit dem Proviant werden wir lange aushalten.“
Ein Schatten im Mond
Am Abend nähern sie sich der Küste. Der Wind hat aufgefrischt, und das Meer zerschlägt sich an den Korallenriffen zu weissem Gischt. Es liegt ein breiter Schaumgürtel vor dem Lande.
Omsky sitzt mit weit vorgerecktem Kopfe und späht nach einer sicheren Fahrrinne. Aber da er in dieser Gegend unbekannt ist, gerät er unversehens in einen Hexenkessel. Kochendes Wasser umgibt das Boot plötzlich auf allen Seiten. Lärmendes Wasser, das in boshafter Weise gurgelt und klatscht und zischt, Wasser, das bellt und lacht.
Das Boot bekommt einen scharfen Stoss und neigt sich zur Seite. Eine Welle hebt es vom harten Felsen und schleudert es auf einen andern, der es nicht freundlicher empfängt. Das ist so, als trieben gefühllose Götterhände mit diesen vier zappelnden Menschenfiguren ein wunderliches Spiel. Ein winziges Fleckchen des Entsetzens und der Todesangst ist das Boot in der Unendlichkeit des fast sündhaft blauen Wassers und der blendend hellen Küste.
Das Brausen der Wellen und das Gepolter der Brandung überschreit das Krachen und Splittern der Planken und überbrüllt auch die Menschenstimmen.
Vom zerschmetterten Boot lösen sich allerlei Dinge, die mit einem Male ein eigenes Leben bekommen. Helle und dunkle Dinge zerstreuen sich, verschwinden in Schaumperlen, hüpfen über grünlich schimmernde Wogenkämme. Einige bleiben unten, andere treiben See und Wind dem nahen Strande zu.
Omsky und Omar schwimmen Seite an Seite. Nicht weit hinter ihnen schwimmt der Forscher. Der Kaufmann hält sich, an das leere Fass geklammert, über Wasser. Denn er kann nicht schwimmen. Das Fass aber steuert in stetem Umdrehen seinen eigenen Kurs. Doch es nähert sich ebenfalls, wenn auch auf Umwegen, dem Strande.
Nun steht Omsky am Lande und sieht den Kaufmann treiben. Hinter dem Korallengürtel ist das Wasser ruhig. So kann Omsky auch noch ein paar kleine Dreiecke sehen, die schnell auf den Kaufmann zusteuern.
Basil Nada ist kaum noch zehn Schritte vom Lande. Aber da seine Fahrt nur gering ist, müssen ihn die schnell segelnden Dreiecke erreichen, bevor er festen Fuss fassen kann.
Omsky kennt diese Dreiecke, denn er hat sie an der Küste Ostafrikas oft gesehn. Er macht einige lange Sätze dem Strand entlang und stürzt sich wieder in die Flut. In kräftigen Stössen arbeitet er sich zum Kaufmann hin.
„Zappeln Sie — schreien Sie, so laut Sie es vermögen! Schreien — schreien!“
„Was ist?“ fragt ängstlich Basil Nada.
„Schreien!“
Omar ist Omsky nachgesprungen. Auch er erreicht Basil Nada.
„O Efendi, du musst mit beiden Beinen ausschlagen wie ein Pferd, sonst reissen sie dir die Haie aus!“
„— Haie?“ keucht Basil Nada und winselt wie ein junger Hund.
„Sie kommen, Efendi!“
Zu beiden Seiten des Kaufmanns halten sich seine Retter und peitschen mit Armen und Beinen das Wasser auf, dass es schäumt. Sie stossen Fass und Kaufmann an den Strand. Und so wird Basil Nada abermals vorm Tode bewahrt.
Basil Nada liegt eine Zeitlang im Sande. Sein Atem geht stossweise und keuchend.
Omsky und Omar haben sich bei ihm niedergelassen. Auch der Forscher kommt zu ihnen und setzt sich auf einen Stein. Er scharrt mit der Schuhspitze im Sand. Alle drei blicken auf das unruhige Wasser, lauschen auf das Donnern der Brandung und den schweren Atem des Kaufmanns und schweigen.
Das Meer beginnt nun einen Teil der Dinge, die im Boot gewesen, an den Strand zu spülen. Darunter sind ein paar Planken.
Omsky erhebt sich und beginnt unverdrossen zu sammeln. Dabei hilft ihm der Araber.
Nordau ist bei Basil Nada geblieben. Er betrachtet ihn mit kaltem Interesse. Doch als der Kaufmann die Augen aufschlägt, nickt er ihm zu.
„Jawohl, verehrter Herr, jetzt sitzen wir auf dem Trockenen.“
Der Kaufmann dreht sich auf die Seite.
„Man hätte draussen warten sollen,“ sagt er mit heiserer Stimme. „Ganz sicher hätte uns ein Dampfer aufgenommen.“
Der Forscher hebt ein wenig die Schultern. Es scheint ihm unnütz, länger mit dieser Möglichkeit zu rechnen. Spöttischen Blickes folgt er Omsky, der am Strande hin und her läuft und das wenige aufliest, was das Meer ihm nun sozusagen als Almosen wieder hinwirft.
Dieser Mensch spielt hier Anführer, als ob Gottvater selber ihn zum Herrn über alle Dinge gesetzt hätte! denkt der Forscher. — Gut, mag er sich plagen.
Dem Forscher Nordau ist ohnedies die Sache verekelt. Seine Hoffnung, seine Ausrüstung, sein Geld, alles ist hin. Wie soll er nun zu einer Expedition kommen?
Er hat sein halbes Leben und sein ganzes Vermögen einer einzigen Sache geopfert. Er ist bis zu diesem Tage nie verzagt. Jetzt aber glaubt er nicht mehr daran, dass es ihm je gelingen könnte, die Schätze von Marib zu holen. Und in verbissenem Ingrimm zürnt er dem Menschen dort, der ihn aus dem Wasser zog.
„Wenn man wenigstens etwas zu trinken hätte,“ seufzt Basil Nada.
Wenn Männer verärgert sind, greifen sie zum Tabak. Nordau sucht in den Rocktaschen. Er findet ein paar aufgeweichte Zigaretten und eine Schachtel Streichhölzer. Basil Nada fährt ebenfalls in die Tasche. Dabei beklagt er sich aufs neue: „Man hätte es nicht dulden sollen ... Man hätte draussen warten sollen. Man hätte ihn zwingen sollen ...“
Wie man das denn hätte anstellen müssen? fragt der Forscher neugierig. Diesen Menschen zwingen — Wie? Der Forscher schaut Basil Nada prüfend ins Gesicht.
„Nun wir sind doch zwei ... und der Araber ... wenn man ihm die Sache klargemacht hätte ... Ach, es ist eigentlich unsere eigene Schuld, dass wir jetzt hier im Sande liegen.“
Trotzdem, bedenkt sich der Forscher, er hat uns das Leben gerettet. Ohne sein Eingreifen hätten uns ganz sicher die Wellen gefressen. Überhaupt ist es vielleicht gar nicht so sinnlos, was er jetzt tut.
Der Forscher sagt das teils aus Lust zum Widerspruch, teils weil ihm das Gerede des Kaufmanns ärgerlich ist. Er steht auf und streut die Streichhölzer und die Zigaretten über den Stein hin.
„Was machen Sie da?“
„In einer Stunde wird alles trocken sein. Dann wird man wenigstens rauchen können.“
Merkwürdig, wie wenig es oft bedarf, den Menschen in eine andere Stimmung zu versetzen. Diese lächerlich kleine Verrichtung gibt dem Forscher wieder seine Tatkraft zurück. Er geht zu Omsky und hilft ihm.
„Ist er denn verletzt?“ fragt Omsky, mit dem Kopf zum Kaufmann hinweisend.
„Nein, das glaube ich nicht.“
Omsky ruft: „Wenn Sie aufstehen können, gehen Sie dem Strande entlang bis zu jener Felsenschlucht dort im Norden. Vielleicht finden Sie dort Wasser.“
Basil Nada dreht sich um. Er hat diesen Befehl weder gehört noch verstanden. Da liegt er auf der Seite, und die Wüstensonne zeichnet sehr klar seine Formen. Auch die nassen Kleider bemühen sich nicht weiter, die Verhältnisse dieses menschlichen Wesens zu enthüllen.
Was an Basil Nada zuerst auffallen muss, das sind die fast unmöglich langen Arme. Sie liegen wie zwei Krücken an seinen Seiten. Auch die Beine haben den Rumpf bis weit unter den Westenrand gespaltet, so dass der viel zu grosse Kopf über der zu schmalen Brust sich auch nicht gut ausnimmt.
Basil Nada hat tiefschwarzes Haar, das ihm bis weit in die Stirn hinein wächst, dazu rote breite Lippen. Nun bewegt er diese Lippen und murmelt allerlei, was vielleicht ihn selber angeht, vielleicht auch diesen Fremden.
Basil Nada ist es nicht mehr gewohnt, dass man in dieser Weise mit ihm verkehrt. Wenn Basil Nada durch die Strassen von Damaskus geht, begleitet ihn der riesenstarke Neger Abulfeda, der den roten Sonnenschirm über ihn hält und die Leute anschreit, so dass Basil Nada unbehelligt durchs grösste Gedränge kommt. Viele Menschen grüssen ihn auf der Strasse und viele drängen sich heran und sind glücklich, wenn sie den Saum seines Kleides erhaschen. Niemand aber wird es wagen, ihm zu befehlen.
So ungefähr beginnen des Kaufmanns Betrachtungen. Doch sie müssen wohl andere Wege finden. Denn er erhebt sich schliesslich doch und marschiert, wenn auch mit deutlichem Widerwillen, der Schlucht im Norden zu.
Draussen auf dem Wasser gleiten die dunklen Dreiecke hin und her. Omar ruft von einem steilen Felsen herab und fuchtelt mit beiden Armen. Omsky und Nordau laufen hinzu und können auf wenige Meter einen ungeheueren Hai liegen sehen. Er liegt auf der Seite, kaum handtief unter der Oberfläche des Wassers und schielt aus dem schmalen Schlitz seines Katzenauges herauf.
Nordau greift in die Rocktasche und steht dann mit gestrecktem Arm. Er zielt umständlich.
„Sie haben eine Waffe?“ fragt Omsky überrascht.
Der Forscher sagt: „Sie sind gewiss ein guter Schütze, das sieht man Ihren Augen an. Ich aber kann nie etwas treffen. Versuchen Sie es. Es stecken noch zwei Patronen im Magazin. Schiessen Sie dem Scheusal das Auge aus.“
Omsky aber ist der Meinung, man solle die Kugel zu einer besseren Gelegenheit sparen. Sie bewerfen den Hai mit Steinen.
„Wasser! Wasser!“ ruft Basil Nada mit schriller Stimme.
Durch tiefeingefressene Rinnen im roten Porphyr plätschern dünne Wasserbänder. Sie kommen von einer hohen, steilen Wand her, die wie eine finstere Burgmauer in die Luft ragt. Das Wasser sammelt sich in Vertiefungen, rein und köstlich, wie in gemeisselten Marmorbecken.
Sie trinken und tauchen ihre Hände ins Wasser und tauchen auch ihre brennenden Gesichter darein.
An einer Stelle, die durch hohe Felsen vom Winde geschützt ist, macht Omar ein Feuer. Omsky und Nordau holen das Segel. Und nun steht ein kleines Zelt da. Basil Nada lehnt sich mit dem Rücken gegen den Felsen und raucht.
Das Zelt steht am Rande eines weiten Tals, das ganz mit hellem Sande angefüllt ist. Hohe Berge ragen auf allen Seiten. Die Berge schillern zart wie Perlmutter. Es wird Abend.
Omar nähert sich zögernd dem Kaufmann und bittet leise: „Herr nimm mich mit in das Land der Adschèm — bei Allah! Ich will dir ein treuer Diener sein. Und ich will dann auch mit dir zurückkehren nach Escham. Denn wahrlich, ich bin es müde, länger in dieser verruchten Fremde herumzufahren. Denn sie ist voll des Bösen.“
Basil Nada hat in der Nacht seine Brille verloren. Nun sieht er wohl die Ferne gut; aber nur mangelhaft kann er die nahen Dinge unterscheiden. Omars Gesicht steht vor ihm, auf der einen Seite vom Feuerschein beleuchtet, auf der andern von der Dunkelheit schon ausgewischt. Basil Nada vermag es nur undeutlich zu erkennen. Er ist zurückhaltend.
„Ich will mir das noch überlegen,“ meint er ausweichend. „Was soll ich übrigens jetzt mit einem Diener? Hier, wo man mir Befehle erteilt und wo ich auch nicht mehr in der Hand habe als du.“
„Sag’ das nicht. Efendi! Ein Grosser, wie du, kann immer Nutzen haben von einem ergebenen Knecht, der ihm zu jeder Stunde beisteht. Und dann kann man auch am Gefolge am besten den Herrn erkennen. Du musst auch bedenken, dass du in ein wildes Land ziehst. Und für zwei ist die Gefahr stets geringer, als für einen einzelnen. Ich aber habe mir schon längst gewünscht, mich einem Mächtigen anzuschliessen. Es ist war, heute nacht habe ich alles verloren, was ich in der langen Zeit in der Fremde ersparte, und niemand wird es mir je zurückgeben. Aber ich will dennoch nicht klagen. Denn nur durch dieses Unglück war es für Omar, den geringen Knecht, möglich, in deine Nähe zu kommen, o Herr. Und das ist wahrlich ein grosses Glück, kennt doch jedes Kind in Damaskuscham deinen Namen und nennt ihn mit Ehrfurcht.“
Es ist etwas in Omars Stimme, das dem Kaufmann gefällt. Ja, wenn er es sich überlegt, muss er diesem einfältigen Burschen recht geben. Auch für den reichen Kaufmann könnte es ein gewisser Vorteil sein, einen ergebenen Diener um sich zu haben.
„Gut denn,“ sagt er. „Es sei also nach deinem Wunsche. „Ich will dir acht Gurusch im Monat geben für den Anfang. Wenn du mir aber treu dienst, will ich dich auch dann in meinem Dienst behalten, wenn wir wieder in Escham sind.“
Omar erfasst des Kaufmanns Hand und küsst sie.
„Allah mehre deine Habe, mein Gebieter!“ murmelt er erfreut.
„Es gibt zwei Möglichkeiten,“ erklärte der Forscher Omsky. „Entweder müssen wir dem Strande folgen oder den Flusslauf entlang ins Gebirge steigen, um die Karawanenstrasse nach Mekka zu erreichen.“
Omsky meint, dass ein Marsch der Küste entlang sehr lang werden könne, da die Städte weit auseinander liegen in diesem Lande. Die Gefahr auf dieser Wanderung würde in der Hauptsache der Durst sein.
Dem stimmt der Forscher zu. Die Regenflüsse seien gewiss schon alle versiegt, meint er. Der Marsch durchs Gebirge sei aber mindestens hundert Kilometer lang. Und das, Verehrtester, ist auch kein Kinderspiel.
Welchen Weg der Forscher vorschlagen würde?
Man sollte auf alle Fälle an der Küste bleiben. Hinter jedem Bergrücken könne doch eine Ortschaft liegen.
„Gut. Versuchen wir es!“ sagt Omsky.
Nach einer Pause fragt er: „Sie kennen dieses Land?“
„Ich habe mich drei Jahre lang im Lande Saba aufgehalten.“
Ei, der Kuckuck, wundert sich Omsky. Und ob der Forscher nun wieder dorthin ziehen wolle, um nach Altertümern zu forschen?
Beide schauen einander für eine Sekunde in die Augen. Diese Sekunde legt einen weiten Graben zwischen sie.
Sie drehen sich dem Feuer zu und schweigen. Dann streckt sich Omsky im Sande aus, verschränkt die Hände hinter dem Kopf und starrt in den Himmel, der wie dunkle Seide schimmert.
Tief ruht der Himmel auf den schwarzen Bergen. Wenige grosse gelbe Sterne funkeln. Der Sand leuchtet fahl im Sternenlichte.
Das ganze weite Tal ist erfüllt von der Stimme des Windes. Das klingt wie dunkler ferner Orgelton.
Ab und zu zerrt ein Luftwirbel lange Flammenzöpfe aus dem Feuer.
Basil Nada ist unter das Zeltdach gekrochen. Omar legt sich aussen auf das Tuch, damit der Wind es nicht fortblase, und beginnt auf diese Weise seinem Herrn zu dienen.
Der Forscher liegt mit geschlossenen Augen und kämpft immer mit demselben Gedanken, den er wie einen grossen Stein hin und her wälzt.
Auch in Omsky ist eine grosse Frage. Die Orgeltöne des Windes formen sich ihm zu einem Sang. Es wird ein Lied. Er hörte es an einem Frühlingstage. Anny hat es gesungen. Nun strömt ihre Stimme von allen Seiten ihm entgegen.
Im Rauschen einer Nacht ...
Die Worte umflattern ihn wie Vögel im Sturm. Und die Erinnerung steht auf und begräbt die Gegenwart.
Es war ein Frühlingstag — jener Tag ist die Ursache, dass er nun hier liegt unter fremden Sternen.
Damals kam ihre Stimme durch die kahlen Äste der alten Bäume. Sie stürzte sich auf ihn. Damals hasste er sie, die Worte, die Stimme und alles zusammen. Er hasste ihren Gang, ihre grauen Augen, ihr schmales, bleiches Gesicht, den Mund, der viel zu rot und gross war. Man soll nie die Ehrlichkeit umgehen. Er hasste das alles in eigentümlicher kalter Glut.
Ein Märzentag war es. Er stand im Hof. Der Himmel war niedrig und starrte von schmutzigen Farben, die Erde ein Gemisch von nassem Schnee und Morast. Das grosse Haus stand darin, kalt und finster. Die Welt war ohne Freude.
Er hatte seinen Koffer gepackt, denn am Morgen wollte er fort, denn das alles war eine sinnlose Qual. Ja, er sehnte sich nach dem kommenden Morgen, der ihm die Freiheit wiedergab. Er ersehnte den Morgen und fürchtete ihn.
Da war es, dass ein Traum begann. Der Traum hat noch kein Ende genommen. Es gibt also doch Dinge, die man nicht von sich werfen und hinter sich liegenlassen kann ...
Omsky fährt in die Höhe. War das nicht das Telephon in der Garage? Nein, es war nur ein Windstoss, der das Zelttuch hob und die beiden leeren Flaschen umwarf. Glas klirrte in einem mit weissem Sand ausgefüllten Talkessel, den wohl seit hundert Jahren keines Menschen Fuss betreten hat.
Und dennoch kommt da ihre helle, hochmütige Stimme durch die Nacht.
„Jawohl, gnädiges Fräulein!“
Der Forscher stützt sich auf den Ellbogen und fragt gähnend: „Wie? — Sagten Sie etwas?“
„Ich? — Nichts ... Vielleicht träumte ich ...“
„Sie redeten. — Ja, wir haben heute allerlei erlebt.“
Aus der dunklen Bergwand steigt der Mond. Sein oberer Rand ist noch mehr eingedrückt als in der vorigen Nacht, gleichsam zerfasert. Die weite Rundung aber steht in der trockenen wolkenlosen Luft in lüsterner Nacktheit. Ein Stück weit gleitet er über den dunklen Felsenrand. Dann zeigt sich etwas Seltsames. Es schiebt sich ein schwarzer Schatten vor die helle Mondscheibe, ein Schatten, der sich bewegt.
Der Forscher sieht ihn. Omar sieht ihn.