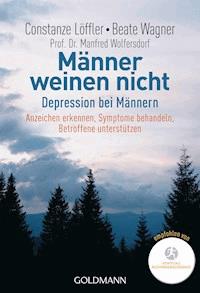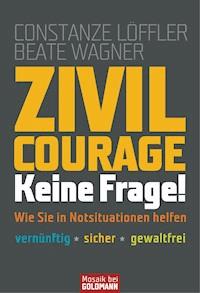
12,99 €
Mehr erfahren.
Ein praktischer Leitfaden zur Umsetzung von Zivilcourage im Alltag
Zivilcourage zeigen heißt, eingreifen statt nur tatenlos zusehen. Aber wie macht man es richtig? Was ist die richtige Strategie bei Pöbeleien allein im Park oder in einer vollbesetzten U-Bahn? Wie erkennt man besonders gefährliche Aggressoren? Wie kann man der Eskalation vorbeugen? Diese und weitere drängende Fragen beantworten die Autorinnen profund und geben zahlreiche mutmachende Beispiele aus der Praxis. Die besten Experten aus Psychologie, Kriminalistik und Selbstverteidigung kommen zu Wort und erklären, wie man sich im Ernstfall verhalten soll. Damit jeder tagtäglich Zivilcourage praktizieren kann – ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 267
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Buch
Hinschauen statt wegsehen, einschreiten statt danebenstehen, helfen statt geschehen lassen. Wer Verantwortung übernehmen will und auch morgen noch ruhigen Gewissens in den Spiegel schauen möchte, braucht vor allem eines: Zivilcourage. Und die kann man lernen. Was ist die richtige Strategie bei Pöbeleien allein im Park oder in einer vollbesetzten U-Bahn? Wie erkennt man besonders gefährliche Aggressoren? Wie kann man der Eskalation vorbeugen? Diese und weitere drängende Fragen beantworten die Autorinnen in diesem Buch mit großer Sachkenntnis und viel Einfühlungsvermögen. Neben aufschlussreichen Hintergrundinformationen zeigen zahlreiche mutmachende Beispiele aus der Praxis, dass zivilcouragiertes Handeln keine Heldentaten erfordert und bereits kleine Gesten viel bewegen können. Daneben beschreiben die besten Experten aus Psychologie, Kriminalistik und Selbstverteidigung genau, wie man sich im Ernstfall verhalten muss. Damit jeder tagtäglich Zivilcourage praktizieren kann– ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.
Autorinnen
Beate Wagner und Constanze Löffler sind Wissenschaftsjournalistinnen mit abgeschlossenem Medizinstudium. Seit Jahren setzen sie sich mit medizinischen, psychologischen und sozialen Themen auseinander. Je komplexer die Materie, desto besser. Die Ergebnisse einer umfangreichen Recherche für den Leser bildhaft, lebendig und klar aufzuschreiben liegt beiden Autorinnen besonders am Herzen. Sie veröffentlichen ihre Texte in führenden deutschen Magazinen und Tageszeitungen.
Die Autorinnen danken Frau Prof. Dr. Margarete Boos von der Universität Göttingen für die wissenschaftliche Beratung.
Constanze Löffler, Beate Wagner
Zivilcourage– Keine Frage!
Wie Sie in Notsituationen helfenvernünftig · sicher · gewaltfrei
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Alle Ratschläge in diesem Buch wurden von den Autorinnen und vom Verlag sorgfältig erwogen und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Eine Haftung der Autorinnen beziehungsweise des Verlags und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist daher ausgeschlossen.
Originalausgabe März 2011
© Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
FK/KW · Herstellung: IH
ISBN 978-3-641-05529-5V004
www.mosaik-goldmann.de
Vorwort der Autorinnen
Mit offenen Augen durch die Welt
Berlin Hauptbahnhof, Gleis1 am Vormittag. Der ICE aus Hamburg fährt ein. Suchende Blicke, Szenen der Begrüßung, ein hektisches Treiben. Die Massen drängeln in Richtung der Rolltreppen und des Fahrstuhls. Dann ist der Bahnsteig plötzlich leergefegt. Weiter geht’s nach Leipzig, der Zugbegleiter ist abfahrbereit, hält seine kleine Kelle in der Hand. Nur eine Tür entfernt von ihm steht eine ältere Frau mit drei Koffern auf dem Bahnsteig. Dass sie merklich aufgeregt ist, registriert er ungerührt. Sie ruft ihm etwas auf Arabisch zu, ihr Gesichtsausdruck ist verzweifelt, die mit Taschen behängten Arme weisen in Richtung des Fahrstuhls. Offensichtlich ist ihr Mann damit noch unterwegs, und sie befürchtet, der Zug könne ohne sie abfahren.
Mir bleibt kaum Zeit für eine Entscheidung. Ich renne auf den Bahnbeamten zu, mache ihn auf die Situation aufmerksam, stürze zu der Dame und dem mittlerweile eingetroffenen Gatten. Ich drücke den Türöffner, schiebe die betagten Herrschaften die Stufen hinauf, ihr Gepäck hinterher– puh, das wäre geschafft. Der Zug rollt an, dankbar winken mir die beiden aus dem Fenster zu und ich gehe wieder meiner Wege.
Zugegeben, danach habe ich mich für Momente richtig gut gefühlt. Ich war zufrieden mit mir, hatte helfen können. Mir ging der Spruch durch den Kopf: Jeden Tag eine gute Tat. Doch ist es eigentlich nicht selbstverständlich, sich gegenseitig zu unterstützen, aufeinander zu achten, sich zu kümmern– auch wenn das persönlich nicht immer etwas bringt?
Hinschauen statt wegsehen, einschreiten statt danebenstehen, helfen statt geschehen lassen: Diese Forderungen sind aktueller denn je. Dabei geht es heute nicht mehr nur darum, die alte Frau sicher über die Straße zu begleiten oder den Zug für eine Ausländerin aufzuhalten. Ob in der Münchner S-Bahn, der Berliner City, am Strand von Mecklenburg-Vorpommern oder der Frankfurter Innenstadt: Immer wieder geraten Menschen in arge Bedrängnis– und Deutschland schaut größtenteils dabei zu.
Im September 2009 wird Zivilcourage hierzulande plötzlich zum großen Thema: Auf dem S-Bahnhof München-Solln stirbt der 50-jährige Dominik Brunner, weil er vier Kinder gegen zwei Halbstarke verteidigen will. Mindestens ein Dutzend Zeugen beobachten das Handgemenge und die Prügelei, eilen Dominik Brunner aus den unterschiedlichsten Gründen aber nicht zu Hilfe. Die Öffentlichkeit ist geschockt: Wie kann ein Mensch am helllichten Tag unter den Augen so vieler Passanten getötet werden? Warum fällt es so schwer, anderen zu helfen?
Klar ist: Brutale Taten wie in München sind Einzelfälle, immer noch und Gott sei Dank. Doch seien Sie ehrlich: Erinnern Sie sich nicht auch an eine Situation aus Ihrem Alltag, in der Sie couragierter hätten sein können, in der Sie spontan hätten zupacken oder helfen wollen, wenn nicht gerade dies oder das Sie daran gehindert hätte?
Zivilcourage heißt, selbstlos für andere einzustehen, auch auf die Gefahr hin, dass einem daraus persönliche Nachteile entstehen. Viele Menschen, für die wir stellvertretend einige Namen in diesem Buch nennen, handeln bereits so. Vielleicht sind es nach dieser Lektüre ein paar mehr. Wenn es uns gelingt, Sie zum Nachdenken anzuregen und für die Perspektive anderer Menschen zu sensibilisieren, dann haben wir unser Ziel schon erreicht.
Wir wollen weder die Welt verbessern noch den moralischen Zeigefinger heben. Doch unsere monatelange Recherche hat gezeigt: Zivilcourage ist nicht so sperrig wie ihr Name. Und sie beginnt bereits im Kleinen. Zivilcourage verlangt keine Heldentaten, es reichen ein offenes Auge und ein großes Herz.
Constanze Löffler und Beate Wagnerim Frühjahr 2011
Vorwort von Bettina Wulff
Jederkann etwas tun
Als zweifache Mutter frage ich mich häufig, wie es meinem Mann und mir gelingen kann, unsere beiden Söhne zu wachsamen und engagierten Menschen zu erziehen. »Zivilcourage– Keine Frage!« von Beate Wagner und Constanze Löffler gibt einige wertvolle Antworten auf diese Frage.
Es gibt wohl nichts Besseres, als unseren Kindern ein möglichst gutes Vorbild zu sein: Täglich bemühen wir uns, wachsam zu sein, nach unseren Mitmenschen zu schauen, uns einzumischen, uns zu engagieren.
Lassen Sie mich daher von einem Beispiel berichten, das für echtes privates Engagement steht und mich zutiefst beeindruckt hat: die Bürgerstiftung Hannover.
Christian Pfeiffer, Jurist und Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, wollte unbedingt die erste Bürgerstiftung in Deutschland gründen. Während seiner Besuche bei amerikanischen Forscherkollegen hatte er bereits Jahre zuvor zahlreiche Stiftungen und deren soziale Projekte kennengelernt– und er war von der Idee fasziniert, mit privatem Kapital die Gesellschaft zu unterstützen. 1996 traf Christian Pfeiffer einige gesellschaftlich engagierte Freunde, um sie von seiner Idee zu überzeugen. Er war erfolgreich. Noch am selben Abend wurde durch die Spenden der Anwesenden die finanzielle Grundlage für die Gründung geschaffen.
Im Jahre 1999 wurde dann die Bürgerstiftung Hannover gegründet. Über 40Projekte werden derzeit von der Stiftung Hannover gefördert: Vom Musikunterricht für benachteiligte Kinder über einen Kinderzirkus mit behinderten und nicht behinderten Jugendlichen bis zur Sommerschule in einem Brennpunkt-Stadtteil.
Sich gegenseitig helfen, für andere Menschen Verantwortung übernehmen, aufmerksam sein– so funktioniert im Kleinen die Familie, und so funktioniert im Großen unsere Gesellschaft. Wer Zivilcourage übt, setzt sich ein für ein friedliches Miteinander aller Menschen einer Gemeinschaft, so verschieden sie auch sind.
Zivilcourage ist eine Tugend, auf die wir nicht verzichten können. Es sollte unser ganz persönlicher Anspruch sein, auch Menschen, die uns fremd sind, in Not zu unterstützen. Es sollte uns allen daran gelegen sein, bei Unrecht beherzt einzugreifen, auch wenn wir nicht selbst betroffen sind. Nur so können wir darauf vertrauen, dass uns oder unseren Kindern ebenfalls geholfen wird.
In vielen gesellschaftlichen Bereichen wird momentan der Ruf nach mehr Zivilcourage laut. Denn brutale Schlägerszenen auf der Straße oder Demütigungen durch Cybermobbing im Internet gehören ebenso zum Alltag wie soziale Ausgrenzung in Schulen und Unternehmen.
Es ist wichtig, physische und psychische Gewalt als soziales Problem zu erkennen und dagegen vorzugehen. Ebenso wichtig ist es, zu fragen, woher diese Gleichgültigkeit und Selbstbezogenheit kommt und wohin uns mangelnde Solidarität und fehlende soziale Verantwortung führt.
Übersetzt man den etwas hölzernen Begriff Zivilcourage, dann heißt das Bürgermut. Und das stimmt: Wer sich für andere einsetzt und dabei ein Risiko für sich eingeht, der braucht Mut. Doch Zivilcourage ist mehr als die korrekte Reaktion in einer Notsituation. Zivilcourage beginnt im Alltag: In der Schlange beim Bäcker, bei der Erziehung unserer Kinder, im Büro.
Wer Zivilcourage lebt, braucht vor allem eines: das Interesse am Miteinander. Und die Bereitschaft, tolerant auf andere Menschen zuzugehen und offen für Neues zu sein! Ich bin dabei, Sie auch?
Herzlichst
Ihre Bettina Wulff
1 Die Tragödie Dominik Brunner
»Das, was dem Leben Sinn verleiht, gibt auch dem Tod Sinn.«
Antoine de Saint-Exupéry
1.1 |Eine Minute Gewalt
Es war ein bewegendes Fest, wird der Bildhauer Stefan Rottmeier später sagen. Bewegend und bedrückend zugleich: Die Enthüllung der von ihm geschaffenen Bronzeplastik für Zivilcourage in Ergoldsbach am 12.September 2010 hat schreckliche Erinnerungen wach werden lassen. Das Denkmal zeigt eine männliche Figur, die sich schützend vor ein Kind stellt. Genau das hatte Dominik Brunner ein Jahr zuvor getan. »Die Statue soll Zivilcourage einen menschlichen Ausdruck geben«, sagt Künstler Rottmeier, »Sie ist Sinnbild für die mutige und selbstlose Tat Brunners.« Der Geschäftsmann aus Ergoldsbach hatte vier Kinder geschützt, die in der Münchner S-Bahn von Jugendlichen bedroht wurden. Kurz danach war Dominik Brunner tot.
Hunderte Menschen kamen an Brunners erstem Todestag in sein Heimatdorf. Der strahlend blaue Himmel sorgte ebenso wie das weiße Tuch, das die Statue zunächst verdeckte, dafür, dass keine Trauerstimmung aufkam. Stattdessen war jeden Moment klar: Ergoldsbach wird von nun an immer mit dem Thema Zivilcourage verbunden sein, auch wegen des ebenfalls an diesem Tag eingeweihten Dominik-Brunner-Hauses.
»An Herrn Brunner. Für Ihren Mut und Ihre Stärke bewundern wir Sie und fragen uns immer wieder, wie wir in dieser Situation gehandelt hätten und wie so etwas Furchtbares hätte verhindert werden können.«1
Mutig und selbstlos zu sein, das war Brunners Ansinnen an jenem Samstagnachmittag 2009. Er hatte einen freien Tag, den er– wie so oft– in München verbrachte. Über Mittag war der 50-Jährige im Müllerschen Volksbad schwimmen gewesen. Am Abend wollte er Freunde auf einer Vernissage treffen. Doch als die Kunstausstellung eröffnet wurde, war Dominik Brunner längst tot. Er starb trotz notfallintensiver Maßnahmen um 18.20 Uhr im Klinikum Großhadern an Herzversagen. Dem vorausgegangen war eine Schlägerei mit zwei Jugendlichen auf dem S-Bahnhof München-Solln.
»Für einen Helden, aber auch für alle, die weggesehen haben und sich jetzt Vorwürfe machen. Wir dürfen nicht noch einmal wegschauen!«1
Das Ereignis in München-Solln hat Deutschland erschüttert und in Wohnzimmern, Gaststuben und Talkshows eine Grundsatzdebatte über die verrohte Jugend, verloren gegangene Werte, eine Gesellschaft aus Einzelgängern und fehlende Zivilcourage entfacht, wie es sie hierzulande bisher nicht gab. Dabei war Brunner längst nicht der Erste, der beim Einsatz für andere sterben musste. Erst im Jahr zuvor erlag der damals 29-jährige Fabian Salar Saremi in Bensheim seinen Verletzungen. Er verteidigte ein Pärchen und wurde dafür von vier Männern zusammengeschlagen. Schwer verletzt lag Saremi am Straßenrand, als ihn ein Taxi überrollte.
München ist ein besonderer Ort
Der Unterschied zu Brunner? Es gab mindestens zwei Umstände,die dem Fall Brunner eine erhöhte Aufmerksamkeit bescherten:
1) Die beiden Jugendlichen traten tagsüber in Anwesenheit mehrerer Beobachter mitten auf einem S-Bahnhof auf Brunner ein. Zeugenaussagen zufolge seien Passanten weitergegangen, und auch der Zugführer wäre einfach losgefahren.
2) Brunner starb in München. Seit Jahrzehnten hat der Ort das Image der idyllisch-sicheren Großstadt. Doch sondert sich hier bereits seit Längerem eine kleine reiche Elite immer mehr von den zahlreichen Menschen aus sozial schwachen Verhältnissen ab. Weil die Stadt nicht sehr groß ist, treffen Jugendliche aus ärmeren Verhältnissen längst nicht nur ihresgleichen im Viertel. »Wenn man junge Leute sieht, die Sportwagen fahren, teure Klamotten tragen, Champagnerrunden werfen und man selbst hat gar nichts, steigt die Wut und Aggression«, sagt Hans Peter Schmalzl, Polizeipsychologe aus München. Gerade im reichen München würden sich sozial schwache Jugendliche als Versager fühlen.
»Mit Betroffenheit halte ich an diesem Ort inne. Wahrscheinlich wäre auch ich unter denen gewesen, die aus Angst um ihr Leben Ihren Hilferuf nicht hören wollten. Dafür möchte ich Sie um Verzeihung bitten!«1
Wer genauer hinsieht, stellt fest: Mögen die Verhältnisse in der bayrischen Metropole vielleicht besonders krass sein– Zivilcourage scheint auch im übrigen Deutschland abhandengekommen zu sein.
Wie findet die Gesellschaft heraus aus dem Dilemma? Die Politik fordert auf Ereignisse wie in Solln reflexartig eine Verschärfung des Jugendstrafrechts und eine stärkere Videoüberwachung im öffentlichen Nahverkehr. Auch die Mehrheit der Bevölkerung spricht sich für härtere Strafen aus, »aus symbolischen Gründen«. 84Prozent der Befragten einer Emnid-Umfrage für den Nachrichtensender N24 sagten, man solle Zivilcourage würdigen, indem man die Strafen für die Täter verschärft.
Vorschnelle Ehrung?
Brunners Tod warf in den Wochen nach der Tat viele Fragen auf; gewiss schien nur eines: Brunner hatte sich vorbildlich verhalten– und musste dafür sterben. Schnell avancierte er zum Helden der Zivilcourage. Posthum erhielt er diverse Preise: Vom Bayrischen Verdienstorden bis hin zum Bundesverdienstkreuz Erster Klasse. Beim Bayern-Spiel gegen Nürnberg erhoben sich eine Woche nach dem Ereignis knapp 70000Menschen zum Gedenken an ihn. Uli Hoeneß hielt eine bewegende Rede und rühmte Brunner als Vorbild, an dessen Verhalten sich die Gesellschaft ein Beispiel nehmen könne. In München soll ein Platz nach ihm benannt werden.
»Jetzt erst recht Zivilcourage zeigen.«1
Hoeneß gehört dem Stiftungskuratorium der Dominik-Brunner-Stiftung an. Die Stiftung gründete sich nur wenige Wochen nach dem Tod des Managers, Initiatoren sind ehemalige Kollegen der Erlus AG– der Dachziegelbetrieb, in dem Brunner Geschäftsführer war–, Angehörige und Freunde seiner Familie. »Es war schnell klar, dass wir etwas Bleibendes gegen das Vergessen und für die Zivilcourage tun wollen«, sagt Peter Maier, Vorstand der Erlus AG und der Brunner-Stiftung.
»Ich betrauere den Tod des mutigen Mannes und fühle mit seinen Angehörigen. Dennoch: Auch die brutalen Täter sind Opfer unserer zunehmend brutalen Gesellschaft.«1
Dass Brunner zum Helden wurde, nimmt man bei der Erlus AG gemischt auf: »Die Medien haben ihn auf diesen Sockel gestellt, auf einmal war er der Held von Solln«, sagt Harald Bardenhagen, Kuratoriumsmitglied der Brunner-Stiftung dem Berliner Tagesspiegel. Die ganze Überhöhung und Heroisierung sei ihm unheimlich. »Natürlich ist Dominik für uns ein Held«, erklärt hingegen Claus Girnghuber, ein guter Freund Brunners und Aufsichtsratsvorsitzender der Erlus AG. »Viel wichtiger aber ist es, dass ihn die Öffentlichkeit als Vorbild sieht.« Helden seien Ausnahmeerscheinungen, mit ihnen identifiziere man sich nicht. »Ein Vorbild hingegen fordert Menschen auf, es ihm nachzutun«, sagt Girnghuber.
Engagement für Menschlichkeit und Nächstenliebe
Die Brunner-Stiftung hilft zukünftig Menschen und deren Angehörigen, die wegen ihres selbstlosen Handelns gesundheitlich oder finanziell in Not geraten sind. Die gemeinnützige Einrichtung unterstützt aber auch soziale Projekte wie zum Beispiel den Verein »ghettokids«. Hier werden Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien in München betreut. »Ziel der Dominik-Brunner-Stiftung ist es, Zivilcourage als Wert zu vermitteln, der über die effekthascherische Berichterstattung hinaus am Leben gehalten und gelebt wird«, so Peter Maier.
»Viele Worte, viele Blumen, viele Kerzen, nur, hilfst du morgen?«1
In den Monaten nach Brunners gewaltsamem Tod kommen immer neue Details der tragischen Minuten auf dem Bahnhof München-Solln ans Tageslicht. Zunehmend beginnt der Thron des Dominik Brunner zu wackeln, der Glanz seines zivilcouragierten Einsatzes zu verblassen. Die Boulevard-Medien beschwören das Grusel-Image der Brunner-Killer und befürworten die Anklage der Täter wegen Mordes. Seriöse Blätter beginnen indes zu zweifeln: Ist diese Anklage gerechtfertigt, und trägt Brunner eine Mitschuld daran, dass die Situation derartig eskalierte?
Denn anders als zunächst vermutet, war es der Jurist, der zuerst zugeschlagen hatte. Das behauptete zunächst der Spiegel unter Berufung auf Zeugenaussagen im Februar 2010. Später geht auch das Gericht davon aus. So soll Brunner nach dem Aussteigen am Bahnhof Solln in Richtung des S-Bahnfahrers gerufen haben: »Jetzt gibt’s hier hinten Ärger.« Dann legte er Jacke und Rucksack ab und näherte sich den beiden Angreifern mit erhobenen Fäusten. Wie Zeugen zu Protokoll gaben, setzte er den ersten Fausthieb und traf einen der beiden Täter ins Gesicht.
»Wenn Du in meinem Herzen lesen könntest, sähest Du den Platz, den ich Dir gegeben habe.«1
Daraufhin steckte sich einer der Täter einen Schlüsselbund zwischen die Finger. Dann gingen die beiden Jugendlichen auf Brunner los, boxten und traten ihn. Brunner schlug mit dem Kopf gegen ein Metallgeländer und rutschte zu Boden. An die zwanzig Mal erwischen die Fußtritte den Mann, auch noch, als Brunner längst wehrlos am Boden liegt. Als die Polizei eintrifft, flüchten die Jugendlichen in ein nahe gelegenes Gebüsch.
»Es erfüllt mich mit Zuversicht, dass es Menschen gibt, die sich so entschieden für Gerechtigkeit einsetzen.«1
Prozess mit Spannung erwartet
Es vergehen neun Monate, bis der Prozess gegen die beiden Haupttäter vor der Jugendkammer am Münchner Landgericht im Juli 2010 beginnt. Eine Zeit, in der Polizei und Staatsanwaltschaft Akten sichten, 53Zeugen und vier Sachverständige befragen. Eine Zeit, in der die Bevölkerung spekuliert, mutmaßt und debattiert, ob auch Brunner schuldig ist.
Der dritte Täter, der in der S-Bahn noch mitgepöbelt hatte, dann aber vorher umgestiegen war, ist zum Prozessauftakt bereits verurteilt. Gegen ihn wurde eine Jugendhaftstrafe von 19Monaten wegen gefährlicher Körperverletzung, versuchter räuberischer Erpressung und öffentlicher Aufforderung zu Straftaten auf Bewährung verhängt.
So sehen keine Mörder aus
Am ersten Tag des Prozesses ist die Luft in dem fensterlosen Sitzungssaal 101 des Strafjustizzentrums zum Zerschneiden. An die 120Pressevertreter haben sich beim Landesgericht München für das Verfahren akkreditiert. Als die beiden Täter durch die weiße Tür in den Sitzungssaal treten, sind viele der Beobachter überrascht, wie harmlos sie aussehen: Zwei schüchtern wirkende, schmächtige Jungs mit schmalen Gesichtern, gekämmt und im frischen Hemd. Auch ihr weiteres Verhalten passt zu dem fast bemitleidenswerten Auftritt. Der Haupttäter Markus Sch. ist physisch und psychisch nicht in der Lage, selbst auszusagen, Sebastian L. antwortet dem Richter in kurzen, monotonen Sätzen.
»Du verdienst unseren ganzen Respekt. Lebe im Himmel weiter. Wir kommen später nach und werden Dir die Hand schütteln.«1
Die Verhandlung dauert zwölf Tage. Der Vorsitzende Richter Reinhold Baier versucht, die in der Öffentlichkeit aufgeheizte Stimmung vom Gerichtssaal fernzuhalten. »Das kann ich absolut nachvollziehen, dass Ihnen nicht wohl in Ihrer Haut ist«, sagt er in fast väterlicher Art zum 18-jährigen Sebastian L. Baier kennt sich aus mit jungen Tätern. Er hat auch die beiden Jugendlichen vom Arabellapark zu langen Haftstrafen verurteilt, die 2007 einen Rentner in München zusammengeschlagen hatten. Der Jugendrichter gilt als empathisch, aber streng in seinen Entscheidungen. Die Täter vom Arabellapark verurteilte er damals zu zwölf und achteinhalb Jahren Haft.
Wir wollten nie töten
Auch Markus Sch. und Sebastian L. müssen mit einem harten Urteil rechnen; die Staatsanwaltschaft klagt die beiden wegen Mordes an. Gleich zu Beginn geben beide Täter zu, in den Konflikt involviert gewesen zu sein, äußern ihr Bedauern und beteuern, sie hätten Brunner weder angreifen noch töten wollen.
Nach dem vierten Prozesstag nimmt die Verhandlung eine überraschende Wende: In ihrer 90-seitigen Anklageschrift hatte die Staatsanwaltschaft ungenau formuliert, Brunner sei an den Folgen des Angriffs der Angeschuldigten verstorben. Nun aber wird klar: Todesursächlich war ein schwaches, krankhaft vergrößertes Herz. Zwar wies Brunners Körper mindestens 22 schwere Verletzungen auf und seine Stirn trug den Abdruck eines Turnschuhs von Markus Sch. Brunner starb jedoch weder an diesen Verletzungen noch wies er Knochenbrüche oder innere Blutungen auf, die für seinen Tod ursächlich gewesen wären.
»Unsere Familie ist sehr betroffen, haben wir doch auch Kinder in diesem Alter, die mit dieser S-Bahn fahren.«1
Es bleibt bei Mord
Mit einem Mal ist das brutale Killer-Image der Täter nicht mehr aufrechtzuhalten. Besonders brisant: Die Staatsanwaltschaft München wusste seit der Obduktion im September 2009 von Brunners vergrößertem Herz, verschwieg diesen Umstand aber bis zu Prozessbeginn.
Vielmehr hält sie weiterhin an der Mordanklage fest. »Herr Brunner ist infolge der Schläge und Tritte daran gestorben, dass das Herz stehen geblieben ist«, erklärt die Oberstaatsanwältin Barbara Stockinger. Ohne die massiven Schläge und Tritte würde er noch leben. Er sei nicht aggressiv gewesen, wollte sich mit seinem Schlag nur schützen. Weder sein erster Schlag noch der unentdeckte Herzfehler seien erheblich. Im Übrigen habe niemand einen Anspruch auf ein gesundes Opfer.
Das Gericht bleibt mit seinem Urteil nur geringfügig unter den von der Staatsanwaltschaft beantragten Strafen: Am 6.September 2010 wird Markus Sch. wegen Mordes und versuchter räuberischer Erpressung zu neun Jahren und zehn Monaten Jugendstrafe verurteilt. Sebastian L. bekommt sieben Jahre Jugendstrafe wegen Körperverletzung sowie versuchter räuberischer Erpressung mit Todesfolge. »Die Angeklagten hatten sich entschlossen, sich an Dominik Brunner zu rächen«, sagt Richter Baier. Sie seien »aufs Höchste verärgert gewesen, dass sie von einem Wildfremden in ihre Schranken gewiesen wurden.«
»Lieber Held, möge Gott Dich mit offenen Armen empfangen. Für Deinen Mut hast Du einen Ehrenplatz im Himmel verdient.«1
Ob dem wirklich so war, wissen nur die Jugendlichen selbst. Sie sitzen mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt Ebrach in Oberfranken ihre Strafe ab. Die Diskussion über den Fall Brunner ist mit dem Urteil nicht beendet. Die Anwälte der beiden Täter haben Revision angekündigt.
1.2 |Chronologie eines Falles
12.September 2009, 15.45Uhr:
An der Münchner S-Bahn-Haltestelle Donnersbergerbrücke bedrohen drei Jugendliche im Alter von 17 und 18Jahren vier Schüler. Die Jugendlichen fordern 15Euro von den 13- bis 15-Jährigen und schlagen mindestens einen der beiden Jungs der Gruppe.
12.September 2009, 15.58Uhr:
Die S-Bahn in Richtung Solln fährt in den Bahnhof ein. Die Schüler steigen ein. Zwei der pöbelnden Jugendlichen ebenfalls, der dritte wechselt in eine andere Bahn. Die späteren mutmaßlichen Täter sprechen laut darüber, wie sie den Schülern das Geld abnehmen wollen. Dominik Brunner schaltet sich ein und fordert die Jugendlichen auf, Ruhe zu geben.
12.September 2009, 16.00Uhr:
Der 50-Jährige verständigt per Notruf die Polizei. Den Schülern bietet er an, gemeinsam mit ihm am S-Bahnhof Solln auszusteigen. Eigentlich wollten sie schon vorher in Mittersendling aussteigen.
12.September 2009, 16.09Uhr:
Die S-Bahn fährt in Solln ein. Brunner steigt mit den Schülern aus, die beiden Angreifer folgen ihnen. Zeugenaussagen zufolge legt Brunner Jacke und Rucksack ab und schlägt in Erwartung eines Angriffs zuerst zu. Die beiden Jugendlichen schlagen zurück und treten auf Brunner weiter ein, auch als er schon am Boden liegt. Brunner verliert das Bewusstsein.
12.September 2009, 16.10Uhr:
Ein Streifenwagen fährt ohne Blaulicht und Martinshorn zum Bahnhof, da aus Brunners Anruf keine akute Bedrohungssituation zu erkennen war.
12.September 2009, bis ca. 16.13Uhr:
Mehrere Augenzeugen rufen bei der Polizei an und melden eine Schlägerei am S-Bahnhof Solln. Die Streife, die bereits unterwegs ist, schaltet nun Blaulicht ein. Der Rettungsdienst wird alarmiert.
12.September 2009, ca. 16.17Uhr:
Ambulanz und Polizei treffen zeitgleich am Bahnhof ein. Brunner liegt bewusstlos am Boden. Die Rettungskräfte beginnen mit der Reanimation, die später im Klinikum Großhadern fortgeführt wird. Die Täter rennen in ein 100Meter entferntes Gebüsch und verstecken sich. Eine Schallschutzwand verhindert allerdings, dass sie entkommen.
12.September 2009, 17.30Uhr:
Sebastian L. und Markus S., die sich in einem nahe gelegenen Gebüsch versteckt haben, werden festgenommen.
12.September 2009, 18.20Uhr:
Dominik Brunner stirbt im Krankenhaus an Herzstillstand durch Kammerflimmern. Die Obduktion ergibt, dass Brunner ein stark vergrößertes Herz hatte. Bis in die frühen Morgenstunden vernimmt die Polizei die Beschuldigten und Zeugen.
13.September 2009:
Am Tatort legen Betroffene Bürger unzählige Blumen, Kerzen und Briefe nieder. Gegen die beiden Hauptbeschuldigten wird Haftbefehl erlassen. Der dritte Jugendliche, der kurz vor der Eskalation die S-Bahn gewechselt hatte, wird festgenommen.
16.September 2009:
Auf dem Parkplatz des S-Bahnhof Solln veranstalten örtliche Kirchen und der Bezirksausschuss eine ökumenische Trauerveranstaltung. Alle öffentlichen Verkehrsmittel in München stehen um 18Uhr für eine Gedenkminute still.
18.September 2009:
Dominik Brunner wird im engsten Kreis in Ergoldsbach beerdigt.
1.3 |Eine tragische Geschichte
Interview mit Prof. Christian Pfeiffer. Der Kriminologe und Jurist leitet das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachen.
Monatelang hielt der tragische Tod Dominik Brunners auf dem Bahnhof München-Solln Deutschland in Atem. Am 6.September 2010 verurteilte die Jugendkammer des Landgerichts München I Markus Sch. (19) wegen Mordes zu einer Jugendstrafe von neun Jahren und zehn Monaten, nur zwei Monate weniger als die höchstmögliche Jugendstrafe. Der Angeklagte Sebastian L. (18) wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu sieben Jahren verurteilt.
Herr Prof. Pfeiffer, wie bewerten Sie dieses Urteil?
Ich kann das Urteil nicht abschließend bewerten, denn der Fall Dominik Brunner wird die Gerichte auch über das Urteil hinaus beschäftigen. Die Anwälte der beiden Täter haben angekündigt, Revision einzulegen. Dann wird der Bundesgerichtshof (BGH) klären müssen, ob rechtliche Fehler in dem Brunner-Urteil aufgetreten sind.
Was könnten das für rechtliche Fehler sein?
Ich kann verstehen, dass die Anwälte der Täter die Begründung des Urteils überprüfen lassen möchten. Der BGH müsste im Falle einer Revision zum Beispiel prüfen, ob das Mordmerkmal aus niederem Beweggrund als nachgewiesen gilt. Niedrige Beweggründe sind §221 STGB zufolge Beweggründe, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und nach allgemeinen Wertmaßstäben besonders verachtenswert sind (Anm. d Red.). Der Anwalt des Täters geht davon aus, dass dem nicht so ist.
Warum nicht?
Es ist unstrittig, dass Brunner sich den beiden in einer kämpferischen Haltung genähert hat. Dann hat er den ersten Schlag gesetzt– und zwar zu einem Zeitpunkt, als die Kinder sich längst in Sicherheit befanden. Es ist gut möglich, dass es in diesem Moment nicht mehr um den Schutz der Kinder ging, sondern um eine Auseinandersetzung zwischen dem »mutigen« Dominik Brunner und zwei pöbelnden Jugendlichen.
Inwieweit würde sich das auf das Urteil auswirken?
Wenn der Bundesgerichtshof erneut prüft, bliebe es bei dem ersten Täter möglicherweise weiterhin bei dem Urteil Mord. Denn Markus Sch. hat auch noch auf Brunner eingetreten, als der schon wehrlos am Boden lag und das nach Feststellung des Gerichts mit Tötungsvorsatz. Der Fakt, dass Brunner zuerst zugeschlagen hat, könnte sich allerdings strafmildernd auswirken.
Und bei dem zweiten Täter?
Der Anwalt von Sebastian L. akzeptiert zwar die Bewertung der Körperverletzung mit Todesfolge. Dennoch hält auch er das Strafmaß von sieben Jahren für zu hoch. Ich kann das nachvollziehen, denn Abschreckung der Allgemeinheit durch ein Urteil hat im Jugendstrafrecht nichts verloren. Junge Täter sollen durch die Strafe wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden. Der Tod Brunners ist überdies durch sein Herzproblem eingetreten.
Wie kommt denn dann das aktuelle Urteil zustande?
In der jetzigen Urteilsbegründung unterstellt die Staatsanwaltschaft zumindest dem Haupttäter, aus Rache auf den Angriff gehandelt zu haben. Außerdem geht sie davon aus, dass der erste Schlag Brunners Nothilfe war. Das ist aber keineswegs so klar, denn mehrere Zeugen gaben an, dass die eigentliche Gefahr längst vorüber war, als Brunner, die Kinder und die Jugendlichen aus der S-Bahn ausgestiegen waren. Ein Schlag aus Nothilfe war also offenbar unnötig.
Ist das jetzige Strafmaß zu hart?
Das hängt von der Bewertung dieser Nothilfe-Frage ab. Es ist hart, aber angemessen, wenn Markus Sch. wirklich die Absicht gehabt hat, Brunner zu töten und auch der BGH die Nothilfelage bestätigt. Das Urteil wäre aber zu hart, wenn zu Beginn des Kampfes objektiv keine Nothilfe erforderlich war. Vom Tötungsvorsatz ist auszugehen: Wer mehrmals brutal auf einen wehrlos am Boden liegenden Menschen eintritt, handelt vorsätzlich und nimmt den Tod des Opfers in Kauf.
Warum hat die Staatsanwaltschaft erst so spät öffentlich gemacht, dass Brunner zuerst zugeschlagen hat und eine Herzschwäche hatte?
Die Staatsanwaltschaft hat die Fakten wohl absichtlich spät veröffentlicht, um eine entsprechende Stimmung zu erzeugen und die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu bringen.
Ist das Urteil richtungsweisend?
Nein, das ist das Ärgerliche an dem ganzen Fall: Das Urteil wird im Hinblick auf den Aspekt Zivilcourage total überschätzt. Das Verhalten Brunners nach dem Aussteigen aus der S-Bahn mag menschlich gesehen nachvollziehbar sein. Objektiv betrachtet hat er sich aber mehr als zweifelhaft verhalten. Nicht nur, dass er seine Jacke ausgezogen und den Rucksack zur Seite gelegt hat, er ist auch aktiv mit erhobenen Fäusten auf die Jugendlichen zugegangen. Und er soll außerdem verbal angekündigt haben, dass es gleich Ärger geben werde.
Wird das Verfahren anderen jugendlichen Straftätern eine Lehre sein?
Nein, die Höhe der Strafe ist nicht abschreckend, sondern das Risiko des Erwischtwerdens. Jugendliche reagieren sehr spontan, die Dynamik einer Tat wie in München-Solln folgt anderen Regeln. Daher bringt es überhaupt nichts, wenn Politiker und die Öffentlichkeit nach derartigen Ereignissen lauthals nach härteren Strafen verlangen.
Ihr Fazit im Fall Brunner?
Brunners Fall ist eine tragische Geschichte. Er hat anfangs zivilcouragiert reagiert und sich der Kinder angenommen. Doch schon in der S-Bahn hat er den ersten gravierenden Fehler gemacht: Er hat niemanden gebeten, ihn zu unterstützen. Auf dem Bahnsteig ging es dann weiter. Trotzdem avancierte Brunner zur Ikone der Zivilcourage. Immer wieder wurde gelobt, dass er alles richtig gemacht habe. Die eigentliche Botschaft des Falles ist hingegen nicht kommuniziert worden: Zivilcourage ist wichtig. Aber wer sich falsch einmischt, gerät schnell in große Gefahr.
2 Tatort Deutschland
»Die Stärke unserer Gesellschaft misst sich am Wohl der Schwachen.«
Helmut Simon
2.1 |Wenn Menschen auf der Strecke bleiben
Sie laufen unmotiviert um den Sportplatz, prügeln sich um zehn Euro, treten gegen Stühle, beschimpfen die Sozialarbeiter und Therapeuten. Die fünfzehn straffällig gewordenen Jungs sind zornig, frustriert, aggressiv. Sie verstehen nicht, warum gerade Boxen ihr Leben verändern soll. »Für was soll ich boxen, wofür den Scheiß? Ich brauch euch nicht, das hier ist ein Abstellgleis.« Mit Sprüchen wie diesen wehren sie sich gegen das Projekt Work and Box. Doch es ist ihre letzte Chance. Ein Jahr haben die Jugendlichen Zeit, sich darin zu bewähren. Sie lernen boxen und werden aufs Leben vorbereitet. Das Ziel der Box-Selbsterfahrung: ein Schulabschluss oder eine Lehrstelle. Wer die Auflagen nicht erfüllt, wandert in den Knast.
Boxen im Ring, Bäume fällen im Wald, Kanu fahren auf dem Fluss, über seine Gefühle reden auf dem »heißen Stuhl«: Wozu das alles? Bisher bestand der Alltag der jugendlichen Straftäter vor allem aus Gewalt und Drogen. Nun sind sie Teil des Work-and-Box-Projekts in Taufkirchen bei München. Hier sollen sie boxen lernen und im besten Fall ein neues Leben beginnen. Es geht um Selbstbewusstsein, Verantwortung, Reibung. »Sie kommen mit ihren Gefühlen in Berührung und müssen sich ihren Platz in der Gesellschaft erkämpfen«, sagt Werner Makella, der das Projekt leitet. Als systemischer Familientherapeut bringt er einen großen Erfahrungsschatz mit, von dem die Jungs profitieren können.
Handys abziehen, Gras rauchen, sich prügeln, Graffiti sprayen oder Autos demolieren– gegen gesellschaftliche Normen zu verstoßen und sich so den Extra-Kick zu holen, das gehört für viele Jugendliche zum Erwachsenwerden– vor allem für die Jungs. Fast jeder junge Mann begeht in seinem Leben mindestens eine kriminelle Tat, belegt die Forschung. Die meisten werden nicht erwischt. Gut so, denn zum überwiegenden Teil sind die kriminellen Hobbys eine vorübergehende Sache. Je älter die Jugendlichen werden, je mehr sich ihre Persönlichkeit ausbildet, desto seltener sind Delikte. Nur zwei bis zehn Prozent schlagen eine kriminelle Karriere ein: Sie begehen auch über das »Rüpelalter« hinaus Straftaten– aus halbstarken Großmäulern werden chronische Delinquenten.
Diese kleine Gruppe immer wieder auffällig werdender Jugendlicher schockiert Politiker, Fachleute und Bürger gleichermaßen. Die Jugendlichen treten brutal zu, benutzen Messer und töten aus nichtigem Anlass. Viele Menschen fragen sich, warum die Zwischenfälle der um sich schlagenden Kids immer brutaler werden. »Anders als früher steht bei ihnen kein materieller Vorteil im Vordergrund, sondern die Gewalttaten an sich«, sagt Christoph Ahlhaus, Ex-Innensenator und heutiger Bürgermeister Hamburgs. Als Auslöser für ihre Taten führen die Angreifer selbst Nichtigkeiten und Banalitäten an. »Der hat mich komisch angeguckt.« Gewalt wird um ihrer selbst willen verübt; sie dient zunehmend der eigenen Unterhaltung und als Zeitvertreib.
Im September 2009