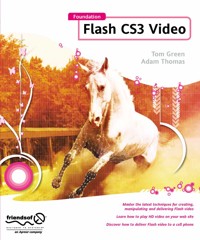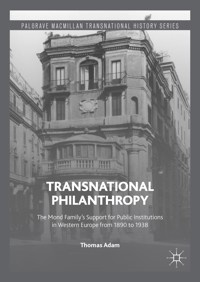Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Campus Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Traditionelle Darstellungen der deutschen Geschichte gehen meist davon aus, die Deutschen seien besonders staatsorientiert. Diese Sichtweise verkennt, dass Deutschland um 1900 eine Weltmacht war, wenn es um das stifterische Engagement seiner Bürger ging: Stiftungen finanzierten öffentliche Museen, förderten die Wissenschaften, unterhielten Gymnasien wie Universitäten und stellten Sozialleistungen zur Verfügung. Dieses Buch, die erste umfassende Darstellung des Stiftungswesens in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, behandelt dieses bislang als Randphänomen der Vormoderne verkannte zivilgesellschaftliche Handeln in allen seinen Aspekten. Thomas Adam verdeutlicht eindrucksvoll, dass Stiftungen mit ihren ungeheuren Finanzressourcen der modernen deutschen Gesellschaft einen spezifischen Charakter gaben, der nicht nur durch Adel oder Staat, sondern ganz wesentlich auch durch selbstbewusste Bürger bestimmt wurde.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Thomas Adam
Zivilgesellschaft oder starker Staat?
Das Stiftungswesen in Deutschland (1815–1989)
Campus Verlag
Frankfurt/New York
Über das Buch
Traditionelle Darstellungen der deutschen Geschichte gehen meist davon aus, die Deutschen seien besonders staatsorientiert. Diese Sichtweise verkennt, dass Deutschland um 1900 eine Weltmacht war, wenn es um das stifterische Engagement seiner Bürger ging: Stiftungen finanzierten öffentliche Museen, förderten die Wissenschaften, unterhielten Gymnasien wie Universitäten und stellten Sozialleistungen zur Verfügung. Dieses Buch, die erste umfassende Darstellung des Stiftungswesens in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert, behandelt dieses bislang als Randphänomen der Vormoderne verkannte zivilgesellschaftliche Handeln in allen seinen Aspekten. Thomas Adam verdeutlicht eindrucksvoll, dass Stiftungen mit ihren ungeheuren Finanzressourcen der modernen deutschen Gesellschaft einen spezifischen Charakter gaben, der nicht nur durch Adel oder Staat, sondern ganz wesentlich auch durch selbstbewusste Bürger bestimmt wurde.
Vita
Thomas Adam ist Professor für transnationale Geschichte an der University of Texas at Arlington (Texas, USA).
Inhalt
Vorwort
1.Einleitung
Zivilgesellschaft und Stiften in den deutschen Staaten vor 1815
Zivilgesellschaft und Demokratie
Aufbau des Buches
2.Zwischen Emanzipation und Einflussnahme: Der Wettbewerb zwischen Adel und Bürgertum auf dem Gebiet der Kunst- und Kulturförderung
Die Stiftung fürstlicher Legitimität durch die Errichtung von Kunstmuseen
Vom Juniorpartner zum Chef: Aristokratische und bürgerliche Unterstützung für die Kunstproduktion und Kunstmuseen
Das Zusammenwirken des königlichen Hofes und der Börse bei der Gründung des Berliner Zoologischen Gartens
Die Rolle herausragender bürgerlicher Stifter: Städel, Richartz und Grassi
Vom Stiften zum unternehmerischen Sponsoring: Das Deutsche Museum in München
Die bürgerliche Übernahme königlicher Museen: Der Kaiser-Friedrich-Museumsverein
Die bürgerliche Förderung königlicher Bibliotheken: Die Freunde der Berliner Königlichen Bibliothek
Der Übergang der Museen von stifterischem Eigentum in städtisches Eigentum
3.Pflanzstätten der höheren Bildung: Der Einfluss der Stifter auf die Zusammensetzung der künftigen intellektuellen Eliten an Gymnasien und Universitäten
Die Rolle von Stiftungen bei der Perpetuierung der sozialen Exklusivität von Gymnasien und Universitäten
Die Motivation zur Errichtung von Stiftungen
Die regionale Verteilung von Stiftungen und deren Verwaltung
Der Einfluss der Stipendienstiftungen auf die Zusammensetzung der Studentenschaft
Die Einrichtung von Stipendienstiftungen zur Unterstützung jüdischer Studenten
Universitätsstipendien für Frauen
4.Zwischen nationalem Anspruch und lokaler Verwurzelung: Stiften für nationale Forschungseinrichtungen
Die Zusammenarbeit von Stiftern und Staat bei der archäologischen Ausgrabung alter Zivilisationen
Die staatlich gesteuerte Suche nach Stiftern für die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft
5.Reformbewegung und Sozialkontrolle: Stiften, Wohnungsbau und die Ordnung familiärer Sozialbeziehungen in der Arbeiterschaft
Modelle der Bereitstellung von Sozialleistungen
Stiften und Wohnungsreform
Stiften und Investieren: Das Modell der gemeinwohlorientierten Aktienbaugesellschaften
Stiften und Sparen: Das Modell der Wohnungsbaugenossenschaften
Stiften und Schenken: Das Modell der Wohnstiftung
Wohnungsreform und Mietzahlung
Der Übergang von stifterischem Eigentum in kommunales Eigentum
6.Bürgergesellschaft und autoritärer Staat: Das Stiftungswesen am Vorabend des Ersten Weltkrieges
Die räumliche und zeitliche Dimension des Stiftungswesens im 19. Jahrhundert
Stiften in Leipzig: Eine Fallstudie
Die Rolle von Frauen im Leipziger Stiftungswesen
Jüdisches Stiften zwischen Ausgrenzung und Integration
Stiftungskapitalien und Volkswirtschaft
7.Auf dem Weg zur staatszentrierten Gesellschaft: Der langsame Niedergang des Stiftens und der Zivilgesellschaft im 20. Jahrhundert
Die Rolle der Stiftungen bei der Finanzierung des Ersten Weltkrieges
Das Schicksal der Zivilgesellschaft im Übergang von der Monarchie zur Demokratie
Die Abgrenzung von jüdischen und »arischen« Stiftungen in den 1930er Jahren
Die sinkende Bedeutung der Stiftungen in den beiden deutschen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg
Eine Gesellschaft ohne Stiftungen? Stiftungen und Stifter in der DDR
Vom Stiften zum Sponsoring: Die Transformation des Stiftens in Westdeutschland
8.Schlussbetrachtungen
Anmerkungen
1. Einleitung
2. Zwischen Emanzipation und Einflussnahme
3. Pflanzstätten der höheren Bildung
4. Zwischen nationalem Anspruch und lokaler Verwurzelung
5. Reformbewegung und Sozialkontrolle
6. Bürgergesellschaft und autoritärer Staat
7. Auf dem Weg zur staatszentrierten Gesellschaft
8. Schlussbetrachtungen
Literatur
1. Archivalien
Dartmouth College Archive
Archiv zur Geschichte der Max-Planck-Gesellschaft
Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde
Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem
Institut für Stadtgeschichte Frankfurt am Main
Landesarchiv Berlin
Stadtarchiv Leipzig
Universitätsarchiv der Humboldt-Universität zu Berlin
Universitätsarchiv Heidelberg
2. Literatur
Vorwort
Dieses Buch ist die überarbeitete und erweiterte Fassung meines 2016 im Verlag Camden House erschienenen Buches Philanthropy, Civil Society, and the State in German History, 1815–1989. Ich bin der Gerda Henkel Stiftung zu Dank verpflichtet, dass sie mir die nötige finanzielle Unterstützung für die Erstellung dieser deutschen Version gewährt hat. Ich möchte mich aber vor allem auch bei Rainer Hüttemann, dem ich während der Hamburger Tage des Stiftungs- und Non-Profit-Rechts im Jahr 2014 begegnet bin und der sich sofort für mein Buchprojekt interessiert hat, dafür bedanken, dass er diese deutsche Version meiner Darstellung der deutschen Stiftungsgeschichte angeregt und unterstützt hat. Birgit Weitemeyer bin ich für die Einladung nach Hamburg sehr dankbar, da diese Einladung den Stein zu diesem Buch sprichwörtlich ins Rollen gebracht hat. Und ich möchte mich bei Rupert Graf Strachwitz bedanken, der das Entstehen sowohl der englischen Version dieses Buches, dessen Manuskript er aufmerksam gelesen hat, als auch der deutschen Version über Jahre hinweg kritisch begleitete und mir vielfältige Anregungen gab.
Dieses Buch fasst meine nun mehr als zwei Jahrzehnte andauende Beschäftigung mit der Geschichte des deutschen Stiftungswesens zusammen. In dieser Zeit hatte ich mehrfach Gelegenheit, meine Forschungen auf verschiedenen Konferenzen in Deutschland einer kritischen Öffentlichkeit vorzustellen und mit Wissenschaftlern in Kontakt zu kommen, die sich der Erforschung des Stiftungswesens verschrieben haben. Ich möchte mich vor allem bei Karen Bork, Bernhard Ebneth, Frank Hatje, Dieter Hoffmann, Elisabeth Kraus, Gabriele Lingelbach, Lutz Miehe, Stephen Pielhoff, Ralf Roth, Clemens Striebing und Michael Werner für ihre intellektuellen Anregungen sowie für ihre Hinweise auf wichtige Archivbestände bedanken.
Meine zahlreichen Forschungsaufenthalte in Deutschland wurden durch Einrichtungen wie dem Center for Advanced Studies an der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin sowie durch Stiftungen wie der Fritz Thyssen Stiftung großzügig gefördert. Die Fritz Thyssen Stiftung gewährte auch den notwendigen Druckkostenzuschuss, um die englische Version dieses Buches zu veröffentlichen.
Arlington, im März 2018Thomas Adam
1.Einleitung
Sozialwissenschaftliche Studien zum Non-Profit-Sektor in Deutschland leiden darunter, dass sie das sozialstaatliche System Westdeutschlands, das sich nach dem Zweiten Weltkrieg ausbildete, in das 19. Jahrhundert zurückprojizieren. Stiftungen werden in diesen Darstellungen regelmäßig zu marginalen, das staatliche Handeln lediglich ergänzenden Institutionen degradiert und Deutschland damit zum Musterbeispiel einer staatszentrierten Gesellschaft (Patron State) stilisiert, in der zivilgesellschaftlichem Handeln nur wenig Raum gelassen wurde. In meinem Buch geht es darum, diese ahistorische Betrachtungsweise zu widerlegen. Die deutsche Gesellschaft vor dem Ersten Weltkrieg war keine staatszentrierte Gesellschaft, in der alle öffentlichen Einrichtungen durch den Staat oder die Kommunen finanziert wurden. Zivilgesellschaftliche Akteure und Institutionen wie Vereine, Stiftungen, Genossenschaften und gemeinnützige Aktiengesellschaften waren für die Finanzierung aller öffentlichen Einrichtungen unabdingbar. Diese Finanzierung kann auch nicht auf das viel beschworene Subsidiaritätsprinzip beschränkt werden, da dieses Prinzip ein organisiertes Miteinander und formelle Absprachen voraussetzt sowie dem Staat die alleinige Initiative zuspricht. Zivilgesellschaft und Stiftungswesen entwickelten sich aber nicht in Koordination mit dem Staat, sondern unabhängig von diesem – und in vielen Fällen auch in Konkurrenz zum Staat.1
Das Stiften in Deutschland zu untersuchen, besitzt eine weit über diese konkrete Fallstudie hinausreichende Bedeutung, da hier erstmals zivilgesellschaftliches Handeln in einem autoritär verfassten Herrschaftssystem – dem Deutschen Kaiserreich – analysiert wird. Existierende Interpretationen, denen zufolge Zivilgesellschaft und Demokratie zwei Seiten einer Medaille seien, werden hierbei erstmals einer historischen Überprüfung unterzogen.
Zivilgesellschaft und Stiften in den deutschen Staaten vor 1815
Zivilgesellschaftliches Engagement, das sich in der Gründung von Stiftungen niederschlug, lässt sich bis in die vorchristliche Antike zurückverfolgen.2 Es entwickelte sich als Reaktion auf soziale Ungleichheit, die sich in verschiedenen Sozial- und Wirtschaftsordnungen manifestierte.3 Stifter des 19. und 20. Jahrhunderts sowie die von ihnen begründeten selbstständigen und unselbstständigen Stiftungen und Vereine stehen in dieser jahrtausendealten Tradition. Stifterisches Engagement vermittelte Stiftern aber auch die Möglichkeit, öffentliche Räume nach ihren Visionen zu formen und sich im öffentlichen Gedächtnis einen festen Platz zu sichern.
Stiften in der Vormoderne war wesentlich durch religiöse Motive bestimmt. So prägte die Aktivitäten katholischer Stifter im Mittelalter und in der Frühen Neuzeit vor allem die Sorge um das Seelenheil nach ihrem Tod. Die katholische Erlösungslehre ermunterte Gläubige, sich auf ihrem Todesbett ihrer irdischen Habseligkeiten durch deren Stiftung an die katholische Kirche zu entledigen. Diese würde sie zum Zweck der Armenpflege verwenden.4 Damit resultierte Stiften im Mittelalter meistens in der Einrichtung unselbstständiger Stiftungen, die von der katholischen Kirche verwaltet wurden. Diese Stiftungen wurden darüber hinaus nicht mit Geld begründet, sondern mit Landbesitz, dessen Ertrag zur Erfüllung des Stiftungszweckes eingesetzt wurde. Aufgrund der wachsenden Zahl von Stiftungen entwickelte sich die katholische Kirche zu einem dominierenden Landbesitzer. So soll sie sich am Vorabend der lutherischen Reformation im Besitz von beinahe der Hälfte des Grundbesitzes in den deutschen Ländern des Heiligen Römischen Reiches befunden haben.5
Die lutherische Reformation am Beginn des 16. Jahrhunderts veränderte und erweiterte die Tradition des Stiftens nachdrücklich. Lutherisches Stiften unterschied sich grundsätzlich vom katholischen Stiften in Bezug auf die Motive des Stifters, den Zeitpunkt der Stiftung und die Stiftungszwecke. Das Errichten einer Stiftung war nun nicht mehr von der Sorge um das Seelenheil bestimmt, sondern durch das Bestreben des Stifters, den Schwachen in ihrer irdischen Gemeinschaft zu helfen. Stiften geschah nicht mehr am Lebensende des Stifters, sondern schon während der Lebzeiten des Stifters. Damit konnte der Stifter die Entwicklung seiner Stiftung verfolgen und gegebenenfalls auch Einfluss auf deren Verwaltung nehmen. Hierzu kam es vor allem dann, wenn er damit unzufrieden war. Martin Luthers berühmter Aufruf an die Obrigkeit und Bürger aus dem Jahr 1524, in dem er beide Seiten dazu aufforderte, Schulen zu errichten und das Bildungswesen finanziell durch die Einrichtung von Stiftungen zu unterstützen, führte zu einer Ausweitung des Stiftungsgedankens von der Armenpflege auf das Bildungswesen. Insbesondere in der höheren Bildung entstanden ambitionierte Einrichtungen, etwa das Seminarum Philippinum an der Universität Marburg (1527) oder das Evangelische Stift an der Universität Tübingen (1536), die die Ausbildung protestantischer Theologen attraktiv machen sollten.6 Damit wurde auch der Kreis der stiftungsverwaltenden Einrichtungen erweitert. Während im Mittelalter lediglich die katholische Kirche als Stiftungsverwalter auftrat, wurden nun auch Institutionen wie die Städte, die Universitäten und die Schulen zu Stiftungsverwaltern. Damit wurde auch die Säkularisierung des Stiftungswesens eingeleitet.7
Die wohl wichtigste Neuerung bestand darin, dass fortan nicht mehr nur unselbstständige Stiftungen entstanden, die durch die Kirche oder staatliche und kommunale Einrichtungen verwaltet wurden, sondern auch selbstständige Stiftungen, die ihren eigenen Verwaltungsapparat besaßen und unabhängig von kirchlichen, kommunalen und staatlichen Einrichtungen existierten und agierten. Die erste derartige selbstständige Stiftung war die im Jahr 1516 in Augsburg durch Jacob Fugger gegründete Fuggerei. Mit seiner Entscheidung, diese Stiftung weder der katholischen Kirche noch der Stadt Augsburg zur Verwaltung anzuvertrauen, sondern sie als eigenständiges Wirtschaftsunternehmen zu begründen, eröffnete Fugger eine neue Stiftungstradition. Die von Fugger begründete Wohnstiftung gab armen katholischen Bürgern der Stadt Augsburg für den symbolischen Preis von einem Rheinischen Gulden jährlich eine Unterkunft. Da der Mietpreis nur von symbolischer Bedeutung war und lediglich ein Drittel der jährlichen Betriebskosten deckte, stattete Fugger seine Stiftung mit einem zusätzlichen Kapital von 25.000 Rheinischen Gulden aus, von dessen Einkommen die Unterhaltung seiner Wohnstiftung finanziert werden sollte. Auf diesem Weg etablierte Fugger eine Einrichtung, die bis zum heutigen Tag existiert.8
Das Stiften entwickelte sich in der nachreformatorischen Epoche für katholische und evangelische Gläubige gleichermaßen zu einer Strategie, um den Zusammenhalt und den Ausbau ihrer jeweiligen Glaubensgemeinschaften zu verstärken. Schon in vorreformatorischer Zeit war es üblich geworden, den Kreis der Empfangsberechtigten einer bestimmten Stiftung hinsichtlich ihres Wohnortes, ihres sozialen Standes und ihrer Religionszugehörigkeit zu beschränken. Die Spaltung der christlichen Kirche in eine katholische und eine evangelische Kirche führte dazu, dass Stifter beider Religionsgemeinschaften Angehörige der jeweils anderen Religionsgemeinschaft vom Kreis der potentiellen Nutznießer ihrer Stiftung ausschlossen. Das wohl bekannteste heute noch existierende Beispiel für katholisches Stiften im Bildungsbereich in diesem Kontext waren die Stipendienstiftungen in der Stadt Köln, die nach den Napoleonischen Kriegen im Gymnasial- und Stiftungsfonds zu Köln zusammengefasst wurden und die ausschließlich für katholische Schüler und Studenten eingerichtet worden waren.9 Diese Stipendienstiftungen waren von wohlhabenden Kölner Bürgern mit dem Ziel begründet worden, den Söhnen Kölner Bürgerfamilien den Besuch der drei Gymnasien der Stadt sowie der Universität zu ermöglichen. Die erste Stiftung ging auf den Arzt Johann Wesebeder zurück, der 1.800 Gold-Gulden im Jahr 1422 zur Einrichtung von vier Stipendien für Gymnasialschüler stiftete.10 Wesebeders Stiftung veranlasste in den folgenden Jahrhunderten zahlreiche katholische Bürger Kölns, seinem Beispiel zu folgen. Zwischen 1422 und 1500 entstanden weitere sechs Stiftungen. Von 1501 bis 1600 kamen 48 Stiftungen hinzu, in der Zeit von 1601 bis 1700 waren es sogar 120 Stiftungen und von 1701 bis 1800 weitere 45 Stiftungen. Damit war die Zahl dieser katholischen Stipendienstiftungen im Zeitraum von 1422 bis 1800 auf insgesamt 220 gestiegen. Sie verwalteten ein Stiftungsvermögen, das sich auf mehrere Millionen Mark belief (im Jahr 1890 verwalteten insgesamt 283 Stiftungen zusammengenommen etwa sieben Millionen Mark).11 Insbesondere die Stiftungen, die nach der Reformation begründet wurden, entwickelten sich zu einem strategischen Mittel, um das Bekenntnis zur katholischen Religion in der Stadt Köln zu befördern, da die Zugehörigkeit zur katholischen Konfession und zu bestimmten Kölner Familien zu Zugangsvoraussetzungen für den Empfang eines Stipendiums im Fall sämtlicher 220 Stiftungen gemacht wurde. Diese Stiftungen waren dazu angelegt worden, den Abfall künftiger Generationen Kölner Bürger vom katholischen Glauben zu verhindern und damit die Ausbreitung des lutherischen Glaubens zu begrenzen.12
In einer Gegenbewegung zu diesen katholischen Stiftungen begannen im 16. Jahrhundert auch evangelische Stifter damit, Stipendienstiftungen zu begründen, die ausschließlich Angehörigen der lutherischen Religion offenstanden. Das wohl an Stiftungen reichste evangelische Gymnasium war das im Jahr 1574 begründete Gymnasium zum Grauen Kloster in Berlin. Dazu hatte vor allem die Streitsche Stiftung beigetragen, die auf den ehemaligen Schüler und erfolgreichen Kaufmann Sigismund Streit zurückging. Streit stiftete diesem Gymnasium im Jahr 1760 mehr als 60.000 Taler und verfügte, dass der Erlös aus dieser Stiftung zur Besoldung von Lehrern, zur Bereitstellung von Stipendien, zum Unterhalt eines Alumnats für zwölf Schüler sowie der Erweiterung der Bibliothek und der Unterrichtssammlungen verwendet werden sollte. Von diesem Vorbild Streits inspiriert, errichteten Absolventen dieses Gymnasiums Stiftungen, die Zuschüsse zu den Lehrergehältern sowie Universitätsstipendien für ehemalige Schüler bereitstellten. Es entstanden darüber hinaus auch Stiftungen, die Wohngeldbeihilfen für pensionierte Lehrer sowie Stipendien für die Töchter von Lehrern sowie die Witwen verstorbener Lehrer zahlten. Das Gesamtstiftungskapital des Gymnasiums zum Grauen Kloster wuchs bis zum Jahr 1902 auf insgesamt mehr als eine Million Mark.13
Das Wachstum der katholischen Bildungsstiftungen in Köln und der evangelischen Bildungsstiftungen in Berlin verdeutlicht beispielhaft die Ausweitung und Ausdifferenzierung des Stiftungswesens in den deutschen Staaten vom Ausgang des Mittelalters bis zur Gründung des Deutschen Bundes. In diesen drei Jahrhunderten gaben Adlige und Bürger mehr und mehr Geld, um Stiftungen für die Armenpflege und die Bildung zu errichten. Besonders die Zeit nach dem Dreißigjährigen Krieg sah einen gewaltigen Aufschwung im Stiften. So wurden zum Beispiel im Königreich Preußen im Zeitraum von 1649 bis 1814 insgesamt 320 Stiftungen gegründet. Von den im Jahr 1814 im gesamten Königreich Preußen existierenden 407 Stiftungen stammten damit fast 80 Prozent aus dieser Zeit.
Provinz
Gesamtzahl der Stiftungen
Zeitpunkt der Stiftungsgründung
vor 1538
1539–1648
1649–1814
Brandenburg und Berlin
196
6
24
166
Ostpreußen
63
2
13
48
Pommern
52
5
12
35
Posen
3
-
-
3
Schlesien
74
10
12
52
Westpreußen
18
2
1
15
Landesweit
1
-
-
1
Gesamt
407
25
62
320
Tabelle 1: Stiftungen in Preußen (1814)
Quelle: Die Zahlen in dieser Tabelle wurden durch eine statistische Auswertung des von Rauer verfassten Preußischen Landbuches gewonnen (Rauer, Preußisches Landbuch).
Während katholische und evangelische Stifter die Einrichtung von Stiftungen bevorzugten, verlegten sich jüdische Stifter auf die Gründung wohltätiger Vereine. Diese Form des kollektiven Stiftens war für das innerjüdische Stiften der Frühen Neuzeit charakteristisch und wurde später, im Kontext der Napoleonischen Kriege, von christlichen Stifterinnen übernommen.14 Jüdische Bestattungsvereine (hevra kaddisha) entstanden in Zentraleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Der erste derartige Verein wurde in Prag im Jahr 1564 begründet. Anfänglich bestand der Auftrag dieser Vereine nur darin, für die Toten der jüdischen Gemeinschaft zu sorgen und die Bestattungsrituale einzuhalten. Mit der Zeit veränderte sich jedoch das Aufgabengebiet dieser Vereine. Die Sorge um die Toten wurde um die Pflege der Kranken erweitert, so dass die hevra kaddisha sich zu allgemeinen Unterstützungsvereinen für die Armen und Schwachen der jüdischen Gemeinden entwickelten. Die Säkularisierung der hevra kaddisha unter dem Einfluss der Aufklärung ließ diese Vereine, so argumentiert Benjamin Baader, zum Prototyp der modernen jüdischen Wohlfahrtspflege werden.15 Ein Musterbeispiel für diesen neuen Typ der jüdischen Wohlfahrtspflege war die 1792 in Berlin gegründete Gesellschaft der Freunde. Seine Mitglieder kümmerten sich nicht nur um die Kranken und Armen und erwiesen den Toten die letzte Ehre, sondern versorgten Gemeindemitglieder auch mit Krankenpflege und finanzieller Unterstützung im Notfall. Diese Leistungen veränderten die Stellung und die Funktion der jüdischen Wohltätigkeitsvereine grundsätzlich.16
Unselbstständige und selbstständige Stiftungen, die in der Regel aus den Aktivitäten einer Einzelperson entsprangen, sowie Vereine und Gesellschaften, die Hunderte und Tausende von Personen zusammenbringen konnten, entwickelten sich im Lauf des 19. Jahrhunderts zu den Grundfesten des religiösen und säkularen Stiftens. Während unselbstständige Stiftungen von ihren Stiftern an von ihnen ausgewählte öffentliche Einrichtungen zur Verwaltung übergeben wurden, entstanden selbstständige Stiftungen als von Kirche und Staat unabhängige Wirtschaftsunternehmen mit einem eigenen Verwaltungsapparat. Beide Stiftungstypen wurden von ihren Gründern für die Ewigkeit angelegt. Vereine und Gesellschaften teilten mit den selbstständigen Stiftungen ihre Selbstständigkeit. Im Gegensatz zu diesen beiden Stiftungstypen waren Vereine aber nicht für die Ewigkeit geschaffen worden. Sie wurden nicht durch die Vision eines einzelnen Stifters und dessen Verlangen nach Unsterblichkeit definiert, sondern durch das Projekt, dem sie ihre Existenz verdankten. Daher waren Vereine nicht so langlebig wie Stiftungen.
Im 19. Jahrhundert gab es auf dem Feld des Stiftens im Wesentlichen zwei Innovationen: (1) die Ausweitung des Stiftens auf das Gebiet der Kunst- und Kulturförderung17 und (2) die Entwicklung der gemeinnützigen Aktiengesellschaft mit begrenzter Gewinnausschüttung (Philanthropy and Five Percent).18 Johann Friedrich Städels Entscheidung zugunsten einer Stiftung für ein Kunstmuseum in Frankfurt am Main markierte einen Wendepunkt in der Geschichte des Stiftens, da mit dieser Stiftung deren Tätigkeitsfeld wesentlich erweitert wurde. Waren zuvor Stiftungen vor allem zur Armenpflege und der Bildungsförderung ins Leben gerufen worden, wurde nun auch die Welt der Kunst- und Kulturförderung zu einem Kerngebiet des Stiftens.19 Das Städelsche Kunstinstitut stellte im 19. Jahrhundert aufgrund seiner Finanzierung durch nur einen einzelnen Stifter jedoch eine Ausnahme dar. Die Mehrzahl der Kunstmuseen verließ sich auf Fördervereine, die häufig als gemeinnützige Aktiengesellschaften mit Hunderten von Mitgliedern/Aktionären und Stiftern gegründet wurden. Diese Aktiengesellschaften dienten allerdings nicht der Profitmaximierung, sondern stellten marktwirtschaftliche Mechanismen in den Dienst der Förderung gemeinnütziger öffentlicher Einrichtungen.
Zivilgesellschaft und Demokratie
Die in diesem Buch vorgestellte Interpretation zum Verhältnis zwischen Zivilgesellschaft und politischer Ordnung besitzt weit über den konkreten deutschen Fall hinaus Bedeutung. Vor allem die Sozialwissenschaften in den USA werden von dem auf Alexis de Tocquevilles Beschreibung der amerikanischen Gesellschaft aufbauenden Paradigma getragen, dass Zivilgesellschaft – und Stiften wird als wesentlicher Bestandteil der Zivilgesellschaft angesehen – und Demokratie zwei Seiten derselben Medaille seien.20 Das ungeheure Wachstum amerikanischer Vereine, Gesellschaften und Stiftungen gilt ihnen als eine Grundbedingung für eine stabile Demokratie.21 Nun sind aber die USA gerade aufgrund ihres stabilen politischen Systems wenig dazu geeignet, diese Theorie empirisch zu belegen, da sich die amerikanische Zivilgesellschaft innerhalb der amerikanischen Demokratie entwickelt hat und sie keinem politischen Systemwechsel ausgesetzt war. Deutschland mit seinen häufigen Systemwechseln bietet dagegen eine ideale Versuchsanordnung, um die These einer kausalen Verbindung von Zivilgesellschaft und Demokratie zu überprüfen.
Die hier erarbeitete historische Untersuchung der Zivilgesellschaft in Deutschland widerlegt die am Beispiel der amerikanischen Gesellschaft postulierte These über eine kausale Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie. Es war gerade die Zeit des autoritären wilhelminischen Kaiserreiches, in dem das Stiftungswesen seinen Zenit erreichte. Der Übergang zur Demokratie im Jahr 1918 leitete den Untergang des Stiftungswesens ein, der sich nicht nur durch die stark veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen erklären lässt. Er war vielmehr das Ergebnis einer zutiefst stiftungsfeindlichen Politik der demokratischen Regierungen der Weimarer Republik. Die nationalsozialistische Diktatur sowie die kommunistische Diktatur in Ostdeutschland waren zwar keine stiftungsfreundlichen Herrschaftssysteme, ließen aber zivilgesellschaftliche Strukturen wie die der Stiftungen dennoch intakt.
Die vorliegende Untersuchung des Stiftens in Deutschland von 1815 bis 1989 lehrt uns, dass Zivilgesellschaft und Demokratie nicht ursächlich miteinander verbunden waren. Eine starke Zivilgesellschaft, wie sie im Deutschen Kaiserreich existierte, führte eben nicht zwangsläufig zu einer stabilen Demokratie, weil gemeinwohlorientierte Bürger die Visionen und Politikentwürfe von autoritären Herrschern wie etwa Kaiser Wilhelm II. teilten. Die Zivilgesellschaft entwickelte sich nicht nur in Opposition zum autoritären Staat, sondern konnte auch autoritäre politische Ordnungen befestigen und stabilisieren.22 Gemeinwohlorientierte Bürger, die sich als Stifter betätigten, entwickelten Stiftungen, deren Wirken in die wilhelminische politische Kultur passte und deren Zukunft sichern sollte. Zivilgesellschaftliches Handeln der Stifter zielte also nicht auf die Überwindung des politischen Systems, sondern auf dessen bürgerliche Ausgestaltung.
Während eine kausale Verbindung zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie somit nicht nachgewiesen werden kann, gab es sehr wohl eine kausale Verbindung zwischen Industrialisierung und Zivilgesellschaft. Auch wenn Stiften ein jahrtausendealtes Verhaltensmuster war, entfaltete sich das Stiftungswesen vor allem nach der Industrialisierung der deutschen Gesellschaft. Die Akkumulation von Vermögen in den Händen von Unternehmern, die ungleiche Verteilung des Wohlstandes und die Herausbildung sozialer Konflikte sowie das Verlangen neuer wirtschaftsbürgerlicher Schichten nach sozialer Anerkennung waren die wichtigsten Voraussetzungen für das gewaltige Wachstum des Stiftungswesens im 19. Jahrhundert. Die deutsche Gesellschaft des 19. Jahrhunderts war eine Gesellschaft im sozialen Umbruch, in der etablierte soziale Hierarchien durch den Aufstieg neuer sozialer Gruppen zerstört wurden. Alte und neue soziale Gruppen nahmen sich des Stiftens als eines sozialpolitischen Verhaltensmusters an, um ihre Dominanz zu bewahren (Adel) oder zu erringen (Wirtschaftsbürgertum). Stifterisches Engagement diente dazu, soziale Ordnungen zu verteidigen, neue soziale Ordnungen zu etablieren und soziale Führungspositionen zu begründen.
Stiften kann kaum als eine demokratisierende Kraft angesehen werden. Stiftungen waren in ihrer Verfassung und in ihrem Charakter kein Ausdruck demokratischen Handelns. Sie entstanden in historischer Perspektive in monarchischen Herrschaftsformen und entwickelten sich als monarchisch verfasste Einrichtungen. Stiftungen wurden in der Regel von einer Einzelperson begründet. Dieser Stifter diktierte die Bedingungen, unter denen die Stiftung operieren sollte. Stifter zeichneten sich allein durch zwei Qualifikationen aus: (1) Wohlstand und (2) eine stifterische Vision. Die stifterischen Visionen waren oftmals diskriminierend, da die Stifter immer den Kreis der potentiellen Nutznießer definierten und dabei bestimmte Personengruppen, die über deren soziale Herkunft, ihr Geschlecht oder ihren Wohnort beschrieben wurden, ein- bzw. ausschlossen. So vergaben Stipendienstiftungen ihre Beihilfen nur an Männer aus katholischen oder evangelischen Familien, die aus einer bestimmten Ortschaft stammen mussten. Wohnstiftungen definierten den Typ derjenigen Arbeiterfamilie, die um eine Wohnung in dem betreffenden Unternehmen nachsuchen durfte, über deren Größe und Einkommen. Diese Regeln wurden von den betreffenden Stiftern zielgerichtet entwickelt und der Stiftung als für die Ewigkeit bindende Bedingung mitgegeben. Aus der Analyse dieser diskriminierenden Bestimmungen im Fall jeder einzelnen Stiftung erschließt sich uns die Vorstellungswelt der Stifter, die über ihre Stiftung versuchten, die Gesellschaft nach ihren Ansichten zu formen.
Auch wenn es keinen kausalen Zusammenhang zwischen Zivilgesellschaft und Demokratie gibt, haben einzelne Einrichtungen der Zivilgesellschaft wie die Vereine und vor allem die gemeinnützigen Aktiengesellschaften zu einer Demokratisierung der Gesellschaft beigetragen. Gemeinnützige Aktiengesellschaften, in denen investierende Stifter sich mit einem auf drei bis fünf Prozent begrenzten Gewinn zufriedengaben, entwickelten partizipatorische Mechanismen, mit denen Männer und Frauen, denen der Erwerb von Aktien offenstand, bereits im 19. Jahrhundert über Stimmrechte verfügten, die ihnen im politischen Leben versagt blieben. Jahrzehnte bevor Männer und Frauen sich gleichberechtigt an den Wahlen zum Preußischen Abgeordnetenhaus oder zum Deutschen Reichstag beteiligen konnten, boten diese Aktiengesellschaften, die der Finanzierung von zoologischen Gärten, Museen und Arbeiterwohnungsunternehmen dienten, wohlhabenden Frauen eine Möglichkeit, an Entscheidungsprozessen über die Gestaltung von städtischen Räumen teilzuhaben. Der Besitz von Aktien in diesen Unternehmen bescherte jedem Aktienbesitzer – Mann oder Frau – eine Stimme in den jährlichen Mitgliederversammlungen. Diese Form des Stiftens gab denjenigen Bürgern und vor allem den Bürgerinnen, die von der Teilnahme am politischen Leben ausgeschlossen waren, eine Stimme. Dies war allerdings eine besondere Form der Demokratie, da sie auf diejenigen Bürger beschränkt blieb, die sich den Erwerb von Aktien in den gemeinnützigen Aktiengesellschaften leisten konnten und wollten. Es waren aber gerade diese Bürger, die ihren Wohlstand dem bestehenden autoritären System verdankten und daher kaum eine Notwendigkeit sahen, diese Ordnung durch ein demokratisches System zu ersetzen. Mit ihrem Engagement zugunsten der stifterischen Ausgestaltung ihrer Heimatstadt vertiefte sich deren Verbundenheit mit dem existierenden politischen System weiter. Diese Bürger und Stifter hatten im Fall einer politischen Transformation viel zu verlieren, aber wenig zu gewinnen.
Aufbau des Buches
Das erste Kapitel des vorliegenden Buches führt den Leser in die Welt der königlichen und bürgerlichen Museen und dem damit verbundenen Wettbewerb um die Vorherrschaft in der Museumsfinanzierung, der sich im 19. Jahrhundert zwischen Adel und Bürgertum entspann. Sowohl die Formierung und Emanzipation des Bürgertums als auch die Urbanisierung veränderten die soziale Struktur der deutschen Gesellschaft nachhaltig. Mit der Herausbildung von Großstädten entstanden urbane Strukturen mit den hierfür typischen Einrichtungen wie zoologischen Gärten, Museen und Opernhäusern bis hin zu öffentlichen Parkanlagen und Theaterhäusern. Die Finanzierung dieser urbanen Strukturen räumte den jeweiligen Geldgebern Gestaltungs- und Deutungshoheit über die sich entwickelnde städtische Gesellschaft ein und entfachte daher einen Wettbewerb zwischen Bürgertum und Adel um die Finanzierung und Kontrolle dieser Einrichtungen. In diesem Wettstreit entstanden monarchische Museen, die von Königen und Großherzogen begründet wurden, sowie bürgerliche Museen, die durch Museums- und Kunstvereine finanziert wurden: Dort fanden sich oftmals Hunderte von Bürgern zusammen. Diese bürgerlichen Vereine und die von ihnen finanzierten öffentlichen Einrichtungen symbolisieren den Gestaltungswillen und das Selbstbewusstsein des Bürgertums in Städten wie Leipzig, Bremen und Hamburg. Der Wettbewerb um die Finanzierung öffentlicher Kultureinrichtungen in den Städten des 19. Jahrhunderts führte zur Herausbildung zweier Stadttypen in Bezug auf die Stiftungskultur: (1) die Bürgerstadt und (2) die Residenzstadt. Während in Bürgerstädten wie Frankfurt am Main, Leipzig und Hamburg öffentliche Einrichtungen allein durch das städtische Bürgertum begründet und finanziert wurden, entwickelte sich in Residenzstädten wie Berlin, Dresden und Karlsruhe ein Finanzierungsmodell, bei dem der jeweilige Landesfürst die Gründung öffentlicher Einrichtungen anstieß, zu deren Finanzierung beitrug, als Namenspatron auftrat und das städtische Bürgertum zur begrenzten Mitwirkung einlud.
Aufgrund der ständig wachsenden Erwerbs- und Unterhaltungskosten für Museen im Lauf des 19. Jahrhunderts erwies sich die alleinige Finanzierung königlicher Museen jedoch zunehmend als unzureichend. So steckten etwa die von preußischen Königen begründeten und zunächst allein von ihnen unterhaltenen Berliner Museen am Ende des 19. Jahrhunderts in einer tiefen finanziellen Krise. Diese Finanzierungsmalaise bot dem Berliner Bürgertum eine Möglichkeit, mittels seiner Beteiligung an Museumsvereinen Einfluss auf die Gestaltung der Museumsausstellungen zu nehmen. Damit gerieten öffentliche Räume mehr und mehr unter bürgerliche Kontrolle.
Das zweite Kapitel untersucht den Einfluss von Stiftern und deren Stiftungen auf die soziale Zusammensetzung der intellektuellen Eliten des wilhelminischen Kaiserreiches. Der wachsende Stellenwert einer Hochschulausbildung in einer industrialisierten Gesellschaft veranlasste eine schnell wachsende Zahl von Bürgern dazu, Stipendienstiftungen einzurichten, die es Söhnen aus christlichen und bürgerlichen Familien ermöglichten, ein Gymnasium und eine Universität zu besuchen. Diese Stiftungen, deren Empfängerkreis durch ihre Stifter in Bezug auf das Geschlecht der Empfänger, ihre Religionszugehörigkeit, ihre Klassenzugehörigkeit sowie häufig auch hinsichtlich ihres Wohnorts eindeutig begrenzt worden war, sollten keineswegs dazu dienen, Arbeiterkindern einen Zugang zu höherer Bildung zu verschaffen. Es ging den Stiftern im Wesentlichen darum, den sozialen Abstieg von Kindern aus bürgerlichen Familien zu verhindern, die sich aus eigener Kraft einen ihrem sozialen Status entsprechenden Bildungsabschluss nicht leisten konnten – etwa weil ihr Vater verstorben war oder die Familie eine sehr hohe Zahl von Kindern hatte, deren Ausbildungskosten (sowohl Gymnasien als auch Universitäten verlangten von ihren Schülern und Studenten erhebliche Schul- bzw. Studiengebühren) selbst bürgerliche Familien nicht immer aus eigener Kraft bewältigen konnten. Diese Stiftungen sicherten damit nicht nur Bürgersöhnen eine standesgemäße Ausbildung, sondern garantierten auch das finanzielle Überleben öffentlicher Bildungseinrichtungen. Stiften diente, wie dieses Kapitel deutlich werden lässt, dazu, soziale Unterschiede zu verstärken, und nicht, sie zu überwinden.
Stiftungen zugunsten von Bildungseinrichtungen sollten die Dominanz einer christlich geprägten Bildungselite in einer Zeit festigen und ausbauen, in der infolge der rechtlichen Gleichstellung von christlichen und jüdischen Deutschen mit der Reichsgründung im Jahr 1871 eine wachsende Zahl jüdischer Schüler und Studenten die Gymnasien und Universitäten besuchte. Das Stiften entwickelte sich in diesem Zusammenhang zu einem wichtigen Instrument in der Auseinandersetzung um die religiöse Zusammensetzung der künftigen intellektuellen Eliten. Der prinzipielle Ausschluss jüdischer Studenten vom Empfang von Stipendien, die von christlichen Stiftern eingerichtet worden waren, rief eine wachsende Zahl jüdischer Stifter auf den Plan, die ebenfalls Stipendienstiftungen errichteten, um Schülern und Studenten jüdischen Glaubens den Besuch höherer Bildungseinrichtungen zu ermöglichen. Das Stiften entwickelte sich damit zu einem heftig umkämpften Instrument in der Auseinandersetzung um den Platz jüdischer Deutscher im geistigen Leben des Deutschen Kaiserreiches.
Am Ende des 19. Jahrhunderts erkannten auch Stifterinnen, die die Universitäten für bürgerliche Frauen öffnen wollten, den Wert von Stiftungen für dieses Bestreben. Stifterinnen boten verschiedenen Universitäten Stipendienstiftungen unter der Bedingung an, dass diese Frauen zum Studium zulassen müssten. Damit versuchten Stifterinnen direkten Einfluss auf die Hochschulpolitik zu nehmen.
Die Studienförderung der Stipendienstiftungen zugunsten jüdischer Studenten und zugunsten von Frauen vervollständigt unser Bild von der langsamen Emanzipation der jüdischen Deutschen und der Frauen im Deutschen Kaiserreich. Es erhellt aber auch den Zusammenhang zwischen der Finanzierung von Bildungseinrichtungen und der Ausweitung von Bildungschancen unter zuvor benachteiligten Bevölkerungsgruppen.
Am Ende des 19. Jahrhunderts wuchs, wie im dritten Kapitel dargestellt wird, die stifterische Unterstützung im Bereich von Bildung und Forschung gewaltig an und brachte nationale Forschungsgesellschaften wie die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft und archäologische Fachgesellschaften wie die Deutsche Orient-Gesellschaft hervor. Diese Verbände gaben ihren Mitgliedern die Möglichkeit, die künftige Ausrichtung der naturwissenschaftlichen Forschung mit zu bestimmen sowie die Aneignung antiker Gesellschaften durch archäologische Ausgrabungen voranzutreiben. Stiften verlieh den Stiftern damit eine Lenkungsfunktion in der modernen akademischen Wissensproduktion. Das dritte Kapitel bietet dem Leser einen Eindruck von der außerordentlich engen Zusammenarbeit zwischen Stiftern und Staat bei der Einrichtung moderner Forschungsinstitute und der archäologischen Ausgrabung untergegangener Zivilisationen wie zum Beispiel der von Babylon in Mesopotamien.
Das vierte Kapitel analysiert die Bereitstellung von erschwinglichem und hygienischem Wohnraum für Arbeiterfamilien durch verschiedene stifterische Einrichtungen wie die gemeinnützigen Aktiengesellschaften, die Baugenossenschaften und die Wohnstiftungen. Diese drei Unternehmensformen entstanden als Reaktion auf die Veränderungen im menschlichen Zusammenleben infolge der Industrialisierung und Urbanisierung. In den Städten des 19. Jahrhunderts mangelte es häufig an ausreichendem und bezahlbarem Wohnraum, der seinen Bewohnern ein menschenwürdiges Dasein bot. Wohnungsmangel, zu hohe Mieten und unhygienische Wohnbedingungen verursachten den Ausbruch von Krankheiten und Epidemien, die nicht nur für Arbeiterfamilien, sondern auch für bürgerliche Familien gefährlich werden konnten. Um diese Gefahren zu begrenzen, entwickelten Sozialreformer in verschiedenen deutschen Städten Ansätze für eine Wohnreform, die bei stiftungswilligen Bürgern auf großes Interesse stieß. Wie schon in der Welt von Kunst und Kultur fanden sich auch in der Welt der Wohnungsreform nicht selten Gruppen von Stiftern zusammen, um Vereine und Gesellschaften zu begründen, die Wohnungen für Arbeiterfamilien errichteten. Im Gegensatz zu den Stiftern, die sich in den Unterstützungsvereinen für zoologische Gärten und Museen sammelten, sahen sich die Stifter, die sich in diesen Wohnungsbauunternehmen trafen, in der Lage, die Struktur der Gesellschaft bzw. ihres kleinsten Bausteines – der (Arbeiter-)Familie – direkt und nachdrücklich zu beeinflussen. Entscheidungen über die Wohnungsarchitektur von der Wohnungsgröße bis zur Aufteilung der Zimmer und der Verteilung der Wohnfunktionen über das Wohnhaus (Schlafen, Kochen, Waschen) beeinflussten die Art und Weise, wie die dort wohnenden Familien und Mietparteien zusammenlebten, erheblich. Die Gründer der hier behandelten Wohnungsbauunternehmen hatten sehr spezifische Vorstellungen über die von ihnen favorisierte Wohnungsarchitektur und die Struktur der diese Wohnungen bewohnenden Arbeiterfamilien.
Das fünfte Kapitel gibt dem Leser einen querschnittsartigen Überblick über die quantitativen Dimensionen des Stiftens am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Stiftungen und Stifter hatten der deutschen Gesellschaft ihren Stempel aufgedrückt. Es gab keinen Bereich des sozialen und kulturellen Lebens in Deutschland, in dem Stiftungen nicht präsent waren. Die Mehrzahl der vorliegenden Gesamtdarstellungen zur deutschen Geschichte haben diesen wichtigen Aspekt der deutschen Gesellschaft des Kaiserreiches fast vollständig ausgeblendet. In den meisten Büchern zur deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts erscheint die deutsche Gesellschaft als eine staatszentrierte Gesellschaft, in der der Staat sowohl die kulturellen als auch die sozialen Institutionen finanzierte. Die stifterische Finanzierung öffentlicher Einrichtungen galt in diesen Darstellungen als ein marginales und vormodernes Phänomen, das allenfalls auf die Notwendigkeit staatlichen Handelns verwies und den Staat zur Übernahme bestimmter Einrichtungen zwang; es konnte in der dortigen Lesart jedoch kein Bestandteil einer modernen Gesellschaft sein. Stiften war aber kein marginales Phänomen, sondern besaß eine zentrale Bedeutung für die Finanzierung öffentlicher Einrichtungen zumindest bis zum Ersten Weltkrieg. So hingen Museen, Opernhäuser, Theater, Parks, Gymnasien, Universitäten, Forschungseinrichtungen und soziale Wohnungsunternehmen von der Großzügigkeit ihrer Stifter ab.
Die Ausblendung des Stiftens in traditionellen Darstellungen zum Deutschen Kaiserreich hatte allerdings auch konzeptionelle und theoretische Ursachen. Insbesondere amerikanische Sozialwissenschaftler gingen und gehen davon aus, dass zivilgesellschaftliche Handlungsmuster wie das Stiften nicht nur zur Ausbildung einer Zivilgesellschaft, sondern zwangsläufig auch zu einer demokratisch verfassten Gesellschaft führen müssten. Die Existenz eines umfassenden Stiftungssektors im autoritär verfassten Deutschen Kaiserreich passt schlichtweg nicht in dieses Paradigma. Damit dient die hier vorgelegte Studie auch dazu, die in den Sozialwissenschaften angenommene kausale Verbindung von Zivilgesellschaft und Demokratie zu widerlegen. Im deutschen Fall erreichte zivilgesellschaftliches Engagement gerade im Deutschen Kaiserreich seinen Höhepunkt und erlebte in der ersten deutschen Demokratie – der Weimarer Republik – einen deutlichen Niedergang, der sich auch in der zweiten (west)deutschen Republik nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzte. Es waren gerade diese beiden demokratischen Systeme, die stiftungsfeindliche Strategien verfolgten und Stiftungen an den Rand der Gesellschaft drängten.
Im Unterschied etwa zu den USA entwickelte sich das Stiften in den deutschen Staaten in rechtlich weitgehend uneingeschränkten Bahnen. Die Regierungen der verschiedenen deutschen Staaten schenkten dem Wachstum der Stiftungen im 19. Jahrhundert kaum Aufmerksamkeit. Mit Ausnahme des Königreiches Bayern gab es zum Beispiel noch nicht einmal staatliche Anstrengungen, um die Zahl der Stiftungen zu erfassen. Es wurden darüber hinaus kaum Gesetze verabschiedet, die das Wirken der Stiftungen regulierten. Die Existenz verschiedener deutscher Staaten bzw. ab 1871 deutscher Bundesstaaten führte auch zur Ausbildung recht unterschiedlicher Stiftungskulturen und Stiftungssektoren, die es dem Beobachter schwer machen, von einem deutschen Stiftungswesen zu sprechen. Es wäre stattdessen besser von einem bayerischen Stiftungswesen, einem preußischen Stiftungswesen usw. zu sprechen. Stiften entwickelte sich nicht in Deutschland, sondern in den deutschen Bundesstaaten.
Stiften wurde kaum rechtlich reguliert, und auch die Institution der Stiftung wurde nicht rechtlich definiert. Es wurde immer vorausgesetzt, dass alle Beteiligten wussten, was unter einer Stiftung zu verstehen sei.23 Es gab allerdings ein staatliches Bestreben, die Anlage der Stiftungskapitalien zu regulieren. Im Lauf des 19. Jahrhunderts bildete sich eine rechtliche Regelung heraus, die die mündelsichere Anlage der Stiftungskapitalien besonders in Staatsanleihen vorschrieb. Damit wurden die von Stiftungen akkumulierten Kapitalien Bestandteil eines Finanzmarktes, der es der deutschen Reichsleitung erlaubte, staatliche Ausgaben wie etwa für die Entwicklung des Sozialstaates, den Ausbau der Infrastruktur sowie die militärische Aufrüstung auf dem Weg der Defizitfinanzierung durch die periodische Auflage von Staatsanleihen zu bestreiten. Auch der Erste Weltkrieg wurde wesentlich durch den Verkauf von Kriegsanleihen finanziert, deren Erwerb den Stiftungsverwaltern aufgedrängt wurde. Da die Kriegsanleihen mit einer gegenüber den traditionellen Staatsanleihen höheren Verzinsung ausgereicht wurden, schien sich anfänglich der Erwerb von Kriegsanleihen für die Stiftungen zu lohnen. Die Kriegsniederlage sowie die Entscheidung der Reichsregierung im Jahr 1925, sich auf Kosten der Kriegsanleihebesitzer – und damit der Stiftungen – zu entschulden, führten viele Stiftungen in den finanziellen Ruin.
Das sechste Kapitel verfolgt das Schicksal der Stiftungen vom Ende des Ersten Weltkrieges bis zur deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990. Entgegen bisheriger Vermutungen, nach denen die Hyperinflation des Jahres 1923 für den Niedergang des Stiftungswesens verantwortlich gewesen sei, entwickelt dieses Kapitel eine etwas andere Interpretation. Es stimmt natürlich, dass die Staats- und Kriegsanleihen durch die Hyperinflation entwertet wurden. Dennoch hätte die deutsche Regierung diese Anleihen auch wieder aufwerten können. Um sich aber der gewaltigen Schulden bei deutschen Anleihebesitzern zu entledigen, entschloss sich die Reichsregierung, auch angesichts der Reparationszahlungen an die Alliierten, im Jahr 1925 zu einem Schuldenschnitt. Er verschaffte der Reichsregierung finanziellen Freiraum und zerstörte gleichzeitig das über Jahrhunderte gewachsene Stiftungswesen.
Es ist daher auch wenig überraschend, dass das Jahr 1925 einen größeren Einschnitt in das Stiftungswesen darstellt als das Jahr 1933 mit der nationalsozialistischen »Machtergreifung«. Die Etablierung des NS-Regimes führte zwar zur Zerstörung aller oppositionellen Vereine und Organisationen, ließ die Stiftungen jedoch weitgehend unberührt. Die bereits in den 1920er Jahren begonnene Zwangsfusion von Stiftungen, die infolge der Entwertung ihrer Kapitalien nicht mehr handlungsfähig waren, wurde auch in den 1930er Jahren fortgesetzt und führte zur Einrichtung großer, aber unpersönlicher Sammelstiftungen, die nicht mehr nach ihrem Stifter, sondern nach ihrem Stiftungszweck benannt waren. Durch die Zusammenlegung von Stiftungen entstanden zwar wieder finanziell handlungsfähige Institutionen, die sich aber in vielen Fällen von der Zweckbestimmung ihrer Stifter entfernt hatten. Und während die Mehrzahl der Stiftungen vor Eingriffen der Nazis geschützt war, wurden die von jüdischen Stiftern errichteten Stiftungen, deren Anteil am gesamten Stiftungsumfang in Deutschland wohl nicht mehr als fünf Prozent betragen haben dürfte, enteignet und zerstört.
Nach dem Zweiten Weltkrieg zeigten kommunistische, sozialdemokratische und selbst christdemokratische Politiker in Ost- und Westdeutschland wenig Verständnis für Stiftungen und favorisierten eine Gesellschaft, in der Stiften bewusst an den Rand gedrängt wurde. Sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland wurden Stiftungen wiederholt dazu gezwungen, mit anderen Stiftungen zu fusionieren: Viele Stiftungen wurden enteignet. Dennoch verschwanden Stiftungen in den beiden deutschen Staaten nicht gänzlich. So wurden in Ostdeutschland diejenigen Stiftungen, die als kirchliche Stiftungen eingestuft wurden, in die Obhut der evangelischen und katholischen Kirche überführt. Vielen dieser Stiftungen gelang es, den Niedergang der DDR zu überleben. In Westdeutschland wandelte sich das Stiftungsverhalten nachdrücklich, indem individuelle Stifter Platz für Unternehmen machten, die in den 1970er und 1980er Jahren zunehmend als Stifter auftraten. Auch wenn das Stiften die Epoche des geteilten Deutschlands überlebte, war es doch in diesen vier Jahrzehnten zu einem marginalen Phänomen in einer staatszentrierten Gesellschaft geworden.
2.Zwischen Emanzipation und Einflussnahme: Der Wettbewerb zwischen Adel und Bürgertum auf dem Gebiet der Kunst- und Kulturförderung
Das Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806 sowie die von Napoleon Bonaparte oktroyierten territorialen Veränderungen, in deren Folge die Zahl der deutschsprachigen Klein- und Kleinststaaten von mehr als 300 auf weniger als 40 reduziert wurde, schwächten die etablierte, auf monarchischen Prinzipien beruhende Ordnung nachhaltig. Mit der Konsolidierung von 39 deutschen Staaten, die im Deutschen Bund zusammengefasst wurden, waren zweifelsohne wirtschaftlich und politisch lebensfähige Staaten entstanden, aber eben auch mehr als 250 Fürsten ihrer Rolle als eigenständige Regenten über Territorien enthoben worden. Das monarchische Prinzip war damit nachhaltig geschwächt. Die in den 1830er Jahren einsetzende Industrialisierung, die im Bau von Eisenbahnlinien wie der zwischen Nürnberg und Fürth (eröffnet 1835) und der zwischen Leipzig und Dresden (eröffnet 1839) einen ersten Höhepunkt erreichte, beschleunigte die sozialen Umbruchsprozesse, in deren Ergebnis der Adel zunehmend seine vorherrschende soziale und wirtschaftliche Stellung einbüßte und das Bürgertum sich mehr und mehr als Konkurrent zum Adel positionierte.
Die einsetzende industrielle Revolution und die damit einhergehende Urbanisierung veränderten den Charakter der deutschen Gesellschaft nachhaltig. Lebten um 1800 noch etwa drei Viertel der deutschen Bevölkerung in ländlichen Kommunen, war es am Ende des 19. Jahrhunderts bereits weniger als die Hälfte. Mehr und mehr Menschen zog es in die Städte und Großstädte, die ihren Bewohnern eine ständig wachsende kulturelle Infrastruktur boten. Opernhäuser, Konzertsäle, öffentliche Parks, zoologische Gärten, Theater und Bibliotheken wurden zu den sichtbarsten Einrichtungen dieser städtischen kulturellen Infrastruktur, die sowohl von adligen Landesherren als auch von stadtbürgerlichen Gruppierungen finanziert wurden. Preußische, sächsische und bayerische Könige erblickten vor allem in der Errichtung von Kunstmuseen eine Strategie, um ihre in den Zeiten der Napoleonischen Kriege stark angegriffene königliche Autorität wiederherzustellen. Aber auch die durch die Industrialisierung zu erheblichem Wohlstand gelangten Bürger in Städten wie Frankfurt am Main, Leipzig und Hamburg erkannten in der Finanzierung von Museen, zoologischen Gärten und Konzerthäusern eine Möglichkeit, städtische Räume und die städtische Gesellschaft nach ihren bürgerlichen Visionen innerhalb monarchischer Ordnungen zu gestalten. Beginnend in den 1820er Jahren entbrannte daher zwischen Adel und Bürgertum in den Städten des 1815 gegründeten Deutschen Bundes ein Wettstreit um die Gründung, die Finanzierung und den Unterhalt städtischer kultureller Einrichtungen. Dieses Ringen um die Kontrolle über kulturelle Einrichtungen war Bestandteil des Machtkampfes zwischen Adel und Bürgertum um die soziale, kulturelle und auch politische Vorherrschaft in den deutschen Staaten.
Dieser soziale, kulturelle und finanzielle Wettstreit beschränkte sich keineswegs auf die Residenzstädte, sondern erfasste beinahe alle Städte. In Bezug auf die Förderung von Kunst und Kultur bildeten sich in diesem Wettkampf zwei Stadttypen heraus: Residenzstädte und Bürgerstädte. Landesfürsten dominierten die Kunstförderung in Residenzstädten wie Berlin, Dresden, Karlsruhe und München. Bürgerliche Stifter bestimmten hingegen die Kunstförderung in Städten ohne fürstliche Höfe wie Bremen, Köln, Hamburg, Frankfurt am Main und Leipzig. Bürgerliche Stifter handelten dabei entweder allein oder formten zusammen mit anderen Stiftern Kunstvereinigungen, die Künstler und Museumsprojekte unterstützten.
Die Stiftung fürstlicher Legitimität durch die Errichtung von Kunstmuseen
Das Streben der Monarchen, ihre in der Zeit der Napoleonischen Kriege (1800–1815) beschädigte Autorität wiederherzustellen, führte nicht nur zur Einführung repressiver Gesetze, die in den 1820er und 1830er Jahren unter anderem die Pressefreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Vereinsfreiheit stark beschränkten, sondern auch zu einem Boom beim Bau von Kunstmuseen und der Gründung von Kunstvereinen, die diese Kunstmuseen unterstützen sollten. In den 1820er Jahren begannen die Landesfürsten von Preußen, Bayern, Baden und Sachsen in ihren Residenzstädten mit der Errichtung von Museumsgebäuden, in denen sie ihre wertvollen Sammlungen von Kunstobjekten, Antiquitäten und Raritäten öffentlich auszustellen gedachten. Diese neuen Gebäude waren großzügig angelegt und unterschieden sich dadurch deutlich von den engen und vollgestellten Kuriositätenkabinetten des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1825 begannen die Bauarbeiten an dem Königlichen Museum (später Altes Museum) auf der bald zur Museumsinsel stilisierten Spreeinsel in Berlin. Eröffnet im Jahr 1830 diente dieses Museum dazu, die königliche Kunstsammlung auszustellen. Diese zog zahlreiche berühmte Besucher aus Europa und Nordamerika an, unter ihnen den dänischen Märchenautor Hans Christian Andersen, den schottischen Historiker John Strang, den französischen Autor und Bildungsminister Hippolyte Fortoul sowie die englische Novellistin und Autorin des Romans Frankenstein Mary Shelley.1 Anna Ticknor, die Ehefrau des Harvard-Professors George Ticknor, befand in ihrem Tagebuch über dieses Museum (das sie im Mai 1836 besuchte), dass es eine umfangreiche Kunstsammlung habe, die sich vor allem zu Bildungszwecken einsetzen ließe. Auch wenn die Sammlung fünf Gemälde Raphaels versammeln konnte, sah Ticknor ihre Stärke vor allem in ihren zahlreichen Gemälden Rembrandts.2
Nur elf Jahre später begannen in unmittelbarer Nähe zum Königlichen Museum die Bauarbeiten für das Neue Museum. Nach seiner Fertigstellung im Jahr 1855 bot dieses Museum der Gipsabdrucksammlung griechischer und römischer Skulpturen sowie einer großen Zahl von Radierungen und Stichen ein neues Zuhause. Diese Sammlungen entwickelten sich zu einem Studienkabinett für Studenten der Königlich Preußischen Akademie der Künste, die sich in unmittelbarer Nähe befand. Studenten der Akademie kamen nach ihren Vorlesungen in das Museum, um hier die Abdrücke der Figuren zu sehen, die in der Vorlesung besprochen worden waren. Unter diesen Studenten befand sich auch George Fisk Comfort aus den USA, der sich als Student an der Akademie von 1863 bis 1865 eingeschrieben hatte. Comfort sammelte in Berlin vielfältige Erfahrungen in der Museumsgestaltung und interessierte sich auch für das Museumsmanagement. Diese Erfahrungen vermittelte er später an die Gründer des Metropolitan Museum of Art in New York. In seinen Briefen schrieb Comfort, dass Professoren der Akademie ihre Studenten häufig in dieses Museum, das die weltweit umfangreichste Gipsabdrucksammlung besaß, führten, um mit Hilfe der Gipsabdrucksammlungen ihre Vorlesungen anschaulich zu gestalten. Comfort zweifelte nicht daran, dass dieses Berliner Museum der beste Ort in der Welt war, an dem man die Entwicklung der Bildhauerei von ihren Anfängen in Ägypten über ihre Blütezeit in der griechischen Antike bis hin zur Neuzeit studieren konnte.3
Die Museumsbauten in Berlin waren der Beginn eines Wettbewerbes zwischen den königlichen und großherzoglichen Herrschern der deutschen Staaten um die Führungsrolle in der kulturellen Deutung von Kunst und Kultur. So finanzierten die bayerischen Könige in ihrer Residenzstadt den Bau der Glyptothek (1816–1830), der Alten Pinakothek (1826–1842) und der Neuen Pinakothek (1846–1853). Im Großherzogtum Baden wurde die Karlsruher Kunsthalle (1840–1846) gebaut. Im Königreich Sachsen finanzierte Friedrich August II. das neue Gebäude der Königlichen Gemäldegalerie (1847–1854), die in das bestehende Ensemble religiöser und kultureller Gebäude in unmittelbarer Nähe des Königlichen Palastes eingegliedert und als neuer Flügel des Zwingers errichtet wurde. Diese Bauprojekte wurden von den besten Architekten ihrer Zeit – Karl Friedrich Schinkel und sein Schüler Friedrich August Stüler in Berlin, Gottfried Semper in Dresden, Heinrich Hübsch in Karlsruhe, Leo von Klenze und August von Voit in München – geplant und ausgeführt. Viele dieser Museumsgebäude entstanden im neoklassischen Stil, wobei ihre Architektur römische und griechische Elemente mit modernen Bautechniken verband.4
Diese Kunstmuseen können als Inseln in dem Strom einer sich schnell verändernden Gesellschaft gesehen werden. Das Ende des Heiligen Römischen Reiches im Jahr 1806, die territoriale und politische Neuordnung der deutschen Staaten nach der Niederlage Napoleons und dem Wiener Kongress sowie die sozialen Auswirkungen der beginnenden Industrialisierung erzeugten Spannungen und Ungewissheit für die Menschen, deren Umwelt sich rasant und unerwartet in einem sehr kurzen Zeitabschnitt veränderte. Der Drang, etwas aus der Vergangenheit zu bewahren, führte zu Nostalgie und veranlasste die Gebrüder Grimm, die bis dahin nur mündlich übertragenen deutschsprachigen Märchen aufzuschreiben.5 In diesem Kontext der Romantik wurden Museen dazu geschaffen, die künstlerische Tradition der Vergangenheit zu bewahren und diese für die Gegenwart mit neuer Bedeutung auszustatten.6 In einer Zeit, in der die ehemals unbeschränkte und kirchlich bestätigte königliche Autorität in eine Legitimationskrise geriet, gaben Museumsprojekte ihren Bauherren die Gelegenheit, ihre Macht öffentlich zur Schau zu stellen und eine Deutungshoheit in Bezug auf künstlerische und ästhetische Standards zu beanspruchen. Es ging den Herrschern darum, ihre angegriffene Legitimität über die Förderung von Kunst wiederherzustellen und eine neue Identität für ihre Staaten zu stiften, die sich aus verschiedenen Territorien mit unterschiedlichen Traditionen zusammensetzten.7 Die politische Neuordnung der deutschen Staaten sowie die Einführung konstitutioneller Regierungsformen in den süd- und mitteldeutschen Staaten beschränkten die Machtpositionen der Herrscher, die nicht nur mit gewählten Parlamenten auskommen, sondern auch politische Funktionen an neugeschaffene Regierungskabinette und Regierungsbehörden sowie an sich selbst verwaltende Kommunen abtreten mussten.8
Vom Juniorpartner zum Chef: Aristokratische und bürgerliche Unterstützung für die Kunstproduktion und Kunstmuseen
Es waren aber nicht nur Könige und Herzöge, die sich mit der Einrichtung von Kunstsammlungen und der Gründung von öffentlichen Kunstmuseen befassten. Kunstsammlungen wie die Preußische Nationalgalerie in Berlin waren häufig das Ergebnis einer Zusammenarbeit von königlichen oder großherzoglichen Herrschern mit wohlhabenden bürgerlichen Stiftern, die sich gleichermaßen um die Errichtung und Ausstattung eines Museums bemühten. So wurde etwa durch das Vermächtnis des einflussreichen Berliner Bankiers Joachim H. W. Wagener, in dem er seine umfangreiche Sammlung von 262 Gemälden im Wert von etwa 100.000 Talern dem preußischen Staat hinterließ, die Gründung der Preußischen Nationalgalerie initiiert. Unmittelbar nach seinem Tod wurde die Wagener’sche Sammlung zunächst in der Berliner Königlich Preußischen Akademie der Künste öffentlich ausgestellt, bevor die Sammlung im Jahr 1876 ihr eigenes Museumsgebäude auf der Museumsinsel erhielt. Wagener betrachtete seine Sammlung als den Kern einer nationalen Kunstsammlung, die eines Gehäuses in Form eines Museumsgebäudes bedurfte, das der preußische Staat bereitstellen sollte.9
Die Zusammenarbeit zwischen Bürgern und Herrschern, die darauf beruhte, dass Bürger Kunstobjekte und Kunstsammlungen zur öffentlichen Zurschaustellung stifteten und die Herrscher die Museumsgebäude finanzierten, in denen diese Sammlungen ausgestellt wurden, wurde im Lauf des 19. Jahrhunderts zu einem charakteristischen Merkmal der Stiftungskultur in den Residenzstädten. Wageners Stiftung, die zur Gründung der Preußischen Nationalgalerie führen sollte, war in ihrem Umfang und Wert unter diesem Stiftungstyp allerdings einmalig. Öffentliche Kunstsammlungen in Residenzstädten wie Karlsruhe, Berlin und München waren in der Regel nicht das Werk eines einzelnen Stifters, sondern vielmehr das Werk einer großen Zahl von Stiftern, die sich in Kunstvereinen zusammenfanden. Diese Kunstvereine, die Hunderte und in manchen Fällen sogar Tausende von Mitgliedern vereinten, wurden nicht nur von dem jeweiligen königlichen oder großherzoglichen Herrscher protegiert, sondern arbeiteten eng mit dem betreffenden Herrscher bei der Umsetzung ihrer Museumsprojekte zusammen. Sie dienten in begrenztem Maß allerdings auch dazu, das Herrschermonopol über die Kunstförderung zu unterhöhlen.
In Karlsruhe beförderten die begrenzten finanziellen Reserven des Herrscherhauses sowie das Bestreben der Bürger nach Teilhabe an der Formierung des ästhetischen Stiles in der Kunst, die öffentlich ausgestellt wurde, die enge Zusammenarbeit zwischen Herrscherhaus und bürgerlicher Gesellschaft. In diesem aristokratisch-bürgerlichen Zweckbündnis verstanden sich die Bürger anfänglich als Juniorpartner des großherzoglichen Hofes.10 Der Großherzog von Baden, Leopold I., dessen Kunstsammlung den Kern der Ausstellungen des Kunstvereins bildete, gab dem Karlsruher Kunstverein Raum für Versammlungen und Kunstausstellungen. Auch erwarben zahlreiche Mitglieder der großherzoglichen Familie eine Mitgliedschaft in dem Kunstverein. Immerhin sechs Prozent der Kunstvereinsmitglieder gehörten der großherzoglichen Familie an. Weitere 16 Prozent kamen aus den Hof- und Regierungskreisen. Die verbleibenden 78 Prozent der Mitglieder stammten aus den bürgerlichen Kreisen Karlsruhes. Unter diesen bürgerlichen Mitgliedern waren 22 Prozent Beamte, 20 Prozent Akademiker und 12 Prozent Kaufleute.11
Aus seiner Rolle als Juniorpartner des großherzoglichen Hofes konnte sich der Karlsruher Kunstverein erst lösen, als sich auch in Mannheim ein Kunstverein bildete. Die Entscheidung des Karlsruher und des Mannheimer Kunstvereins, sich mit den Kunstvereinen in Darmstadt, Mainz und Straßburg zum Rheinischen Kunstverein zusammenzuschließen, beförderte dessen Emanzipation vom Herrscherhaus. Seine umfangreichen Kunstankäufe für Gemäldeverlosungen unter seinen Mitgliedern und für die Einrichtung vereinseigener Sammlungen ließen diesen überregionalen Kunstverein zu einem Konkurrenten der fürstlichen Kunstförderung werden.12
Dennoch setzte der Karlsruher Zweigverein des Rheinischen Kunstvereins auf die Zusammenarbeit mit dem Großherzog. Die Kunstförderung in Karlsruhe befand sich in den Händen des Großherzogs Leopold I., der den Kunstverein in seiner Residenzstadt subventionierte, eine umfangreiche Kunstsammlung besaß und den Bau der Karlsruher Kunsthalle, die im Jahr 1846 eröffnet wurde, antrieb und finanzierte. Dieses Kunstmuseum, das zum Eigentümer der großherzoglichen Kunstsammlung wurde, sollte die Lebensqualität der Karlsruher Bevölkerung durch die öffentliche Zurschaustellung ästhetischer Vorbilder verbessern.13
In Mannheim entwickelte sich die Kunstförderung im Gegensatz zu Karlsruhe als eine bürgerliche Angelegenheit, nachdem die Stadt ihren Status als Residenzstadt der Herzöge der Pfalz im Jahr 1778 verloren hatte. Der Wegzug des Kurfürsten Karl IV. von der Pfalz nach München infolge des Bayerischen Erbfolgekrieges verursachte einen künstlerischen Exodus, der das kulturelle und künstlerische Klima der ehemaligen Residenzstadt nachträglich beschädigte. Die Eingliederung der Stadt Mannheim in das Großherzogtum Baden im Jahr 1802 führte zu einer weiteren Marginalisierung der aristokratischen Kunstförderung in der Stadt. In den 1840er Jahren begannen wohlhabende Bürger und Mitglieder des Kunstvereins bedeutende Summen für den Ankauf von Gemälden auszugeben, die Bestandteil einer permanenten Kunstausstellung werden sollten. Diese Kunstsammlung erhielt ihr eigenes Museumsgebäude allerdings erst 1907.14
Während die Initiative zum Bau von Museen vor allem von königlichen und herzoglichen Herrschern ausging, wurde die Gründung von Kunstvereinen in der Regel von Bürgern angestoßen, die sich aktiv in der Kunstförderung engagierten, oder von Beamten, die die Nützlichkeit von Kunstvereinen für die Finanzierung königlicher und herzoglicher Kunstmuseen sowie für die Unterstützung lokaler Künstler erkannten. Der sogenannte Verein der Kunstfreunde im Preußischen Staate wurde in Berlin im Jahr 1825 vor allem dazu gegründet, um lokale Künstler zu unterstützen und diesen auch Reiseaufenthalte in Italien zu finanzieren. Eine Gruppe von Künstlern und Kunstfreunden um Wilhelm von Humboldt initiierte die Gründung dieses Kunstvereins, der bald die Unterstützung der Hohenzollern-Familie und des Berliner Bürgertums fand. Der Verein der Kunstfreunde im Preußischen Staate diente wie der Karlsruher Kunstverein als ein Unterstützer der königlichen Kunstförderung und nicht einer eigenständigen bürgerlichen Kunstförderung. Friedrich Wilhelm III. wurde zum Protektor des Kunstvereins gekürt, dem 25 königliche Hoheiten, Herzöge und Fürsten angehörten.15
Nur im Fall des Münchner Kunstvereins ging die Initiative zur Vereinsgründung wohl zumindest indirekt von einem Mitglied der königlichen Familie aus. Da die engsten Freunde des Kronprinzen Ludwig eine maßgebliche Rolle bei der Gründung des Kunstvereins spielten, vermutet der Historiker York Langenstein, dass der kunstliebende Kronprinz indirekt die Gründung des Kunstvereins vorantrieb. Unter den Gründungsmitgliedern befanden sich Ludwigs ehemaliger Lehrer Johann Joseph Franz Otto Ritter von Kirschbaum, die Freunde des Kronprinzen Freiherr Wilhelm von Gumppenberg und August Graf vom Seinsheim. Kronprinz Ludwig instruierte die Beamten, die mit der Genehmigung der Vereinsgründung beschäftigt waren, ihm regelmäßig über deren Fortschritt zu berichten.16
Kunstvereine entstanden im Lauf des 19. Jahrhunderts in fast allen großen zentraleuropäischen Städten.17 Der Münchner Kunstverein und der Kunstverein in Halberstadt scheinen hierbei eine Vorreiterrolle für die Gründung derartiger Vereine in den Städten des Deutschen Bundes gespielt zu haben. Langenstein schreibt dem im Jahr 1821 gegründeten Münchner Kunstverein sogar die Rolle eines Modelles für alle nachfolgenden Gründungen zu.18 Friedrich Lucanus, ein Mitglied des Vorstandes im Kunstverein in Halberstadt, hielt dagegen in der Festschrift zum 25-jährigen Bestehen seines Vereins im Jahr 1855 fest, dass der Halberstädter Verein als Muster für die Gründung gleichartiger Vereine in Hannover, Halle, Braunschweig, Magdeburg, Königsberg und Stettin diente. In den Jahren von 1821 bis 1853 entstanden insgesamt 41 Kunstvereine in den Groß-, Mittel- und Kleinstädten des Deutschen Bundes.19 Diese Vereine organisierten Kunstausstellungen, unterstützten lokale Künstler durch die Auktion ihrer Kunstwerke unter den Vereinsmitgliedern und trieben die Gründung von Kunstmuseen voran.
In diesen Vereinen versammelten sich Hunderte und Tausende von Mitgliedern. Der Münchner Kunstverein zählte 3.164 Mitglieder im Jahr 1844. Der Düsseldorfer Kunstverein brachte 3.685 Mitglieder und der Berliner Kunstverein 2.283 Mitglieder (jeweils im Jahr 1840) zusammen.20
Stadt/Region
Gründungsjahr
München
1821
Berlin
1825
Dresden
1828
Düsseldorf
1829
Halberstadt
1830
Frankfurt am Main
1830
Hamburg
1830
Altona
1830
Wien
1831
Hannover
1832
Braunschweig
1832
Königsberg
1832
Stettin
1832
Potsdam
1834
Magdeburg
1834
Kassel
1834
Halle
1834
Prag
1835
Breslau
1835
Posen
1835
Münster
1835
Mannheim
1836
Straßburg
1836
Karlsruhe
1836
Darmstadt
1836
Mainz
1836
Stuttgart
1836
Augsburg
1836
Leipzig
1837
Nürnberg
1838
Köln
1838
Lübeck
1838
Regensburg
1838
Würzburg
1838
Triest
1839
Bamberg
1839
Salzburg
1839
Pesth
1840
Bremen
1842
Ulm
1843
Greifswald/Rostock/Stralsund
1843
Gotha
1846
Erfurt
1853
Krakau
1854
Tabelle 2: Gründung von Kunstvereinen in zentraleuropäischen Städten (1821–1854)
Quelle: Lucanus, Der Kunstverein in Halberstadt, S. 166–168.
Mit der Förderung der Künste erschlossen sich Bürger, die vor und nach der Revolution von 1848/49 nur über geringe politische Mitwirkungsrechte verfügten, Möglichkeiten, öffentliche städtische Räume mitzugestalten. Und während Kunstvereine in Residenzstädten wie Karlsruhe und Berlin in enger Zusammenarbeit mit den Herrscherhäusern entstanden und operierten, repräsentierten die Kunstvereine in den Bürgerstädten Hamburg, Bremen und Leipzig einen bewussten Gegenentwurf zur aristokratischen Kunstförderung.21 Diese bürgerlichen Kunstvereine trugen maßgeblich zur Aneignung der Kunstproduktion und des Kunstgenusses durch das Bürgertum bei. Sie schufen soziale Räume für Kunstausstellungen und beförderten die Herausbildung eines Kunstmarktes.22 Kunstvereine waren für den preußischen Kunsthistoriker Franz Kugler vor allem im Norden des Deutschen Bundes bereits in den 1830er Jahren die wahren Kunstförderer.23
Kunstvereine etablierten darüber hinaus mit dem kollektiven Stiften eine neue Form des Stiftens. Dieses kollektive Stiften ergab sich aus der Notwendigkeit, die finanziellen Ressourcen von mehreren Stiftern für die Einrichtung und Unterhaltung von kostenintensiven Kunstsammlungen und Kunstmuseen zu erhalten und zu bündeln. Die Errichtung eines bürgerlichen Kunstmuseums konnte nur in wenigen Fällen wie etwa im Fall des Frankfurter Bürgers Johann Friedrich Städel durch die finanzielle Unterstützung eines einzelnen Stifters verwirklicht werden.24 Der kollektive Charakter des bürgerlichen Stiftens stellte aber auch ein Gegenmodell zum aristokratischen Stiften dar, das immer auf die Glorifizierung der stifterischen Aktivitäten eines einzelnen Herrschers ausgerichtet war. Kunstvereine betonten demgegenüber die Zusammenarbeit einer großen Zahl von Bürgern. Dieses Zusammenwirken von bildungsbürgerlichen und wirtschaftsbürgerlichen Schichten trug nicht nur zur Integration verschiedener bürgerlicher Gruppierungen in eine sozio-kulturelle bürgerliche Klasse bei, sondern versorgte diese Klasse über das Kunstmuseum mit einer von allen Beteiligten geteilten Klassenidentität.
Kunstvereine erlebten im Lauf des 19. Jahrhunderts erhebliche Veränderungen. In ihren Anfangsjahren beschränkten sich die Kunstvereine auf die Förderung der Kunst, indem deren Vereinsmitglieder Kunstobjekte lokaler Künstler in Auktionen und Lotterien erwarben.25 Kunstvereine organisierten aber auch Vorträge und Veranstaltungen, in denen den Vereinsmitgliedern nicht nur Kunstwissen vermittelt, sondern ihnen auch die Gelegenheit gegeben wurde, sich mit Künstlern und Kunstexperten direkt zu unterhalten.26 Allmählich begannen Kunstvereine, Kunstwerke anzukaufen und Kunstsammlungen zusammenzutragen, die nicht das Eigentum einzelner Sammler, sondern das kollektive Eigentum des Kunstvereins waren und den Kern eines bürgerlichen Kunstmuseums bildeten. In Städten wie Leipzig beteiligten sich Kunstvereine sogar an der Finanzierung städtischer Kunstmuseumsgebäude. Diese bürgerlichen Kunstmuseen entstanden in einer zweiten Welle von Museumsgründungen und Museumsbauten, die auf die erste Welle der Gründung und Errichtung königlicher und großherzoglicher Museen folgte. In diesem Kontext wurden aus Kunstvereinen Museumsvereine.