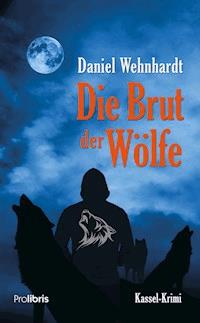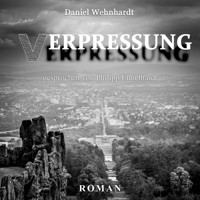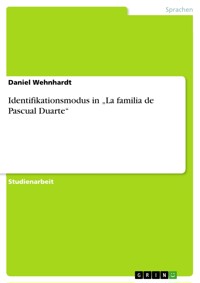Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Zeitgeschichtliche Kriminalromane im GMEINER-Verlag
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Sommer 1945. Die Überlebenden des Holocaust haben alles verloren. Ihre Heimat, ihre Familien, ihre Freunde. Erfüllt von grenzenlosem Hass geben einige wenige von ihnen dem gesamten deutschen Volk die Schuld an dem schwersten Verbrechen der Menschheit - der Ermordung von sechs Millionen Juden. Die Geburtsstunde der Nakam, einer jüdischen Untergrundorganisation. Fünfzig Männer und Frauen, die sich nach Vergeltung sehnen. Ihr Ziel: sechs Millionen für sechs Millionen - Auge um Auge, Zahn um Zahn.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 382
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Wehnhardt
Zorn der Lämmer
Roman
Zum Buch
Gibt es ein Recht auf Rache? Abba, Vitka, Ruzka und Leipke haben das Grauen überlebt: Zusammen mit der Roten Armee ziehen die vier Freunde als Befreier in ihre Heimatstadt Wilna ein. Zwei Jahre später verbindet die jungen Juden vor allem eins: das Verlangen nach Gerechtigkeit. In Tarvisio, einer kleinen italienischen Stadt im Kanaltal, treffen sie auf Soldaten der Jüdischen Brigade und beteiligen sich an deren Vergeltungsaktionen. Abba, dem charismatischen Dichter, ist die Erschießung von Nazi-Tätern jedoch nicht genug. Unter seiner Führung gründen Gleichgesinnte die Rächergruppe Nakam. Fortan verfolgen die Männer und Frauen einen tödlichen Plan: Durch ihn sollen genauso viele Deutsche wie Juden im Holocaust sterben. Was sie jedoch nicht ahnen: Mächtige Gegenspieler im Hintergrund setzen alles daran, den Massenmord zu verhindern …
Daniel Wehnhardt, 1984 in Fürstenhagen geboren, studierte in Kassel Spanisch und Politikwissenschaften. Seine Romane handeln von politischen Verschwörungen, Rechtsterrorismus und der Macht der Wirtschaft. In seiner Freizeit widmet er sich der Literatur und den asiatischen Kampfkünsten. »Zorn der Lämmer« ist sein Debüt im Gmeiner-Verlag. Mehr Informationen: www.danielwehnhardt.de
Impressum
In diesem Roman verbinden sich Fakten und Fiktion.
Die meisten Personen tragen ihre richtigen Namen und sind –
soweit es die Recherche erlaubte – in ihrem Handeln historisch
korrekt wiedergegeben. Vereinzelte Figuren und deren Handlungen
sind frei erfunden, sodass Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten
Personen rein zufällig und nicht beabsichtigt sind.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2021 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Sven Lang
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © T.Den_Team / stock.adobe.com
ISBN 978-3-8392-6816-2
Gedicht
Wherever the murderer may hide away,
There shall we be, night and day,
Our eyes will be fixed on him
As the sunflower follows the sun.
In his innermost rooms are we,
As the shadow that clings to his steps,
We are in the poison dormant
In the slender, hollow needle.
Nathan Altermann
Widmung
Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus.Möge ihr Vermächtnis uns allen eine ewige Verantwortung sein.
PROLOG
Als Sarah zu sich kam, hörte sie nur ein leises Wimmern.
Sofort schossen mehrere Fragen durch ihren Kopf. Was war bloß mit ihr passiert? Warum lag sie hier in dieser Grube? In einem Meer von steifen, kalten, leblosen Körpern. Umhüllt von einer Wolke des Gestanks nach Blut, Kot und Urin.
So roch der Tod, dachte Sarah.
Stück für Stück setzte sich ihre Erinnerung wieder zusammen. Da war diese herrische Stimme gewesen, die ihr befohlen hatte, sich auszuziehen. Der Tritt gegen den Unterschenkel, der sie auf die Knie fallen ließ, und die prankengleichen Hände, die ihre Arme gewaltsam hinter ihrem Kopf verschränkten.
Dann die ratternden Schüsse eines Maschinengewehrs.
Das Letzte, an das sie sich erinnerte, waren der Ausdruck in den Augen ihrer Mutter und ihre geflüsterten Worte: »Vertraue auf Gott, denn er weist dir den Weg.« Im Gegensatz zum Rest der Familie war ihre Mutter schon immer sehr gläubig gewesen.
Sarah versuchte sich zu bewegen. Sie durfte keine weitere Zeit verlieren. Unverzüglich musste sie sich auf die Suche nach den anderen begeben. Aber wo waren sie nur geblieben? Hatten Gott oder das Schicksal es mit ihnen genauso gut gemeint wie mit ihr? Hatte außer ihr sonst noch jemand überlebt?
Plötzlich hörte Sarah in der Ferne Männer grölen. Waren das etwa … Soldaten? Auf jeden Fall waren es Deutsche, das erkannte sie am Klang ihrer Stimmen. Sie näherten sich. Begleitet von Gelächter und dem Geräusch klirrender Flaschen.
Am Rand der Grube angekommen, zückten die Männer ihre Maschinenpistolen. Luden durch … und feuerten hinein. Pfeifend schossen die Kugeln an Sarahs Kopf vorbei. Panisch vor Angst presste sie beide Hände auf ihren Mund. Der leiseste Mucks würde sie verraten.
Kurz darauf verstummten die Pistolen. Sarah hörte, wie einer der Männer seine Hose herunterließ. Sekunden später ging warme Flüssigkeit auf ihr nieder und lief an ihrem Rücken und an ihrer Brust hinab. Erneutes Gelächter hallte von oben herunter. Weitere Männer pinkelten in die Grube und verschwanden anschließend in der Dunkelheit.
Minutenlang blieb Sarah liegen. Bewegte sich keinen Zentimeter und lauschte stattdessen aufmerksam in die Schwärze der Nacht. Während sie betete, dass dieser Albtraum bald vorbei sein würde, fraß sich die Kälte durch ihre urin- und blutgetränkten Lumpen. Eine Ewigkeit verging, bis das Grölen endgültig verstummt war.
Sarah robbte vorsichtig an den Rand der Grube heran. Kroch so behutsam wie möglich über Rücken, Arme, Beine und Gesichter und zog sich mit letzter Kraft aus dem Loch heraus.
Vor ihren Augen erstreckte sich der Wald. Zu ihrer Überraschung sah er in der Dunkelheit beinahe friedlich aus. Als ob er die Todesangst nicht verspürte, die sie und die anderen durchlitten hatten, als sie von den Soldaten mit Maschinenpistolen in ihn hineingeführt worden waren.
Auf einmal wieder das Crescendo deutscher Stimmen. Fluchend kämpften sich die Soldaten einen Weg durch das Dickicht zurück zur Grube, und obwohl Sarah nicht verstand, was sie sagten, ließ der Klang ihrer Sprache das Blut in ihren Adern gefrieren. Ob sie bemerkt hatten, dass jemand mit dem Leben davongekommen war? Wenn ja, würden sie nun überall nach ihr suchen?
Sie musste sich verstecken, dachte Sarah. Jetzt oder nie. Denn eine Flucht würde ihr nicht gelingen, das spürte sie. Dafür waren die Deutschen zu viele, und außerdem würde sie durch das Unterholz zu langsam vorankommen. Zweifellos wäre sie früher oder später in Schussweite der Maschinenpistolen.
Mit riesigen Schritten hetzte sie in den Wald. Suchte Schutz zwischen den Bäumen, während ihr Herz raste und sie am ganzen Körper zitterte. Hektisch atmete sie ein und aus, sodass Atemwolken aus ihrem Mund schossen und sich auflösten in der Nachtluft.
Bei diesem Anblick kam Sarah auf eine Idee. Aber ob sie funktionierte? Sie musste es wenigstens versuchen. Den immer lauter werdenden Stimmen nach zu urteilen, blieben ihr nur noch wenige Minuten, bis die Soldaten wieder in ihrer unmittelbaren Nähe sein würden.
Deshalb stieß Sarah ihre Hände in die Erde hinein und grub wie besessen in den Boden. Ihre Fingernägel rissen ein, Blut quoll hervor, aber sie machte weiter, bis vor ihren Augen Sterne tanzten.
Dann plötzlich ein Schuss.
Sarah schreckte hoch. Zusammen mit dem Knall schoss das Echo ihres Schreis durch den Wald. Von Baum zu Baum, bis herüber zu der Grube, aus der sie soeben erst entkommen war. Hatten die Deutschen sie etwa gehört?
Das Knacken der Schritte wurde lauter, die Soldaten bewegten sich nun durchs Geäst auf sie zu. Keuchend rammte sie ihre blutigen Hände immer wieder in den Boden, bis sie endlich die erste Erdschicht abgetragen hatte. Dann legte sie sich in die Kuhle hinein und bedeckte ihren Körper in Windeseile mit Laub und Gestrüpp.
Sarah schloss die Augen. In Gedanken sprach sie das Gebet, das sie von ihrer Mutter gelernt hatte. Es war das einzige, das sie sich je gemerkt hatte.
»Erhabener, es ströme Deine Barmherzigkeit und erbarme Dich über Dein Kind geliebtes. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, die Herrlichkeit Deiner Macht zu schauen! Dies ist das Sehnen meines Herzens: Erbarme Dich und verbirg Dich nicht!«
Die Schritte kamen näher und näher.
ERSTES BUCH – Die kultivierten Tage
Zum wiederholten Mal fischte Vitka Kempner die Karte aus ihrer Tasche.
So ein Mist, fluchte sie innerlich. Wie sollte sie auf diesem zerfleddernden Fetzen Papier überhaupt etwas erkennen?
Immer wieder verglich sie die verwaschene Zeichnung mit der Landschaft vor ihren Augen und hielt verzweifelt Ausschau nach irgendeinem Anhaltspunkt. Nach irgendetwas, das ihr sagte, dass sie noch immer in die richtige Richtung ging. Doch dieses verfluchte Ding war einfach zu nichts zu gebrauchen. Vitka musste sich eingestehen, dass sie auf den verzweigten Wegen längst die Orientierung verloren hatte.
Frustriert stopfte sie die Karte wieder zurück in ihre Tasche und fuhr sich durchs Gesicht. Wegen der Strapazen der letzten Monate war sie immer dünner geworden. Ihre Wangenknochen traten inzwischen deutlich unter ihrer blassen Haut hervor, und der lange Marsch, zu dem sie vor Stunden aufgebrochen war, zehrte zusätzlich an ihren Kräften.
Trotzdem hatte Vitka immer noch keinen Hinweis auf ihr Ziel entdeckt. Hatte sie ihren Auftrag etwa unterschätzt? Die Warnungen der anderen hatte sie jedenfalls allem Anschein nach nicht ernst genug genommen.
Vor zwei Wochen waren Mitglieder der Jungen Garde im Wald auf ein Mädchen gestoßen. Nackt, halb erfroren, der Körper übersät von blauen Flecken und getrocknetem Blut. Tagelang war das Mädchen umhergeirrt und hatte sich vor den Deutschen versteckt. Dass es den Klauen dieser Bestien tatsächlich entkommen war, erschien vielen in der linksgerichteten zionistischen Jugendorganisation wie ein Wunder.
Doch das, was Sarah ihren Rettern anschließend berichtete, war noch viel dramatischer. So unvorstellbar, dass ihr niemand glauben wollte. Vor allem nicht Jakob Gens, der Chef der jüdischen Polizei, der sie für verrückt erklärte und sofort ins Krankenhaus bringen ließ.
Noch am selben Abend berief die Junge Garde eine Versammlung ein. Auch Vitka nahm an dem Treffen im Ratskeller teil. Stolz akzeptierte sie den Auftrag, den die anderen ihr erteilten: Sie sollte zu Abba Kovner gehen. Ihr Anführer, der sich in einem Frauenkloster außerhalb der Stadt versteckt hielt, musste dringend von Sarah erfahren. Alle hofften, dass er schon wissen würde, was zu tun sei.
Für ihre Mission war Vitka wie geschaffen. Ein polnisches Bauernmädchen wie sie, das nicht jüdisch aussah und auch keinen jiddischen Dialekt sprach, fiel bei den Deutschen nicht besonders auf. So war es der Jungen Garde erfolgreich gelungen, sie aus dem Getto zu schleusen und in einer Dachgeschosswohnung in einem Haus am Stadtrand unterzubringen. Vitka lebte dort zusammen mit ihrer Vermieterin, einer alten Dame, der sie im Haushalt half und deshalb keine Miete zahlte. Unbemerkt richtete sie in ihrem Zimmer ein kleines Lager ein, von wo aus sie regelmäßig Essen und Kleidung ins Getto schmuggelte. Denn dank ihrer Erscheinung war es für sie kein Problem, ungehindert durch das Tor in der Rudnitskaja-Straße zu gelangen. Durch das Tor, das für die Bewohner zugleich Anfang und Ende ihrer beengten, todbringenden Welt darstellte und durch das man in jenes Viertel gelangte, in das man die Juden im Mittelalter schon einmal eingesperrt hatte.
Dieser düstere Gedanke holte Vitka zurück in die Gegenwart. Enttäuscht, dass sie offenbar an ihrer Mission gescheitert war, schaute sie hinauf zum Himmel. Der Mond war bereits aufgegangen und durch sein fades Licht wirkte die Landschaft wie gefroren. Bauernhöfe, Felder, Bäume – über der Welt, wie sie sich Vitka zeigte, lag tiefe, friedliche Stille. Kraftspendende Ruhe inmitten einer Zeit des Sterbens.
Dann, als Vitka ihren Kopf wieder senkte und in die Ferne sah, erkannte sie plötzlich etwas. Wie ein Fingerzeig kletterte der Mondschein einen Hügel hinauf, der sich am Ende eines Feldwegs zum Himmel wölbte. War das etwa …? Viele in der Jungen Garde hätten wohl behauptet, dass dies ein Zeichen Gottes gewesen war.
Obwohl Vitka nicht an derartige Phänomene glaubte, folgte sie dem Weg und erklomm so die Spitze des Hügels. Oben angekommen, schnappte sie nach Luft. Erschöpft von dem langen Marsch ließ sie ihren Blick über die Landschaft zu ihren Füßen schweifen.
Jetzt endlich entdeckte sie es: Unrhythmisch flackernder Kerzenschein erhellte die Fenster des Dominikanerklosters. Schwaches, schummriges Licht, das einen zerbrechlichen Keil der Hoffnung in die Dunkelheit trieb.
*
Abba hockte im Schneidersitz auf seiner Matratze und blätterte in der Bibel.
Obwohl er kein gläubiger Jude war, hatten die kämpferischen Passagen der Heiligen Schrift es ihm so angetan, dass er sie manchmal, wenn er in der entsprechenden Stimmung dafür war, regelrecht verschlang. Vor allem waren es die Geschichten über die jüdischen Armeen der Vergangenheit, die ihn so faszinierten. Erzählungen über mutige junge Männer, die durch die Wüste Palästinas marschiert waren und dabei schmerzliche Niederlagen erlitten, aber ebenso berauschende Siege gefeiert hatten. Männer, wie auch Abba einer sein wollte.
Jedes Mal, wenn er diese Geschichten las, riefen sie ihm etwas in Erinnerung: sein Schicksal. Denn Abba war davon überzeugt, zu Höherem bestimmt zu sein. Nicht etwa durch Gott, wie viele ihm unterstellten. An dessen Existenz hegte Abba berechtigte Zweifel. Genauso wenig wusste er, was genau sein Schicksal für ihn bereithielt. Doch was auch immer es sein würde, er fühlte sich bereit dazu.
Dann hörte er plötzlich ein zaghaftes Klopfen. Abba hob den Kopf und erkannte das Gesicht der Mutter Oberin. Anna Borkowska, wie sie mit bürgerlichem Namen hieß, hatte seine Tür einen Spaltbreit geöffnet und lugte in seine Kammer hinein.
»Entschuldige die späte Störung«, flüsterte sie, »hier ist ein Mädchen, das dich unbedingt sprechen möchte.«
Abba schenkte der Frau ein Lächeln und schob die Bibel unter seine Matratze. »Lass sie ruhig herein«, sagte er und richtete sich auf.
Ihr, die von allen im Kloster nur »Mutter« genannt wurde, hatte Abba nichts Geringeres als sein Leben zu verdanken. Nachdem die lebhafte, heute fünfunddreißig Jahre junge Frau ihr Studium in Warschau beendet hatte, war sie in den Konvent in der Nähe von Kolonia Wilenska gegangen. Später, als die Deutschen in Litauen einmarschiert waren, hatte sie für Abba und sechzehn weitere Mitglieder der Jungen Garde die Tore ihres Stifts geöffnet. Hatte sie dort vor den Nazis versteckt, sie zur Tarnung in Trachten gehüllt und allesamt zum Arbeiten auf die Felder geschickt. Es hatte nicht lange gedauert, bis sich trotz der immensen Unterschiede zwischen den christlichen Schwestern und den säkularen Juden eine enge Beziehung entwickelte.
Als nun das Mädchen, das so dringend zu ihm wollte, seine Kammer betrat, hätte Abba sich am liebsten die Augen gerieben. Sie sah aus wie eine junge Bäuerin, etwa sechzehn oder siebzehn Jahre alt. Unter ihrem Kopftuch lugten hellblonde Strähnen hervor, während ihre müden Augen die leidvolle Geschichte einer Vertriebenen erzählten, einer jungen Frau, der man alles genommen hatte.
Sie, die um ein Treffen gebeten hatte, stand nun sprachlos da und zitterte am ganzen Körper. Auf dem Weg zum Kloster musste sie halb erfroren sein. Abba bückte sich, griff nach der Wolldecke auf seiner Matratze, schüttelte sie aus und legte sie dem Mädchen um die Schultern.
»Wie heißt du?«, fragte er.
Langsam, wie in Zeitlupe, formten sich ihre Lippen nun zu einem Lächeln. Als hätte dies ihr trauriges Gesicht neu erschaffen, wirkte sie plötzlich heiter und ausgelassen. Augenblicklich fühlte Abba sich von ihrer kindlichen Art eingenommen.
»Ich heiße Vitka«, sagte sie. »Ich soll dich zurückholen.«
Abba verzog das Gesicht. »Zurück?« Er kratzte sich am Kinn. »Wohin zurück?«
»Zurück ins Getto«, antwortete Vitka. »Es gibt dort jemanden, den du kennenlernen musst.«
*
Je näher sie dem Tor kam, desto schneller schlug ihr Herz. Bis zur Kontrollstelle waren es keine hundert Meter mehr. Vor ihr standen nur noch wenige Menschen in der Schlange. Wie eine ständige Bedrohung baumelte über ihrem Kopf das Schild mit der Aufschrift »Das Mitführen von Lebensmitteln ist untersagt! Zuwiderhandelnde werden erschossen!«im Wind hin und her.
Hannahs zittrige Finger glitten in ihre Tasche. Fest und voller Hoffnung umklammerte sie die Konserve. Eine alte Frau mit mitleidigen Augen hatte sie ihr im Vorbeigehen zugesteckt, gerade als Hannah nach der Arbeit in der Fabrik zurück ins Getto geführt worden war. Wenn es ihr doch nur irgendwie gelingen würde, sie an den Wächtern der jüdischen Polizei vorbeizuschleusen! Dann würde sie die Erbsen ihrer Mutter schenken, die von allen in ihrer Familie am meisten unter dem Hunger litt. Er hatte aus der Frau, die früher nur so vor Kraft und Lebensfreude gestrotzt hatte, ein klappriges, dem Leben überdrüssiges Skelett gemacht.
Dann, während Hannah wartete und im Stillen betete, entdeckte sie plötzlich ein bekanntes Gesicht. War das etwa … Levi? Vor einem Jahr hatte der schlaksige Junge in der Schule noch neben ihr gesessen. Eine Zeit lang war Hannah sogar überzeugt gewesen, dass er für sie geschwärmt hatte.
Jetzt stand er hier und bewachte das Tor an der Ecke zur Niemiecka-Straße. Trug einen feinen sauberen Anzug, mit der blau-weißen Binde der jüdischen Polizei um den linken Oberarm, dazu eine Trillerpfeife um seinen Hals und einen hölzernen Schlagstock an seinem Handgelenk. Mit eisigem Blick untersuchte er die Menschen auf verbotene Gegenstände.
»Arme hoch!«, befahl er auch ihr, als Hannah an der Reihe war.
Erst jetzt erkannte er sie. Mit einem Mal funkelten seine Augen und einen flüchtigen Moment lang formten sich seine Lippen zu einem zaghaften Lächeln. Levi wartete, bis Hannah ihre Arme in die Luft streckte, tastete sie anschließend nur mit spürbar sanftem Druck ab, aber als er die Dose in ihrer Tasche erfühlte, hielt er kurz inne. Mitleidig sah er sie an, während eine Träne an Hannahs Wange herunterkullerte. Sie zuckte mit den Schultern.
»Los! Weitergehen!«, befahl Levi zu ihrer Überraschung. Beherzt schob er sie an sich vorbei.
Hannah konnte ihr Glück kaum fassen! Sie nahm ihre Arme herunter, verschränkte sie vor ihrer Brust und flüsterte ein schüchternes »Danke«. Levi zwinkerte ihr zu und winkte schließlich den Nächsten aus der Schlange zu sich.
Mit gesenktem Kopf verließ Hannah die Kontrollstelle und wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Sie hatte es tatsächlich geschafft. Sie freute sich bereits auf das Gesicht, das ihre Mutter machen würde, wenn sie –
»Halt!«, schallte es auf einmal zwischen den Häuserwänden. »Du da, sofort stehen bleiben!«
Wie ein Blitz schoss der Klang der sonoren Stimme durch Hannahs Körper. Obwohl sie den Mann nicht sehen konnte, spürte sie augenblicklich seine unmittelbare Anwesenheit. Widerwillig drehte sie sich herum und erkannte ihn sofort: Diese stahlblauen Augen, diese dunklen, zu einem strengen Seitenscheitel gekämmten Haare und diese akkurat sitzende Uniform würde sie für den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen.
Franz Murer.
»Der Herr der Juden«, wie sie ihn nannten. Der Mann, der als Stellvertreter des Gebietskommissars für jüdische Angelegenheiten zuständig war und dessen Namen man im Getto nur hinter vorgehaltener Hand aussprach. Ihm gegenüberzustehen bedeutete meistens nur eines: den sicheren Tod.
»Komm her!«, schrie Murer. Mit seinem Schlagstock zeigte er auf Hannahs Hose. »Was hast du in der Tasche? Na los, hol’s raus!«
Hannah zögerte. Wie versteinert stand sie da, nur noch wenige Meter vom Haus ihrer Eltern entfernt. Sie konnte von hier aus sogar das ausgemergelte Gesicht ihrer Mutter ausmachen. Sie stand hinter einem der verdreckten Fenster und hielt sich die Hand vor den Mund.
Hannahs Knie schlotterten. Um sie herum herrschte Stille. Sogar die Kontrolleure am Tor hatten ihre Arbeit unterbrochen. Dutzende Augenpaare blickten sie an, während sie sich Murer mit wackeligen Schritten näherte.
Dann plötzlich der erste Hieb. Mit voller Wucht traf der Schlag des SS-Obersts sie im Gesicht. Hannah stürzte zu Boden, doch Murer trat und schlug sie weiter. Sie spürte jeden Tritt, krümmte sich vor Schmerzen. Blut lief ihr ins Gesicht. Um sie herum wurde es dunkel. Murers berauschtes Stöhnen entschwand langsam ihrem Bewusstsein.
Bis sie schließlich nichts mehr fühlte außer Wärme. Die Welt, die sie umgab, verschwamm zu einem verwaschenen Gemälde. Allumfassender Frieden breitete sich in ihrem Körper aus.
*
Schweigend trotteten Vitka und Abba zusammen durch die Nacht. Vom Mondschein geleitet durchquerten sie Felder, umliefen Ortschaften, in denen in manchen Häusern noch Licht brannte, und sprangen über Bäche, die sich als Ausläufer der Wilija wie Wurzeln eines Baumes durch die Landschaft zogen.
Seitdem sie das Kloster hinter sich gelassen hatten, hatten sie kein Wort miteinander gesprochen. Und das, obwohl Vitka davon ausgegangen war, dass Abba sie pausenlos über Sarah ausfragen würde. Dass er wissen wollen würde, was das Mädchen den Mitgliedern der Jungen Garde denn erzählt hatte und warum dies für ihren Kampf von solcher Bedeutung war. Doch zu ihrer Überraschung schien ihr Anführer, den sie sich aufgrund der Beschreibungen viel redseliger vorgestellt hatte, einfach nur die Stille zwischen ihnen zu genießen.
Trotzdem fühlte Vitka sich wohl bei ihm, so viel konnte sie bereits sagen. Abbas Gegenwart beruhigte sie, weckte in ihr ein Gefühl von Geborgenheit. Etwas, das sie bisher nur im Kreis ihrer Familie empfunden hatte. Bis zu diesem Moment hatte sie geglaubt, dass sie es nie wieder empfinden würde.
Während die beiden sich den Toren der litauischen Hauptstadt näherten, blickte Vitka verstohlen zu Abba hinüber. Er sah genau so aus, wie die Mitglieder der Jungen Garde ihn beschrieben hatten: ein schlanker, drahtiger Mann mit langen Armen und Beinen. Dazu hochgezogene Schultern, dunkle, traurige Augen, die einen geheimnisvollen Glanz versprühten, und weiche, fast weibliche Gesichtszüge. Trotzdem, fand Vitka, strahlte er auf sie zugleich eine rohe, männliche Kraft aus.
Nach einiger Zeit brach Abba das Schweigen zwischen ihnen. »Was ist mit deinen Eltern?«, fragte er. »Sind sie auch im Getto?«
»Nein«, antwortete Vitka. Demütig senkte sie ihr Haupt. »Sie sind tot.«
»Das tut mir leid. Wenn du möchtest, kannst du mir davon erzählen.«
Vitka überlegte kurz, doch dann schüttelte sie nur den Kopf. Denn das Angebot ihres Anführers hatte dunkle Erinnerungen in ihr wachgerufen. Erinnerungen an den Tag, an dem sie ihren Eltern zum letzten Mal gegenübergestanden hatte. An den Moment, vor dem sie sich vorher immer gefürchtet hatte. Der Augenblick, in dem es hieß, für immer Abschied zu nehmen.
Das letzte Mal hatten sie sich in der Kirche gesehen. In dem verlassenen Gotteshaus, in das die SS alle dreitausend Juden nach der Eroberung von Vitkas Heimatstadt gesteckt hatte. Kalisz, so raunte man in den Straßen, sollte zur judenfreien Zonewerden. Am Morgen dieses Tages, der ihr letzter gemeinsamer Tag werden sollte, waren Vitkas Eltern noch verzweifelt durch die Stadt gelaufen. Hatten bis zuletzt versucht, irgendetwas in Erfahrung zu bringen, während Vitka derweil zu Hause auf sie gewartet hatte. Erst am frühen Abend waren sie zurückgekehrt.
»Was geschieht nun mit uns?«, fragte Vitkas Mutter. Die Tränen in ihren Augen verrieten, dass sie die Antwort bereits zu kennen glaubte. Vielleicht hatte sie auch gehofft, dass Vitkas Vater ihr etwas anderes sagen würde. Dass er ihr versprechen würde, alles käme in beste Ordnung.
Doch stattdessen nahm er ihr Gesicht in beide Hände und drückte ihr einen Kuss auf die Stirn. »Wir werden umgesiedelt«, erklärte er. Das war es, was die Deutschen ihm, dem die familiengeführte Schneiderei gehörte, erzählt hatten.
Am Abend klopfte es dann an ihrer Wohnungstür. »Los, alles einpacken und mitkommen!«, schrien zwei Soldaten mit vorgehaltenen Maschinenpistolen. Eine Viertelstunde später, nachdem sie eilig ihre Koffer gepackt hatten, bestiegen sie einen Lkw. Zusammen mit den jüdischen Nachbarn aus ihrer Straße quetschten sie sich auf die Ladefläche und fuhren in bedrückendem Schweigen durch die Dämmerung.
An der Kirche angekommen, pferchten die Soldaten sie mit gellenden Pfiffen und Geschrei in das Gotteshaus. Draußen, vor den großen, bemalten Bleiglasfenstern, sahen sie ein hellrotes Flackern.
Vitkas Vater begriff es als Erster. Für ihn waren die Fackeln der Beweis: Er war einem fatalen Irrtum unterlegen. In wenigen Minuten würde von den dreitausend Juden aus Kalisz niemand mehr am Leben sein. Verschlungen von den gefräßigen Flammen oder aber erstickt im Rauch des Feuers.
»Du musst verschwinden«, befahl er Vitka augenblicklich. Mit Tränen in den Augen fiel sich die kleine Familie um den Hals. Da war er, der Moment, den Vitka am liebsten niemals, auf keinen Fall aber bereits in so jungen Jahren, erleben wollte.
»Los, los!«, wiederholte ihr Vater. Er trennte Mutter und Tochter, die einander eng umschlungen hielten. »Gleich bleibt dir keine Zeit mehr!«
Dann kämpfte Vitka sich durch die Menschenmenge. Fuhr ihre Ellenbogen aus, wie ihre Mutter es ihr befohlen hatte, und boxte sich so einen schmalen Weg frei. Schließlich entdeckte sie die winzige Kammer, von der ihr Vater gesprochen hatte, und quetschte sich durch ein enges Fenster mühsam ins Freie. Während sie zu dem nahe gelegenen Waldstück rannte, hörte sie Schreie und spürte in ihrem Rücken die Hitze der Flammen. Keuchend erreichte sie die erste Reihe der Bäume. Als sie einen Blick zurück riskierte, waren die Schreie bereits verstummt. Unendlich lange Sekunden später war Vitka die einzige noch lebende Jüdin aus Kalisz.
Abbas mitfühlendes Nicken holte sie zurück in die Gegenwart.
»Ich kann verstehen, dass du darüber nicht sprechen magst«, sagte er. »Mögen deine Eltern in Frieden ruhen.«
»Danke«, sagte Vitka. »Ich hoffe sehr, dass sie es tun.«
Hand in Hand marschierten sie weiter den Lichtern der Stadt entgegen. Ein zarter, am Horizont wabernder Schimmer, der ihnen den Weg leitete.
Im Morgengrauen erreichten Abba und Vitka ihr Ziel. Von einem der bewaldeten Hügel, die Wilna wie eine Kette umschlossen, schauten sie herab auf die in einer Senke liegende Stadt. Im Dunst der frühen Morgenstunden hatte ihr Anblick etwas Malerisches. Gepflasterte Straßen schlängelten sich zwischen byzantinischen Ecken und zerfallenden Holzhäusern hindurch. Die Wilija, auf deren Wasser die wenigen Strahlen der Morgensonne tanzten, zog sich wie ein silbernes Band durch die Stadt. Vorbei an zahlreichen Kirchtürmen mit rostbraunen Kupferdächern, die sich in den Himmel streckten und einander wegen der engen Bebauung beinahe zu berühren schienen. Am Rande des Waldes, der an die Stadt grenzte, erhob sich majestätisch das Schloss.
Abba liebte Wilna. Seine Familie lebte schon seit mehreren Generationen hier. Bevor die Deutschen einmarschiert waren, hatte er zusammen mit seinen Eltern und seiner Schwester in bescheidenen Verhältnissen in einem Haus gewohnt. Sein Vater hatte sich immer gewünscht, dass Abba seinen Lebensunterhalt auf praktische Weise verdienen würde – genauso wie er. Doch dabei hatte er die Rechnung ohne seinen Sohn gemacht. Denn Abba hatte nie etwas anderes im Sinn gehabt, als Künstler zu werden. Zeichnen, Dichten, Bildhauen – das waren die Dinge, für die er sich begeisterte. Unzählige Male war deshalb zwischen ihnen ein heftiger Streit entbrannt. Heute fragte Abba sich, ob sie dazu überhaupt jemals wieder Gelegenheit haben würden.
»Du siehst traurig aus«, bemerkte Vitka.
Erschrocken drehte Abba sich zu ihr herum. Wieder schaute sie ihn aus ihren kindlich-naiven Augen an.
»Du hast recht«, antwortete er und nickte zaghaft. »Auch ich habe einen Teil meiner Familie verloren.«
Die Große Provokation hatte Abbas Leben für immer verändert. Noch immer blitzten die Erinnerungen an diesen Tag regelmäßig in ihm auf: das ohrenbetäubende Poltern der Soldaten, die durch die Treppenhäuser gestürmt waren und jeden Juden verhaftet hatten, den sie in die Finger bekamen. Die flehenden Rufe der Menschen, die die Deutschen aus ihren Wohnungen auf die Straße geschleift, verprügelt oder an Ort und Stelle hingerichtet hatten. Unter Tränen hatte Abba mit angesehen, wie ein Soldat ein Baby an den Füßen gepackt und seinen winzigen Kopf so lange gegen eine Hauswand gehämmert hatte, bis dessen Schreie für immer verstummt waren.
Ihm, Abba, hatte die Junge Garde hingegen ein sicheres Versteck besorgt. Von dort aus hatte der Anführer die Räumung des Gettos miterlebt. Auch seine Mutter war verschont blieben. Im Gegensatz zu seinem Vater, den ein anderes Schicksal ereilt hatte. Zusammen mit anderen Männern hatten die Deutschen ihn zu einem Bahnhof verschleppt, um sie in den Osten umzusiedeln, wie sie es nannten, wenn sie die Juden an die Orte brachten, von denen nie jemand zurückgekommen war. Deshalb befürchtete Abba, dass er seinem Vater am Morgen dieses Tages zum letzten Mal in die Augen gesehen hatte.
Jetzt spürte er plötzlich eine sanfte Berührung. Vitkas Hand ruhte auf seiner Schulter und schob seine Erinnerungen beiseite.
»Lass uns gehen«, sagte sie, »Sarah wartet auf uns.«
*
Ungläubig starrte Ruzka Korczak ihm ins Gesicht. Er war es tatsächlich: Abba Kovner, der Anführer der Jungen Garde.
Bisher hatte sie ihn noch nie gesehen, sondern immer nur gehört, wie sich die anderen Mitglieder über ihn unterhielten. Sie alle sprachen von ihm in den höchsten Tönen, und für viele, so bekam Ruzka den Eindruck, stellte er so etwas wie einen Retter dar. Einen Heilsbringer, der sie alle erlösen würde.
Ein Mensch allein konnte unmöglich solche Erwartungen erfüllen, dachte sie.
Doch nachdem Abba das Zimmer betreten hatte, erschien es ihr, als habe seine Energie augenblicklich den ganzen Raum erfüllt. Seine Anziehungskraft war gewaltig, und so ertappte Ruzka sich bei dem Gedanken, dass er wie geboren sei für seine Rolle als Anführer. Welch großes Glück sie doch hatten, dass es Vitka gelungen war, ihn an den Deutschen vorbei ins Getto zu schleusen.
Nun stand Abba leibhaftig neben ihr in dem Krankenhauszimmer. Mit wachen, einfühlsamen Augen schaute er auf das einzige Bett im Raum.
In ihm lag Sarah. Das Mädchen, auf das Mitglieder der Jungen Garde im Wald gestoßen waren, in dem es sich tagelang vor den Deutschen versteckt hatte.
Sarah war leichenblass. Obwohl die Schwestern sie mehrmals gekämmt und sich intensiv um ihre Verletzungen gekümmert hatten, war sie noch immer gezeichnet von den Strapazen ihrer Flucht. Als ob jede Zelle ihres Körpers stumme Schmerzensschreie ausstieß.
»Ich bin Abba«, stellte der Anführer der Jungen Garde sich vor. Behutsam streichelte er Sarahs Hand. Seine Stimme klang warm und kraftvoll. »Ich bin gekommen, um mir deine Geschichte anzuhören.«
Sarah schaute ihm wortlos in die Augen. Ihr Blick wanderte umher, als ob sie vor den Erwartungen, die die Anwesenden an sie und ihre Erzählungen knüpften, zu fliehen versuchte.
»Aktion Gelbe Scheine«, flüsterte sie schließlich. »Die Deutschen, sie haben alle aus dem Getto getrieben.« Ruzka erkannte eine Träne, die langsam an der Wange des Mädchens herunterkullerte. »Mein Vater hatte einen Arbeitsschein, das war sein Glück. Für meine Mutter und mich hatte er ein Versteck organisiert, eine dunkle, stickige Kammer. Da haben wir uns zusammen mit den anderen hineingequetscht. Den ganzen Tag lang war es laut auf der Straße. Wir haben Schreie gehört. Trillerpfeifen. Haben gehört, wie die Menschen davongerannt sind.« Sarahs Blick wirkte wie versteinert. »Plötzlich hat jemand die Tür eingetreten. Soldaten haben uns an den Haaren aus der Kammer gezerrt.«
Wieder verfiel sie in nachdenkliches Schweigen, als ob die Erinnerungen an diesen Tag zu schwer wogen, um sie ohne Pause zu erzählen. Erneut wanderten ihre glasigen Augen haltlos durch das Zimmer. An dem speckigen Fenster, durch das man nach draußen auf den Innenhof sehen konnte, blieben sie haften. Beklemmende Stille erfasste den Raum.
Nun ließ Abba sich achtsam auf der Matratze des Krankenbetts nieder. »Wohin haben sie euch gebracht?«
»Sie haben uns zu einer Lichtung gefahren«, antwortete Sarah. Ihre Stimme klang noch brüchiger als zuvor. »Wir mussten uns ausziehen und unsere Sachen auf einen Haufen werfen.« Mit ihren Händen malte sie einen Berg in die Luft. »Dann haben sie uns in den Wald geführt, eine Gruppe nach der anderen. Wir haben Schüsse gehört. Zurückgekommen sind nur die Soldaten. Irgendwann sind wir an der Reihe gewesen.«
Die Anwesenden lauschten Sarahs Bericht mit hängenden Köpfen und geschlossenen Augen. Nur Abba schaute von Zeit zu Zeit zu ihr hoch. Legte bedächtig seine Hand auf ihre Schulter oder streichelte ihr über den Kopf. Ruzka ertappte sich bei dem Gedanken, dass auch sie gerne seine Hände auf ihrem Körper gespürt hätte.
In Etappen erzählte Sarah den Rest ihrer Geschichte. Davon, wie sie sich vor den Deutschen im Unterholz versteckt hatte. Wie sie tagelang durch den Nadelwald gekrochen war und dabei den Soldaten, die ihre Fährte aufgenommen hatten, immer wieder nur knapp entkommen war.
Abba wirkte bestürzt. Ruzka beobachtete ihn von der Seite. Ob sich ihrem Anführer in diesem Augenblick dieselbe Erkenntnis aufgedrängt hatte? Dieses Massaker, dachte Ruzka, veränderte alles.
*
Wildes Geschrei erfüllte den Keller des Ratsgebäudes. Leipke Distel hielt sich die Ohren zu. Kopfschüttelnd beobachtete er das Schauspiel, das sich ihm vor seinen Augen bot. Er war der Einzige, der noch ruhig auf seinem Stuhl saß. Das Treffen der Jungen Garde, das Abba einberufen hatte, war völlig aus dem Ruder gelaufen.
»Wo bist du so lange gewesen?«, fragten einige Mitglieder ihren Anführer.
In der Tat hatte Abba sich eine Weile nicht blicken lassen. Dann war er plötzlich wie aus dem Nichts im Getto aufgetaucht. Viele waren erschrocken gewesen, als sie ihn wiedersahen, denn Abba hatte sich verändert. In seinen Augen lag nun ein kalter, unbeirrbarer Blick. Er trug schmutzige, zerlumpte Kleider und hatte sich seit Tagen nicht rasiert. Ein seltenes Bild, das alle irritierte. Bisher war er doch dafür bekannt gewesen, großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres zu legen.
Zu Leipkes Überraschung ging Abba jedoch auf keine der Fragen ein. »Wir müssen uns den Tatsachen stellen«, begann er stattdessen. Obwohl er mit tiefer und fester Stimme sprach, war im flackernden Kerzenschein, der das Gewölbe spärlich beleuchtete, das nervöse Zittern seiner Hände zu sehen. »Die Deutschen sagen, sie hätten unsere Familien und Freunde in den Osten umgesiedelt. Wie wir aber nun durch Sarah wissen, ist das eine Lüge. Sie haben sie alle in den Wald nach Ponary gebracht.« Indem er einzelnen Zuhörern einen Moment lang tief in die Augen sah, verlieh er seinen folgenden Worten noch mehr Gewicht. »Sie haben sie nur aus einem Grund dort hingebracht: um sie alle zu erschießen.«
Ungläubig wanderten die Blicke der Mitglieder durch den Kellerraum. Selbst für Leipke, dessen Eltern im Rahmen der Umsiedlungsaktion ebenfalls mitten in der Nacht abgeholt worden waren, klang das unvorstellbar. Warum sollten die Deutschen so etwas tun? Schließlich waren es doch die Juden, die ihnen als Zwangsarbeiter in den kriegswichtigen Fabriken dienten. Für Leipke ergab das keinen Sinn.
Abba ging noch einen Schritt weiter. Er fragte in die Runde: »Wisst ihr, was ich dadurch verstanden habe? Dass das nur der Anfang ist.« Er stemmte die Hände in die Hüften. »Einen anderen Schluss lassen Sarahs Erzählungen nicht zu. Das war keine Einzelmaßnahme. Erinnert euch: Die Deutschen sind organisiert, sie denken systematisch. Womit wir es hier zu tun haben, liebe Freunde, ist eine Maschinerie, und diese Maschinerie dient nur einem einzigen Zweck: Das Judentum in Gänze zu vernichten.«
Nun meldete sich plötzlich Rachel zu Wort. Dank ihrer lauten, festen Stimme gelang es ihr, die wachsende Unruhe zu übertönen. »Natürlich sind wir alle zutiefst verstört durch das, was Sarah uns berichtet hat«, sagte sie. Um sich der Zustimmung der Anwesenden zu versichern, drehte sie sich kurz zu ihnen herum und sah einigen von ihnen flüchtig in die Augen. »Aber wenn du mit deinen Vermutungen richtigliegst, was schlägst du uns dann vor? Wie sollen wir es schaffen zu überleben?«
Eine Zeit lang schaute Abba in erwartungsvolle Gesichter. Als habe er die Verantwortung gespürt, die nun auf seinen Schultern lag, verlor sich sein kalter Blick in der Unendlichkeit.
»Wir müssen begreifen«, setzte er wieder an, »dass uns niemand retten wird. Wir sind auf uns allein gestellt.«
»Dann verschwinden wir«, brüllte jemand in den Raum hinein. »Wir hauen ab, bevor es noch schlimmer kommt.«
Abba schüttelte den Kopf. »Flucht ist eine Illusion, das werden die Deutschen nicht zulassen.« Nachdenklich kratzte er sich an seinem Kinn. »Deshalb stehe ich heute Abend vor euch: Lasst uns nicht wie Lämmer zur Schlachtbank gehen! Ich sage: Lieber sterben wir als freie Menschen im Kampf, als dass wir durch die Gnade unserer Mörder weiterleben.«
Jetzt klinkte sich Samuel Posner in die Diskussion ein. Per Handzeichen bat er ums Wort und wartete, bis sich die Unruhe gelegt hatte. »Bei allem, was uns manchmal trennt«, sagte er, »gibt es doch etwas, das uns vereint.« Er klang besonnen, als wollte er gerade einen lebensmüden Mann daran hindern, Selbstmord zu begehen. »Es ist der Glaube. Nicht nur der Glaube an Gott oder der Glaube an das Himmelreich. Nein: Es ist die Überzeugung, dass unser aller Platz in Eretz Israel ist.« Samuel stemmte eine Hand in die Hüfte und zeigte mit der anderen in südöstliche Himmelsrichtung. »Somit ist jeder Kampf, den wir hier austragen, umsonst. Ich plädiere dafür, dass wir unsere Kräfte nicht für eine sinnlose, zum Scheitern verurteilte Sache verschenken.« Jetzt legte auch er eine Kunstpause ein, um dem Schluss seiner Wortmeldung einen besonderen Ausdruck zu verleihen. »Was wir stattdessen tun sollten? In meinen Augen haben wir nur eine Pflicht: so viele Menschen wie möglich zu retten.«
Auch Ruzka ergriff nun das Wort. Sie war die Erste, die es nicht mehr auf ihrem Platz hielt.
Leipke überraschte ihre emotionale Reaktion, denn bisher hatte er die junge, auffallend kleine Frau als still und in sich gekehrt erlebt. Doch ihre neue, lebhafte Art gefiel ihm. Schmunzelnd beobachtete er, wie Ruzka schnaufte und mit einer Hand durch ihr braunes Kraushaar fuhr. Vor lauter Wut bekam ihr ohnehin kupferfarbenes Gesicht einen noch rötlicheren Ton, und ihre mandelbraunen Augen, die ansonsten Wärme und Jugend ausstrahlten, sprühten vor Erregung.
»Weißt du eigentlich, was du da sagst?«, fauchte sie in Samuels Richtung. »Dass wir tatenlos zusehen sollen, wie das jüdische Volk vernichtet wird? Dass wir uns verkriechen sollen wie feige Ratten? Warten, bis alles vorüber ist?« Mit dem Ausdruck größtmöglicher Verachtung schüttelte sie den Kopf. »Wie könntest du jemals wieder jemandem in Eretz Israel in die Augen sehen? Wirst du erzählen, dass du dich versteckt hast, als es darum ging, dein Volk zu verteidigen?«
Dieser Einwand brachte Samuel zur Weißglut. Nun sprang auch er, der soeben noch sachlich argumentiert hatte, von seinem Stuhl auf und stieg in das erregte Gestenspiel ein. Lautstark brüllten er, Ruzka, Abba und die anderen gegeneinander an. In dem Ratskeller standen sich nun zwei Lager feindlich gegenüber, die die Argumente der Gegenseite in Bausch und Bogen niederschrien.
Leipke brachte dafür kein Verständnis auf. Eines hatte die Versammlung ihm somit deutlich gezeigt: In der Frage des Widerstands würde in der Jungen Garde so schnell keine Einigkeit herrschen.
*
Erst zwei Wochen waren vergangen, seitdem ein Bote ihm den geheimnisvollen Umschlag ausgehändigt hatte. »Wir müssen uns treffen«, hatte in sauberer Handschrift in Großbuchstaben auf einem einzelnen Blatt gestanden. Jetzt saß der Verfasser dieser Botschaft vor ihm.
Am liebsten hätte Abba sich deshalb ungläubig die Augen gerieben, denn auch für ihn war Isaak Wittenberg bis zu diesem Augenblick nur eine mystische Gestalt gewesen. Eine okkulte Person, die niemand je gesehen hatte und über die nur sehr wenige Informationen im Getto kursierten. Niemand konnte Abba sagen, wie alt Wittenberg war, wie er aussah und wo er herkam. Das Einzige, das man über ihn wusste, war, dass er enge Kontakte nach Moskau pflegte.
Nun saßen sich die beiden glühenden Kommunisten gegenüber. Abba studierte Wittenbergs Gesichtszüge genau. So wie er es immer tat, ließ er seinen spontanen Eindrücken freien Lauf und speicherte sie in seiner Erinnerung ab. Immer wieder behauptete Vitka, dass das die typische Angewohnheit eines Künstlers sei. Eine eigentümliche Art, mit der diese die Menschen und ihre Umgebung betrachteten.
Von Wittenbergs Erscheinung war Abba überrascht. Wie ein intellektueller Revolutionär, für den er ihn gehalten hatte, sah dieser Mann beileibe nicht aus. Vielmehr hatte er ein breites Gesicht und einen immensen Stiernacken, wodurch er eher den Charme eines handfesten Bauern versprühte. Ständig zupfte er an seinem Anzug, der ihm nicht recht zu passen schien und in den er sich offensichtlich nur gegen heftige innere Widerstände der Tarnung wegen hineingezwängt hatte.
Von dem Moment an, in dem Wittenberg die Wohnung in der Straschun-Straße betreten hatte, war sein Blick ausgesprochen kühl gewesen. Ebenso wie seine Worte zur Begrüßung: »Normalerweise habe ich nicht viel übrig für Zionisten.« Er sprach mit einer Stimme, die nicht minder kräftig war als seine Schultern. Mit dem Kinn deutete er in die Richtung des einzigen Fensters. »Schon gar nicht für den da.«
Josef Glassmann, der Angesprochene, verzog keine Miene. Stattdessen lehnte er weiter lässig an der Wand, sodass sein römisches Profil deutlich zu sehen war. Ohne auf Wittenbergs Provokation einzugehen, schaute er aus seinen geheimnisvollen, dunklen Augen nach draußen auf die verschneite Winterlandschaft. Der Anführer der Betar, der im Gegensatz zur Jungen Garde rechtsgerichteten zionistischen Jugendorganisation, war Abbas Einladung gefolgt und ebenfalls zu diesem Treffen erschienen. Von ihm, der der jüdischen Polizei beigetreten war, um Jakob Gens im Auge zu behalten, erhoffte Abba sich wichtige Informationen.
Nach einer Weile ergriff schließlich auch Glassmann das Wort. »Es gibt vieles, das uns trennt«, sagte er besonnen, »und anscheinend sind wir einzig in unserer gegenseitigen Abneigung vereint. Trotzdem hoffe ich, dass diese Zusammenkunft noch eine andere Absicht verfolgt als die, uns unserer Differenzen zu versichern.«
Auf Wittenbergs Lippen bildete sich ein Schmunzeln. Anerkennend nickte er Glassmann zu, als habe dieser soeben eine Art Charaktertest bestanden. Mithilfe seiner bulligen Arme drückte er sich von der Matratze hoch, faltete seine Hände hinter dem Rücken und ging an der fensterlosen Wand hin und her. »Einmal mehr irren Sie sich«, setzte er zu einer kurzen, aber offensichtlich vorbereiteten Rede an. »In der Tat gibt es noch mehr, das uns vereint.« Immer wieder verlieh er seinen Sätzen durch wohl platzierte Kunstpausen Wirkung. Eine rhetorische Technik, derer sich auch Abba häufig bei seinen Reden bediente. Im Unterschied zu Wittenberg, der sich diese bewusst angeeignet zu haben schien, war sie ihm jedoch bereits in die Wiege gelegt worden. »Was uns verbindet, ist nicht der Glaube an Gott. Den haben wir längst eingetauscht. Nein, wir alle drei klammern uns an etwas anderes.«
»Die Hoffnung«, vervollständigte Glassmann. »Die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Der ewige Traum von einem Land der Verheißung.«
Wittenberg nickte. »Ja, wir mögen unterschiedliche Vorstellungen besitzen, wer der Urheber dieser Verheißung ist und wie das Gelobte Land aussehen soll«, sagte er und schüttelte daraufhin den Kopf, »aber kämpfen wir allein, wird keine davon wahr werden.« Er drehte sich um, zog eine Hand hinter seinem Rücken hervor und streckte sie den Männern entgegen.
Abba sah ihn fragend an. »Ein Pakt?«
»Nennen wir es Waffenstillstand«, korrigierte Wittenberg. »Für die Dauer des Krieges. Hier im Getto kämpfen wir nicht mehr als Kommunisten oder Zionisten. Wir kämpfen zusammen. Als Juden.« Mit seiner ausgestreckten Hand ging er weiter auf die anderen zu. »FPO – Fareinikte Partisaner Organisatzije.«
Glassmanns Lippen formten sich zu einem zaghaften Lächeln. Mit der Schulter stieß er sich von der Wand ab.
»FPO«, wiederholte er und legte seine Hand auf die von Wittenberg.
Erwartungsvoll sahen die beiden Männer zu Abba herab. Noch immer hockte der Anführer der Jungen Garde im Schneidersitz auf seiner Matratze. Doch schließlich erhob er sich, legte seine Hand auf die der anderen und sprach die drei Buchstaben leise vor sich hin.
»Darauf stoßen wir an«, sagte Wittenberg. Mit seiner freien Hand fischte er eine Flasche Wodka aus seinem Beutel. »Auf dass wir eines Tages als freie Männer miteinander trinken können.«
*
Mit pochendem Herzen lag Vitka im Gras. Inzwischen hatte das Zittern ihren ganzen Körper erfasst.
»Bleib ruhig«, sagte sie sich. »Verlier jetzt bloß nicht die Nerven!«
Vorsichtig tastete sie mit ihrer linken Hand nach dem Karabiner, der neben ihr im Gras lag. Mit der rechten umklammerte sie den Stiel der Handgranate, als ob ihr Leben davon abhing, und gewissermaßen tat es das auch: Für den Fall, dass etwas schiefging, waren das ihre einzigen Waffen.
Eine Woche lang hatte Vitka nach der perfekten Stelle gesucht. War stundenlang an den Gleisen entlanggelaufen, unermüdlich, trotz ihrer schmerzenden Füße, bis sie sie endlich gefunden hatte: die Brücke, von der Abba ihr erzählt hatte. Sie lag etwa zwanzig Kilometer von Wilna entfernt und führte über eine tiefe Schlucht. Hier sollte der deutsche Zug vorbeikommen, beladen mit Soldaten, Nahrungsmitteln und Nachschub für die Front. Er würde das erste Ziel der Partisanen sein. Von diesem Anschlag erhofften sie sich, dass sie der Wehrmacht einen spürbaren Schlag versetzen würden. Als es darum ging, wer den Plan ausführen sollte, hatte Vitka sich sofort freiwillig gemeldet.
Nun, während es zu dämmern begann, wurde sie ungeduldig. Mit aller Macht kämpfte sie gegen die Müdigkeit, die allmählich Besitz von ihr zu ergreifen drohte. Immer wieder fielen ihr für ein paar Sekunden die Augen zu. Sie glaubte, sich nicht mehr lange wachhalten zu können. Wann tauchte dieser verdammte Zug endlich auf?
Einen Moment lang befürchtete Vitka, dass sie mit ihrem Auftrag scheitern würde. So wie gestern Abend, als die Mission auf Messers Schneide gestanden hatte. Sie war so vertieft gewesen in die Untersuchung der Bahnschienen, dass ihr die Soldaten, die in dem nahe gelegenen Wald Schießübungen abgehalten hatten, nicht aufgefallen waren.
»Hände hoch!«, hatte plötzlich eine Stimme in Vitkas Rücken befohlen. »Hast du die Schilder nicht gelesen?«
Vor ihr stand ein junger Unteroffizier mit vorgehaltenem Karabiner. Als er sie misstrauisch beäugte, durchfuhr Vitka augenblicklich eine eisige Kälte. Sofort war ihr klar, dass jedes falsche Wort ihren Tod bedeuten könnte.
»Ich komme aus Wilna«, erklärte sie mit sanfter Stimme. Sie versuchte, so unschuldig wie möglich zu klingen. »Ich habe mich verlaufen. Können Sie mir helfen?«
Vermutlich war es ihr nicht jüdisches Aussehen, das ihr auch diesmal wieder das Leben rettete. Denn sofort winkte der junge Deutsche einen Bauern herbei, der gerade mit seinem Karren den Waldweg entlangkam. »Zeigen Sie diesem Mädchen den Weg nach Wilna«, befahl er ihm und zwinkerte Vitka vielsagend zu, bevor er wieder im Wald verschwand.
Doch erst nachdem auch der Bauer davongefahren war, wich allmählich die Anspannung aus Vitkas Körper. Es war pures Glück gewesen. Wäre der Deutsche nur kurze Zeit später aufgetaucht, hätte er sie auf frischer Tat ertappt, wie sie die Sprengladung angebracht hätte. Ihr Aufeinandertreffen wäre gänzlich anders verlaufen. Er hätte sie verhaftet und entweder der SS oder der Gestapo vorgeführt. So oder so wäre es ihr Todesurteil gewesen.
Ein flackerndes Licht holte Vitka aus ihren Erinnerungen. Sie schüttelte sich und kniff ihre Augen zusammen. Wie ein scheues Reh huschte das Licht zwischen den Bäumen umher. Über ihnen erkannte Vitka einen zarten, verblassenden Schweif, der in staccatoartigem Rhythmus mit dem Nachthimmel verschmolz.
Es musste der Rauch einer Dampflok sein. Der Zug, auf den sie nun schon seit Stunden wartete, näherte sich ihrer Stellung. Von jetzt auf gleich war Vitkas Müdigkeit verflogen.
Jeden Moment fuhr er über den Zünder, dachte sie, schloss die Augen und betete. In wenigen Sekunden würden die Rebellen das erste Zeichen ihres Widerstands setzen.
Es knallte, und Vitka zuckte zusammen. Mit lautem Krachen schoss eine meterhohe Stichflamme zwischen den Bäumen empor, und ein grelles Licht, das Vitkas Augen blendete, erleuchtete die umliegenden Felder taghell. Obwohl sie weit genug entfernt lag, spürte Vitka die Hitze der Explosion.
Als hätte diese ihre Wahrnehmung verlangsamt, spielte sich auf einmal alles wie in Zeitlupe ab. Trümmer rieselten wie übergroße Schneeflocken vom Himmel. Knisterndes Feuer hüllte den Zug in eine schwarze Rauchwolke, und die entgleiste Lok tuckerte mitsamt den angehängten Waggons unbeirrt der Schlucht entgegen.
Auf Vitkas Lippen breitete sich ein zufriedenes Lächeln aus. Mithilfe des Karabiners drückte sie sich aus dem Liegen auf die Knie und beobachtete die Szenen, die sich vor ihren Augen abspielten.
Das war für ihre Familie, dachte sie.
Wer Wind sät, wird Sturm ernten.
*
Ruzka schloss die Augen. Zwischen ihren Beinen wurde es warm und feucht.